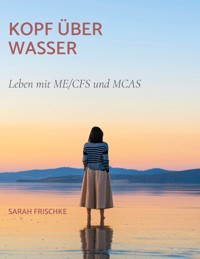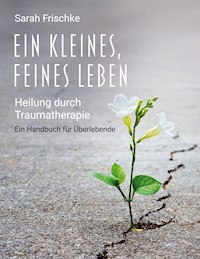
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Handbuch richtet sich in erster Linie an Menschen mit komplexen Traumafolgestörungen. Als Ratgeber hat es das Ziel, den Weg durch den Therapie-Dschungel zu ebnen und über die Grundsätze und Methoden der Traumatherapie aufzuklären. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Vermittlung von praktischen Tipps und Übungsvorschlägen. Die Autorin greift dafür u.a. auf das Wissen zurück, das sie dank ihrer eigenen langjährigen Traumatherapie besitzt. Die theoretische Grundlage bilden die aktuellen Kenntnisse in der Psychotraumatologie, welche durch eigene konkrete Erfahrungen ergänzt wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
There is a crack in everything that’s how the light gets in.
Leonard Cohen
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Vorwort
Hinweise zu diesem Buch
Das Märchen von der kleinen Fee
Chronologie meiner Therapien
Grundlagen der Traumatherapie
Trauma und seine Folgen
Dissoziation und die dazugehörigen Symptome
Traumatherapie
Therapieplatz-Suche
Welche ambulanten Therapien sind zugelassen?
Die Suche nach einem ambulanten Therapieplatz
Probatorische Sitzungen
Stationäre Traumatherapie
Weitere Unterstützungsmaßnahmen
Therapie-Ende und Überbrückungsmaßnahmen
Stabilisierung bedeutet Sicherheit
Die ersten Wochen in der Traumatherapie
Äußere Sicherheit
Innere Sicherheit
Psycho-Edukation: Zur eigenen Expertin werden
Selbstachtung und Selbstfürsorge
Selbstachtung
Körperliche Selbstfürsorge
Emotionale Selbstfürsorge
Selbstmanagement mit Hilfe von Skills
Einblick in die DBT-Therapie
Eine Übersicht zu den wichtigsten Skills
Notfallkoffer, Notfalltasche und -liste
Ressourcenorientierung: Gutes für sich tun
Was sind Ressourcen?
Übungen zur Ressourcenfindung
Probleme und Lösungsansätze
Imaginationsübungen: Gute innere Bilder
Vor- und Nachbereitung der Imaginationsübungen
Die einzelnen Imaginationsübungen
Mögliche Probleme und Lösungsansätze
Wie können Imaginationsübungen helfen?
Körpertherapien in der Traumatherapie
Somatic Experiencing
Nervus Vagus-Übungen
Verbindung zwischen Meditation und Bewegung
Geeignete Entspannungsübungen
Weitere ergänzende Körper-Therapien
Wie setze ich die Methoden ein?
Hochspannung
Inneres Chaos
Dissoziative Zustände/ Abdriften
Flashbacks
Albträume
Schmerzen
Belastende Gefühle
Traumaexposition: Hurry slowly
Traumakonfrontation: Ja oder Nein?
EMDR
Bildschirmtechnik/ Screen-Technik
BeobachterInnen-Technik
TRIMB
IRRT
Selbstfürsorge anlässlich der Trauma-Konfrontation
Trauma-Integration: Es ist vorbei
Ist Heilung möglich?
Anhang
Danksagung
Regeln zur Selbsthilfe im Internet
Antrag auf Kostenerstattungsverfahren – Musterschreiben
Meine Top Twelve der Fachliteratur
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Schatztruhe
Literaturverzeichnis
Einzelne Quellen
Einleitung
Vorwort
Im Jahr 2022 blicke ich mit Dankbarkeit auf 16 Jahre Traumatherapie zurück. Sie rettete mir das Leben. Als junge Erwachsene litt ich unter Depressionen und war chronisch arbeits- und magersüchtig. Innerlich trug ich schwer an den Folgen von körperlicher Misshandlung sowie emotionalem und sexuellem Missbrauch, den ich in meiner Kindheit und Jugend erleben musste. Nach außen spielte ich die Rolle einer erfolgreichen, talentierten und attraktiven jungen Frau, die kaum jemanden hinter die Kulissen ihrer Seelenbühne blicken ließ. Die Diskrepanz, die mich zerriss, war groß.
Meine erste Traumatherapeutin kontaktierte ich jedoch erst, nachdem ich mit Mitte 30 während eines Reha-Aufenthalts erkennen musste, dass ich aufgrund einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung körperlich und psychisch nicht mehr in der Lage war, zu arbeiten. Damals hatte ich das Ziel, so schnell wie möglich wieder an meinen Arbeitsplatz zurückzukehren. Ich rechnete mit einem Sprint von einigen Monaten. Aber die Traumatherapie sollte sich zu einem intensiven Marathon mit vielen Höhen und Tiefen entwickeln. Sie wurde von gravierenden Erkenntnissen über meine Kindheit und Jugend, schweren körperlichen Erkrankungen und einschneidenden Lebensveränderungen begleitet. Viele Lebensentwürfe musste ich auf diesem Weg begraben. Andere Träume wurden endlich wahr.
Heute führe ich ein „kleines, feines Leben“, das ich mir mit Unterstützung meiner therapeutischen HelferInnen und meinem privaten Umfeld erkämpft habe. Meine psychischen Erkrankungen habe ich zum Großteil hinter mir gelassen. Ich überlebe nicht mehr die Schatten der Vergangenheit, sondern lebe dank der Traumatherapie im Hier und Jetzt.
Über diesen, meinen ureigenen, Weg möchte ich in diesem Handbuch berichten, das als Ratgeber und Orientierungshilfe den Weg durch den Therapie-Dschungel ebnen und über die Grundsätze und Methoden der Traumatherapie aufklären soll. Mein Schwerpunkt liegt dabei auf der Vermittlung von praktischen Tipps und Übungsvorschlägen. Hierfür greife ich u.a. auf mein Wissen zurück, das ich dank meiner langjährigen Traumatherapie besitze. Die theoretische Grundlage bilden die aktuellen Kenntnisse in der Psychotraumatologie, welche ich durch eigene konkrete Erfahrungen ergänze.
Dabei richte ich mich in erster Linie an Menschen mit komplexen Traumafolgestörungen. Vor allem dürften sich Betroffene angesprochen fühlen, die durch langanhaltende Traumata in der Kindheit schweres Leid erfahren mussten und im Erwachsenenalter wieder mit dem Schrecken konfrontiert wurden. Ihnen möchte ich das notwendige Wissen an die Hand geben, um mit Hilfe einer fachlich fundierten und geeigneten Traumatherapie Symptome zu lindern, zu heilen und so die eigene Lebensqualität (wieder) zu steigern.
Mein Ziel ist es, Mut zu machen und aufzuzeigen, dass es möglich ist, Hürden zu überwinden und neue Wege zum Leben zu finden. Dabei gehe ich auch auf die Stolpersteine, Schwierigkeiten und Umwege in einer Psychotherapie ein. Denn diese gab es bei mir zuhauf, u.a. weil ich anfangs zu naiv war und kaum Wissen über die Traumatherapie und deren Methoden hatte.
Schön wäre es, wenn auch Unterstützer- und BehandlerInnen von diesen Schilderungen profitieren. Denn es gibt meines Erachtens bis auf wenige Ausnahmen nach wie vor zu wenig Literatur, die den Weg zu und durch eine Traumatherapie aus Sicht einer Betroffenen schildert. Ich hoffe, ich kann diese Lücke ein wenig füllen.
Beppo, der Straßenkehrer
„… Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang; das kann man niemals schaffen, denkt man.
“Er (Beppo) blickte eine Weile schweigend vor sich hin, dann fuhr er fort: „Und dann fängt man an, sich zu beeilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es mit der Angst, und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen."
Er dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter: "Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten."
Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte: "Dann macht es Freude; das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein." Und abermals nach einer langen Pause fuhr er fort: "Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt wie, und man ist nicht außer Puste."
Er nickte vor sich hin und sagte abschließend: "Das ist wichtig."
Michael Ende aus „Momo“1
Hinweise zu diesem Buch
Folgende Anmerkungen dienen zum besseren Verständnis und zur optimalen Handhabung des vorliegenden Buches. Bitte berücksichtigen Sie diese vor der Lektüre.
1. Sie können dieses Buch auf unterschiedliche Art und Weise nutzen. Primär ist es als Handbuch und Ratgeber sowie Begleitbuch zur Traumatherapie gedacht. Es kann aber auch in einem Rutsch durchgelesen werden, wenn Sie sich über die Traumatherapie im Allgemeinen informieren wollen. Zudem ist das Buch als Nachschlagewerk geeignet. Wichtig ist, dass Sie für sich den bestmöglichen Nutzen daraus ziehen. Markieren Sie, machen Sie Notizen, schreiben Sie Ihre Erfahrungen dazu. Alles ist erlaubt. Es ist Ihr Buch.
2. Meine ambulanten Traumatherapeutinnen wurden u.a. von Michaela Huber ausgebildet. Die Traumatherapie-Station, auf der ich meine stationäre Intervall-Therapie machte, arbeitet nach dem Modell von Luise Reddemann. Daher konzentriere ich mich hauptsächlich auf die Therapiekonzepte dieser beiden führenden Traumatherapeutinnen, die die Traumatherapie-Landschaft in Deutschland nachhaltig prägten.
3. Ich habe für dieses Buch bewusst die weibliche Schreibweise gewählt. Denn aufgrund meines Geschlechts und meiner eigenen Betroffenheit kann ich die Art der Traumabewältigung und die nachfolgende Traumatherapie nur aus einer weiblichen Sicht schildern. Männern mit komplexen Traumafolgestörungen würde ich mit einer neutralen Schreibweise nicht gerecht werden, da ich das männliche Erleben und Verarbeiten von Traumata und Traumatherapie nicht einschätzen kann. Trotzdem heiße ich natürlich jeden männlichen Leser herzlich willkommen und bitte, sich von der Schreibweise nicht stören zu lassen.
4. Mir war wichtig, mit diesem Handbuch einen Ratgeber zu gestalten, der so wenig Triggerpotential wie möglich enthält. Daher finden Sie in diesem Buch keine detaillierten Schilderungen der traumatischen Erlebnisse in meiner Kindheit und Jugend. Zudem habe ich entschieden, mich bei triggerfähigen Themen so kurz wie möglich zu fassen, um das Hilfreiche in den Vordergrund zu stellen. Um Sie trotzdem an meiner Geschichte teilhaben zu lassen, habe ich meine Vergangenheit in einem Märchen „verpackt“. Dies heißt nicht, dass ich dem Leid keinen Platz geben möchte, das bei vielen Betroffenen nach wie vor so präsent ist. Ich finde es mehr als wichtig und notwendig, dass das Leid geschildert werden darf und dass es ZeugInnen und ZuhörerInnen gibt, die dazu einladen und dies mit den Betroffenen aushalten. Das wünsche ich jeder Einzelnen von Ihnen. Gleichzeitig möchte ich mit diesem Buch jedoch eine möglichst triggerfreie Zone schaffen, die auch für aktuell instabile Betroffene gefahrlos begehbar und damit lesbar sein soll. Daher finden Sie z.B. Triggerzeichen bei dem Begriff „sex*** Missbrauch“.
5. Lesen Sie das vorliegende Buch so achtsam wie möglich. Denn bei aller Vorsicht geht es um die Therapie von schweren Traumata. Auch wenn ich meine Worte sehr vorsichtig gewählt habe, gibt es wahrscheinlich immer noch Passagen, die in der einen oder anderen LeserIn heftige Gefühle auslösen können. Achten Sie daher gut auf sich. Streichen Sie Worte oder Texte, die Ihnen nicht guttun, notfalls mit einem dicken schwarzen Stift durch. Ersetzen Sie diese mit anderen Begriffen, die besser geeignet sind. Und machen Sie beizeiten eine Pause, um sich wieder zu stabilisieren.
6. In der Abfolge der einzelnen Kapitel ist keine chronologische Reihenfolge zu sehen, da unterschiedliche Methoden und Übungen in der Traumatherapie oft parallel erlernt und geübt werden. Die theoretischen Beschreibungen und Erläuterungen habe ich durch meine eigenen Erfahrungen ergänzt. Diese sind zwecks besserer Lesbarkeit kursiv und in einer anderen Schriftart gedruckt und setzen sich so vom erklärenden Text stark ab. Gedichte und Geschichten, die mich während meiner Traumatherapie stark geprägt haben, finden ihren Platz in den entsprechenden Kapiteln.
7. Die Informationen, Hinweise und Tipps in diesem Buch wurden in den letzten Jahren umfassend recherchiert und überprüft. Zudem basieren sie auf eigenen subjektiven Therapie-Erfahrungen, die über einen Zeitraum von zwanzig Jahren gesammelt wurden. Ich erhebe in diesem Buch jedoch keinen Absolutheitsanspruch. Jede einzelne LeserIn wird eine Traumatherapie anders erleben. Jede hat ihre eigene Geschichte, eigene Schwächen und Stärken sowie Ressourcen. Traumafolgestörungen zeigen sich auf unterschiedlichste Art und Weise. Daher ist Traumatherapie immer individuell und wird in der Beziehung zwischen TherapeutIn und KlientIn geklärt. Für die praktische Anwendung der enthaltenen Hinweise und Tipps kann somit keine Haftung übernommen werden.
8. Quellenverweise sind entweder direkt vor Ort oder im Literaturverzeichnis am Ende des Buches zu finden. Dort habe ich alle Quellen aufgelistet, mit denen ich in den letzten Jahren verstärkt gearbeitet habe. Interessierte LeserInnen finden zudem Verweise auf weiterführende Literatur.
9. Da ich mich durch die eigene Erkrankung bedingt bereits seit fast zwanzig Jahren mit der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung sowie der Traumatherapie beschäftige, konnte ich leider nicht immer im Nachhinein herausfinden, auf welche AutorIn mein Wissen und meine Erfahrungen zurückzuführen sind. Vieles habe ich in meinen Traumatherapien – zum Großteil in Gesprächen – erfahren. Ich bitte daher um Verständnis, falls die eine oder andere Quelle vergessen wurde. Für diesbezügliche Hinweise bin ich sehr dankbar.
10. Dieses Handbuch kann weder (Fach-)Arzt- und Therapiebesuche noch eine gründliche Diagnostik und Behandlung ersetzen. Damit behaupte ich nicht, dass man sich nicht auch allein von quälenden Traumata befreien kann. Aber ich bin überzeugt, dass es dafür ein Gegenüber braucht. Denn vor allem bei Traumata, die durch Menschen verursacht wurden, geht es um Beziehung – um die Beziehung zu sich selbst, zu den Menschen und zu der Welt.
11. Medikamente gehören in die Hände von Fachleuten. Aus diesem Grund werde ich in diesem Buch nicht detaillierter über die medikamentöse Behandlung berichten, obwohl diese bei komplexen Traumafolgestörungen angeraten sein kann. Ich selbst nahm sehr lange Zeit ein Antidepressivum ein, das für die Posttraumatische Belastungsstörung zugelassen ist. Zudem benötige ich nach wie vor ein Antidepressivum, um besser einschlafen zu können. Bei Fragen zu diesem Thema ist jedoch eine PsychiaterIn die richtige Ansprechperson.
12. Die vorgestellten Übungen und Maßnahmen sollten – wenn nicht anders vermittelt – zunächst mit Hilfe einer TherapeutIn eingeführt oder zumindest besprochen werden. Bitte fangen Sie nicht allein damit an, vor allem nicht in instabilen Zeiten. Manche Übungen können ohne Vorbereitung und Anleitung überfordern und destabilisieren.
Das Märchen von der kleinen Fee
Es war einmal ein kleines Feenkind mit bernsteinbraunen Augen, die tief in die Seele der anderen Menschen schauen konnten. Seine rabenschwarzen lockigen Haare umrandeten ein blasses Gesicht. Man konnte den Eindruck gewinnen, Schneewittchen sei wiedergeboren.
Dieses kleine Feenkind wurde auf die Erde geschickt, um dort ein wenig Sanftheit und Liebe in den Alltag zu bringen. Als Eltern wurde ein sehr junges Paar ausgewählt, das kürzlich geheiratet hatte. Die beiden frisch Vermählten versprachen, sehr gut auf die kleine Fee zu achten und ihr alles beizubringen, was sie brauchte, um auf der Erde zurecht zu kommen.
Aber das junge Paar hatte ein Geheimnis. Keiner wusste, dass sich der junge Vater hinter geschlossenen Türen zu einem großen rot-schwarzen Drachen verwandelte, der sehr böse werden konnte, wenn jemand weinte. Dann spie er viel Feuer, das alles verbrannte und zerstörte. Da aber alle kleinen Kinder weinen, wenn sie Zähne bekommen oder Hunger haben, schrie auch das kleine Feenkind sehr viel. Das war sehr schlimm. Denn der Vater verwandelte sich dann sofort zu einem Drachen und tat der kleinen Fee sehr, sehr weh, woraufhin diese noch mehr weinte. Daher sperrte die Mutter die kleine Fee immer öfters ein. Diese war dann so lange in ihrem Zimmer eingeschlossen, bis der Drache wieder weg war. Später, als die kleine Fee dann älter wurde, spielte sie meist still in ihrer Ecke und versuchte, nicht aufzufallen. Erst als ihre kleine Koboldschwester in die Familie kam, vergaß sie manchmal ihre Angst. Denn die Koboldschwester brachte Spaß auf die Erde. Und so war endlich auch Lachen im Haus.
Immer wieder wurde dieses Lachen jedoch vom Gebrüll des Drachenvaters übertönt. Die Koboldschwester versteckte sich dann sofort hinter einem Tarnumhang. Die kleine Fee jedoch hatte gehört, dass Magie Drachen besänftigen kann. Außerdem wollte sie ihre Mutter nicht mit dem Vater allein lassen. Daher nahm die kleine Fee ihr Zauberbuch, stellte sich tapfer vor den Drachen und wedelte mit ihrem kleinen Zauberstab. Aber sie fand die passenden Zaubersprüche einfach nicht. Da wurde der Drache noch böser und spuckte noch mehr Feuer. Es war jedes Mal ein schreckliches Erlebnis, das sich tief in das Herz der kleinen Fee einbrannte. Sie verkroch sich dann weinend in einer Ecke, woraufhin die Mutter sie wieder in ihr Zimmer sperrte. Denn Weinen war ja nach wie vor streng verboten.
In dieser Zeit versteckte sich die kleine Fee oft in einer Höhle, um dort von einer anderen Welt ohne Drachen zu träumen. In der Schule hatte sie schon ein Stück dieser Welt kennen gelernt. Sie traf dort andere Feen, Zauberer, Elfen, Menschen, Zwerge und viele andere Wesen. Mit ihnen hatte sie viel Spaß und konnte den Drachen oft für eine kurze Weile vergessen. Aber sie wusste auch, dass sie niemandem etwas über ihren Vater erzählen durfte. Es war nämlich verboten, über Drachen zu sprechen. Dies erklärte ihr die Mutter immer wieder sehr eindringlich.
Die kleine Fee wurde größer und wuchs zu einem wunderschönen Mädchen heran. Aber der Drachenvater hörte nicht auf, Feuer zu spucken. Je älter die Fee wurde, desto schlimmer wurde es. Er wollte die kleine Fee härter machen, da er ihre Sanftheit nicht mochte. Zudem missfiel ihm ihr zunehmendes Selbstbewusstsein. Daher betitelte er die kleine Fee mit Namen, die Feen sehr, sehr wehtun. Andere Familienmitglieder machten es ihm nach und lachten darüber. Dies verletzte die kleine Fee zutiefst. Sie war überzeugt, als Fee nichts mehr zu taugen. Aber sie hoffte, dass alle mit den bösen Sprüchen aufhören würden, wenn sie winziger wäre.
Gesagt, getan. Sie hörte von heute auf morgen auf zu essen und zu trinken. Sie schrumpfte und schrumpfte, und wurde winzig klein. Die kleine Fee war schließlich so klein, dass sie manchmal nicht mehr zu sehen war. Die Menschen draußen in der Welt begannen, die kleine Fee zu suchen und bei den Eltern nachzufragen. Auch die Mutter machte sich viele Sorgen um die kleine Fee. Gleichzeitig hatte sie jedoch auch Angst, dass das „Drachengeheimnis“ entdeckt würde. Daher sprach auch niemand über den großen Drachen, als die kleine Fee schließlich zum Arzt gehen musste. Stattdessen wurde sie gezwungen, sehr viel zu essen und wieder größer zu werden. Das Größerwerden verursachte ihr jedoch sehr, sehr viele Schmerzen. Aber keiner wollte sie verstehen. Im Gegenteil: Wenn die kleine Fee bittere Tränen vergoss, brüllte wieder der Drache. Sie fühlte sich so allein. Aber auch die Mutter fühlte sich sehr einsam und unglücklich, da der Drache zunehmend ohne Anlass Feuer spie.
Da entschieden die Eltern, zwei weitere Kinder in die Familie aufzunehmen. Die kleine Fee bekam von ihrer Mutter den Auftrag, gut für die beiden Kinder zu sorgen. Diese hatte wenig Zeit, da sie viel auf dem Feld arbeitete, um den Drachen zu besänftigen. Oft war sie den ganzen Tag weg und kam erst abends spät nach Hause. So machte die Fee den Haushalt und hütete die Kinder. Die Koboldschwester half ihr dabei. Oft gingen die Beiden mit den kleinen Kindern zusammen in die Natur, in die Wälder und Wiesen. Sie wurden von einem großen Wolf begleitet, der ihnen irgendwann zugelaufen war, um sie zu beschützen. Auf ihren Wanderungen kamen sie oft an einen See, der für die kleine Fee sehr wichtig war. Dann schaute sie den Vögeln zu, die sich auf dem See tummelten und dachte bei sich: „So frei möchte ich auch sein.“
Und sie erinnerte sich an die Worte eines großen Zauberers, der ihr einmal erklärte, dass die große Prüfung im nächsten Jahr die Tür zur großen weiten Welt und damit zur Freiheit öffnen würde. Wenn sie alle wichtigen Zaubersprüche auswendig konnte, bekäme sie den Schlüssel, den sie brauchte, um diese Tür zu öffnen. Die kleine Fee wollte diesen Schlüssel unbedingt haben. Sie hatte schon so viele Geschichten über die große weite Welt gehört und wollte unbedingt dorthin. Denn sie spürte immer mehr, wie gefangen und traurig sie im Drachenhaus war. Auch merkte sie, wie die Mutter immer verbitterter und kraftloser wurde. Daher musste sich etwas ändern. „Vielleicht ist die Mutter ja wieder freundlicher, wenn ich den Schlüssel habe,“ dachte sie bei sich und lernte in jeder freien Minute. Oft tat sie das nachts heimlich, weil die Eltern böse wurden, wenn sie zu viel in ihren Zauberbüchern las. Sie wollte es unbedingt schaffen. Niemand konnte sie davon abhalten.
Eines Tages passierte der kleinen Fee jedoch etwas Schreckliches. Sie hatte wider Erwarten ein wenig Zeit für sich, und war allein auf eine große Wanderung gegangen. An einem See ruhte sie sich ein wenig aus. Da kam ein junger Mann vorbei und gesellte sich zu ihr. Sie plauderten eine ganze Weile, bevor sich die kleine Fee verabschiedete. Sie hatte noch einen langen Heimweg vor sich und wollte nicht zu spät nach Hause kommen. Der junge Mann wollte sie jedoch zum Bleiben überreden, was die kleine Fee ablehnte. Da schaute der junge Mann sie sehr böse an, fauchte kurz und verwandelte sich blitzschnell in einen schwarzen giftspeienden Drachen. Die kleine Fee war so überrascht, dass ihr alle Zaubersprüche, die sie kannte, im Hals stecken blieben. Das Gift des Drachens wirkte sehr schnell. Die kleine Fee konnte nicht mehr reden und sich auch nicht mehr bewegen. Sie hörte nur noch kurz das böse Lachen des jungen Drachens, bevor sie in eine tiefe Ohnmacht fiel. Erst nach einigen Stunden – es war schon Nacht und stockdunkel – wachte die kleine Fee zitternd und weinend wieder auf. Etwas Unaussprechliches war geschehen. Und sie wusste, dass sie stark sein musste und niemanden um Hilfe bitten durfte. „Ich darf nichts verraten. Es ist strikt verboten und einfach zu gefährlich, über Drachen zu sprechen.“, sagte sie zu sich selbst.
Auf dem beschwerlichen Heimweg nahm sie sich daher vor, alles tief in sich zu verschließen und nie mehr daran zu denken. Aber sie schaffte es nicht. Jeden Abend kamen die Erinnerungen an den Drachen wieder. Wenn die Fee im Spiegel ihre Feenfrauen-Gestalt erblickte, wurde sie immer wieder an das schreckliche Ereignis erinnert. Ihren großen Schmerz konnte sie nur lindern, indem sie wieder schrumpfte. Wieder hörte sie auf zu essen und zu trinken. So nur konnte sie so ihr Drachengeheimnis vor der Familie verbergen.
Aber irgendwann war sie winzig klein. Ihr Kräfte schwanden. Die kleine Fee bekam riesengroße Angst, da sie merkte, dass sie immer schwächer wurde. „Eigentlich müsste ich zu dem großen Zauberer gehen, und ihn um Rat fragen“, dachte sie bei sich. Aber dafür war keine Zeit mehr. Die große Prüfung stand nämlich bevor. Und auf diese hatte sie doch schon so lange gewartet. Sie musste diese einfach bestehen. Also nahm sie alle ihre Kräfte zusammen und ging zu der großen Schule, in der die großen Zauberer bereits auf sie warteten. Dank vieler Heiltränke und mit ihrer allerletzten Kraft löste sie alle Aufgaben. Der Rat der Magier war begeistert. Die kleine Fee selbst konnte ihr Glück kaum fassen.
Als die kleine Fee bei den großen Feierlichkeiten den Schlüssel zur großen weiten Welt überreicht bekam, brach sie jedoch unter dem Gewicht des Schlüssels zusammen. Sie war einfach zu klein und zu schwach geworden. Der Schlüssel war viel zu groß und zu schwer für sie. Was sollte sie nur tun? Nun hatte sie den so heißbegehrten Schlüssel. Aber sie schaffte es noch nicht einmal, diesen nach Hause zu tragen. Da kam ihr der treue Wolf zur Hilfe. Er schaute sie traurig an, bevor er anfing zu sprechen: “Wir wollen Dich nicht gehen lassen. Aber wenn Du hierbleibst, wirst Du sterben. Du musst gehen. Die Koboldschwester hat schon Dein Bündel gepackt. Ich bringe dich auf meinem Rücken zum Tor der Welt. Heute Nacht, wenn der Drache schläft, geht es los. Wir müssen aber leise und vorsichtig sein. Er darf nicht erwachen.“ Die Fee schauderte. Würde sie je wieder ihre geliebte Mutter und ihre Geschwister sehen, wenn sie flüchtete? Aber sie wusste, dass der Wolf Recht hatte. Daher packte sie leise ihr Bündel, umarmte noch einmal ihre schlafenden Geschwister und gab ihrer Mutter einen letzten Kuss.
Dann stieg sie auf den Rücken des Wolfes und hielt sich an seinem dicken Fell fest. Er rannte durch die Nacht, durch finstere Wälder und dunkle unbewohnte Städte. Zum Morgengrauen erblickten sie schon aus der Ferne ihr Ziel: Das Tor zur Welt leuchtete golden in der aufgehenden Sonne. Das also war der Zugang zur Freiheit und zu neuen Erkenntnissen. Hier musste die Fee hindurch. „Schnell,“ flüsterte der Wolf. „Du hast nicht mehr viel Zeit.“ Er schaute sie mit traurigen Augen an. Die Fee schüttelte den Kopf. Sie konnte sich doch nicht auch noch von dem treuen Wolf trennen, der ihr so viel Kraft und Schutz gegeben hatte. Aber dieser schubste sie sanft zum Tor, rieb noch einmal seinen Kopf an ihrem Bein und lief zurück in den Wald.
Die kleine Fee war nun ganz allein. Mit allerletzter Kraft packte sie ihren neuen Schlüssel und steckte ihn in das Schloss des Tores. Er passte. Sie öffnete die Tür, ging langsam hindurch und blieb überrascht stehen. Vor ihr lag ein großer Garten mit wundervollen Blumen, in dem die Schmetterlinge tanzten und die Vögel wunderschöne Melodien sangen. Riesige Bäume ragten in den Himmel und grüßten sie mit ihren wippenden Zweigen, die sich vor ihr verneigten. Sie war so vertieft in diesen Anblick, dass sie gar nicht merkte, wie die Tür zurück ins Schloss fiel. Vorsichtig ging sie ein paar Schritte, bis sie zu einer Bank kam, auf der sie sich kurz ausruhen wollte. Kaum saß sie, fiel sie jedoch in einen tiefen, tiefen Schlaf – so erschöpft war sie.
Als sie aufwachte, lag sie in einem wunderschönen Bett, zugedeckt mit einer dicken weißen Daunendecke. Sie erschrak, weil sie nicht wusste, was mit ihr geschehen war. Da sprach eine gütige Stimme zu ihr:“ Liebes Kind, Du bist in Sicherheit. Aber Du bist noch sehr schwach. Du musst noch ein wenig ruhen, bis Du weiterziehen kannst.“ Die kleine Fee erblickte eine alte Frau mit schlohweißen Haaren, die ihr lächelnd ein Glas reichte. „Trinke das! Bald wird es Dir besser gehen.“ Die alte Frau hatte Recht. Nach einigen Wochen tanzte die Fee mit den Schmetterlingen im Garten. Sie merkte, dass sie nun stark genug war, weiterzugehen. Da bedankte sie sich bei der alten Frau und zog weiter in eine berühmte Wasserstadt, von der sie schon viel gehört hatte. Dort bewarb sie sich bei einer großen Zauberschule und wurde von dieser auch aufgenommen. Sie lernte viele interessante Freundinnen und Freunde kennen. Endlich war sie in der großen weiten Welt angekommen und konnte all das, wovon sie schon immer geträumt hatte, erleben und genießen. Die kleine Fee wusste gar nicht, wo sie zuerst hinschauen und -hören sollte. Es war alles so neu und interessant für sie.
Sie bereiste neue Welten, lernte fremde Zaubersprüche und Sprachen kennen und entdeckte die vielen Geheimnisse dieser Welt, über die sie schon so viel gehört hatte. Trotzdem wurde sie manchmal sehr, sehr traurig, wenn sie an ihre Familie dachte. Der Drachen wütete nach wie vor. Die Fee verspürte große Schuld, weil sie ihre Mutter und die Geschwister im Stich gelassen hatte.
Durch ihre Flucht aus dem Drachenhaus veränderte sich aber auch ihr Zuhause. Als die Mutter merkte, dass ihre kleine Fee verschwunden war, verfiel diese in eine große Trauer und Wut. Sie kämpfte zum ersten Mal mit allen Kräften gegen den Drachen und verscheuchte ihn aus der Gegend. Das Lachen kehrte wieder in das Haus zurück.
Dies hörte auch ein einsamer Wanderer, der sich zu der Mutter und den kleinen Geschwistern gesellte. Als die Fee das hörte, bebte sie vor lauter Freude. Sie konnte wieder nach Hause zurückkehren, ohne etwas befürchten zu müssen. Der Drache war verschwunden. Oft kam sie nun auf ihren vielen Reisen zuhause vorbei. Auch ging sie wieder auf die Wanderungen mit ihrem geliebten Wolf. Zwar fiel es ihr manchmal schwer, zu vergessen, was in dem ehemaligen Drachenhaus alles vorgefallen war. Aber mit der Zeit lernte sie, dass es dort wieder erlaubt war, zu lachen und Spaß zu haben.
So verging die Zeit. Die kleine Fee wurde zu einer Frau und wirkte mit ihren Zaubersprüchen und Erkenntnissen in vielen Gegenden und Orten. Zudem lernte sie einen jungen Zauberer kennen, der sie sehr liebte – und der ihr das auch zeigte. Auch sie liebte den Zauberer über alles. Die Fee lernte zum ersten Mal, wirklich zu vertrauen. Und so entschieden sich die Beiden, gemeinsam in eine noch größere Wasserstadt zu ziehen, um dort zusammen neue Zaubertränke zu entwickeln und das Leben zu zweit zu entdecken. Ihr Haus wurde zu einem Haus der Freude, in dem viele Freunde und Bekannte einkehrten. Und auch wenn sie manchmal viel zu tun hatten und langsam merkten, dass es auch in der Wasserstadt nicht nur gute Wesen gab – sie waren glücklich.
Eines Abends fing die Fee jedoch an, bitterlich zu weinen. Sie weinte so lange, bis das ganze Haus in einem Meer voller Tränen stand, und die Möbel durch die Gegend schwammen. Der junge Zauberer versuchte alles, um sie zu trösten. Aber er schaffte es einfach nicht. Selbst über seine berühmten Witze konnte die kleine Fee nicht mehr lachen. Und auch wenn sie vor lauter Erschöpfung und Schmerzen einschlief, weinte sie im Schlaf weiter.
Da erinnerte sich der Zauberer an die alte Frau, die der Fee schon einmal geholfen hatte und ließ diese holen. Als die alte Frau eintrat und die kranke Fee so in ihrem Bett liegen sah, seufzte sie. Nun war es so weit. Sie erzählte, dass sie der kleinen Fee damals, als diese so krank war, den Zaubertrank des Vergessens zu trinken gab. Dieser Zaubertrank bewirkte, dass die kleine Fee alle Drachen, die sie in ihrem Leben getroffen hatte und die ihr geschadet hatten, vergessen konnte.
„Der Zaubertrank sollte jedoch nur so lange wirken, bis Du stark genug bist, den Drachen in die Augen zu schauen.“, ergänzte die weise Frau. „Das bist Du nun. Ab sofort wirst Du Dich an alles erinnern. Du wirst vieles in Gedanken wieder erleben, und es wird sehr wehtun. Aber Du wirst es schaffen, meine Fee. Du bist klug und stark. Du hast einen treuen Gefährten und gute Freunde. Wir alle helfen Dir. Außerdem kenne ich weise und kluge Elfen, die wissen, mit Drachen umzugehen.“ Die Fee zitterte vor Angst. Sie wusste, dass die alte Frau Recht hatte. So viele Tage und Nächte verbrachte sie schon mit den Erinnerungen an die Drachen. Sie war davon schon so erschöpft, dass sie weder schlafen noch essen konnte.
So entschied sie sich, den beschwerlichen Weg zu den Elfen zu wagen, um diese um Rat zu fragen. Da es ein langer und gefährlicher Weg sein würde, wurde sie von dem jungen Zauberer begleitet. Viele Tage waren sie unterwegs. Die Fee wurde immer schwächer. Oft musste der Zauberer sie tragen, weil sie sich nicht mehr auf ihren Beinen halten konnte. Die Beiden begegneten vielen gefährlichen Hindernissen. Aber gemeinsam schafften sie es, diese zu bezwingen und zu den Elfenhöhlen zu gelangen. Bei den Elfen wurden sie sehr herzlich empfangen. Die Fee wurde sofort auf die Krankenstation gebracht, da sie sehr geschwächt war. Dort gaben ihr die Elfen verschiedene Heilkräutertränke zu trinken, die teilweise sehr bitter schmeckten, die Fee jedoch wieder stärkten. Langsam kehrten ihre Kräfte zurück. Der Zauberer blieb noch für einige Tage, um sich für den Rückweg auszuruhen. Oft saß er an ihrem Bett und las ihr Märchen aus den fremden Ländern vor, die sie so liebte. So verbrachten sie viele Stunden gemeinsam.
Dann jedoch war es so weit: Er musste gehen. Beide wussten, dass sie sich nun eine lange Zeit nicht mehr sehen würden. Zum Abschied umarmten sie sich lange und versprachen sich einander, bei ihrem Wiedersehen zu heiraten. Der Zauberer drückte die Fee noch einmal fest an sich und ging.
Wieder einmal war die Fee ganz allein. Aber es dauerte nicht lange, bis sie andere Feen und Kobolde kennenlernte, die ähnliche Dinge erlebt hatten. Mit ihnen konnte sie all die schrecklichen Erinnerungen teilen. Die Elfen brachten allen bei, dass es wichtig war, über Drachen zu sprechen. Sie unterstützten die Fee und halfen ihr, die richtigen Worte zu finden. Sie lernte, mit den Erinnerungen zu leben und über diese zu sprechen, zu weinen und auch wütend zu werden. Zudem lernte sie von den Kobolden, laut zu schreien, Streiche zu spielen und mit den Füßen zu stampfen. Es fiel ihr sehr schwer, aber langsam machte es ihr sogar Spaß. Die Kobolde wiederum lernten, ruhiger zu werden und sich zu entspannen. Es waren anstrengende Wochen für alle.
Aber die Fee merkte, dass diese Zeit gut für sie war. Dank der Heilkräuter kehrte langsam, aber sicher ihre Kraft zurück. Sie konnte wieder lachen. Ihre Augen erblickten das Schöne in den Gärten der Welt. Immer öfter sah man die Fee singend und tanzend durch die Wälder spazieren. Nachts schlief sie tief und fest. Die bösen Träume waren vergessen. Dafür wuchs ihre Ungeduld, Neues zu erleben, umso mehr. Oft stand die Fee am Zaun und schaute sehnsüchtig in die Ferne. Was dort draußen wohl vor sich ging? So gern würde sie wieder neue Abenteuer erleben. Sie träumte bereits davon, mit ihrem Zauberer wieder die Welt zu entdecken. Aber war sie schon stark und kräftig genug? Die kleine Fee nahm sich ein Herz und ging zu den Elfen, um diese um Rat zu fragen.
Diese schwiegen lange, bevor sie anfingen zu sprechen: „Liebe Fee, gern würden wir Dich noch hier bei uns behalten. Wir haben Dich sehr liebgewonnen. Und Du tust vielen von uns gut. Wir haben auch viel von Dir gelernt. Du bist schon einen sehr langen Weg gegangen, und Du hast bereits einiges geschafft. Es wird Zeit, wieder nach draußen zu gehen. Viele Schritte liegen noch vor Dir. Doch wir sind uns sicher, dass Du diese nun auch ohne uns gehen kannst. Wir wissen auch, dass es wichtig für Dich ist, wieder in die Welt hinauszugehen, um dort Deine Pläne weiter zu verfolgen. Deine Freunde warten da draußen auf Dich. Aber Du musst noch gut auf Dich Acht geben und an Dich denken. Versprich’ uns, dass Du Dich noch lange Zeit schonen wirst nach dieser schweren Krankheit.“ Die Fee umarmte die Elfen freudig, und versprach unter Tränen, immer an deren Worte zu denken. Sie war den Elfen so dankbar für alles, was sie für sie getan hatten. Gleichzeitig freute sie sich auf ihren Zauberer, die weite Welt und ihre Freunde.
Und wieder packte die Fee ihr Bündel, bedankte sich bei den Elfen und ging los. Dieses Mal hatte sie keine Angst vor dem langen Weg, hatte sie doch wieder genügend Kraft gesammelt und meisterte die Hindernisse spielerisch. Auf halbem Wege kam ihr voller Freude der junge Zauberer entgegen. So sehr hatte er sich nach seiner Fee gesehnt. Als sie gemeinsam zuhause ankamen, warteten schon viele Freunde auf die Beiden. Sie hatten schon alles für die Willkommens- und Hochzeitsfeier vorbereitet. Alle jubelten und feierten das junge Paar mit Gesängen und Tanz. Bis in das Morgengrauen saßen sie zusammen. Die Fee schaute sich immer wieder um, und konnte ihr Glück kaum fassen. Sie war fast gesund und konnte wieder lachen. Sie hatte Freunde, die sie liebten und schätzten. Und sie wusste, dass noch viele neue Abenteuer in dieser großen weiten Welt auf sie und ihren Mann, den Zauberer warten würden.
ENDE
Das vorhergehende Märchen entstand in einer Reha-Klinik. Diese besuchte ich, nachdem ich mit 34 Jahren zum ersten Mal zusammengebrochen war. Bis dahin führte ich nach außen ein gutes, spannendes und erfolgreiches Leben. Nach einem Wirtschafts- und Japanologie-Studium arbeitete ich in unterschiedlichen Unternehmen und machte Karriere, ohne es wirklich geplant zu haben. Darüber hinaus hatte ich einen großen Freundeskreis, einen liebevollen Freund und reiste viel. Meine Familie besuchte ich nach wie vor sehr oft. „Eigentlich“ war alles gut. Trotzdem war ich oft traurig und sehr ernst. Die Magersucht, die ich in meiner Jugend entwickelt hatte, war zwar kaum mehr sichtbar. Aber ich war nach wie vor latent magersüchtig und hatte große Probleme mit dem Essen. Zudem fühlte ich mich oft wie ein Alien inmitten meiner Kollegen. Ich merkte, dass ich den Machtkämpfen in der Wirtschaft seelisch nicht gewachsen war. Langsam zeigte sich auch meine Arbeitssucht. In jedem Unternehmen arbeitete ich bis zum Umfallen und war öfters nahe am Burnout. Mit Anfang 30 begann ich deswegen eine Verhaltenstherapie, wobei ich jedoch stets an der Oberfläche blieb. Ich ahnte bereits, dass mich Untiefen erwarteten – und war noch nicht bereit, mich in diese zu begeben.
Durch ein Ereignis in der Familie, in der Gewalt in der Ehe eine entscheidende Rolle spielte, sollte sich jedoch alles ändern. Als ich davon hörte, brachen die Mauern des Vergessens entzwei, und Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend überfluteten mich. Ab dem Moment war ich nicht mehr dieselbe. Mühsam versuchte ich jeden Tag aufs Neue meine Fassung zu wahren, obwohl tief in mir die Schrecken und Ängste von früher wucherten. Ich zeigte alle Symptome einer ausgeprägten Posttraumatischen Belastungsstörung. Tagsüber quälten mich Erinnerungen. Immer öfter erschrak ich und wurde zunehmend gereizter. Nachts konnte ich nicht mehr einschlafen. Und wenn ich doch einmal einschlief, zerstörten Albträume meinen Schlaf. Als Folge arbeitete ich bis spät in die Nacht und vermied es zu schlafen. Ich nahm innerhalb kürzester Zeit stark an Gewicht ab. Der Selbstekel griff um sich. Mein Verhaltenstherapeut versuchte mich zu unterstützen, indem er mit mir meine Familiengeschichte aufarbeitete. Eine Traumakonfrontation sollte mir helfen, ein friedlicheres Verhältnis zu meinem Körper aufzubauen. Aber mir ging es danach noch schlechter. Als mich mein Therapeut deswegen an eine Körpertherapeutin verwies, die mit der aufdeckenden Skan-KörpertherapieIarbeitete, kam ich vom Regen in die Traufe. Die Körpertherapie destabilisierte mich zunehmend. Die ersten Erinnerungen an den sex*** Missbrauch kamen hoch, was ich nicht verkraftete. Beide BehandlerInnen waren jedoch davon überzeugt, dass ich auf dem richtigen Weg sei. Damals vertraute ich ihnen und machte ich weiter. Die Instabilität jedoch wuchs.
Heute weiß ich, dass eine umfassende Stabilisierung vor der Traumakonfrontation dringend notwendig gewesen wäre. Stattdessen setzten meine BehandlerInnen weiterhin auf Konfrontation. Ich reagierte mit zunehmenden Weinkrämpfen und starker Erschöpfung. Zusätzliche Trigger am Arbeitsplatz machten das Fass voll. Auf Bitte meines Therapeuten reichte ich schließlich einen Antrag auf eine Reha-Behandlung ein, der erst einmal abgelehnt wurde. Während des Widerspruchsverfahrens brach ich dann zusammen. Mein Hausarzt schrieb mich damals sofort krank und beschleunigte das Aufnahmeverfahren in die Rehabilitationsklinik.II
In dieser Klinik schrieb ich mein Märchen, das mir heute noch sehr viel bedeutet. Nach meiner Rückkehr nach Hause entschied ich mich, meine Verhaltenstherapie abzubrechen und wandte mich zum ersten Mal an eine Traumatherapeutin. Damals war ich noch davon überzeugt, einen Großteil meiner therapeutischen Arbeit bereits geschafft zu haben. Im Nachhinein war es jedoch erst der Anfang eines langen Wegs. Einige weitere heftige Krisen sollten mich noch ereilen. Körperlich habe ich stark gelitten. Inzwischen weiß ich, dass es noch einige andere Drachen gab, die der kleinen Fee schadeten. Zudem sollten noch einige Aufenthalte bei den Elfen folgen. Meine Abenteuer sind heute um einiges kleiner, aber umso intensiver. Mein Zauberer ist inzwischen mein Mann. Viele Wölfe sollen bei uns noch ein Zuhause finden. Heute ist mir klar, dass dieses Märchen nie enden wird. Es ist mein Leben.
I Bei der Skan-Körperarbeit liegt eine KlientIn nur mit dem Slip bekleidet auf einer Matte. Sie wird von der Skan-TherapeutIn angeleitet, für eine lange Zeit tief und rhythmisch (mal schnell, mal langsam) zu atmen. Dabei kommen verschiedene Massage- und Berührungs-Interventionen zur Anwendung. Darüber hinaus werden Übungen aus der Stimm-, Ausdrucks- und Bewegungsarbeit genutzt. Die Methode wirkt grundsätzlich sehr aufdeckend.Quelle: Eigene Erfahrungen und https://www.skanakademie.de/was-ist-skan, zuletzt aufgerufen am 15.09.2021
II Über die Aufenthalte in der Reha-Klinik werde ich später mehr berichten. Darüber hinaus finden Sie eine Auflistung über meine Therapien im Anschluss.
Chronologie meiner Therapien
2000 bis 2003Verhaltenstherapie und Skan-Körpertherapie
2003/ 2004Aufenthalte in einer Reha-Klinik mit traumatherapeutischem Angebot
Anfang 2004 bis Mitte 2016Therapie bei einer Trauma-Fachberaterin sowie Körper- und Psychodrama-Therapeutin
Erste und zweite Ergotherapie
2007 und 2009Intervall-Therapie in einer psychiatrischen Klinik mit Station für Traumatherapie
Ende 2018 bis Ende 2020Verhaltenstherapie
Ende 2020 bis heuteKörperorientierte Traumatherapie
Traumaspezifische Ergotherapie
Physiotherapie und Osteopathie
Grundlagen der Traumatherapie
Trauma und seine Folgen
Das Wort „Trauma“ kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Wunde“ oder „Verletzung“. Daher wird von einem psychischen Trauma gesprochen, wenn eine mentale oder seelische Verletzung vorliegt.2 Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff „Trauma“ heutzutage jedoch zu häufig und voreilig benutzt. Aussagen wie „Nationalmannschaft erleidet eine traumatische Niederlage“ oder „Das Weihnachtsfest war ein einziges Trauma“ und „Mein Chef hat mich heute in der Konferenz traumatisiert“ sind in der Allgemeinbevölkerung und vor allem auch in den Medien keine Seltenheit mehr. Für Menschen mit schweren Traumafolgestörungen ist dies nur schwer auszuhalten, da ihr eigenes Leid damit indirekt bagatellisiert wird. Auch in der Fachwelt wird bereits vor einer Bagatellisierung und inflationären Nutzung des Begriffs „Trauma“ gewarnt.3
Schon aus diesem Grund ist es unabdingbar, sich wieder auf die medizinische Definition von Trauma zu konzentrieren. Diese findet sich in den internationalen Klassifikationssystemen bzw. Diagnose-Katalogen ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)4 und DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)5, in denen die Bedingungen für ein Trauma festgelegt wurden:
Bei einem Trauma muss objektiv eine frühere außergewöhnliche Bedrohung oder ein katastrophenartiges Ausmaß einer Situation vorliegen. Darunter fallen u.a. der drohende Tod und eine tatsächliche oder drohende ernsthafte Körperverletzung, egal ob es sich um die Person selbst handelt oder ob sie als Augenzeuge eine solche Tat beobachtet oder erfährt. Dies gilt vor allem dann, wenn nahestehende Personen wie Familienmitglieder oder FreundInnen betroffen sind. Zudem zeichnet sich ein Trauma laut ICD 10 dadurch aus, dass subjektiv "… bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung…“ auftauchen würde.6 Ein weiteres Zeichen von Trauma sind intensive Gefühle wie Angst, Hilflosigkeit oder Schrecken.7 Zu traumatischen Ereignissen zählen damit unter anderem Naturkatastrophen, Unfälle, schwere oder lebensbedrohliche Erkrankungen, Überfalle, Folter, Flucht, Misshandlung, sex*** Missbrauch und Vernachlässigung im Kindesalter.
Selbstverständlich können auch andere Ereignisse und Situationen eine starke Belastung im Leben darstellen, die schwer zu verarbeiten ist. Einige Personen werden z.B. durch eine Scheidung oder einen Arbeitsplatz-Verlust traumatisiert. Aber oft ist der Trauma-Begriff hier schon nicht mehr zielführend. Trotzdem ist es bei zu hoher Belastung ratsam, in solchen oder anderen einschneidenden Lebensphasen eine Psychotherapie zu beginnen.
Traumata sind umso schwerer zu gewichten, je früher und öfter sie im Leben eines Menschen stattfinden. Mit gravierenden Folgen ist vor allem bei traumatischen Erlebnissen in der frühen Kindheit zu rechnen. In ein weiteres Extrem rutschen die Traumafolgestörungen, wenn ein Kind von einem Elternteil zerstörerische Gewalt, Vernachlässigung oder gar Missbrauch erleben muss. Diese Situation ist ausweglos und kaum zu verkraften.
Auch im Erwachsenenalter ist die Trauma-Belastung höher, wenn das Trauma von Menschen verursacht wurde (man-made desaster). Eine Naturkatastrophe wird daher meist besser verarbeitet als ein Überfall. Wird die existentielle Bedrohung durch einen nahestehenden geliebten Menschen (z.B. aus der Familie oder dem Freundeskreis) ausgelöst, wiegt das Trauma besonders schwer. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sich ein Trauma umso stärker auswirkt, je geringer die Handlungsmöglichkeiten des Opfers waren.8 Daher kann jemand, der sich während eines Bank-Überfalls wehren und befreien konnte, meist besser mit dem Erlebten umgehen als sein Kollege, der keine Möglichkeiten der Gegenwehr hatte. Ein weiterer Faktor, der die Traumafolgestörungen stark beeinflusst, ist die Reaktion des Umfelds auf das erlebte Trauma. Völlig klar dürfte sein, dass Vorwürfe und Unverständnis die traumatische Belastung verstärken, während Verständnis, Hilfe und Schutz Betroffene entlasten können.
Als ich elf Jahre alt war, stürzte ich von einem Dachboden in die Tiefe. Ich hatte damals das große Glück, dass ich aus einer Höhe von drei Metern auf einen Holzfußboden und nicht auf Stein fiel. Trotzdem war ich schwer verletzt. Als ich ins Krankenhaus eingeliefert wurde, bestand der Verdacht auf Hirnblutungen. Damals wurde ein Pastor gerufen, da mit dem Schlimmsten gerechnet wurde. Ich selbst bekam von diesem Schrecken kaum etwas mit und erwachte erst später in meinem Krankenhausbett. Die Bilanz fiel ernüchternd aus, meine Eltern waren nachhaltig erschüttert. Mein linker Arm und meine Nase waren gebrochen. Das Gesicht war entstellt. Darüber hinaus wurde eine schwere Gehirnerschütterung diagnostiziert. Mir ging es in den ersten Tagen körperlich sehr schlecht, aber meine Eltern kümmerten sich rührend um mich. Auch meine Großeltern kamen zu Besuch. Der Pastor schaute öfters vorbei und erklärte mir immer wieder, dass ich eine ganze Schar von Schutzengeln beschäftigt hatte. Seelisch wurde ich daher gut aufgefangen. Eine Woche später rannte ich mit neuen Freundinnen schon wieder über die Krankenhausflure und wurde von den Krankenschwestern ausgeschimpft. Nach meiner Krankenhaus-Entlassung spielte ich trotz all der Handicaps sofort wieder Fußball, was Hausarrest zur Folge hatte. Ich hatte zwar kurzzeitig Angst vor Höhen, aber gleichzeitig war ich die Heldin in meiner Schule und besaß den Gipsarm als Trophäe. Nach zwei Monaten war alles wieder vergessen. Ich wanderte wieder in den Bergen und konnte dies genießen. Die Reaktion meines Umfelds hatte mir damals geholfen.
Während einer lebensbedrohlichen Situation ist das angeborene biologische Stresssystem eines Menschen völlig überfordert.9 Unter normalen Umständen ist unser Nervensystem bei Gefahr auf „Kampf“ oder „Flucht“ eingestellt. Eine ausweglose, erschütternde und lebensbedrohliche Lage führt jedoch zur Erstarrung. Wenn diese nach dem traumatischen Erlebnis nicht aufgelöst wird, verbleibt die Trauma-Energie im Körper. Das Nervensystem bleibt in der lebensgefährlichen Situation hängen, und das Gehirn kann das Erlebte nicht mehr vollständig und angemessen verarbeiten.10 Die traumatisierte Person hat keine Möglichkeit mehr, das Geschehene in das biografische Gedächtnis zu integrierenIII, wodurch eine akute Belastungsreaktion entsteht.
Diese kann sich sowohl in einer Übererregung als auch in einer Untererregung des autonomen Nervensystems zeigen, was sich in weitreichenden und quälenden Folgesymptomen niederschlägt. Beide Zustände stören das vegetative Nervensystem eines Menschen maßgeblich und wirken sich wiederum negativ auf dessen körperliches Wohlbefinden aus. Schwierig wird es vor allem, wenn beide Zustände parallel bestehen.
Eine Übererregung zeichnet sich durch anhaltende Stresssymptome aus wie erhöhte Wachsamkeit (Hypervigilanz oder Hab‘ Acht-Stellung), Schreckhaftigkeit, Einschlafund Durchschlafstörungen sowie Albträume. Betroffene ziehen sich oft zurück und vermeiden Situationen, die an das Trauma erinnern. Aufgrund einer verstärkten Reizbarkeit kann zudem die Aggressionsbereitschaft steigen. Darüber hinaus leiden die meisten Trauma-Opfer unter unklaren körperlichen Beschwerden und Flashbacks. Letztere werden auch als „Albträume am Tag“ bezeichnet. Dabei wird das erschütternde Ereignis nicht mehr aus der Distanz und als Erinnerung wahrgenommen. Im Gegenteil: Traumatisierte Menschen rutschen bei einem Flashback mit den dazugehörigen Gefühlen und Sinneswahrnehmungen in die Vergangenheit und durchleben das Trauma noch einmal neu. Es fühlt sich in dem Moment genauso an wie damals.
Eine Untererregung des autonomen Nervensystems kann wiederum zu emotionaler Taubheit, einem starken Ohnmachtsgefühl und im Extremfall zu Dissoziationen führen. Dissoziation ermöglicht, dass Schmerz oder Gefühle in der Situation selbst nicht wahrgenommen werden. Zudem ist eine Amnesie für das Ereignis selbst (bzw. für Bruchteile des Ereignisses) möglich. So nur ist erklärlich, warum z.B. ein verletztes Unfallopfer den Unfallort verlässt, obwohl es mit einem gebrochenen Bein eigentlich nicht mehr gehen kann. Das traumatisierte Opfer dissoziiert zu diesem Zeitpunkt. Später wird es sich in der Regel daran nicht mehr erinnern. Damit die oben genannten Symptome wiederum gelindert werden können, muss das Gleichgewicht des Nervensystems nach einem Trauma unbedingt wiederhergestellt werden. Betroffene sollten daher direkt nach dem traumatischen Erlebnis von Fachleuten und/oder ihrem privaten Umfeld adäquat unterstützt und behandelt werden.11 Wenn dies gelingt, wird davon ausgegangen, dass ein Großteil der Beschwerden innerhalb der ersten zwei Wochen abklingt. Der Rest der Symptome sollte nach drei bis vier Monaten verschwunden sein.12 Erhalten Menschen nach einem Trauma jedoch keine bzw. wirkungslose Unterstützung, können sich die oben genannten Belastungssymptome chronifizieren. Eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) entsteht.
DIE ZWEI UNTERFORMEN DER PTBS
1. Klassische PTBS
2. Komplexe PTBS
Zu 1) Klassische PTBS
Bei einem einmaligen bzw. Mono-Trauma wird von einer klassischen posttraumatischen Belastungsstörung (klassische PTBS) gesprochen. Ein Mono-Trauma ist z.B. ein schwerer Unfall, ein Überfall, eine Vergewaltigung, eine Naturkatastrophe oder auch eine schwere Erkrankung wie eine schwere Covid-Erkrankung mit Beatmung oder ein geplatztes Gehirn-Aneurysma, das überlebt wird. Da sich die Über- oder Untererregung des autonomen Nervensystems bei einer PTBS chronifiziert, können die dazugehörigen Symptome den Alltag stark beeinträchtigen. Bei der PTBS erleben Betroffene über eine längere Zeit ihr Trauma durch Flashbacks und Albträume immer wieder aufs Neue. Viele Traumatisierte vermeiden daher alles, was sie an das Trauma erinnert. Sie halten sich von den Orten des Geschehens fern und weichen anderen Menschen oder Tätigkeiten aus. Viele versuchen, sich mit Alkohol, Drogen, Essen, Arbeit oder Sport zu betäuben. Damit wollen sie den Symptomen und Gefühlen entgehen, die angesichts der Traumata hochkommen.
Das Ungleichgewicht des vegetativen Nervensystems und die damit zusammenhängenden Symptome bleiben jedoch bestehen. Ein Teufelskreis entsteht. Oft kommen weitere Störungen wie Depressionen, Suchterkrankungen oder Angst- und Panikattacken hinzu, die wiederum dringend behandelt werden müssen. Unerlässlich für deren erfolgreiche Behandlung ist jedoch, dass der Zusammenhang zur PTBS erkannt und in den therapeutischen Gesamtbehandlungsplan integriert wird. Eine Traumatherapie unter Berücksichtigung der Begleiterkrankungen ist damit früher oder später angezeigt.
Oft ist jedoch, je nach Begleiterkrankung, vorab noch ein Entzug, eine medikamentöse Behandlung oder auch eine Gewichtsstabilisierung notwendig. Danach erst schließt sich die Behandlung einer klassischen PTBS an. Dabei wird in der Regel nach einer Stabilisierungsphase eine Traumakonfrontation durchgeführt, die dann in die Integrations- und Verarbeitungsphase mündet.
Zu 2) Komplexe PTBS
Die komplexe PTBS wird diagnostiziert, wenn wiederholte Traumatisierungen über einen längeren Zeitraum stattfanden. Dies ist z.B. bei Erwachsenen während einer Geiselhaft, Inhaftierung, bei langanhaltender häuslicher Gewalt, im Krieg und auf der Flucht der Fall. Im Kindesalter spielen vor allem Vernachlässigung, Misshandlungen oder Missbrauch eine große Rolle.
Menschen mit komplexen und oft frühen Traumafolgestörungen leiden unter denselben Symptomen der klassischen PTBS. Zusätzliche Symptome kommen jedoch noch hinzu. Sie haben meist Schwierigkeiten, Gefühle wahrzunehmen und zu kontrollieren, was regelrecht Angst vor Emotionen auslösen kann. Darüber hinaus kann die mangelnde Fähigkeit, die Gefühle unter Kontrolle zu halten, in Selbstverletzung, Suizidversuchen oder riskanten Sexualverhalten münden. Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit werden durch Dissoziation stark beeinträchtigt.IV
In der Folge kann sich die Persönlichkeit der Betroffenen stark verändern. Obwohl die Betroffenen Opfer waren, fühlen sie sich oft schuldig angesichts dessen, was ihnen geschehen ist. Ohnmachtsgefühle und Hilflosigkeit führen zudem zu einem Gefühl der Aussichts- und Hoffnungslosigkeit. Bisherige Überzeugungen und Werte brechen in sich zusammen. Auch großes Misstrauen gegenüber Mitmenschen ist verbreitet. Paradoxerweise idealisiert manche Betroffene stattdessen die Täter und hält an schädigenden Beziehungen fest. Dadurch besteht ein großes Risiko, erneut zum Opfer zu werden. Und nicht zuletzt kann es leider auch vorkommen, dass Trauma-Überlebende selbst zu Tätern werden und andere Menschen zum Opfer machen.13
Die komplexe PTBS wird meist von weiteren psychischen Störungen wie z.B. Depression, Angst-, Ess- und Suchtstörungen sowie Somatisierung oder somatoforme Störungen begleitet oder gar überlagert, und wird daher nach wie vor oft übersehen, was wiederum zu Fehlbehandlungen führt. Eine Psychotherapie, die sich nur auf die – leicht ersichtlichen – Erkrankungen (z.B. Depression, Suchterkrankungen oder Essstörungen) konzentriert, wird den Betroffenen jedoch langfristig nicht helfen. Rückfälle sind daher nicht selten.
Erst jetzt wird die komplexe PTBS als offizielle Diagnose im ICD-11 aufgenommen, das 2022 in Kraft tritt.14 Auch in der neuen Leitlinie zur Diagnostik und Behandlung von Traumafolgestörungen wurde die komplexe PTBS erst jetzt berücksichtigt und separat erläutert.15 Dies wird höchste Zeit, da die bisherige Behandlungs-Leitlinie, die hauptsächlich die klassische PTBS im Blick hatte, vielen Betroffenen nicht gerecht wurde. Für die Behandlung von komplex traumatisierten Personen muss grundsätzlich eine weitaus längere Therapiezeit und Stabilisierungsphase als bei der klassischen PTBS eingeplant werden.
Besonders häufig kommt die komplexe PTBS bei Traumata im Kindesalter vor. Diese werden auch als Entwicklungstraumata bezeichnet und haben weitreichende und schwerwiegende Folgen. Unter anderem kann die körperliche und psychische Entwicklung des Kindes stark beeinträchtigt werden. Bei einem schwertraumatisierten Kind entstehen andere, stressanfälligere Strukturen als bei einem Kind, das unbelastet aufwächst.16 Dissoziative Störungen z.B. treten vor allem nach schweren Traumatisierungen im Kindesalter auf. Des Weiteren sind körperliche Folgeerkrankungen aufgrund des – chronisch hohen – Stressniveaus und eines beeinträchtigten vegetativen Nervensystems nicht selten.
Aber oft bleibt die komplexe PTBS im Kindesalter unbemerkt bzw. verschwiegen, da gerade bei Gewalt in der Familie meist ein Schweigegebot besteht. Auch bei sex*** Missbrauch sind Sprechverbote die Regel. Ein aufmerksames Umfeld würde eventuell etwas bemerken. Jedoch wird häufig über die vielen kleinen und größeren Anzeichen, dass etwas nicht stimmt, hinweggesehen. Einer Studie zufolge17 baten bereits in den letzten 70 Jahren viele Jugendliche, die missbraucht wurden, direkt bei den Jugendämtern um Hilfe. Sie wurden jedoch über Jahrzehnte hinweg nicht ernst genommen. Stattdessen glaubten die sozialpädagogischen Fachkräfte den Beteuerungen der Eltern oder waren überzeugt, dass trotz allem die Familie nach wie vor der beste Ort für die Jugendlichen sei.
Jüngere Kinder haben wiederum keinerlei Chance bei Gewalt oder Missbrauch in der Familie, wenn nicht Nachbarn, Lehrkräfte, Erzieher, Ärzte, Geschwister oder Freunde und Bekannte ihren Verdacht äußern.18 Aber nach wie vor schauen viele Mitmenschen bei solchen Vorkommnissen weg oder trauen sich nicht, diese zu melden. Und auch wenn heutzutage im Vergleich zu früher mehr auf eine verzögerte Entwicklung oder Verhaltensauffälligkeiten des Kindes geachtet wird, wird meist kein Zusammenhang zu einem verschwiegenen Trauma hergestellt.
Später entwickeln frühtraumatisierte Jugendliche dann häufig Essstörungen, Süchte, Angststörungen, Zwangs- oder Borderline-Störungen sowie Depressionen, die inzwischen meist registriert und therapeutisch behandelt werden. Aber auch hier wird die posttraumatische Störung nicht oder erst später berücksichtigt, da die Jugendlichen aufgrund von weitreichenden Amnesien für die erfolgten Traumata oder wegen der Schweigegebote nicht über das Erlebte sprechen können. Manche Betroffene können dank der Amnesien sogar eine unauffällige Jugend verbringen und später als Erwachsene ein hinreichend normales Leben führen. Wenn jedoch das Trauma durch ein belastendes Ereignis oder einen TriggerV wieder in das Bewusstsein dringt, kann die Mauer der Amnesie fallen. Die Erwachsene wird mit den Erinnerungen an das schreckliche Erlebnis in der Kindheit überflutet. Viele Menschen mit komplexen Traumafolgestörungen aus der Kindheit befinden sich daher bereits im mittleren Erwachsenenalter, wenn sie zum ersten Mal mit der Diagnose „Komplexe PTBS“ konfrontiert werden. Oft dauert es sogar Jahrzehnte, bis Traumafolgestörungen aus der Kindheit erkannt werden.
Manchmal kommt es auch vor, dass eine erwachsene KlientIn wegen eines aktuellen Traumas oder einer anderen psychischen Störung in der Gegenwart therapeutisch behandelt wird, obwohl diese – ohne es zu wissen – unter einer komplexen PTBS leidet. Durch Amnesien für frühere Traumata erinnert sie sich jedoch nicht und schildert somit in der Anamnese keine weiteren erlebten Traumata, was zu einer unzureichenden Diagnostik und Behandlung führen kann. Zudem verschweigen einige erwachsene KlientInnen die früheren Traumata aus Scham oder aufgrund eines noch bestehenden Sprechverbots. Wenn eine TherapeutIn dann nicht explizit nachfragt, wird sie davon nichts erfahren. Durch eine herkömmliche Traumatherapie und eine nach sich ziehende Trauma-Konfrontation können jedoch die Erinnerungen an längst verdrängte oder abgespaltene traumatische Erlebnisse hochkommen. Das Risiko der nachträglichen Destabilisierung ist groß, wenn danach nicht so schnell wie möglich wieder stabilisiert wird. In einem solchen Fall sollte die neu festgestellte komplexe Posttraumatische Belastungsstörung sofort therapiert werden.
Auch ich war mit Mitte 30 bereits erwachsen, als mich die Erinnerungen an die Traumata in meiner Kindheit überfluteten. Heute weiß ich, dass ich bereits als Säugling Gewalt in der Familie erleiden musste. Damals reagierte niemand, obwohl es einige MitwisserInnen gab. In meiner Familie wurden die früheren Gewalttaten grundsätzlich bagatellisiert und teilweise bis heute geleugnet. Sichtbar waren meine Probleme trotz allem: Bereits im Kindergarten zeigte ich starke Ängste und kaute meine Fingernägel ab, bis sie ausfielen. Mein Umfeld bemerkte daher des Öfteren, dass ich Probleme hatte. Aber die LehrerInnen, NachbarInnen, Verwandten, Pastoren oder Ärzte sprachen bei Schwierigkeiten in der Regel nicht mit mir, sondern mit meinen Eltern. Diese wiederum sprachen nicht über die Gewalt, die bei uns zuhause herrschte. Auch eine starke Magersucht in meiner Jugend wurde daher nur unzureichend behandelt, da das Hauptaugenmerk meines Hausarztes und auch der Lehrer auf der Gewichtszunahme lag. Eine PsychotherapeutIn wurde damals nicht zu Rate gezogen. Da ich in der Schule nur durch gute Noten auffiel, wurde es als „nicht schlimm“ angesehen. Zaghafte Versuche meinerseits, auf meine Nöte aufmerksam zu machen, schlugen fehl. Daher sprach ich auch nach einer Vergewal*** in meinem 19. Lebensjahr mit niemanden. Ich hatte zu oft die Erfahrung gemacht, dass mir in solchen oder ähnlichen Situationen immer die Schuld gegeben wurde. Aber meine Magersucht verschlechterte sich schlagartig. Aufgrund eines körperlichen Zusammenbruchs wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert und von Ärzten sowie Krankenschwestern nach Schwierigkeiten in der Familie befragt. Aber ich war schon verstummt. Mein Misstrauen war zu groß. Eine Woche nach Einlieferung entließ ich mich auf eigene Verantwortung und ging wieder zur Schule.
Während des Studiums, das ich 800 km von zuhause entfernt absolvierte, machte ich noch einen Versuch, eine Psychotherapie für Essstörungen zu finden. Ich hatte jedoch keinen Erfolg. Die Wartezeiten betrugen zum Teil Jahre. Daher entschied mich damals, wieder einmal allein zu kämpfen. Erst mit 31 Jahren sollte ich meine erste Verhaltenstherapie beginnen, von der ich bereits berichtete. Da hier anfangs jedoch keine umfassende Anamnese gemacht wurde, stand allein meine Arbeitssucht und das Risiko des Burnouts im Vordergrund. Erst vier Jahre später wurde während der Reha-Maßnahme die komplexe PTBS festgestellt, die auf die wiederholten Traumata in meiner Kindheit und Jugend zurückzuführen ist. Die schwere dissoziative Störung, die mich bereits mein Leben lang begleitete, wurde wiederum erst nach einer umfassenden Diagnostik während eines Aufenthalts auf einer Trauma-Station entdeckt. Ich war damals bereits 37 Jahre alt.
Dissoziation und die dazugehörigen Symptome
Dissoziation wird als Fähigkeit bezeichnet, etwas aus dem Alltagsbewusstsein abzuspalten. Dabei blendet das Gehirn unwichtige Wahrnehmungen aus, während es die relevanten Dinge und vor allem die Gesamteindrücke speichert.19
Laut des amerikanischen psychiatrischen Klassifikationssystem DSM-IV ist das Hauptmerkmal der Dissoziation die „… Unterbrechung der normalerweise integrativen Funktionen des Bewusstseins, des Gedächtnisses, der Identität oder der Wahrnehmung der Umwelt“.20
Dieses Phänomen kennen auch gesunde Menschen, wenn sie z.B. auf eine bestimmte Tätigkeit oder Aufgabe voll konzentriert bzw. im „Flow“ sind. Sie vergessen in diesem Moment alles andere, so dass weitere Wahrnehmungen, Sinneseindrücke oder Körperempfindungen nicht mehr in ihr Bewusstsein gelangen. Ein bekanntes Beispiel ist der zerstreute Professor, der einzig und allein an seinem Fachgebiet interessiert ist. Er ist von seiner Forschung so besessen, dass er alles um sich herum vergisst und immer wieder Sachen verlegt. Das ist Alltags-Dissoziation, die auch bei Tagträumen zu beobachten ist. Eine mangelnde Integrationsfähigkeit und damit Neigung zur Dissoziation kann außerdem bei extremer Übermüdung, hohem Stress oder schweren Erkrankungen auftreten.
In bedrohlichen, gefährlichen und überwältigenden Situationen ist die Dissoziation eine sinnvolle und hilfreiche Reaktion des menschlichen Organismus. Die Erinnerungen an das Trauma werden unwissentlich vom Bewusstsein abgespalten, um das Unaushaltbare nicht mehr spüren zu müssen oder sogar ganz zu vergessen.21 Damit können Betroffene nicht mehr bewusst auf bestimmte Erinnerungen zugreifen.22 Sie werden geschützt. Schwierig wird es jedoch, wenn die Dissoziation nach dem Trauma bestehen bleibt. Das Gehirn greift dann auch später bei allem, was an das Trauma erinnert (z.B. Gerüche, Farben, Formen, Geräusche oder Berührungen), auf diesen Schutz zurück. Eine dissoziative Störung entsteht. Diese kann sich in einer großen Bandbreite von Symptomen zeigen, die in leicht bis schwer oder in vorübergehend bis chronisch unterteilt werden können. Folgende Symptome können bei einer dissoziativen Störung auftreten:23
DIE SYMPTOME EINER DISSOZIATIVEN STÖRUNG
Dissoziative Amnesie
Bei einer dissoziativen Amnesie können sich Betroffenen nicht mehr oder nur teilweise an das Trauma erinnern. Oft sind nach dem Trauma daher nur noch Bruchteile des Ereignisses im Gedächtnis vorhanden (z.B. Gerüche, Farben oder Stimmen). Der Rest ist abgespalten.
Biografische Amnesie
Hier können sich Menschen nicht mehr an wichtige Erlebnisse oder Zeiträume erinnern. Bei schweren dissoziativen Störungen weiten sich die Gedächtnislücken auf den Alltag aus, so dass Betroffene keine Erinnerung mehr daran haben, was sie kurz vorher getan haben. Die dissoziative Amnesie zeigt sich aber auch in sogenannten Zeitverlusten. Die betroffene Person schaut dann auf die Uhr und weiß nicht, was z.B. in den letzten drei Stunden passiert ist. Ihrem Bewusstsein fehlt diese Zeit und damit auch das, was sie in dieser Zeit getan hat.
Derealisation: Entfremdung von der Umwelt
Hier wird die Umwelt als verändert, unwirklich oder wie im Nebel wahrgenommen. Die betreffende Person fühlt sich dann von der Umwelt wie abgetrennt („als ob ich einen Schleier vor Augen habe und deswegen alles nicht mehr richtig sehe“, „als ob eine Glasscheibe zwischen uns steht“, „als ob ich in Watte gepackt bin und deswegen alles ganz dumpf mitbekomme“). Auch kann die Realität, die in diesem Moment nicht aushaltbar erscheint, wie in einem Film oder einem Traum wahrgenommen werden („das ist alles nicht wahr“, „das passiert nicht mir“).
Wichtig!
Zu unterscheiden ist die biografische Amnesie von der Kindheitsamnesie. Bei letzterer, die völlig normal ist, gibt es keine Erinnerungen an die ersten zwei bis drei Jahre. Noch bis ins Schulalter können die Erinnerungen lückenhaft sein.
Depersonalisation: Entfremdung von sich selbst und vom eigenen Körper
Eine Betroffene kann sich bei Depersonalisations-Symptomen oft nicht mehr fühlen oder spüren. Teilweise wird auch der Körper – oder auch nur bestimmte Körperteile – nicht mehr oder nur noch verändert wahrgenommen. Für die Person fühlt sich dies so an, als ob sie neben sich steht. Darüber hinaus berichten einige Menschen mit dieser Störung, dass sie das Gefühl haben, in ihrem Innersten einen Beobachter zu haben, der das eigene Verhalten und Handeln kommentiert.
Zu wenig oder zu viel fühlen
Manche Menschen mit dissoziativen Störungen haben das Problem, dass sie zu viel fühlen und z.B. Schmerzen viel stärker wahrnehmen als unbelastete Personen. Dies trifft auch auf Gefühle und Wahrnehmungen zu. Es ist jedoch genauso möglich, dass sie an einem anderen Tag die Schmerzen und Gefühle kaum oder gar nicht mehr wahrnehmen.
Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen
Hierunter versteht man den Verlust der normalen Hautempfindungen in einzelnen Körperbereichen oder am gesamten Körper. Dabei sind u.a. Symptome wie Nadelstiche, Kribbeln auf der Haut oder auch Taubheit zu beobachten.24
Dissoziative Fugue