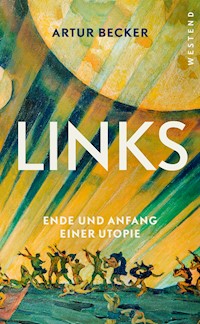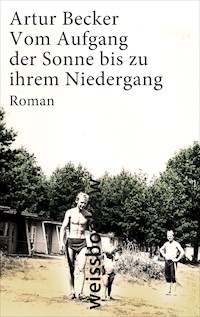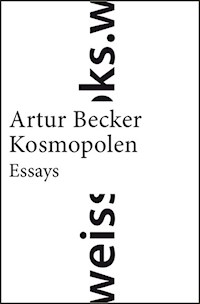
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weissbooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Artur Becker ist seinen deutschen Lesern bisher als großer Erzähler und Romanautor bekannt. Doch "dieser außergewöhnliche Wanderer zwischen seiner ursprünglichen Heimat Polen und seiner neuen Heimat Deutschland" – so Manfred Mack vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt, beschenkt uns seit Jahren nicht nur mit seinen Gedichten und Prosawerken, sondern auch mit Dutzenden von Rezensionen und Essays, in denen er versucht, sein polnisches Erbe seinen deutschen Lesern zu vermitteln. Nein, nicht nur zu vermitteln, Artur Becker ist ein Missionar, er ist überzeugt, fast besessen davon, seine deutschen Leser zu überzeugen, dass ihr Weltbild unvollständig bleibt, wenn sie nicht die Erfahrungen ihrer polnischen Nachbarn zur Kenntnis nehmen und in ihr Weltbild integrieren. Und er begibt sich auch auf das belastete, verminte Gebiet der deutsch-polnischen Erinnerung an die Geschichte. Souverän und mutig zeigt er Deutschen und Polen einen Ausweg aus der vermeintlichen Erbfeindschaft und ruft das gemeinsame, verbindende jenseits der nationalen Verblendung in Erinnerung."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
weissbooks.w
Impressum
Artur Becker
Kosmopolen
Auf der Suche nach einem europäischen Zuhause
Essays
© Weissbooks GMBH Frankfurt am Main 2016
Alle Rechte vorbehalten
Konzept Design
Gottschalk + Ash Int’l
Foto Artur Becker
© Susanne Schleyer
Erste Auflage 2016
ISBN 978-3-86337-098-5
Dieses Buch ist auch als Printausgabe erhältlich
ISBN 978-3-86337-105-0
arturbecker.de
weissbooks.com
Artur BeckerKosmopolenAuf der Suche nach einemeuropäischen ZuhauseEssays
Kosmopolen
Am Ende des Buches befindet sich ein Quellenverzeichnis. Einige Texte des vorliegenden Essaybandes sind vorwiegend zwischen 2006 und 2015 in Tageszeitungen publiziert worden – vor allem in der Frankfurter Rundschau.
Der Autor bedankt sich bei seinem Freund Bernd Gosau, ein besonderer Dank gilt der Stiftung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ) in Warschau, deren freundliche Unterstützung die Publikation dieses Essaybands möglich gemacht hat.
Für Magdalena
»Die Generation ist verloren gegangen. Ebenso die Städte. Die Nationen.
Aber all das geschah etwas später. Derweil im Fenster die Schwalbe,
Die das Ritual der Sekunde feiert.
Und dieser Junge, hegt er schon den Verdacht,
Dass die Schönheit hier immer nie richtig da und immer verlogen ist?«
Czesław Miłosz, »II. Tagebuch eines Naturalisten«
aus: »Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang« (1974)
»Es ist eine der gewaltigsten Irrungen des Durchschnittsmenschen,
an die Endgültigkeit des Lebens zu glauben und des Gefühls der
Knechtschaft des Lebens im Tode ledig zu sein.«
E. M. Cioran, »Auf den Gipfeln der Verzweiflung« (1934)
Inhalt
I.
Ein Reisebericht
Im Zug durch Deutschland
II.
Im Geistland
Gegen den Tod
Von der schweren Geburt einer neuen Epoche
Fragebogen zum Katholizismus
Der Schuldirektor
Grüße aus New York
Irrlichter im Netz
Der Tod ist bei mir zu Hause kein Brachland
Zeit
Über den Tod
»Der Christ ist ein Mensch der Hoffnung«
Zum Konflikt zwischen der EU und Russland
III.
Orte am Weg
Die Rückkehr nach Czerwonka
Mein letztes Sakko aus Bartoszyce
Der Sachsenhain an der Aller
Die Wolfsschanze bei Gierłoż
An meinen Schutzengel aus Polen
Grüße aus Venedig
Bremen – eine Zukunftsschau
Zamęty
Riga – erzähl mir Deine Geschichte!
Die Schlacht bei Tannenberg
Die Bremer Buchhandlung Franz Leuwer
Berliner Blog (Auszüge)
Krakau: Die Dame mit dem Hermelin
Hoyerswerda: Flüchtlinge sind wir auch
IV.
Die poetische Landschaft
An Adelbert von Chamisso
Meine deutsche Sprache und ich
Im Garten der modernen polnischen Literatur
Die Zukunft ist nicht nur violett
Musiklyrik
Das Lied vom Weltende
Von der Schönheit der verstümmelten Welt
Schon Herbst, Herr, es ist Zeit …
Das Fahrtenbuch eines Kosmopolen aus Hausach
Über die Zukunft der Literatur und der Identitätssuche
Vom Weltenbrand, den wir jeden Tag löschen
V.
Der Kontinent Heimat
In den Gärten meiner Kindheit
Verwandte, keine Nachbarn
Vertreibung heißt auch »wypędzenie«
Dort, wo meine Heimat anfängt
Von der Spaltung der Polen
Sowjetisches Erbe
Mein kleines Europa
G. G. und Danzig
»Aus Danzig kommt das Licht …«
Mitgewandert: Ein Ziegelstein
Sonett
Ein moderner Nomade
Heimat, du süßes Wort …
Nach dem Untergang
VI.
Ein Reisebericht
Im Zug durch Polen
VII.
Ein Gespräch
Auf der Suche nach einem Zuhause
Quellenverzeichnis
I
Ein Reisebericht
Im Zug durch Deutschland
»Nie kochaj żadnego kraju: kraje łatwo giną.« –»Liebe kein einziges Land: Länder gehen leicht unter.«
Czesław Miłosz
Im Sommer 1951 machte sich der polnische Dichter Czesław Miłosz (1911–2004) von Paris aus auf den Weg nach La Combe-de-Lancey in den Alpen, einem Kaff bei Grenoble, um den dort lebenden Stanisław Vincenz (1888–1971) zu besuchen, einen anderen großen Exilanten, vor allem aber einen alten weisen Mann. Miłosz hatte nämlich zu Anfang desselben Jahres bei der polnischen Botschaft in Paris das Handtuch geworfen und wohnte nun im Verlagshaus der Exilzeitschrift Kultura, das 1947 von Rom in den Pariser Vorort Maisons-Laffitte umgezogen war. Man könnte sagen: Der Dichter war ein frisch gekürter Kosmopolit und – vor allem aus der Sicht der kommunistischen Machthaber – ein Verräter.
Sein Verleger, der Publizist Jerzy Giedroyc (1906–2000), kam auf die Idee, den Vierzigjährigen zu Vincenz zu schicken, da Miłosz nirgendwo ein warmes Plätzchen finden konnte: Er glich einem Nervenbündel und terrorisierte mit seiner Verzweiflung und Schwarzmalerei nicht nur Giedroyc, sondern auch alle anderen Mitarbeiter und Freunde von Kultura, wie etwa Józef Czapski oder Zofia Hertz. Janina, Miłosz’ Frau, hielt sich mit dem gemeinsamen Sohn Piotr immer noch in den USA auf, wo ihr Mann fünf lange Jahre im diplomatischen Dienst der Volksrepublik Polen tätig gewesen war, und der polnische Dichter machte sich Vorwürfe, er hätte seine Familie in große Schwierigkeiten gebracht, da er nun über kein regelmäßiges Einkommen verfügte. Seine Flucht in die Freiheit – in das westliche Asyl – empfand er nicht als Befreiung, und die politischen, literarischen und existenziellen Konsequenzen seiner Entscheidung bereiteten ihm schlaflose Nächte.
Giedroyc tat das Richtige, als er beschloss, seinen Autor zum Meister Vincenz zu schicken, dem Kenner des Huzulenlandes in den Karpaten und dem Liebhaber der Antike, dem Erzähler und Sokratiker, dem Homer-Spezialisten und Essayisten, dem Dostojewski-Übersetzer und Philosophen. Der dreiundzwanzig Jahre ältere Vincenz war ein echter Hirte und ein leidenschaftlicher Naturverehrer, der die vorchristliche Literatur und Philosophie als Waffe gegen den modernen Nihilismus einsetzte und das Leben und seine Schönheit lobpries.
Seit Miłosz die Freiheit gewählt hatte, um der Indoktrination durch die Kommunisten und ihrem »neuen Glauben« zu entkommen, schien er schwer erkrankt zu sein. Er dachte sogar an Selbstmord und fühlte sich wie ein Renegat; ein Dichter durfte doch seine Nation niemals im Stich lassen, was ihn, der ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein besaß, sehr bedrückte.
Die Linken in Frankreich – etwa Jean-Paul Sartre oder später Pablo Neruda – lehnten Miłosz kategorisch ab. Zu dieser Ablehnung hatte natürlich auch die Veröffentlichung seines berühmten Essaybandes Verführtes Denken, der die psychologischen Verhaltensweisen von Intellektuellen im Stalinismus gnadenlos seziert, einen entscheidenden Beitrag geleistet. Der Vertrieb des Buches wurde durch den Verlag Gallimard geschickt gestört, was zur Folge hatte, dass er nie wieder bei Gallimard etwas drucken wollte. Polen, die ihrer Exilregierung in London nahestanden, fanden für den Verräter Miłosz ebenso wie die Kommunisten nur Worte des Spottes, zahlreiche Pasquills wurden in dieser Zeit geschrieben, das heißt, sowohl die Marxisten wie auch Antikommunisten – zum Beispiel Sergjusz Piasecki (1901–1964) – suchten nach einem Stock, um den in Litauen geborenen »Überläufer« (einen ehemaligen Diplomaten eines stalinistischen Regimes) zu schlagen, obwohl er für viele einer der wichtigsten polnischen Dichter jener Zeit war. Man verband zumindest mit Miłosz Hoffnungen auf die Wiederkehr großer polnischer Nationaldichtung, vergleichbar mit derjenigen von Adam Mickiewicz.
Schließlich geschah ein Wunder: Durch die Besuche bei Vincenz und den Briefwechsel mit ihm kam Miłosz tatsächlich zur Ruhe, der Verbannte und Gejagte fand langsam wieder zu seiner gewohnten schriftstellerischen Kondition zurück, obwohl er in den für ihn stürmischen Fünfzigerjahren oft keine Gedichte schreiben konnte – Prosa und Essays waren ihm wie gewöhnlich leicht aus der Feder geflossen, doch die Lyrik hatte sich fast ein Jahrzehnt standhaft gewehrt. Nur unter großer Mühe hatte der Autor von Verführtes Denken in jener schweren Zeit seine Gedichte zu Papier gebracht.
Welche Medizin fand der alte Mann, den Miłosz russifizierend prafiesor nannte, und der junge Menschen zu sich nach Hause einlud, um gemeinsam Platons Texte zu studieren, für die geschundene Seele seines Patienten?
»Ich möchte so sehr, dass der Gottvater Stanisław Vincenz ähneln möge. Ich würde mich dann überall sicher fühlen, und nicht nur in seinem Haus, wo ich bis jetzt tiefer geschlafen habe, als anderswo«, meinte die Philosophin Jeanne Hersch einmal, eine Schülerin Karl Jaspers, mit der Miłosz nicht nur eine lange intellektuelle Freundschaft verbunden hatte, sondern auch eine Liebschaft. Der alte Mann gab also seinem hochbegabten Patienten etwa Folgendes mit auf den Weg: »Ein Mensch muss ein Zuhause haben! Miłosz, Sie müssen sich einen Ort suchen, an dem Sie zu Hause sein werden. Und noch eines: Sehen Sie die Hügel dort drüben? Und die Steine? Und das Gras, das hier wächst? Vergessen Sie das nie: Es sind keine französischen Hügel und Steine, und es ist auch kein französisches Gras! Die Natur gehört weder den Nationen noch den Menschen …« Der Balsam seiner Philosophie und eben nicht nur seiner tröstenden Worte wirkte ausgezeichnet; Miłosz, der verlorene Poet, der im Exil unter der Entfremdung wie kein anderer litt, schrieb bereits im Herbst 1951 das Gedicht Mittelbergheim und später das ontologisch kongeniale Notizbuch: Bon am Genfer See: Der ewige Moment und die stoische Ruhe eines namenlosen Spaziergängers, der am Flussufer steht und zuschaut, wie die Zeit fließt, wie die Geschichte vergeht und eine neue entsteht, wurden endlich wiedergefunden.
Aber warum erzähle ich das alles? Ich will versuchen, es zu erklären.
Angeblich ist die Entwurzelung eine der schlimmsten Gefahren für unsere Psyche, und C. G. Jung behauptete sogar, dass der Mensch ohne Religion krank werden würde – er müsse etwas haben, woran er glauben könne. Natürlich, es gibt Götter, denen man besser nicht trauen sollte. Man muss stets genau prüfen, an wen und an was man glaubt. Jeder ist selbstverständlich frei und kann tun, was er will. Freiheit ist neben der Liebe die stärkste Waffe des Menschen gegen jedwede existenzielle Verzweiflung, und nicht umsonst attestierte der russische Philosoph Nikolai Alexandrowitsch Berdjajew (1874–1948) der anthropozentrischen Literatur Dostojewskis, dass sie sich vor allen Dingen mit dem Begriff der Freiheit auf allen vorstellbaren Ebenen auseinandergesetzt hätte. Die Freiheit fungiere bei Dostojewski als der Ursprung sowohl des Bösen wie auch des Guten. Der Einzelne treffe die Entscheidung, in welche Richtung er gehen wolle.
Dostojewskis Anthropozentrismus war nun für die Psychologie und Philosophie des 20. Jahrhunderts so etwas wie ein gefundenes Fressen. Sartre fiel es sogar nicht schwer zu behaupten, dass der Mensch zur Freiheit verurteilt sei, womit er aus ihm den Schmied seines eigenen Schicksals machte. Dann konnte man auch leicht den nächsten Schritt wagen und sagen: »Die Hölle, das sind die anderen.«
Und so glauben die Atheisten an die Lehren von Bertrand Russell oder Richard Dawkins, an den Darwinismus und an den unbestechlichen Logos des Menschen, der ihrer Meinung nach keinen bärtigen Vater im Himmel brauche, da der Homo sapiens von allein wisse, was sich gehöre und was nicht, womit auch klar sei, dass er kein Gefangener eines Weltenverwalters und -schöpfers mehr sein dürfe. Die Geschichte des menschlichen Geistes und Bewusstseins habe an dem Punkt Null angefangen und erlebe seitdem eine stetige Erweiterung und Entwicklung, sodass man mehr und mehr über das Sein im Universum erfahren könne, sagen die Atheisten. Das ist eine progressive Sichtweise der Geschichte, wie man sie bei den ketzerischen Theologen findet: etwa bei Origenes oder Teilhard de Chardin, die dem menschlichen Geist und der Schöpfung eine stete Weiterentwicklung bis zur Erreichung der Vollkommenheit und damit auch der Erlösung prophezeiten.
Aber selbst Atheisten müssen an etwas glauben (was mich wiederum ein wenig beruhigt).
Und woran glaube ich? Und was hält mich am Leben? Manchmal glaube ich an Gott, und ein anderes Mal kann ich ihn nirgendwo finden. Dann bin ich ein Verlorener, ein Atheist. In solchen Momenten lese ich wieder theologische Werke. Oder ich greife ganz tief in die geheimnisvollste Schatzkiste unserer Kulturgeschichte und hole aus ihr Swedenborg, Jakob Böhme oder gnostische Texte heraus. Ab und zu bin ich mir wiederum hundertprozentig sicher, dass es die Erlösung gibt und dass der Logos in unserer Welt göttlichen Ursprungs ist. In diesem Fall denke ich sofort, dass man sich nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen sollte, was uns die Zukunft bringen mag. Der Schmerz, der daraus resultiert, dass wir uns die Unendlichkeit oder die Ewigkeit kaum vorstellen können, verschwindet plötzlich.
Ich war zumindest stets davon überzeugt, dass es irgendwo im Universum – vielleicht bloß nur in uns – einen Ort geben muss, an dem man mit der Schöpfung nicht mehr hadert. An diesem Ort haben Krankheit und Tod selbstverständlich nichts zu suchen, und die Dialektik des Guten und Bösen (das Problem der Theodizee) sollte dort endlich aufgehoben sein. Es gibt in meinem Leben Augenblicke, in denen ich das Gefühl habe, den Ort der geistigen Harmonie sehr gut zu kennen. Ja, ich besuche ihn sogar, und eigentlich ist er mein Zuhause – ich wohne dort.
Diesen Ort, dieses seltsame Land nenne ich Kosmopolen. Die Idee dazu verdanke ich dem Schriftsteller Andrzej Bobkowski (1913–1961), einem anderen großen polnischen Exilanten, der den Neologismus Kosmopolacy (die Kosmopolen) geprägt hatte, und zwar für seinesgleichen. Es geht darum, wie man als im Ausland lebender Pole und Intellektueller von der Weichsel zum unerschrockenen Weltbürger werden könne. In der Emigration eine neue Identität aufzubauen, ohne dass man sein Heimatland verstoßen und seine Herkunft verleugnen müsste, ist selbstverständlich eine schwierige Aufgabe; man kann scheitern. Oder man wechselt komplett die Haut und die Zunge und wird sozusagen neugeboren. Joseph Conrad sei laut Bobkowski ein ausgezeichnetes Beispiel für einen Musterkosmopolen. Der Schriftsteller hatte durch die englische Sprache eine neue literarische Identität angenommen, und wenn man in seinen Büchern nach polnischen Spuren sucht, so könnte man sicher dort fündig werden, wo es um die Charakterzüge romantischer Figuren, wie zum Beispiel Lord Jim oder Willems aus Der Verdammte der Inseln, geht.
Es gibt verschiedene Formen des Kosmopolismus. Manche wissen gar nicht, dass sie Kosmopolen sind, obwohl sie es de facto sind. Manche haben mit Polen nichts zu tun und sind auch nie emigriert: Trotzdem sind sie Kosmopolen. Und andere wiederum wohnen in diesem mythischen Land, aber es ist ihnen gar nicht klar. Und noch andere wiederum ziehen ein T-Shirt an, auf dem demonstrativ ein Bekenntnis abgegeben wird.
Und wann habe ich erfahren, dass ich ein Kosmopole bin?
Am 16. März 1985 setzte ich mich in Poznań in den Zug nach Hannover. Auf dem Bahnsteig stand mein Posener Mädchen, und der Abschied war grausam für diese zwei verliebten Teenager, die wir Anfang der Achtziger gewesen waren. Ich aber wusste, dass uns nichts auseinanderbringen konnte, uns und unsere Liebe: Weder der Kalte Krieg noch unsere Eltern. Ich war ein erfahrener Gauner, hatte ich doch fast ein ganzes Jahr allein in Polen gelebt und auf meinen Reisepass gewartet. Meine Eltern lebten bereits im »Reich«, wie wir es gern spöttisch ausdrückten, wenn wir von der kapitalistischen BRD sprachen.
Erwachsen kam ich zu meinen Eltern, die sich in Verden an der Aller angesiedelt hatten, kam mit poetischer und politischer Erfahrung nach Deutschland, obwohl ich noch ein sechzehnjähriges Kind war und Hunger hatte, großen Hunger. Die damals meist vor Leere gähnenden Regale der sozialistischen Lebensmittelläden hatten mich hungrig und gierig gemacht.
Dieser Zug nach Deutschland sagte mir bereits in Poznań, wer ich war: ein Kind Europas, und gleichzeitig spürte ich, was Zbigniew Herbert einmal gedacht haben musste, als er mit nur hundert Dollar im Portemonnaie seine erste Stipendienreise in den Westen antrat: Ein Barbar war ich in diesem für mich fremden Garten, in dem die Westdeutschen und Franzosen eine gemeinsame Sprache sprachen. Ihre Kleidung, ihr Parfüm und ihr Geld sagten mir, wo die Grenze zwischen ihnen und mir verlief. Sie lebten in der Offenen Gesellschaft. Sie durften zum Beispiel den Marxismus nach ihrer eigenen Vorstellung auslegen und auch in die Tat umsetzen. Sie konnten zumindest als Theologen des Neuen Glaubens die marxistische Doktrin bestimmen. Seltsamerweise erzählten mir die westdeutschen Altachtundsechziger, wenn wir uns über ihre Liaison mit dem Marxismus unterhielten, dass sie zum Schluss immer an dem autoritären Führungsstil ihrer Redner, Häuptlinge und Komitees gescheitert seien. Die autoritäre »Masche« ist eine Krankheit sowohl der Linken wie auch der Rechten, und aus einer abgehobenen Perspektive scheint ein psychologisches Studium beider uralter Feinde sehr hilfreich und ergiebig zu sein; ihre äußeren Verhaltensweisen ähneln einander, obwohl sie in erster Linie selbst für diese Einteilung in Schwarz und Weiß – in Linke und Rechte – verantwortlich seien, wie der polnische Philosoph und Marxismuskritiker Leszek Kołakowski (1927–2009) in einem seiner Essays schreibt.
Dann kam die Warterei in Ostberlin, wo der Zug zusätzliche Waggons oder eine neue Lok bekam, und ich werde nie vergessen, wie selbstherrlich die DDR-Grenzbeamten waren: Ich fühlte mich zumindest wie ein Verbrecher, als ich ihnen meinen Reisepass und Koffer übergab – ihnen, den Dienern der Angst, und ihren deutschen Schäferhunden. Honecker war angeblich der Einzige unter den greisen Parteisekretären des Warschauer Paktes gewesen, der 1981, im Jahr der Einführung des Kriegsrechts, mit seinen Soldaten in Polen hatte einmarschieren wollen, um die nicht enden wollenden Streiks und Demonstrationen der Solidarność zu beenden. Mit dieser wahnhaften Idee bewies er kein historisches Feingespür, keine historische Eleganz: deutsche Soldatenstiefel wieder in Polen? Das hätte ganz schlimm enden können. Und überhaupt: Das Fatale an den Linken und Marxisten ist, dass sie ihr intuitives Gespür für historische Ereignisse und Konflikte überschätzen. Kołakowski würde sagen, in ihrer Negierung der Wirklichkeit und in ihrem Glauben an die Kraft der Utopie begeben sie sich in die Gefahr des Moralisierens.
Die Linken handeln in erster Linie emotional, weil sie glauben, die Geschichte auf ihrer Seite zu haben. Schließlich sei sie, so die Linken, eine Dienerin ihrer laizistischen Eschatologie, denn eines Tages, in gar nicht so ferner Zukunft, werde die Welt von den bösen Ausbeutern in den industriellen Gesellschaften frei sein. Übrigens: Mir ist bis heute schleierhaft, wie Berdjajew den Marxismus mit dem russisch-orthodoxen Christentum verkuppeln wollte – seine Religionsphilosophie schätze ich, vor allem seine Interpretationen der Romanfiguren von Dostojewski. Exzellente Arbeiten. Doch die Idee, dass zwei gegensätzliche Eschatologien, wie die des Marxismus und die des Christentums, ein gemeinsames Ziel haben könnten, ist – milde gesagt – absurd. Außerdem würde ich immer die Religion wählen, wenn ich die Wahl zwischen ihr und einer politischen Ideologie hätte.
Aufatmen konnte ich erst in Helmstedt. Als endlich alle Passkontrollen erledigt worden waren, verschwand plötzlich die Angst vor den Schäferhunden, Grenzbeamten und den Sowjets. Ich bin im Westen angekommen, in der geliebten Freiheit, dachte ich mir, und das gar nicht naiv, sondern »realpolitisch«. Helmstedt ist für mich ein poetischer Ort mit einer tiefen historischen Symbolik, und wenn ich heute nach Polen fahre, muss ich beim Passieren der Gedenkstätte in Helmstedt immer an meine Ausreise und auch an Giordano Bruno denken, nicht nur an Solidarność oder an die Demonstrationen in Leipzig.
Nur wenige wissen, dass es in Helmstedt einmal eine Universität gegeben hatte und dass einer ihrer berühmtesten Gastprofessoren Giordano Bruno gewesen war. Für seine ketzerischen Ideen wurde er 1600 auf dem Campo dei Fiori in Rom verbrannt. Ein Espresso auf diesem wunderschönen Marktplatz, auf dem man immer noch Orangen, wie sie in dem gleichnamigen Gedicht von Miłosz beschrieben werden, kaufen kann, kostet ein Vermögen. Ich bin dort mehrere Male gewesen, und ich liebe diese unsterbliche Piazza: Ich liebe sie vielleicht deshalb, weil sie für mich in dem mythischen Land Kosmopolen liegt, also gar nicht in Rom. Es ist ein Land, in dem ich schon in meiner Kindheit gewohnt habe, allerdings ohne es zu wissen. Zwischen Himmel und Erde liegt diese Gegend, in der es keine Vergangenheit und Zukunft gibt, sondern nur die Gegenwart. Und man kann sie dort alle treffen: Giordano Bruno und Czesław Miłosz, Stanisław Vincenz und natürlich auch Kinder, die in dem ewigen Fluss des »Hier und Jetzt« schwimmen, die von der Vergänglichkeit der Welt und des Menschen Gott sei Dank keine Ahnung haben – die nicht wissen, dass es den Tod wirklich gibt.
Man trifft in Kosmopolen die heimatlosen Dichter und Philosophen, man trifft dort aber auch die Naiven, die Ahnungslosen, die meinen, ihre ethische Aufrichtigkeit werde sie vor jeder denkbaren Gefahr beschützen. Und leider begegnet man dort auch solchen Kreaturen, die verloren sind und für sich keinen Platz in der Welt finden können, obwohl sie intuitiv spüren, dass es irgendwo einen heilenden Heimatort für ihre verzweifelten Seelen geben muss.
Ich glaube, dass selbst Stanisław Vincenz, der Miłosz von der Krankheit der Entfremdung und des Identitätsverlusts geheilt und der diesem schwierigen Patienten den Planeten Erde für seine Füße und für sein Schreiben zurückgegeben hatte, erst viel später – nämlich in seiner Emigration in Frankreich – entdeckt haben könnte, dass er in einem anderen Land als Kosmopolen nie gelebt hatte. Nationen mit ihren Grenzen und ihren Muttersprachen vergewaltigen und schneiden die Erde auf wie eine Wassermelone. Sie essen von dieser süßen Frucht und ahnen nicht, dass sie eine Sünde begehen. Sie sind besitzergreifend und von Natur aus materialistisch veranlagt: Sie kaufen und verkaufen das Land und führen in seinem Namen Stammeskriege. Doch in Wahrheit gehört die Erde nur sich selbst, und der Mensch ist auf ihr bloß Gast.
In Kosmopolen geht es jedoch nicht nur friedlich zu, wie in einem Paradies, in dem der Mensch noch nicht in den Apfel gebissen hat, um wenig später – nach dieser Heilung und nicht Versuchung – sich seiner eigenen Stimme bewusst zu werden und die Zeilen »Cogito ergo sum« und »Carpe diem« auszusprechen.
Kosmopolen, das ist auch ein gefährliches Land, weil man sich in ihm vor der Welt verstecken kann: vor der Wirklichkeit und Matrix unserer Staaten und Gesellschaften. Ich habe in meiner Kindheit lange in diesem Land der Freiheit und Träume gelebt, ohne einen blassen Schimmer davon zu haben, was das eigentlich bedeutete, und selbst die polnischen Züge, die mich aus Bartoszyce über Korsze in Masuren zu Magdalena nach Poznań brachten, kamen aus Kosmopolen. All meine Reisen, und ich konnte sie nur deshalb durchführen, weil ich meine Eltern belog, führten in jener Zeit in die Großstädte: Gdańsk, Sopot, Poznań, Warszawa, Katowice, Sosnowiec und Kraków. Viele winterliche oder sommerliche Nächte verbrachte ich in diesen Zügen; in Katowice sah ich dann das erste Mal die berühmte Veranstaltungshalle Spodek, das UFO aus Glas und Beton, ein architektonisches Meisterstück des Sozialismus. Im Spodek traten meine Helden auf, meine Rockbands, und an den Stränden von Danzig hörte ich von einem Radiorekorder Jazz und Rock, schrieb meiner Magdalena Briefe und Gedichte und unterhielt mich mit Engländern oder Deutschen, die den FKK-Strand besuchten. Ich wusste damals nicht, dass es auf der Welt den Tod gab. Wann hatte ich das erste Mal davon erfahren? Im Zug nach Deutschland, am 16. März 1985? Vielleicht.
Ich habe keine Angst vor dem Vorwurf, ich würde pathetisch sein und mein Herkunftsland glorifizieren, denn in Wahrheit bin ich noch skeptischer als meine Kritiker. Die Emigration hat aber in meinem Leben für klare Verhältnisse gesorgt. Ich weiß, dass die Wahrheit ein labiles, zerbrechliches Produkt ist und dass sie viele Väter haben kann. Eine Wahrheit ist für mich dennoch unumstößlich: Mein Herz ist in Polen, mein Intellekt in Europa und mein Körper gehört der Gaia, unserer gemeinsamen Mutter Erde; das war schon immer so gewesen, und ich verdanke diese Dreiteilung meiner polnischen Heimat und meinen Eltern – Masuren und der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Drei Nachnamen (Bäcker bis 1945, Bekier nach dem Zweiten Weltkrieg, Becker nach meiner Ausreise 1985) hatte dieses blutige Jahrhundert meiner Familie verpasst.
Dreigeteilt kam ich also nach Deutschland und versuchte hier, möglichst schnell eine emotional-intellektuelle Verbindung zu meinem neuen Land herzustellen, in dem ich bereits 1989 – vier Jahre nach meiner Ankunft bei meinen Eltern in Verden – begann, auf Deutsch zu schreiben: Ich dachte, dass mich Miłosz, der sein ganzes Leben lang dem Polnischen treu geblieben war, auf ewig verdammen würde, aber ich mochte nicht mehr leiden. Wer seine Muttersprache für eine fremde Dichtung aufgibt, muss sich warm anziehen. Mir war nicht kalt, ich wollte bloß, dass mein neuer Freund Peer, den ich 1989 während unseres gemeinsamen Zivildienstes kennengelernt hatte, erfuhr, was für Gedichte ich schrieb: Und so übersetzte ich sie für ihn ins Deutsche. Die Steine rollten wenig später von allein, und ich konnte dieses deutsche Geröll nicht mehr stoppen.
Eine Botschaft von Vincenz und seinem Patienten habe ich dennoch sehr gut verstanden: Ich musste mir auch einen Ort suchen, der nur mir gehören würde, und wenn doch nicht auf Erden, so wenigstens in meinen Büchern, in der Literatur, am Fluss der Zeit. Da wurde mir schnell bewusst, dass Kosmopolen die einzige Lösung sein konnte.
Viele meiner Leser oder Gastgeber bei den Veranstaltungen wundern sich, warum ich denn in diesem Kaff Verden an der Aller leben würde, und nicht in Berlin zum Beispiel. Sie verstehen nicht, dass ich in der Welt wohne. Sie wissen nicht, dass Verden im Norwegischen »die Welt« heißt und dass der Fluss Aller für mich die Milchstraße symbolisiert – genauso wie mein polnischer Fluss Łyna, der durch meinen Geburtsort Bartoszyce fließt: Er hieß im Ostpreußischen Alle.
Die symbolische Dreiteilung habe ich übrigens auch heute noch nicht aufgegeben.
Die Deutsche Bahn bringt mich im Durchschnitt dreißig bis vierzig Mal im Jahr in alle möglichen Städte dieses Landes, in denen ich aus meinen Büchern lese oder an öffentlichen Diskussionen teilnehme. Doch kenne ich die BRD mittlerweile so gut wie meine masurische Provinz, kenne ich wirklich dieses Land? Habe ich es in meinen Blick einbezogen? Warum beschleicht mich dann oft das Gefühl, dass ich den Zug von Poznań nach Hannover nur ab und zu verlasse, um am Bahnsteig ein Päckchen Zigaretten, eine Tageszeitung und einen Kaffee zu kaufen?
Und dennoch weiß ich ganz genau, was an meinem neuen Land und an mir selbst deutsch ist.
Deutsch an meinem Ego ist das Selbstbewusstsein, das ich mir durch die Emigration schwer erkämpft habe. Ich nenne diese Metamorphose deutsch, weil sie in diesem Staat stattgefunden hat, und nicht woanders. Das Selbstbewusstsein, dass ich in einer fremden Sprache genau das sagen kann, was mir mein intimstes, in Polen geborenes Herz diktiert, ist ein wunderbares Geschenk.
Allerdings musste ich mich in Deutschland von mir, dem Emigranten, von meiner Geschichte also, und von den Deutschen schon nach wenigen Jahren meines neuen Lebens befreien, musste vergessen, was ich bei Ernest Gellner über die Identität und Emanzipation der Nationen, was ich bei Johann Gottlieb Fichte über das Selbstbewusstsein gelernt hatte. Ich musste mich freischwimmen und meine Zimmer so einrichten, damit mich niemand schon gleich nach dem ersten Blick identifizieren und katalogisieren konnte. Ein Dichter weiß es, Länder zerfallen, und wer seine Heimat liebt, wird spätestens mit dem Tod alles verlieren. Der Preis, den wir für die Erfüllung der irdischen Liebe zahlen müssen, ist immer hoch, und wenn ich eines Tages Magdalena durch den Tod verlieren werde, werde ich schrecklich leiden: bis zu einer möglichen Wiederbegegnung im Jenseits, vielleicht aber nur in Kosmopolen. Das Gefühl also, dass meine Herkunft zerbrechlich geworden war und dass ich in der Bundesrepublik eine Gastrolle spielte, bestärkte mich darin, in Kosmopolen für immer wohnen zu bleiben, in einem Land der Freidenker und Liebhaber der Schönheit und Wahrheit, aber auch in einem Land der Suchenden und Verzweifelten.
Man missversteht mich trotzdem bis heute.
Sarah Elsing, eine junge Journalistin, schrieb in der FAZ über die Chamisso-Preisverleihung 2009 in München, ein deutscher Autor würde sich für einen Literaturpreis niemals bei Deutschland bedanken. Zu pathetisch war ihr mein Auftritt erschienen. Aber sie hatte wohl den Kontext überhört und nicht verstanden, und ich konnte ihr keine Vorwürfe machen, denn woher sollte sie sich in der polnischen Dichtung und Kulturgeschichte so gut auskennen wie ich?
Ich bedankte mich bei Deutschland, das ist wahr, ich sagte aber im gleichen Atemzug, dass nun Baczyńskis Tod nicht umsonst gewesen sei. Der junge Dichter – Autor von mehr als 500 Gedichten und eine lyrische Ausnahmebegabung – fiel nämlich am 4. August 1944 im Warschauer Aufstand: dreiundzwanzig Jahre alt wurde er nur, und Anfang zwanzig war auch seine Frau Basia gewesen, als sie auf den Warschauer Straßen ebenfalls im Kampf umkam.
Baczyńskis großartiges poetisches Talent ist brutal zerstört worden – dass es solche Verluste gegeben hat, ist das eigentliche Verbrechen: der geistige Mord an einer Nation, und der Mord an einem jungen Liebespaar.
Das Jonglieren mit historischen Bällen, das Zuspielen des Balles oder, wenn nötig, einer Handgranate – das musste ich in Deutschland erst lernen. Die Deutschen, ein kluges, erfinderisches Volk, sind gerne rechthaberisch und, wie es Gombrowicz sagen würde, der Deutsche wolle dem Deutschen überlegen sein. Der pädagogische Impetus meiner neuen Landsleute ist mir kein Rätsel mehr – der Protestantismus und die Philosophie (Luther und Kant, die Romantik und der Idealismus Made in Germany) sind natürlich starke Zugpferde der Deutschen. Anfang der Neunziger des vorigen Jahrhunderts kamen sie jedoch nach Polen immer noch mit der Überzeugung zu Besuch, wir bräuchten Hilfe bei der Einführung der Demokratie, aber wir Polen bedankten uns höflich und sagten, wir würden es allein schaffen. Auf einer Konferenz der Konrad Adenauer Stiftung in Riga vor einigen Jahren explodierte ich innerlich vor Wut, als ich Zeuge davon wurde, wie eine deutsche Politikerin während einer Diskussion Russland zu mehr Demokratie ermahnte, wobei ihre strafenden Worte und ihr böser Blick den russischen Konferenzteilnehmern galten. Das war nicht der richtige Moment dafür, und mich störte die pädagogische Impertinenz des Westens sehr, die ich schon damals gut kannte. Der betroffene Patient hat nach solch einer Rüge jedes Mal das Gefühl, ein minderwertiges Mitglied eines exklusiven Klubs zu sein. Warum wissen manche deutsche Politiker nicht, welchen enormen Einfluss die russische Religionsphilosophie und die russische Ideengeschichte im 19. und 20. Jahrhundert auf das westeuropäische Denken und Schrifttum hatte? Dostojewski, Wladimir S. Solowjow, Nikolai A. Berdjajew und Leo I. Schestow haben mehr oder weniger ganze Generationen in Europa mit ihrem Denken bereichert und beeinflusst, vor allem die westlichen Existenzialisten, Schriftsteller und Religionsphilosophen.
Und ich hoffe nach wie vor, dass Baczyńskis Tod wirklich nicht umsonst gewesen war, allein deshalb hoffe ich das, weil die Bundesrepublik es verstanden hatte, mir und anderen Emigranten aus Polen einige schöne Geschenke zu machen: kulturgeschichtliche Geschenke meine ich, sodass meine Stimme irgendwann imstande war, entweder ein klares »Ja« oder ein klares »Nein« zu artikulieren. »Ja« zu Karl Jaspers und Thomas Mann. »Nein« zu Carl Schmitt und Ernst Jünger. Ich habe zwar einige Texte von Jünger gerne gelesen, wie zum Beispiel Ausschnitte aus seinen Tagebüchern, dann den Essay Der Waldgang oder die Geschichten Auf den Marmorklippen, und genauso erging es mir mit Schmitts Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen, eine gute Lektüre war es, aber es ist nicht mein Kosmos. Diese Autoren sind für mich so deutsch – deutsch durch und durch in ihrem kulturgeschichtlichen Heroismus: Der einsame Wolf geht aus Protest gegen die Welt in den Wald und sinniert über die Einmaligkeit der Schöpfung und der deutschen Außergewöhnlichkeit – das ist ihr ewiger Germanozentrismus.
Ich würde doch vor Hass sterben, könnte in meinem neuen Zuhause nicht leben, wenn ich in Baczyńskis Uniform in Deutschland paradieren würde, jeden Tag in dieser mit Blut beschmierten Uniform eines jungen Soldaten der AK, der Landesarmee, der heldenhaft gegen die Nazis gekämpft hatte.
Nach achtundzwanzig Jahren in der BRD kann ich also sagen, dass dieser Staat auch mir gehört. Ich fühle mich für ihn genauso verantwortlich wie für meine Heimat in Masuren, für mein Polen. Scharfzüngige Kritiker, die aus mir einen »waschechten« Antipolen oder einen bösen Kosmopoliten machen wollen, lassen mich kalt. Nationales Bewusstsein zum einzigen Identifikationsfaktor zu machen, ist nicht nur dumm, sondern auch verantwortungslos. Ich möchte ebenso nicht für meine Kritik am folkloristischen und unreflektierten Katholizismus im Fegefeuer schmoren. Der Katholizismus ist nämlich in meinem Land ein polnischer: ein polnischer Christus steht bei Świebodzin, eine gigantomanische Skulptur, wie man sie aus Rio de Janeiro kennt, und eine polnische Maria, Mutter Gottes, wird in den Kirchen meiner Heimat angebetet. Eine Reduzierung auf die nationale Zugehörigkeit oder Konfession lässt mich erschaudern, weil ich sofort an Götzen, Halbgötter, Tyrannen oder an grausame Götter denken muss. Deshalb frage ich mich immer wieder: In wessen Namen hat Brutus das Messer gezückt, um seinem Feind tödliche Stiche zuzufügen? Im Namen des römischen Volkes? Der Putschisten, die Cäsar loswerden wollten? Im Namen der Machtgier? Oder doch im Namen der Gerechtigkeit? Und wenn ich mir Kazimierz Kutz’ Historienfilm von 1994 über das Massaker an den gegen das Kriegsrecht protestierenden Bergleuten im Bergwerk »Onkel« ansehe, wird mein Nationalbewusstsein sofort wachgerüttelt. Ich spüre plötzlich diese unheimliche kollektive Brandung und ich weiß auf einmal, was das Kollektiv bedeutet, welche Stärke es hat: Die Wut auf die Mörder der Bergleute vereint mich mit meiner polnischen Nation. Die Wut und Ohnmacht – diese beiden Gefühle kenne ich aus meiner Heimat gut.
Nein, den Patriotismus verstehe ich anders. Ich will meinem Land dienen, doch es muss mir Freiheit garantieren. Ich möchte sagen: »Lasst mich Kosmopole sein!«
Ich bin aber aus anderen Gründen auf Polen stolz: Ich bin glücklich darüber, dass wir der Welt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Jerzy Andrzejewski, Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska, Tadeusz Różewicz, Leszek Kołakowski und Zygmunt Bauman geben konnten und dass wir dem Materialismus immer getrotzt hatten. Die drei Teilungen meines Landes im 18. Jahrhundert, die beiden Weltkriege und das Regime der Kommunisten hinderten uns nicht daran, in jeder Epoche ein kulturgeschichtlich blühendes Leben zu entfalten – Europa und Amerika mit neuen Ideen und Büchern zu bereichern.
Deutschland verdanke ich im Gegenzug etwas anderes, aber genauso Wichtiges und Kostbares, was meine Denkweise absolut auf den Kopf gestellt hatte. Ich misstraue den Reisepasseinträgen, gleichzeitig weiß ich, dass ich nur in meinem Kosmopolen glücklich werden kann. Die Deutschen, die den Deutschen immer nur Deutsche sein wollen – wie alle Einheimischen unter sich –, wissen gar nicht, wie sehr sie einander beschneiden. Das tun, wie gesagt, alle, die ihre Kleidung und ihr Gesicht im Spiegel für ihr einziges wahres Antlitz halten. Mit anderen Worten: Die Emigration nach Deutschland erinnerte mich daran, dass ich ein Erdling bin, jemand, der aus dem Universum stammt. Den Akt der Vertreibung aus dem Paradies – in meinem Fall aus Masuren und der dort glücklich verbrachten Kindheit – erlebte ich als eine Art Erleuchtung: Ich wusste auf einmal, dass Raum und Zeit sakrale Funktionen haben und dass nur aus holistischer Perspektive die ontologische Dialektik unseres Daseins betrachtet und begriffen werden kann. Die Symbolik der Orte, an denen wir geboren wurden und leben, ist wichtiger als jedwede pathologische Schattenseite der Gesellschaft, in der wir sowohl als Kinder wie auch als Erwachsene unseren Platz finden müssen.
Wir werden schließlich immer wieder zu Stanisław Vincenz zurückkehren müssen, und ich fühle mich in meinem neuen Land tatsächlich nicht mehr fremd, weil dieses Land in erster Linie den Menschen, die hier leben, gehört und nicht ausschließlich einer Nation, die es im Übrigen eines Tages nicht mehr geben wird, so wie es heute die Pharaonenägypter nicht mehr gibt. Baalbek in Libanon ist eine Stadt ohne Namen wie Miłosz’ Wilna, Adam Zagajewskis Lemberg oder mein Bartoszyce.
Und niemand sollte so unglücklich und einsam werden, wie es Miłosz einmal gewesen sein musste. Er schreibt in einem Gedicht über seine kalifornische Einsamkeit in der Bucht von San Francisco – nach Frankreich sein zweites Exil –, dass er den weißen Möwen von seinem Schmerz erzählen müsse, da es niemanden gebe, der ihn verstehen und erhören könne. Ich weiß, was er in diesen Versen ausdrücken wollte. In Deutschland bin ich auch der Einsamkeit meines stillen Ortes, an dem ich lebe, begegnet. Denn in Wahrheit lebe ich in diesem Arbeitszimmer an der Aller wie ein Eremit, und wenn ich dann die Züge besteige, staune ich über die buntscheckigen Bewohner der Bundesrepublik: über die Millionen von kleinen Planeten, die vor meiner Nase friedlich koexistieren. Ich bin natürlich ein wachsamer Geist und ein penetranter Beobachter, die Geschichte meiner Heimat hat mich dies gelehrt: Ich halte Wache, aber ich habe keine Angst mehr, wie ich sie einmal vor der Sowjetunion hatte, allerdings ohne an der so für Polen typischen Russenphobie gelitten zu haben. Ich mache mir selbst um das 21. Jahrhundert keine Sorgen mehr, um die Zukunft, obwohl ich schon 1989 meinen Freunden erzählt habe, dass das Abendland bald eine ähnliche ökonomische und gesellschaftliche Wende erleben wird wie der ehemalige Ostblock – wir befinden uns mittlerweile in der westlichen Kultur nicht mehr am Anfang dieser Wende, sondern mittendrin.
Ich bin auf dem Weg nach Stuttgart, zum 150. Geburtstag von Robert Bosch – was für ein Unternehmer! Bosch ist nicht Krupp; der weltberühmte Firmengründer hatte sich um eine Versöhnung mit Frankreich bemüht, hatte den Nazis getrotzt und war auch in den sozialen Fragen ethisch seiner Zeit weit voraus gewesen. Stationen für meine weiteren Veranstaltungen werden in den nächsten Tagen sein: Hamm, Chemnitz, Köln, Bochum, Wuppertal, Remscheid und Dresden. Die Deutsche Bahn, die bei den Berufsnörglern, nämlich den Deutschen, ständig in der Kritik steht, kann bei mir Pluspunkte sammeln. Deutsche Omnipotenz war mir schon immer ein Dorn im Auge, es muss nicht alles perfekt funktionieren, es gibt nicht auf jede Frage eine Antwort.
Ich darf nicht lügen. Mein Verhältnis zu Deutschland ist selbstverständlich nicht einfach, obwohl ich in diesem Staat gerne lebe und für meine Freunde Liebe empfinde. Ich wollte zwar kein deutscher Autor werden, doch nun schlage ich mir selbst mit den Fäusten an den Kopf, bekenne mich zu meiner Schuld und sage: »Ich bin es aber geworden …« Habe ich mich den Deutschen ergeben? Meinem Schicksal, meiner Bestimmung? Sie war zu mir stets großzügig. Die deutsche Theosophie zum Beispiel, sie belohnte mich fürstlich: Ich verliebte mich in die theosophischen Werke des Schuhmachers Jakob Böhme. Und Meister Eckharts Predigten gehören für mich zu den großartigsten Dingen, die das Abendland hervorbringen konnte: wie Blaise Pascals Pensées oder Simone Weils Vorchristliche Schau.
Also müssen wir doch Frieden schließen, liebe Deutsche? Müssen wir, tun wir, obwohl ich trotzdem niemals verstehen werde, warum am 1. September 1939 Polen überfallen wurde. Es war jedenfalls eine meiner ersten Fragen gewesen, die ich 1985 nach meiner Ankunft in der BRD oft stellte: »Wie konnte das passieren?« Eine weitere Frage lautete: »Warum habt ihr so wenig gegen das Regime unternommen?« Ein älterer Autorenkollege, der im Zweiten Weltkrieg ein Teenager gewesen war, antwortete mir nach Jahren, um meiner Frage endlich ein bisschen entgegenzukommen: »Wir mussten alle mitmachen, weil wir Angst hatten – Angst davor, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, im Gefängnis zu landen, ins KZ zu kommen …«
Danke. Eine solche Antwort verstehe ich.
Auf dem Weg nach Stuttgart treffe ich am Hannoverschen Hauptbahnhof den Satiriker und Publizisten Wiglaf Droste. Es gibt Autorenkollegen, die ich auf meinen kosmopolnischen Reisen immer wieder treffe. »Wahlverwandtschaften« entstehen ganz automatisch, wie es scheint. Ich frage mich jedes Mal, wenn ich Droste sehe – übrigens ein Mann mit tadellosen Manieren, was bei den Schriftstellern leider nicht immer der Fall ist –, ob Günter Grass jemals seine Texte gelesen hat. Ich mag Drostes scharfsinnige und dichterisch elegante Zunge und ich mag es auch, dass er in der BRD einige treue Feinde hat. Wer sich lange auf den Wellen von Lobeshymnen tragen lässt, wird irgendwann blind für das vor eigener Haustür geschehende Unglück.
Ich habe in der BRD gelernt, dass ich meine Meinung standhaft verteidigen muss. Mir gefällt es, wie manche Diskurse in Deutschland geführt werden: Zumindest wird man gehört, und nach der verbalen Schlacht kann man mit seinem Gegner an der Bar sogar ein Bier zusammen trinken. Konsens ist eine schwierige Sache, das ist mir sonnenklar, doch muss es dazu nicht immer kommen. Durch die Emigration habe ich auch verstanden, wie wichtig unsere unterschiedlichen historischen Perspektiven sind: unsere Blicke von innen und außen auf Europa und auf uns selbst und unsere Nachbarn.
Söhne von Schriftstellern fangen meistens irgendwann selber an zu schreiben, und so war es auch bei Andrzej Vincenz, dem Sohn von Stanisław Vincenz, der heute als ehemaliger Slawistikprofessor in Heidelberg lebt. Anfang der Neunzigerjahre sagte er in einem Interview für die Exilzeitschrift Kultura, es wäre ihm erst in Deutschland, also in der Emigration, klar geworden, dass seine Landsleute ein ganz anderes Verhältnis zu Schlesien hätten als die Deutschen. Dass es dort in Schlesien Polen und polnische Aufstände gegeben hätte, würden die Deutschen eigentlich nicht begreifen. Sie würden sich fragen: Welche Polen? Warum? Schlesier ja, es ist ihr Land gewesen, aber was haben dort die Polen zu suchen? Woher kommen die denn plötzlich? Etwas Ähnliches habe ich während meiner bundesrepublikanischen Diskussionen und Reisen schon oft erlebt. Unsere unterschiedlichen historischen Perspektiven sollten uns jedenfalls nachdenklich machen.
Von Zeit zu Zeit versuche ich, die Haut und den Blickwinkel zu wechseln. Judenwitze kann ich zum Beispiel nicht mehr hören, weil ich schon zu lange in Deutschland lebe und gegen gewisse Art von Oberflächlichkeit und Vulgarität geimpft worden bin. Erika Steinbach und ihre Schützlinge würden staunen, doch mir ist das Nachkriegsleid der Ostpreußen und Schlesier historisch und individuell genauso präsent wie die tägliche Gehenna der Polen während der Okkupation durch die Nazis. Es tut einem jedenfalls gut, wenn man wenigstens fünf Sekunden lang die Welt aus einer fremden Perspektive sehen kann, auch wenn man sie abstoßend oder unakzeptabel findet.
Auf dem Geburtstag von Robert Bosch begegnete ich alten Freunden und lernte an meinem Tisch ein sympathisches Stuttgarter Ehepaar kennen: zwei deutsche Kosmopolen, die wie ich Mitte vierzig sind – er arbeitet als Geschäftsführer in einem großen Verlag, sie ist Rechtsanwältin. Wir verstanden uns sofort, wir kritisierten wohlwollend die Geburtstagsreden der prominenten Gäste, wir redeten über Romane von Patrick Modiano, Michel Houellebecq und Philip Roth (und damit über den heutigen Zeitgeist) und wir redeten über die weltweite ökonomische Krise. Wir kamen schließlich auch auf Osteuropa zu sprechen, das meinen beiden Kosmopolen durch zahlreiche private und geschäftliche Reisen bestens vertraut ist. Wir Kosmopolen haben eine gemeinsame Sprache, weil wir Nomaden in unserem Europa geworden sind. Und wir lieben es, so zu leben, als wären wir ständig auf Reisen – einerseits; andererseits sind wir glücklich in unserem bundesrepublikanischen Zuhause, das wir als liberal und offen empfinden. Wir haben keine Komplexe, und die Staatsgrenzen, die uns einst trennten, haben wir längst vergessen. Wir können uns diesen kulturgeschichtlichen Luxus leisten, nicht deshalb etwa, weil wir in der Gesellschaft privilegierte Positionen haben. Nein, unser europäisches Bewusstsein ist frei von uralten Vorurteilen, und meine beiden Gesprächspartner kennen auch das Land Kosmopolen sehr gut aus eigener Erfahrung, ein Land, in dem jeder nach seiner geistigen Konstitution sich frei entfalten kann und nicht gestört oder gar bedroht wird. Solche unvorhergesehenen Begegnungen sind mir am liebsten. Sie zeigen mir, dass man neugierig sein muss und auch das Risiko der Enttäuschung nicht scheuen darf. Ich kann gut verstehen, warum es in Bochum den transnationalen Kulturverein namens »Kosmopolen« gibt und warum sich dort Menschen jeglicher Couleur und Zunge herumtreiben, um verschiedene Projekte zu realisieren. Es geht in Bochum nicht nur um die alte Tradition der polnischen Emigration, der Polonia im Ruhrgebiet. Ich habe in diesem Verein auch viele Polen kennengelernt, die ähnliche biografische Erfahrungen haben machen müssen wie ich. Sie sind ein Teil der globalisierten Gesellschaft geworden und es freut mich, dass sie in ihrem bundesdeutschen Erfolg ihre polnische Sprache und Herkunft nicht verleugnen. Sie wissen um die penetrante Oberflächlichkeit der Facebook-Kommunikation und auch um die Bedeutung der Regionen und kleinen Heimaten in einem föderalistischen System. Sie wissen, dass nur sie selbst in unserer Gesellschaft etwas verändern und bewirken können.
Zwei Freunde von mir, die sich gar nicht zu den Kosmopolen bekennen, obwohl sie in der Sekundärliteratur oder in privaten Gesprächen oft so bezeichnet werden, sind Schriftsteller wie ich. Dariusz Muszer (geb. 1959), der Autor von Gottes Homepage (2007), lebt in Hannover und schreibt Polnisch und Deutsch. Er ist auch Übersetzer, während der Wahlberliner Krzysztof Niewrzęda (geb. 1964) ausschließlich auf Polnisch seine Literatur verfasst – zuletzt veröffentlichte er das Buch Zamęt (Wirrwarr, 2013). Aber ähnlich wie Muszer lebt er schon seit über zwanzig Jahren in der BRD, und man könnte unsere literarische Freundschaft wegen des recht regen Austausches als eine Art magisches Dreieck bezeichnen. Jedenfalls wohnen wir auf dieser polnisch-deutschen Insel nicht allein, wir können einander jederzeit unsere Sünden, Misserfolge und Pläne für die Zukunft beichten.
Und trotz all der erbaulichen und positiven Nachrichten aus Kosmopolen darf ich meinen einmal gewählten Weg – gewiss etwas hitzköpfig und aus Neugierde – nicht mehr verlassen. Für mich muss ich nach wie vor eine literarische, ontologische und kulturgeschichtliche Lösung für das Zeit-und-Raum-Problem finden. Deshalb ist mir die Suche nach einer beständigen und universellen Identität wichtiger als der erhabene, aber mühselige Kampf gegen das Unkraut in einer Schrebergartenkolonie, die bei der nächsten Sintflut für immer und ewig von der Erdoberfläche verschwinden wird.
II
Im Geistland
Gegen den Tod
1. Teil: Universal Die letzte Rettung
»Jeder, der stirbt, ohne das Unvergängliche zu kennen,stirbt in bedauernswertem Zustand;aber diejenigen, die das Unvergängliche kennen,erlangen Unsterblichkeit,wenn beim Sterben der Körper abgelegt wird.«
Brihadaranyaka-Upanischad
Mein Leben lang – es sind mittlerweile mehr als vierzig Jahre geworden, die mir mehr oder weniger abhandengekommen sind – beschäftigte mich dieses Rätsel: Warum bin ich von so vielen Menschen umgeben, die sich das Wissen unserer Vorfahren nicht zunutze machen, und zwar in einem besonderen Fall – nämlich im Kampf gegen den Tod? Ich war noch nie mit der Vorstellung einverstanden, dass quasi nur ein epikureischer Lebensstil die einzige Lösung sein könne: ein bisschen Sex, ein bisschen Geld und Metaphysik, ein bisschen Leid, das man aushalten muss, und ab in den Sand, in dem vielleicht das große Nichts auf einen lauert oder eine angenehme Überraschung. Und der Atheismus ist mir so fremd, dass ich mich bis jetzt nur mit Widerwillen mit den philosophischen Verführungen der Existenzialisten habe auseinandersetzen können. Was bringen einem, der davon fest überzeugt ist, dass es Reinkarnationen und die »ewige Wiederkehr« aller Dinge gibt, Werke von Sartre oder von irgendwelchen Atheisten? In meinem Fall, obwohl ich Sartres Texte und ihnen ähnliche gerne lese, eigentlich herzlich wenig, denn ich muss mich nicht aufbäumen und meine eigene private Revolte gegen die Vergänglichkeit unserer Existenz und gegen die Eitelkeit unseres Egos zelebrieren, um die physischen und psychischen Leiden zu lindern. Ich weiß, dass wir unsterblich sind und dass es irgendwo da draußen einen Computer gibt, auf dessen Festplatte alle Taten und Werke der Natur und jedes einzelnen Menschen gespeichert werden. Ich verfüge natürlich über keine Beweise, die durch experimentelle Beobachtungen nachprüfbar wären und aus denen hervorgehen würde, dass es die Unsterblichkeit und ein ewiges, lebendiges Gedächtnis unserer Taten wirklich gibt. Und die Theorie der »Vielen Welten«, wie sie von dem US-Wissenschaftler Hugh Everett III in der Quantenmechanik entwickelt wurde, ist letztendlich nichts Neues, denn in zahlreichen Schriften alter Religionen findet man so viele Beschreibungen verschiedener geistiger Ebenen und Dimensionen, dass einem schwindelig wird vor all dem provozierenden Reichtum des Universums – aber wer versteht schon, worum es in der Quantenphysik im Detail geht? Ich bin kein Naturwissenschaftler und kann lediglich Vermutungen äußern. Doch ich brauche keine Beweise. Ich weiß nur, dass nichts verloren geht, nichts vergessen bleibt und nichts für immer vernichtet werden kann. Das Wissen um den sich ewig wiederholenden Tanz der Natur und des Menschen ist uralt, und ich habe es mir nur deshalb aneignen können, weil ich nicht in der Einsamkeit lebe. Denn ich führe seit Jahren einen Diskurs mit unseren Vorfahren, die doch für uns die wichtigsten Fragen schon vor langer Zeit gestellt haben, zumindest was das Diesseits und das Jenseits angeht. Buddha, Krishna, Gilgamesch, Ezechiel, Jesus, Zarathustra, Mani, Mohammed, Sokrates, Seneca, Luther, Giordano Bruno und so viele andere Rebellen, unbekannte Schamanen aus Sibirien oder Australien, unbekannte Straßenpoeten und vergessene Lebenskünstler. Wozu haben sie auf der Erde gelebt? Warum war es ihnen so wichtig, uns Erdlingen Licht und Hoffnung zu bringen, dass wir nicht umsonst sterben würden? Sie haben sich doch alle mehr oder weniger zu Narren gemacht. Man möge sich bloß Jesus Christus vorstellen, der in der Nacht vor seiner Kreuzigung im Olivengarten Gethsemane hitzige und absurde Monologe führt – schweißbedeckt und erdabgewandt, besessen und »entrückt«. Heute würde man den frommen Essener-Sympathisanten für geisteskrank erklären und in die Obhut der Psychiatrie übergeben.
Ich weiß, dass ich mir im Laufe der langjährigen Lektüre philosophischer, heiliger und ketzerischer Bücher meine eigene Religion »zusammengeschustert« habe, aus vielen Bausteinen, die auf den ersten Blick kaum miteinander kompatibel sein dürften. Wenn man so will, ist aber der Synkretismus für einen Autor, der keine Lust hat, auf Godot zu warten, die einzige Lösung. Viel zu tief sitzt außerdem in mir die Erfahrung des Sozialismus und des Katholizismus aus meiner polnischen Provinz in Masuren, obwohl ich damals bloß ein Junge von fünfzehn Jahren war, als dass ich mich mit offenen Armen in die Fänge irgendeiner Ideologie oder Orthodoxie begeben könnte. Deshalb auch ist es so schwierig für mich, am Sonntag in eine polnische Dorfkirche zu gehen, um im Chorgesang den Herrn zu preisen. Ich traue dem Frieden nicht und denke sofort daran, dass mir ein Pfarrer die Seele stehlen kann. Ich will nicht sein Sklave werden, will nicht von einem, der behauptet, auserwählt zu sein und eine klerikale Legitimation zum Predigen zu besitzen, zum Glauben an Gott gezwungen werden. Ihr Gott, den sie in ihren kalten Kirchen gefangen halten, ist in Wahrheit ein Sklaventreiber, erfunden von einer Priester- und Herrscherkaste. Jegliche Hierarchisierung erscheint mir suspekt, obwohl ich wohl nie begreifen werde, wie ein Vogel oder ein Baum denkt und fühlt. Der Freundschaftspakt eines Vogels mit der Natur kommt mir unheimlich vor – das Geheimnis seiner Anima kann sich mir nicht erschließen. Was weiß er und was treibt ihn an? Womöglich ist er sogar klüger und glücklicher als ein Mensch, der seine Umwelt beherrschen will. Ich habe unseren Planeten und alles, was auf ihm existiert, stets als einen göttlichen Ausdruck begriffen.
Jesus sagt uns, dass wir das Haus des Schöpfers in erster Linie in uns selbst finden können, und nicht in einem monumentalen bombastischen Gebäude aus toten Steinen, aus toter Symbolik und Poesie, und auch nicht in den theologischen Büchern, deren Papier vergilbt und zu Staub zerfällt. Meine polnische Großmutter Natalia Frankowska (1913–1999) mütterlicherseits, eine einfache Frau und zugleich eine eifrige, unbelehrbare Katholikin, liebte ihren Gott, zu dem sie in der Pfarrkirche von Bartoszyce betete, wirklich – es war kein bloßes Lippenbekenntnis, obwohl sie im Krankenhaus, als sie schon im Sterben lag und halluzinierte, immerhin noch die Kraft fand, Jesus und Maria zu beschimpfen und für all das, was ihr in ihrem Leben misslungen war, verantwortlich zu machen. Die Zweifel im Augenblick des Todes, wie sie meine Großmutter geäußert hat, sind uns bestens bekannt, und zwar vor allen Dingen von Jesus, da er doch am Kreuz einen gewaltigen Vorwurf erhoben hat, indem er fragte: »Vater, warum hast Du mich verlassen?« Wir wissen, dass der Psalm 22, das Sterbegebet der Juden, genau mit diesen Worten beginnt – Jesus hat jedoch als strenger Kritiker der jüdischen, um ihre Macht bangenden Priester und Thoralehrer seine Zweifel am Kreuz bereits im Namen des modernen Menschen geäußert: Da war nur noch ein kleiner Schritt zu tun in Richtung des Existenzialismus und der Säkularisierung der eschatologischen Probleme.
Dass der Mensch nur in der Sisyphos-Revolte gegen den Tod überhaupt erst zum Menschen wird und damit auch weiterhin in der Welt überleben kann, verstehe ich sehr gut, und dennoch – im Kampf gegen den Tod brauche ich ein anderes Opium, eine andere Lektüre: Sie muss mich aufbauen und darf nicht bei mir zu einem Zerwürfnis mit der Welt und meinen Mitmenschen führen.
Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass wir Schriftsteller und Künstler fast immer in verschiedene Rollen schlüpfen müssen. Wir tun es, um uns selbst zu schützen – uns, unsere Werke und unsere ästhetische Haltung. Und wir tun es bestimmt nicht deshalb, um uns ein möglichst angenehmes Überleben in unserer Welt der nicht enden wollenden Menschenfresserei zu sichern. Leszek Kołakowskis Essay Narr und Priester von 1959 ist mir oft die letzte Rettung, denn in den beiden kann ich mich bestens wiedererkennen.
Aber an den Tagen, an denen ich ein Komödiant und Zweifler bin, verliere ich den Kampf gegen den Tod. Meine Bejahung, dass die Schöpfung einen tiefen, verborgenen Sinn hat, ist dann zum Scheitern verurteilt. Ich erinnere mich dann daran, dass die tristen Tage des Zweifelns vergehen werden.
Der größte Feind des Glaubens und des Hoffens auf eine Wiederherstellung aller Zeiten, wie es uns das Neue Testament oder der urchristliche Theologe Origenes zum Beispiel versprechen, ist jedoch unser geheimnisvoller Körper. Im Sterbebett, wenn der Krebs an einem nagt, weiß plötzlich jeder, dass das Ende unausweichlich ist und dass nun die Abrechnung kommt: Der Atheist wird sich mit dem großen Nichts, das er erwartet, messen müssen; und der Gläubige fürchtet sich plötzlich vor dem Gericht, das über ihn gehalten werden soll. Und derjenige, dessen Bewusstsein beim Horten von Geld und materiellen Gütern tiefes Leid der Unersättlichkeit erfahren hat, wird erneut die Flucht ergreifen und scheitern, denn jede Verlängerung des Mietvertrages für unseren Körper ist eine Selbsttäuschung. Früher oder später wird auch dieses Spiel beendet werden.
Die Angst vor der Natur, die uns gnadenlos und böse erscheinen mag, da wir alle eines Tages sterben müssen, habe ich schon früh entdeckt. Meine erste Erektion, das Staunen über die sexuelle Begierde, zeigte mir, wie fremd einem der eigene Körper werden kann. Das soll ich sein?, fragte ich mich, diese sichtbar gewordene Erregung aus Fleisch und Blut? Die Entdeckung der Sexualität sei der erste Schritt in die Hölle, würde meine Großmutter Frankowska seligen Angedenkens bestimmt sagen. Sie war nicht prüde, aber sie hatte eine feste Vorstellung davon, was Sünde sei. Sie wusste nämlich, dass manche Sünden und Dummheiten notwendig sind, damit wir uns entwickeln und dadurch vorankommen können. Und sie fürchtete sich vor dieser Erkenntnis und Entdeckung, weil damit das Dunkle in uns – in ihrer Vorstellung der Satan – eine wichtige Funktion besitzen und dem Lichten, Jesus Christus, ebenbürtig sein müsste. Diesen manichäischen Dualismus verdanke ich meiner polnischen Großmutter. Zum einen habe ich als Kind meinen Körper oft in einer tiefen Ekstase des Glücks erlebt, zum anderen war es mir manchmal schleierhaft, warum ich mich in der Zukunft darum bemühen sollte, ihn gesund zu halten, diese tickende Zeitbombe: »Wozu an einem Auto herumschrauben«, sagte ich mir, »wenn es sowieso eines Tages gänzlich aus dem Verkehr gezogen werden muss.« Ja, es machte mir als Kind große Angst, dass ich theoretisch und praktisch in einer Armbanduhr zum Aufziehen wohnte, die jederzeit stehen bleiben und nie wieder repariert werden kann.
Ich bin glücklich, dass ich in einer intakten, von Menschenhand kaum manipulierten Natur geboren wurde und aufwachsen konnte – es ist das Land meiner Kindheit und der »Dreitausend Seen« in Ermland und Masuren. Bei uns gab es keine Schwerindustrie, keine vergifteten Wolken und Gewässer, keine Chemtrails. Die weite Welt, die Neonlichter der amerikanischen Großstädte, dieser Beton- und Glaswüsten, die buntscheckigen Cafés und Supermärkte des Westens kannte ich als Kind nur aus dem Kino. Die Filme King Kong und Die drei Tage des Condor lösten bei mir damals, Mitte der Siebziger des vorigen Jahrhunderts, einen kulturellen Schock aus, denn plötzlich tauchte dieser Moloch auf und drang in mein kindliches Bewusstsein ein – das Babylon unserer Tage: New York, für einen Normalsterblichen aus Bartoszyce unerreichbar. Und was tat ich in meiner Provinz? Ich ging zur Erstkommunion, marschierte an jedem 1. Mai zum »Platz der Kommunisten«, rezitierte »am Tag der Arbeit« ins Mikrofon Gedichte von Konstanty Ildefons Gałczyński, beobachtete heimlich die reizenden Schwestern, Freundinnen und Schülerinnen meiner Mutter und fuhr mit meinen Eltern an den Dadaj-See, an dem mein Vater im Auftrag des Wirkwarenbetriebes aus Bartoszyce ein Erholungszentrum leitete.
Meine Sommerferien verbrachte ich mit dem Studium der Natur, ohne zu wissen, dass sie weder das Böse noch das Gute verkörpert, obwohl in mir langsam eine beunruhigende Vorahnung heranreifte: Eine Feldgrille erleidet doch tausend Tode, wenn sie von einer Amsel gefressen wird, dachte ich. Ein hüpfendes Stück Aal in der Bratpfanne meiner Mutter sprach zu mir wie ein lebendiger Fisch. Ameisen im Wald des Dadaj-Sees gerieten in Aufruhr und Panik, wenn ich mit einem Stock ihre Behausung zerstörte. Dabei wollte ich lediglich erfahren, wo die Königin wohnt. Von den Kiefernstämmen troff das duftende Harz, weil ich mit einer Axt die Rinde abtrennte, aus der ich anschließend Modellboote schnitzte. Und auf den Brettern eines Stegs schlug ich mit einem kräftigen Schlag auf den Kopf zappelnde Plötzen, die keine Luft mehr zum Atmen bekamen, tot – voller Stolz, dass auch ich ein guter Angler war. Ertrunkene bevölkern die masurischen Seen, und sie kamen damals schon auch zu mir, dem Kind der Provinz. An jedem Morgen, an dem ich am Dadaj-See aufwachte, fühlte ich mich wie ein Abenteurer, der in der Wildnis ums Überleben kämpfen muss. Ich stellte mir vor, ich würde einen schwarzen Sombrero tragen, ich war Old Shatterhand und der tapfere Ernő Nemecsek von der Paulstraße. Regnete es aber tagelang, spielten wir Kinder im Gemeinschaftsraum des Erholungszentrums Tischtennis. Unsere Eltern stritten miteinander, gingen fremd und tranken Wodka. Die polnischen, russischen und deutschen Lieder, die meine Mutter Irena zusammen mit ihrer Schwester am Lagerfeuer sang, trieben alten Männern Tränen in die Augen, und die jungen Spunde bleckten ihre Zähne und träumten in der Nacht vom langen schwarzen Haar Irenas und ihrer Schwester Krystyna. Aber jeden Tag rief uns der Wald, riefen uns Pilze und Blaubeeren, die wir sammelten und am Abend verspeisten, zu: »Ihr Menschen! Vergesst uns nicht! Lasst uns nicht allein!«
Meine Kindheit war ein einziger Rausch gewesen, und seltsamerweise hatte ich als kleiner Junge nie das Gefühl gehabt, dass die Zeit unbarmherzig sei und alles, was ihr in den Weg komme, augenscheinlich zerstört werden müsse. Es gab für mich damals nur eine Zeit, und die hieß »jetzt«. Dabei waren die äußeren Umstände meiner Kindheit denkbar schlecht. Der Sozialismus brach mehr und mehr zusammen und unsere Eltern lebten in einer moralisch zerrütteten Welt, die von der desolaten Ästhetik der sowjetischen Ideologie und Denkweise bestimmt wurde, und in diesem künstlich geschaffenen Kosmos gab es wenig Hoffnung; Komplexe, Vorurteile und Misstrauen dominierten den Alltag. Dagegen erschien die Natur wie ein Retter in Not. Dass sie aber mit ihrer unfassbaren Schönheit lediglich eine geschickte Verführerin spielt, war mir damals nicht klar gewesen. Die Augen eines Kindes sehen nicht, dass sie von einem Unschuld ausstrahlenden Bernstein, der eine hübsche Mücke umschließt, verführt werden. Die Natur ist grausam, weil sie zu Anfang unseres irdischen Daseins den Neuankömmlingen, ihrer eigenen Familie sozusagen, Wärme und Geborgenheit vortäuscht – später aber, wenn ihre Zöglinge erwachsen werden, offenbart sie ihr wahres Gesicht: nämlich das der Gleichgültigkeit. Und das Paradoxe an dieser Gleichgültigkeit ist, dass wir dem Weltall, in dem wir leben, arbeiten und agieren, nicht einmal den Vorwurf machen können, man behandle uns ungerecht. Manchmal kommen wir uns wie zeitlose Zuschauer vor, während im Kreis der Geburten, Jahreszeiten, Präzessionen, Kometenwanderungen und Supernova-Explosionen Kulturen und Zivilisationen neu entstehen und wieder verschwinden. Kaum dass man geboren wurde, muss man sich langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass der Friedhof geduldig auf uns wartet. Die Natur ist ein Leichenfresser, ihre Schönheit und Unschuld sind reines Gift, und der manichäische Dualismus, das Lichte und das Dunkle, bringt uns, die wir mit einem Bewusstsein und mit der Fähigkeit, Mitleid für andere Lebewesen zu empfinden, ausgestattet sind, zur Verzweiflung. Soll man den Manichäern Glauben schenken? Sind wir wirklich im Zuge des nicht enden wollenden Krieges zwischen Gott und seinem Widersacher entstanden bzw. erschaffen worden?
Nach dieser Entdeckung der absoluten Herrschaft der Natur über alle Dinge und Lebewesen auf unserem Planeten kam mir die Liebe zu Hilfe. Als ich mich 1983 in Magdalena K. verliebte, war ich gerade mal fünfzehn und sie vierzehn. Aber dieser Schritt zur Verliebtheit hin, zum Lieben, war sehr wichtig, weil ich das erste Mal Waffen gegen den Tod bekam, die wirklich etwas taugten. Die kleine private Bibliothek meiner Mutter, einer Polnischlehrerin in Bartoszyce, erweckte bei mir plötzlich großes Interesse: Ich wollte erfahren, was die Erwachsenen über die Liebe geschrieben haben. In den verglasten Bücherregalen meiner Mutter warteten auf mich in der polnischen Übersetzung Werke von William Shakespeare, Robert Graves, Ernest Hemingway, Alberto Moravia und Thomas Mann, dann die Polen Czesław Miłosz, Cyprian Kamil Norwid und Marek Hłasko. Ich nahm ihre Bücher auf meine Zugreisen nach Poznań zu Magdalena mit und las eines nach dem anderen. Das Besorgen von Fahrkarten für die hoffnungslos überfüllten, nach Zigaretten, Wodka und Urin stinkenden, im Winter meist kalten oder total überhitzten Züge war schnell ein Ritual geworden. Die Fahrkarten dienten mir als Lesezeichen und nach meiner Rückkehr nach Hause brachte ich es jedes Mal nicht übers Herz, sie wegzuwerfen. Sie waren ja Augenzeugen meiner Liebe.
Am frühen Morgen oder spät in der Nacht kam ich dann in Poznań an, meistens unausgeschlafen, und im Taumel der Liebe sagte ich dem Tod direkt ins Gesicht: Du wirst mich nicht besiegen. Magdalenas violett geschminkte Augenlider begrüßten mich auf dem Bahnsteig, und wir fuhren in die Wohnung ihrer Eltern. Wenn ich mit Magdalena endlich allein war, hörten wir in ihrem Zimmer leise Musik, wechselten die Radiosender und Kassetten, und mehr und mehr gewöhnten wir uns aneinander, auch wenn wir zwischendurch lange schwiegen. Wir redeten über Filme, über Bücher, die sie regelmäßig im Antiquariat kaufte, und über unsere Zukunft. Wir befanden uns mitten im Kampf gegen den Tod und merkten es nicht einmal. Und wir liebten uns.