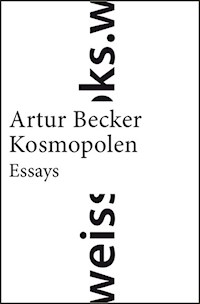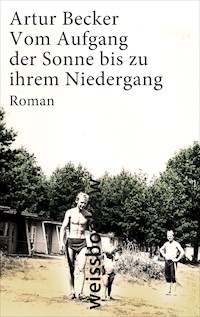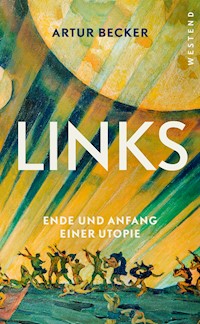
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Rechte und die autoritären Aspirationen mancher Politiker und Regierenden machen uns wieder Angst - die Geschichte darf sich doch nicht wiederholen. Die Linken müssen sich neu aufstellen, müssen kämpfen, damit es in unseren globalisierten Gesellschaften ein Gleichgewicht der verschiedenen Kräfte und Denkweisen gibt. Dabei dürfen sie ihre Wurzeln nicht vergessen - erwachsen aus der Dialektik der Aufklärung besitzen die Linken die stärkste Waffe, die sie progressiv einsetzen können: die Utopie. Nur mit einer Utopie im Gepäck kann die Linke getrost in die Zukunft schauen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ebook Edition
Artur Becker
Links
Ende und Anfang einer Utopie
Ein Essay
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-354-4
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2022
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz: Publikations Atelier, Dreieich
Druck und Bindung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
IDie Utopie als ureigene Kraft der Linken
IIVom imaginierten Ende her …
III… einen neuen Anfang denken
Anmerkungen
Bibliografie
Orientierungspunkte
Titel
Inhaltsverzeichnis
Für Magdalena
»Aus einigem Abstand wäre Dialektik als die zum Selbstbewusstsein erhobene Anstrengung zu charakterisieren, sie sich durchdringen zu lassen.«
Theodor W. Adorno in »Negative Dialektik« (1962)
»Es fällt schwer die Einsamkeit zu akzeptieren. Gelingt das einem, dann wird er überreich belohnt. Und ich glaube, ein Dichter kann nur glaubwürdig schreiben, wenn er in seinem Leben zu bitteren Erfahrungen, zur Einsamkeit, ja sogar zur Niederlage das Ja zu sagen wagt.«
Czesław Miłosz in »Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang« (1974)
Vorwort
»Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen.«
Ernst Bloch in »Das Prinzip Hoffnung« (1954)
Ein Buch mit dem so einfach anmutenden Titel Links zu schreiben, hat selbst nicht wenig von einem utopischen Vorhaben. Der Begriff ›links‹ gehört schließlich nicht nur zu den am stärksten umkämpften, sondern vor allem zu den unschärfsten Begriffen unserer Gegenwart. ›Links‹, das kann heute gleich alles oder auch nichts bedeuten. Die einen kaprizieren den Begriff auf eine parteipolitische Linie und verbinden ›links‹ mit der Partei Die Linke, jener Partei, die bei der letzten Bundestagswahl knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert ist und nicht erst seitdem auf der Suche nach ihrer Identität ist. Diese Suche ist dabei durchaus repräsentativ für die Unschärfe des Begriffs ›links‹ insgesamt. Für andere meint ›links‹ nämlich viel mehr, und zwar eine grundlegende Lebensform, die sich auf Kernthemen besinnt, die historisch gemeinhin als ›links‹ gelten: den Kampf für die Nichtprivilegierten, die Unterdrückten und gegen den Kapitalismus als System, das Unterschiede und Wettkampf geradezu heraufbeschwört und letztlich nur ein Ziel verfolgt – möglichst viel Kapital anzuhäufen. Dass nicht wenige dieser Kernthemen als populistische Parolen von der internationalen Rechten gekapert werden konnten, ist nur ein weiterer Beleg für die Krise des Begriffs ›links‹.
Ganz im Gegensatz zu diesem Wunsch nach historischer Rückbesinnung versteht eine Gegenbewegung »links« gerade als einen mit neuen Identifikationsmöglichkeiten zu füllenden Begriff, etwa mit der sogenannten ›Wokeness‹, die den Kampf für je einzelne, benachteiligte Gruppen meint, dabei aber, so eine gewichtige Kritik, das gesellschaftliche Allgemeine, ja, die soziale Frage aus dem Blick zu verlieren droht. ›Links‹ scheint aber nicht selten auch das Synonym zu sein für die Haltung einer Haltungslosigkeit, einem bloß noch privilegierten, pseudo-linken Öko-Lifestyle: ›Links‹, das kann heute auch bedeuten, im Elektro-SUV zum Biobäcker zu fahren, um einen Dinkelbrocken für 10 Euro zu kaufen. Ein Konsens-Kommunismus, bei dem sich moralischer Gemeinsinn oft darauf beschränkt, die Weltanschauung der eigenen Blase zu spiegeln. In einer Gegenwart, in der auf Kinderarbeit setzende Billigmodeketten Che-Guevara-Shirts verkaufen, ist eine Antwort auf die Frage danach, was ›links‹ eigentlich bedeutet, bedeutet hat und vor allem bedeuten kann, wichtiger denn je.
In diesem Sinne scheint es mir absolut drängend, die Bedeutung von ›links‹ neu zu denken, zu definieren, zu positionieren. Denn ›links‹, das meint weder bloße Parteizugehörigkeit noch einzig den Lifestyle der Bionaden-Bourgeoisie. Ich möchte auf den folgenden Seiten versuchen, die Frage danach, was »links« eigentlich bedeuten kann, noch einmal grundlegend zu stellen, ich möchte sie, im Sinne Blochs, »an der Wurzel fassen«. Gegen die vorschnelle begriffliche Einengung auf eine bestimmte Bedeutungsdimension einerseits und der begrifflichen Entleerung aufgrund einer Vielzahl unscharfer Bedeutungsansprüche andererseits muss eine Definition von ›links‹ vielmehr einer definitorischen Offenheit ins Auge sehen, die gleichwohl nicht die Geschichte ihres Begriffs verleugnet. Wenn die linken Kräfte unserer Gesellschaft wieder zu einer wirklichen Kraft finden wollen, die Ideelles und Reales miteinander vereint, dann muss sie ihre Wurzeln wiederfinden. Sie muss die Utopie wiederentdecken – und zwar nicht als einen nie zu erreichenden Wunschtraum, sondern im Sinne eines dialektischen Kampfes um eine neue, eine gerechtere Welt. Die Utopie denken, das heißt, mit den eingangs zitierten Worten Blochs, einen neuen Anfang von einem imaginierten Ende her zu denken.
Ich selbst kenne den Realsozialismus aus der Volksrepublik Polen und dem Kalten Krieg. Obwohl ich nur knapp 17 Jahre meines Lebens in diesem politischen System gelebt habe, konnte ich seine Schokoladen- wie seine krankhaften Schattenseiten ausgiebig kennenlernen und studieren. Polen ist natürlich ein spezifisches Land, der Sozialismus beziehungsweise Kommunismus konnte in meiner Heimat nach der Abrechnung mit dem Stalinismus nie so erfolgreich gedeihen wie in der DDR. In Polen hatte ich vielmehr den Eindruck, ich würde in einem Staat mit zwei Staatsreligionen oder -ideologien leben: der marxistischen Doktrin auf der einen Seite und der katholischen auf der anderen.
Wir lebten in der Volksrepublik Polen in einer Diktatur, und obwohl die Linken den Nationalismus verabscheuen, waren der Nationalismus und der rechtskonservative Patriotismus – das Leben und Aufopfern für das Vaterland – wesentliche Parolen dieses sozialistischen Staates, der eigentlich von Rechten innerhalb einer linken Arbeiterpartei regiert wurde. Das zeigt schon, dass die Definition der Linken nicht nur heute keine einfache Sache ist, sondern, bei genauerem Hinsehen, schon damals war. Ja, überhaupt ist es schwer, holistisch zu erklären, was ›Links-sein‹ eigentlich bedeutet: Schließlich geht es nicht zuletzt um Mythos und Ideologie zugleich. Wer sich auf den Marxismus einlässt, muss wissen, so schreibt auch Leszek Kołakowski 19761, dass er sich auf eine moderne Mythologie einlässt. Er sagt dazu: »Die Entwicklung des Marxismus aber hat die Wissenschaft in eine Mythologie und in eine weiche Materie verwandelt, aus der das Rückgrat der Vernunft entfernt worden ist.«
So habe auch ich als Jugendlicher den Realsozialismus erlebt: Er glich einem Glauben. Czesław Miłosz2 spricht in diesem Zusammenhang sogar vom »Hegelianischen Bienenstich«, da sich die Weltgeschichte um jeden Preis positiv – bis zur Auflösung jedweder Form von Regierung und zur proletarischen Diktatur – erfüllen müsse, und zwar in einem vollkommenen Frieden für alle Menschen und nicht nur für die sozialistischen Staatsbürger. Die Situation war also höchst widersprüchlich. Zwar war das Glaubenskonzept des Sozialismus utopisch, doch zugleich erlebten wir in Polen täglich die Diktatur der Regierenden, der neuen Eliten, der ›Parteibonzen‹, die doch eigentlich abgeschafft werden sollten. Dieses Verständnis von Utopie, die begrifflich etwas permanent vorstellt, ohne es auch nur im Ansatz einzulösen, ist gerade nicht meines. Die Utopie, wie ich sie denke, ist eine dialektische, die von der Gleichzeitigkeit des Visionierens eines absolut Neuen wie des realistischen Betrachtens der realen Situation und der Reflektion über beides lebt.
Der alltägliche Marxismus, der aus vielen Widersprüchen bestand, knüpfte in seiner Ideologie an ältere christliche Ideen an: an den Gottesstaat Augustinus’ oder den autoritären Staat Thomas von Aquins, in dem der Papst über dem König steht und Gott über den irdischen Angelegenheiten des Menschen. Der Marxismus, wie er in den Ländern des Realsozialismus täglich praktiziert wurde, hatte also erstaunlicherweise mit den Ideen der Aufklärung wenig zu tun, wenn er sich auch tolerant sowie bürger- und menschennah gab. Die Verfassungen waren modern und fortschrittlich, doch die sozialistischen, autoritär regierten Staaten erzeugten einen hässlichen Sumpf, in dem Rassenhass, Nationalismus, Kriegsgelüste und Korruption dominierten; selbstverständlich war da auch Platz für Antisemitismus. Die Linken hatten im Ostblock ihre ursprüngliche Idee des Widerstandes vollkommen aufgegeben. Die Arbeiterklasse durfte nicht mitregieren, sie musste sich mit hohen Lebensmittelpreisen herumschlagen, verfiel dem Alkoholismus und wählte nicht selten den Weg der Emigration und Flucht in den Westen.
Im Namen der geschichtlichen Notwendigkeit und des Fortschritts haben die sozialistisch-kommunistischen Regierungen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ihre eigenen Völker begangen. Vielleicht ist das eine Erklärung dafür, dass die Idee der Utopie, die meines Erachtens der Motor linken Denkens und Handelns ist, gänzlich aus den Augen verloren wurde. Sicher jedoch sind diese Entwicklungen ein Ergebnis der Vorstellung, eine bloße Verneinung des Vorherigen sei selbst schon eine neue Idee; bei Kołakowski heißt es in diesem Sinne: »Der Nationalsozialismus war eine Negierung der Weimarer Republik und deshalb doch nicht links.« Die Linke braucht folglich ein konkretes Denken der Utopie, ein utopisches Denken, dem notwendig Handlung folgen müssste. Links heißt in diesem Sinne nicht Moralisieren oder Träumen, es heißt, das Neue denken und so in die Welt bringen.
Immer schon hat es mich gestört und wütend gemacht, dass die Kommunisten im Ostblock auf einem hohen Ross saßen, moralische Predigten hielten, aber zum Schluss für ihre Kritiker, die Dissidenten, stets nur eine Antwort hatten: Repressalien. Das Scheitern der marxistischen Linken in Polen und anderen Ostblockländern besteht ja darin, dass sie für die Wirklichkeit und damit auch für das Elend der desolaten Wirtschaft keine praktische Antwort gefunden haben. Der sozialistische Staat war korrupt und ökonomisch wie ideologisch ausgebrannt. Und die Linken, die regierten, waren in Wahrheit rechte nationalistische und konservative Ideologen, die ihre Privilegien genossen – unter dem Deckmantel der sozialistischen Erfolgspropaganda.
Als ich 1985 die Volksrepublik verließ, hatte ich in Polen bereits Gedichte publiziert und hielt mich selbstverständlich für einen Antikommunisten: Ich hasste die Sowjetunion, war aber als Liebhaber der russischen Kulturgeschichte russophil. Dostojewski und Brodsky lieferten mir viele Beweise dafür – aber auch die russischen Religionsphilosophen und Existenzialisten wie Nikolai Berdjajew, Leo Schestow oder Wladimir Solowjow –, dass Russland niemals auf den Leninismus oder den Stalinismus reduziert werden darf.
Doch mit dem Beginn des Studiums der Kulturgeschichte Osteuropas und der Germanistik an der Universität Bremen sowie mit dem Beginn des Schreibens und Publizierens auf Deutsch im Jahre 1989 eröffneten sich mir neue Möglichkeiten für die Auseinandersetzung mit der westlichen Linken. Mein jugendlicher Antikommunismus wurde rasch begraben, und ich begriff, dass für mich die westliche Linke zwar attraktiver war als die Linke aus dem ehemaligen Ostblock, es aber auch hier einiges gab, das mit meiner Vision nicht zusammenging.
Natürlich fiel mir damals als Erstes auf, was viele Emigranten aus Osteuropa genauso wie ich empfunden hatten: die manchmal ungeheure Naivität der Linken aus der 68er-Studentenbewegung – sie hatten zwar für die moderne westliche Gesellschaft viele positive Veränderungen bewirkt, doch sie ›kochten in der eigenen Soße‹, wie man im Polnischen sagt, was heißt, dass sie in ihrer Idiosynkrasie und ihrem Elitarismus auf mich behäbig und arrogant wirkten. Viele dieser Linken verklärten die DDR oder die Sowjetunion, obwohl ihnen die dort begangenen Verbrechen längst bekannt waren – immerhin waren wir schon in den Achtzigerjahren angekommen.
Die manichäische Teilung dieser Tage trug dabei zwar uralte Charakterzüge wie in der Antinomie ›Proletariat versus Bourgeoisie‹, aber das war auch alles: Der Böse war weiterhin der Staat, der sich mit dem Kapital zu verbrüdern schien, wobei die westlichen Linken nicht begriffen, dass sie Sozialleistungen genießen konnten, von denen man im Sozialismus nur hatte träumen können. Und wie Yves Montand, der sich als Linker und Kommunist bezeichnete, sagte, dass er lieber in einem teuren Sportwagen als in einem Panzer sitze, so dachten (und denken bis heute) viele Linke. Die SPD-Wähler und Arbeiter galten jedenfalls oft als Spießer, die ›Arbeiterklasse‹ war für die intellektuellen Linken uninteressant geworden, zumal sich die SPD mehr und mehr von ihren Wurzeln abwandte: Die radikalen Linken wirkten auf mich besonders lächerlich, da sie mich entweder als einen rechtskonservativen Junker aus Ostpreußen oder als katholischen, romantischen Lech-Wałęsa- und Solidarność-Anhänger betrachteten – mein Gott!, dachte ich immer wieder, sie romantisieren etwas, das sie nicht einmal verstehen.
Aber letztendlich hatten sie alle, egal ob radikal oder liberal, eine Gemeinsamkeit: Sie sahen nicht unbedingt frohen Mutes in die Zukunft, die Welt erschien ihnen in einem erbärmlichen Zustand. Der Mensch, so der einende Befund, hatte den falschen Weg gewählt: den Weg eines Parasiten. Es ist kein Wunder, dass im Jahr 1980 die Partei der Grünen gegründet wurde und dass ökologische Fragen von Jahr zu Jahr mehr und mehr zu einem globalen Thema und ihrer Hauptsorge wurde.
Einen gewissen Kulturpessimismus vermittelt auch die Dichtung von Miłosz, hat er doch mit eigenen Augen gesehen, wozu die Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs und die Stalinisten nach 1945 fähig waren. Aber sowohl Miłosz als auch sein bester Schüler Zbigniew Herbert halfen mir, an die Utopie zu glauben, daran, dass wir als menschliche Zivilisation in der Zukunft Lösungen für unsere Probleme finden würden. Nicht nur technologische für unsere Umweltprobleme, sondern auch für die Fragen unseres sozialen wie metaphysischen und transzendenten Daseins. Jedenfalls war ich schon als Fünfzehnjähriger davon überzeugt, dass unsere materialistisch ausgerichtete Zivilisation keine große Zukunft vor sich hatte und früher oder später ein klägliches Ende finden müsste. Kurz gesagt: Ich sah im Kulturpessimismus eine positive Chance, ich dachte also dialektisch. Der Zusammenhang von Dialektik und Utopie ist auf den ersten Blick nicht selbstverständlich, fast scheinen beide Begriffe sich auszuschließen. Warum ich glaube, dass gerade ein Zusammendenken dieser beiden Ideen der Grundstein für eine neue Linke ist, werde ich in diesem Essay zu zeigen versuchen.
Gegenüber Utopien war die Linke seltsamerweise immer schon skeptisch, wie etwa der Vorzeigelinke und marxistische Intellektuelle Antonio Gramsci, der in einem Artikel von 19183 schreibt: »Die Utopie besteht gerade darin, die Geschichte nicht als eine freie Entwicklung zu konzipieren, die Zukunft als etwas Feststehendes, bereits Vorgezeichnetes zu sehen, an vorbestimmte Pläne zu glauben.«
Gramsci schrieb auch über russische Maximalisten, die während der Februarrevolution 1917 den totalen, den »ganzen« Sozialismus anstrebten, und da war kein Platz für Utopien, da musste immerhin sofort gehandelt werden – das Radikale birgt jedoch immer die Gefahr, dass man, die schnellen Erfolge einer Revolution feiernd, an seinen eigenen, sehr hochgeschraubten Ansprüchen scheitert, was ja letztendlich den Maximalisten passiert ist.
Es hatte zumindest lange gedauert, bis ich begriff, dass die westeuropäische Linke, die wiederum bestimmte Ansprüche stellte und hatte, tatsächlich nicht imstande war, die Sorgen eines osteuropäischen und regierungskritischen Intellektuellen zu begreifen. Sie hielten ihn schlicht für einen Verräter an der sozialistischen und damit fortschrittlichen Sache und Idee. So ist übrigens auch zu erklären, dass Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und Pablo Neruda Czesław Miłosz ablehnten. Nein, ich kam mir nach meiner Ankunft in Westdeutschland Mitte der Achtzigerjahre wirklich oft wie ein Rechtskonservativer und gar Nationalist vor. Dabei war ich bloß aus einem Land angereist, das unter der Nazibesatzung in ganz Europa die größten Opfer gebracht hatte – vergleichbar eigentlich nur mit Russland und der Ukraine –, sodass meine Geschichtsperspektive ganz anders war als die der Deutschen. Und trotzdem kam ich aus einem gescheiterten, ›gefallenen‹ politischen System, kurz gesagt: als Verlierer.
Ältere Linke, die noch eine lebhafte Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und sein Ende hatten, wussten darüber Bescheid, dass es in Warschau während der Nazibesatzung zwei Aufstände gegeben und dass in Polen neben dem Holocaust eine zweite Vernichtung stattgefunden hatte: die an 3,2 Millionen polnischen Juden und die an 2,8 Millionen polnischen Christen; vom kulturellen Verlust, von endgültiger Auslöschung von Kulturgütern und intellektuellem Potenzial wollen wir an dieser Stelle gar nicht erst anfangen zu sprechen. Junge Linke, insbesondere in Westdeutschland, hatten dagegen nur Russland vor Augen. Von Trotzki und Bakunin fasziniert, übersahen sie Polen und seine Rolle zwischen dem russischen Imperium und Preußen, zwischen der Sowjetunion und Nazideutschland. Das ist bis heute so, vor allem in den Kreisen der Sozialdemokraten, die sich mit dem polnischen Katholizismus schon immer schwergetan haben.
Kehren wir aber in den Westen zurück. Bereits in den Siebzigern und Achtzigern zeichnete sich in der BRD ab, was später zur Krise der Linken einen wesentlichen Beitrag leisten sollte: Sie ließ sich von den Grünen und den Volksparteien ihre Themen stehlen. Was sie ebenso verschlief, war die Tatsache, dass ihr auch der moderne Kapitalismus mit seiner Marktwirtschaft einen Strich durch die Rechnung machte, denn der Lebensstandard in der Europäischen Union konnte auch für das Prekariat angehoben werden, sodass der Konsum für die Arbeiterschaft attraktiv wurde, vor allem dank der Kredite.
Als ich 1985 im Westen ankam, wunderte ich mich über die zahlreichen sozialen Erleichterungen und Gesetze. Der Arbeiterklasse im Sozialismus ging es auf jeden Fall viel schlechter als ihren Leidensgenossen im Westen, doch die westliche Linke hatte mehr oder weniger eine ganz andere Kundschaft gewonnen und etabliert. Es hatte ein regelrechter Paradigmenwechsel stattgefunden, dessen Zeuge ich noch werden konnte, denn zum einen waren die Arbeiter keine Sklaven mehr von geldgierigen Kapitalisten, die ihnen lediglich einen Hungerlohn zahlten, zum anderen wechselten sie auch zunehmend das politische Lager. Das taten sie, weil sie sich von den Linken und Sozialdemokraten nicht mehr repräsentiert fühlten, da diese zwar vorgaben, für Gleichheit und Gerechtigkeit einzutreten, die Realität aber ein ganz anderes Bild offenbarte: eine Multikulti-Gesellschaft, das Eindringen der liberalen Narration der Regierungsinstitutionen und der EU in ihre lokalpatriotisch-traditionelle Lebensweise, die zunehmende Elitenbildung in der Politik und Wirtschaft, deren Sprache für sie fremder und fremder wurde, wie auch die immer komplizierter wirkende Vernetzung dieser Eliten in der globalisierten Welt. Sie gaben ihre Freiheit im Namen der Sicherheit auf, wie es Zygmunt Bauman ausdrücken würde: Sie wurden rechtskonservativ und hatten gar kein Interesse mehr an einer Zukunft, die für sie ökonomisch und sozial ohnehin unter einem großen Fragezeichen stand. In diesem Sinne hatten sich die Linken von ihren ehemaligen Wählern verabschiedet, wie es auch Didier Eribon treffend diagnostiziert, wobei er von seinen Kritikern in Frankreich selbst als ein privilegierter Salonlinker betrachtet wird.
Eribon beschreibt diesen Paradigmenwechsel sehr treffend, wenn er in Bezug auf die Gelbwesten-Bewegung sagt, diese folge »nicht der traditionellen ideologischen, sondern der sozialen Spaltung (…). Dies ist Teil eines globalen Problems. In vielen wohlhabenden Demokratien hat sich die Linke vollständig von ihrer Volksbasis gelöst. Im 20. Jahrhundert verteidigte sie Gewerkschaften und Arbeiter, aber in den letzten 40 Jahren hat sich der Begriff der Gleichstellung gewandelt und eine neue Bedeutung erhalten. Es sind Frauen, Schwule, Lesben und Einwanderer und nicht die Arbeiterklasse, die heute an den Rand gedrängt und die im Herzen von sozialistischen Parteien und Sozialdemokraten getragen werden. In der Folge verloren die Parteien den Kontakt zur weißen Arbeiterklasse und allgemein zu den Volksmassen.«4
Nun schwächelt die Linke schon seit Jahren, sie steht im Schatten ihrer größten Erfolge: im Westen im Kontext der 68er-Revolution, der Gründung der Grünen und der Friedensproteste, und im Osten hat sie nach 1989 noch nie ein leichtes Leben gehabt – sie verliert seit geraumer Zeit ihre Wähler an Rechtskonservative, wobei die Arroganz der Linken: ihre Neigung zum moralistischen Auftreten und Gebaren, zu ihrem Imageverlust sicherlich einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Vor allem die intellektuellen Linken haben sich schon vor langer Zeit vom Prekariat abgewandt. Zudem haben sie ein gewaltiges Problem mit radikalen Forderungen, weil sie im Alltag nicht realisierbar sind und dem ›Vorankommen‹ und dem Konsens im Wege stehen, zumal die Linke den Populismus weder ideologisch noch praktisch umsetzen kann. Die Linke ist eine Vertreterin der Minderheit, und ihre große Schwäche besteht darin, dass sie politisch oft scheitert, weil sie, wie Kołakowski behauptet, keine richtige »politische Bewegung« ist, »sondern nur die Summe spontan entstandener moralischer Einstellungen« bildet.
Ich habe im polnischen Sozialismus den Missbrauch der Linken durch den sowjetischen vulgarisierten Marxismus als eben solch eine moralistische Lehrstunde empfunden – in Verbindung mit der Vaterlandsliebe und der Liebe zu unseren sozialistischen Brüdern wirkte dieser Missbrauch noch gewaltiger. Die Märsche am 1. Mai in meiner Geburtsstadt Bartoszyce in Masuren, um den Sieg der Arbeiterklasse und des Sozialismus zu feiern – sie erinnerten mich später, nach meiner Ausreise in die BRD, an die Märsche der Hitlerjugend, die im Sachsenhain in Verden an der Aller, wo ich über 20 Jahre lang mein Arbeitszimmer gehabt und 15 Bücher geschrieben hatte, zur Sonnenwende mit ihren brennenden Fackeln aufmarschiert war.
Eine Zivilisation, die lediglich auf Wachstum und Fortschritt der Technologien setzt, wird niemals der linken Utopie einer gerechten Welt nahekommen. Es kann doch kaum das Ziel des menschlichen Daseins sein, ungeheure Reichtümer anzuhäufen. Auch ist das Ziel, ein politisch-ökonomisches System aufzubauen, das jedem ein Grundeinkommen sichern und damit auch die Existenzängste nehmen könnte, noch nicht als Utopie zu verstehen. Nein, vielmehr drücken alle Utopien und Mythen zunächst unsere Sehnsucht nach erfüllten Zeiten aus, nach dem ewigen Frieden in dem Ozean, aus dem wir alle kommen, wie es Freud 19305