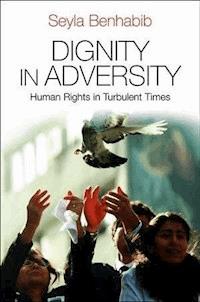21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Auch wenn »globale Menschenrechte« mittlerweile zum Standardrepertoire des politischen Diskurses gehören, ist ihre philosophische Rechtfertigung nach wie vor umstrittenes Gebiet. Für manche sind Menschenrechte das Trojanische Pferd, mit dem der Westen seinen neoliberalen way of life in alle Welt zu exportieren trachtet, andere wiederum verbinden mit der Idee einer Weltbürgerschaft mit verbrieften Rechten einen unzulässigen Eingriff in die Souveränität demokratischer Staaten. Seyla Benhabib entwickelt in ihrem Buch ein diskursethisches Instrumentarium, um solche falschen Gegensätze zu überwinden. Anhand zahlreicher Beispiele – Kopftuchstreit, Flüchtlingspolitik, humanitäre Interventionen – zeigt sie Wege zu einem engagierten, kontextsensitiven demokratischen Kosmopolitismus jenseits von Interventionismus und Indifferenz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
2Auch wenn »globale Menschenrechte« mittlerweile zum Standardrepertoire des politischen Diskurses gehören, ist ihre philosophische Rechtfertigung nach wie vor umstrittenes Gebiet. Für manche sind Menschenrechte das Trojanische Pferd, mit dem der Westen seinen neoliberalen way of life in alle Welt zu exportieren trachtet, andere wiederum verbinden mit der Idee einer Weltbürgerschaft mit verbrieften Rechten einen unzulässigen Eingriff in die Souveränität demokratischer Staaten. Seyla Benhabib entwickelt in ihrem Buch ein diskursethisches Instrumentarium, um solche falschen Gegensätze zu überwinden. Anhand zahlreicher Beispiele – Kopftuchstreit, Flüchtlingspolitik, humanitäre Interventionen – zeigt sie Wege zu einem engagierten, kontextsensitiven demokratischen Kosmopolitismus jenseits von Interventionismus und Indifferenz.
Seyla Benhabib ist Eugene Meyer Professor für Politische Theorie und Philosophie an der Yale University. Zuletzt erschienen Die Rechte der Anderen. Ausländer, Migranten, Bürger (2008) und Hannah Arendt – Die melancholische Denkerin der Moderne (stw 1797).
3Seyla Benhabib
Kosmopolitismus ohne Illusionen
Menschenrechte in unruhigen Zeiten
Suhrkamp
4Kapitel 2 wurde von Andreas Fliedner übersetzt, Kapitel 6 von Jeanette Ehrmann und Kapitel 9 von Stefan Eich.
Alle übrigen Texte und Kapitel hat Karin Wördemann ins Deutsche übertragen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der folgende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2165.
© dieser Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2016
© Seyla Benhabib
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
eISBN 978-3-518-74182-5
www.suhrkamp.de
Inhalt
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Vorwort zur englischen Ausgabe
1 Einleitung: Kosmopolitismus ohne Illusionen
2 Ein anderer Universalismus Einheit und Vielfalt der Menschenrechte
3 Gründe nennen und Rechte beanspruchen: Die Konstruktion des Rechtssubjekts
4 Gibt es ein Menschenrecht auf Demokratie? Jenseits von Interventionismus und Indifferenz
5 Menschenrechte jenseits nationaler Grenzen? Eine Annäherung an den globalen Konstitutionalismus
6 Dämmerung der Souveränität oder das Aufstreben kosmopolitischer Normen? Eine Neubewertung von Staatsbürgerschaft in Zeiten des Umbruchs
7 Demokratische Iterationen und demokratische Exklusionen Eine Debatte um die gerechten Grenzen des demokratischen Demos
8 Die Wiederkehr der politischen Theologie Die Kopftuchaffäre im Spiegel des vergleichenden Konstitutionalismus
9 Menschenrechte und die »Kritik der humanitären Vernunft«
Nachweise
7Vorwort zur deutschen Ausgabe
Die Sprache der Menschenrechte ist zur Lingua franca, wenn nicht gar zur Realität globaler Politik geworden. Doch der Siegeszug dieses Vokabulars hat auch Dilemmata und Paradoxien in der Theorie und Praxis der Menschenrechte mit sich gebracht. Theoretisch haben sich, seit die Menschenrechte politisch zu hohem Ansehen gelangt sind, die Meinungsverschiedenheiten mit Blick auf ihre philosophische Rechtfertigung verstärkt: Sie reichen von minimalistischen Versionen der Menschenrechte als Elementen einer dünnen universalistischen Moral, von der es heißt, sie sei allen Kulturen gemein, bis hin zu der Behauptung, dass die Menschenrechte notwendige Mindestbedingungen artikulieren, die rechtmäßige Staaten erfüllen müssen, um als Mitglieder der politischen Weltgemeinschaft anerkannt zu sein.
Diese theoretischen Dilemmata werden von Paradoxien in der Praxis begleitet. In den letzten Jahrzehnten berief man sich auf die Menschenrechte, um »humanitäre Interventionen« im Irak sowie in Afghanistan und Libyen zu rechtfertigen, während der Menschenrechtsschutz weder im Fall des Völkermords in Ruanda in den 1990er Jahren zu ähnlichen Unternehmungen geführt hat noch dazu, der Ausbreitung des Islamischen Staats Einhalt zu gebieten, oder dazu, den seit 2014 in Scharen vor dem Bürgerkrieg in Syrien fliehenden Menschen zu helfen. Die Berufung auf die Menschenrechte, um eine beliebige Intervention zu rechtfertigen, eine andere aber nicht, hat zu dem verständlichen Vorwurf geführt, dass die Supermächte ihre Heuchelei maskieren und ihre illegitimen internationalen Militärvorhaben bemänteln, indem sie die Sprache der Menschenrechte verwenden.[1] Doch selbst ohne Krieg und Intervention sind die Menschenrechte das Trojanische Pferd der weltweiten Verbreitung des globalen Kapitalismus, der alle Lebensformen und Gemeinschaften auf seinem Weg pulverisiert, heißt es.
Ungeachtet dieser berechtigten Bedenken ist eine andere Per8spektive möglich und plausibel: Die Weltgesellschaft der Staaten hat sich seit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 und der anschließenden Entstehung eines zugegebenermaßen fragilen globalen Menschenrechtsregimes unwiderruflich gewandelt (siehe Kapitel 3 und 5). Die Menschenrechte sind nicht einfach normative und philosophische Grundsätze zum Schutz der menschlichen Würde, Vernunft oder Handlungsfähigkeit. Sie haben durch die vielen transnationalen Menschenrechtskonventionen, die von der überwältigenden Mehrheit der Staaten auf der Welt unterzeichnet wurden, die Form positiver, justiziabler Rechte angenommen. Die Positivierung der Menschenrechte in Form von transnationalen Menschenrechtsgesetzen ist ein Novum in der Weltpolitik, das die Bedeutung der staatlichen Souveränität verändert. Es wäre ein Fehler, die emanzipatorischen Potentiale zu ignorieren, die von diesen Veränderungen ermöglicht werden.
Anna Grear hat in ihrem Beitrag zum Cambridge Companion to Human Rights Law sehr treffend die zweifache Geste zusammengefasst, mit der wir das Versprechen und zugleich das Scheitern von Menschenrechten und von Menschenrechtsgesetzen anerkennen sollten. »Die Menschenrechte brechen wohl ihr Versprechen, wenn es ihnen nicht gelingt, die Träger von Empörung und Mitleid zu sein. Es ist wohl genau der Augenblick erlebter ›Nacktheit‹ angesichts der ›Leere‹ selbst, in der ›gefühlten‹ Lücke zwischen dem ›Jetzt‹ und dem ›noch nicht‹, in dem rohen Widerspruch zwischen dem menschenrechtlichen Versprechen und dem menschenrechtlichen Verrat, [in dem] die grenzenlose Energie und Paradoxie der Menschenrechte wiederkehrt. Denn gerade in der Erfahrungswirklichkeit des Verrats am Versprechen des Universellen, […] branden die menschlichen Energien zurück in den Raum des menschenrechtlichen Scheiterns, finden neue Worte, atmen (buchstäblich) einen Schmerz, der die Menschenrechte als einen unaufhörlichen Kampf um die Konstituierung der Menschenfamilie wiedererweckt. Hoffnung liegt vielleicht in der Idee, dass sich die kritische Energie der Menschenrechte mit der internationalen Verankerung des Menschenrechts noch nicht erschöpft hat […].«[2]
9Der Schmerz, der angesichts »des Verrats am Versprechen des Universellen« und angesichts des »Kampfs um die Konstituierung der Menschenfamilie« wiedererwacht, ist nirgendwo akuter zu spüren als dort, wo wir mit dem Los des Flüchtlings und Asylsuchenden konfrontiert sind. Im Sommer 2015 lenkte der Tod eines kleinen Flüchtlingsjungen namens Aylan Kurdi im Ägäischen Meer die Aufmerksamkeit der Welt wieder einmal auf das Versagen der internationalen Gemeinschaft, die Menschenrechte der Verwundbarsten zu schützen. Mit den denkwürdigen Worten von Hannah Arendt wäre zu sagen, »daß das Recht auf Rechte oder das Recht jedes Menschen, zur Menschheit zu gehören, von der Menschheit selbst garantiert werden müßte. Und ob dies möglich ist, ist durchaus nicht ausgemacht.«[3] Als Arendt dies 1951 niederschrieb, waren die Institutionen des gesetzlich geregelten Menschenrechtsschutzes noch sehr neu und fragil. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords waren beide im Jahr 1948 verabschiedet worden, und die Genfer Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge wurde gerade erst formuliert. Es gab keine internationalen Übereinkommen hinsichtlich der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Rechte. Erstaunlich ist daher nicht Arendts politische Hellsichtigkeit, sondern dass wir mehr als ein halbes Jahrhundert später beim Umgang mit den Bedingungen für Flüchtlinge und Asylsuchende so wenig Fortschritte gemacht haben.
Das ist deshalb so, weil die Menschenrechte von Flüchtlingen und Asylsuchenden die grundlegende Spannung zwischen Menschenrechten und den Rechten von Staatsbürgern offenbaren. Menschenrechte sind immer auch die Rechte derer, die irgendeiner menschlichen Gemeinschaft angehören, und in einem staatszentrierten System ist der Staat das am stärksten definierende und umfassendste Organ der Zugehörigkeit (siehe dazu die Kapitel 6 und 8). Sobald es entweder durch Bürgerkrieg, politische oder religiöse Kriege, durch Naturkatastrophen oder ökologische Verheerungen zu einem Verlust dieser Zugehörigkeit kommt, wird jemand zu einem Menschen mit Sonderstellung. Man wird zu einer IDP (im In10land Vertriebenen), gehört zu einer PRS (zu Menschen, in einer andauernden Flüchtlingssituation) oder wird zu einem Staatenlosen (siehe dazu Kapitel 9). Dies sind neue Kategorien für Menschen, deren Zugehörigkeit zur Menschenfamilie prekär geworden ist.
Während dieser prekäre Status für viele ein Zeichen der falschen Versprechen der Menschenrechte ist, mit denen Menschen offenbar zu bloßen Objekten des Mitleids und des Mitgefühls gemacht werden, sehe ich ihn nicht nur als ein Zeichen des Scheiterns, sondern auch des Aktivismus und des politischen Engagements. Im Sommer 2015 rebellierten nicht nur Aktivisten der Zivilgesellschaft in ganz Europa gelegentlich gegen ihre Regierungen, indem sie den Flüchtlingen halfen und sich den Behörden auf verschiedene Weise widersetzten,[4] sondern auch die Flüchtlinge selbst beriefen sich oft auf ihr Menschenrecht auf Asyl, wehrten sich gegen den Rassismus der slowakischen und ungarischen Polizeikräfte, drängten sie zurück und rissen Zäune nieder. Die Menschenrechte erzeugen also eine Sprache der normativen Anspruchshaltung, welche die bestehende Institutionalisierung des gesetzlichen Menschenrechtsschutzes transzendiert und damit den Menschen ohne Mitspracherecht eine Stimme leiht. Der politische Aktivismus der »Pass- und Ausweislosen« überall auf der Welt, wie zum Beispiel der »Träumer« in den USA – junge Menschen, die mit ihren Familien als Kinder in die Vereinigten Staaten kamen, dort aufwuchsen und Schulen oder Universitäten besuchten, ohne ihren Status zu kennen – und der »sans papiers« in Frankreich, zeugt von dieser Macht einer Sprache der Rechte.
Die dialektische Spannung zwischen den universellen Menschenrechten, wie sie in vielen internationalen Pakten formuliert sind, und den Staatsbürgerrechten wird allerdings nicht nur an den Grenzen des demos sichtbar. Auch für die Bürger liberaler Demokratien kann diese Spannung eine Ursache für Kämpfe und Auseinandersetzungen sein. Denn wie hängen internationale Menschenrechte und verfassungsmäßige Rechte zusammen? Worin unterscheiden sie sich? Über welche Bandbreite hinweg kann die Formulierung bestimmter Rechte, wie der Meinungsfreiheit 11und der Religionsfreiheit, bei verschiedenen liberalen Demokratien variieren? Welche Formulierungen erachten wir für legitimer als andere? Die grundsätzliche wechselseitige Abhängigkeit zwischen demokratisch ausgeübter Souveränität des Volkes und den Menschen- und Bürgerrechten legt die Frage nahe: Handelt es sich bei diesen Rechten um das, was der Wille des demos dahingehend beansprucht, oder sind gewisse Beschränkungen in das eingebaut, was als Form der akzeptablen Willensäußerung des demos gelten darf, um auf diese Weise eine illiberale Mehrheitsherrschaft zu verhindern (siehe dazu Kapitel 5 und 7)? Indem ich das »Recht, Rechte zu haben«, durch eine diskurstheoretische Rechtfertigungsstrategie weiterführe und als den Schutz der kommunikativen Handlungsfähigkeit von Personen konkretisiere (Kapitel 2 und 3), argumentiere ich, dass Menschenrechte eine »kontexttranszendierende« Funktion haben. Sie erschaffen dadurch Horizonte »jurisgenerativer Politik«, selbst wenn demokratische Mehrheiten beschließen werden, »die Rechte der anderen« zu begrenzen. Dieses theoretische Argument bildet das Herzstück dieses Buchs; und es unterscheidet meine theoretische Position sowohl von der »minimalistischen« als auch von der »funktionalistischen« Rechtfertigung der Menschenrechte.[5]
Die in diesem Band versammelten Aufsätze wurden über einen Zeitraum von fast zehn Jahren, zwischen 2006 und 2014, verfasst. Viele wurden zunächst in einer englischen Ausgabe unter dem Titel Dignity in Adversity. Human Rights in Troubled Times (Polity Press 2011) veröffentlicht. Diese deutsche Ausgabe verzichtet zwar auf die Kapitel 2, 3 und 10 der englischen Ausgabe, schließt allerdings zwei neue Kapitel (Kapitel 3 und 9) ein. Zum Zweck der Veröffentlichung wurden alle Aufsätze in diesem Band teilweise neu geschrieben und die Anmerkungen vielfach gekürzt und gestrafft.
Ich möchte Karin Wördemann für ihre Sorgfalt und Geduld während der Arbeit an dieser Neuausgabe danken; meinem Assistenten Stefan Eich, der Kapitel 9 übersetzte, das ursprünglich meine im Mai 2014 gehaltene Dankesrede anlässlich der Verleihung des Meister-Eckhart-Preises war, gebührt ein besonderer Dank für 12seine Bemühungen. Clara Picker half in einem fortgeschrittenen Stadium, die Kapitel 2 und 6 aus ihrer gedruckten Version zu konvertieren, und hat diese Arbeit wie von Zauberhand erledigt.
Schließlich danke ich Eva Gilmer für ihre Ermutigung zu dieser Übersetzung und für ihr aufmerksames Lektorat.
Die deutsche Fassung dieses Buches widme ich meiner kosmopolitischen Freundin Anna-Jutta Pietsch (1937-2015), die mir während meiner ersten Jahre in Deutschland Hospitalität geboten hat.
Seyla Benhabib
New York, im April 2016
13Vorwort zur englischen Ausgabe
Es muss der 18. September 2001 gewesen sein, als ich mit meiner 14jährigen Tochter die Whitney Avenue in New Haven, Connecticut, überquerte, unterwegs zu einer Niederlassung des Roten Kreuzes, um für die Opfer des Anschlags auf die knapp 150 Kilometer entfernten Twin Towers und die dort im Einsatz befindlichen Rettungskräfte Blut zu spenden. Als ich der diensthabenden Krankenschwester meinen Namen nannte, erstarrte sie für einen Augenblick: »Ben-Habib« – war das nicht ein arabischer Name? »Wer ist diese Frau mit ausländischem Akzent, die hierherkommt, um Blut zu spenden«, schien sie sich zu fragen.
Meine Tochter, die das Zögern der Krankenschwestern bemerkte, verstand sofort, dass ich für eine Araberin oder Muslimin gehalten wurde, und drückte mitfühlend meine Hand. An diesem frühen Abend in Connecticut konnte ich mich nicht des Eindrucks erwehren, dass meine Geste der Solidarität mit den Opfern vom 11. September und den Feuerwehrleuten und Polizisten von New York City nicht erwünscht war und, wie sich dann herausstellte, tatsächlich auch nicht gebraucht wurde: Studenten der Yale University und anderer Hochschulen waren bereits zu den Rote-Kreuz-Stellen geeilt, und die Blutbanken waren gut gefüllt.
Trotzdem schmerzte mich etwas. Bei der Moral dieser Geschichte geht es nicht um eine Diskriminierung von Menschen aus dem Nahen Osten, Muslimen oder arabischen Amerikanerinnen, auch wenn diese real ist. Sie handelt vielmehr von der Komplexität und Multiplizität von Identitäten, die mein Name bezeugt, die aber die bürokratische Verwaltung in einer zunehmend sicherheitsorientierten weltpolitischen Umgebung in einer Kurzschrift registriert, die während des sogenannten »Kriegs gegen den Terror« auf unmissverständliche Signale der Gefahr verkürzt ist. Die Krankenschwester vom Roten Kreuz konnte nicht wissen, dass ich eine in Istanbul geborene sephardische Jüdin bin, deren frühester bekannter Vorfahre »Jacob Ibn-Habib« hieß, aus Zamora in Spanien stammte und dessen Nachkommen Rabbiner und bekannte Mitglieder einer jüdischen Gemeinde in Spanien und später in Thessaloniki und Gallipoli waren. Nach manchen historischen Aufzeichnungen 14versuchten meine Vorfahren zwar, die christlichen Obrigkeiten davon zu überzeugen, den Juden den Verbleib in Spanien zu gestatten, hatten aber keinen Erfolg damit und verließen das Land wie Tausende in dieser Zeit, um im Osmanischen Reich Zuflucht zu suchen.[1]
Der Islam war für sie keine Religion von Krieg und Dschihad, sondern nur eine Religion der Toleranz, die Juden respektierte und ihnen das »Gastrecht« in Kants Sinne gewährte, und das nicht nur, weil sie das »Volk des Buches« waren, der Torah, die der Islam neben dem Neuen Testament als heilig anerkannte. Gewiss, die Geschichte der Juden des Osmanischen Reichs ist nicht frei von Erfahrungen der Diskriminierung, Vorurteile, Unterdrückung und Ausschließung. Doch wenn ich dann von der l’affaire du foulard – der »Kopftuchaffäre« – lese, die Frankreich in Atem hielt, nachdem französische Behörden muslimische Mädchen der Schule verwiesen, die mit bedecktem Kopf zum Unterricht erschienen waren, und an den »türban or başörtü meselesi« in der Türkei denke, erinnere ich mich an meine eigenen Großmütter und Tanten. Sie handhabten Bedeckung und Offenheit ihres Haars sehr ähnlich wie ihre muslimischen Nachbarn. Ich denke auch an orthodoxe jüdische Frauen, die an öffentlichen Orten in Brooklyn, Queens und Jerusalem ebenso wie in Paris und London Perücke tragen. Und ich frage mich, bin ich eine türkische Jüdin? – Eine jüdische Türkin? – Eine sephardische Jüdin, die in einem Land mit muslimischer Mehrheit aufgewachsen ist? Ein Kind von Atatürks Republik? – Was bedeutet das alles?
Die Art und Weise, wie der politische Islam nach dem 11. September 2001 die Bühne der Weltpolitik erobert hat, zwang diese Aspekte meiner Biographie, denen ich bislang nur private Bedeutung beigemessen hatte, in theoretische und politische Debatten der Gegenwart hinein, welche die »Dialektik der Aufklärung« und die jüdische Erfahrung, das internationale Recht und den Holocaust, den Islam im heutigen Europa und die Bedeutung des zeitgenössischen Kosmopolitismus thematisieren.
Die folgenden Kapitel diskutieren die Philosophie und Politik der Menschenrechte, indem sie eine systematische Darstellung ihres Platzes innerhalb des Projekts der Diskursethik und der kom15munikativen Rationalität vorlegen. Sie untersuchen diese Rechte auch vor dem Hintergrund sich wandelnder Konzeptionen von Staatsbürgerschaft in Europa, die insbesondere durch die muslimische Migration und den neuen Zustrom von Flüchtlingen und Asylbewerbern herausgefordert sind. Heute sind die Spannungen zwischen dem Statuswandel des internationalen Rechts und dem normativen Ideal eines demokratisch selbstregierten Volkes die Quelle erbitterter Streitigkeiten. Für manche ist das internationale Recht etwas, was die demokratische Souveränität untergräbt; für andere – und dazu zähle ich mich – verstärkt es die demokratische Souveränität. Mein Ziel in diesem Buch ist es, diese vielschichtige Landschaft zu erkunden und den Menschenrechtsdiskurs in eine Vision von demokratisch iterativer Politik einzuordnen.
Danksagungen
Ein Sabbatjahr der Universität Yale in der Zeit vom Januar bis Juli 2009, das zudem vom Wissenschaftskolleg zu Berlin großzügig ergänzt wurde, hat mir ermöglicht, diese Aufsatzsammlung zu konzeptualisieren. Ein späterer Aufenthalt am Forschungskolleg Humanwissenschaften in Bad Homburg v.d.H. von Mitte Juni bis Mitte Juli 2010 erlaubte mir, dieses Projekt weiterzuverfolgen. Mein Dank gilt Dieter Grimm, Andrea Büchler und Dipesh Chakrabarty, die die Zeit am Wissenschaftskolleg mit mir teilten, sowie Rainer Forst und Stefan Gosepath, die mir mit Mitteln des Exzellenzclusters »Die Herausbildung normativer Ordnungen« den Aufenthalt in Bad Homburg ermöglichten. Ich danke auch Peter Niesen und David Owen für ihre scharfsinnigen Kommentare zu meinem Projekt in der Bad Homburger Arbeitsphase.
Gespräche mit Benjamin Barber, Ken Baynes, Richard Bernstein, Hauke Brunkhorst, Maeve Cooke, Nancy Fraser, Alessandro Ferrara, Jürgen Habermas, Regina Kreide, Thomas McCarthy, David Rasmussen, Bill Scheuermann und Christian Volk haben mein Leben und mein Denken bereichert. Unter meinen Kollegen an der Yale University bin ich Bruce Ackerman, Alex Stone Sweet, Anthony Kronman, Karuna Mantena und Andrew March für ihre Kritik und Feststellungen dankbar. David Garcia Alvarez, ein spanischer Fulbright-Stipendiat in Yale, war in den letzten Jahren ein äußerst 16anregender Gesprächspartner in Fragen des Kosmopolitismus und hat mich großzügig mit zahlreichen Literaturhinweisen versorgt, die ich sonst vielleicht übersehen hätte.
Meine Zusammenarbeit mit Reset – Dialogue of Civilizations und die Seminare, die wir seit 2007 in Istanbul durchgeführt haben, gaben mir die Gelegenheit, regelmäßig in die Türkei zurückzukehren und die Bedeutung der Menschenrechte in diesen turbulenten Zeiten immer wieder zu erleben und zu überdenken. Ich danke Giancarlo Bosetti und Nina von Fürstenberg für die Ermöglichung der Istanbuler Seminare.[2]
Ein besonderes Wort des Dankes gebührt Judith Resnik, meiner unermüdlichen Freundin und Kollegin an der Yale Law School, deren Interesse an Gender, Föderalismus, Migration und Menschenrechten mein Denken im letzten Jahrzehnt inspiriert hat. Robert Post, dem derzeitigen Dekan der Yale Law School, danke ich für einen gemeinsam durchgeführten Kurs über »Menschenrechte und Souveränität«, in dessen Verlauf viele der hier diskutierten Themen erst schärfer in den Blickpunkt rückten. Im Sommer 2010 unterrichteten Leora Bilsky von der Tel-Aviv Law School und ich zusammen eine Mini-Version des Seminars über Menschenrechte und Souveränität am Zvi Meitar Center for Advanced Legal Studies, wo wir diese Themen in den Zusammenhang des Holocaust und der jüdischen Geschichte im 20. Jahrhundert stellten. Die Interaktion zwischen normativer Theorie und juristischem Denken, die diese drei Wissenschaftler in ihrer Arbeit verkörpern, hat viele Aufsätze inspiriert, die hier versammelt sind.
Meine Studenten Anna Jurkevics, Peter Verovsek und Axel Wodrich waren mir bibliographisch und mit ihren Kommentierungen eine große Hilfe. Besonders Anna Jurkevics hat bei den verschiedenen Fassungen der vorliegenden Aufsätze unermüdlich und sorgfältig Hilfe geleistet.
Turkuler Isiksel, die im Herbst 2010 ihre ausgezeichnete Dissertation Europe’s Functional Constitution: A Theory of Constitutionalism Beyond the State[3] abschloss, hat mich viele Jahre lang mit ihren Überlegungen und Texten zur Europäischen Union inspiriert.
17Meinem Mann, Jim Sleeper, schulde ich nicht nur Vorschläge für den Titel dieses Buchs, sondern auch Dank für editorische und logistische Assistenz über Kontinente hinweg. Dass meine Tochter Laura Schaefer das Eintreten für die Menschenrechte zu ihrem Lebensziel gemacht hat, ist für mich ebensosehr Ermutigung wie ein Grund, stolz zu sein.
Die englische Fassung dieses Buchs ist der Erinnerung an zwei Lehrer gewidmet, die ich in den Jahren 2009 und 2010 verloren habe. John E. Smith, Clarke Professor of Moral Philosophy an der Universität Yale, war mein Doktorvater und nach 1972 eine moralische Instanz für mich. Von ihm lernte ich das Gespräch zwischen der deutschen Philosophie und dem amerikanischen Pragmatismus aufzunehmen und auszubauen.
David E. Apter, Heinz Professor of Political Science and Sociology an der Universität Yale, war mein kosmopolitischer Mentor, dessen Verpflichtung auf sozialen Wandel und anspruchsvolle Theorie in den Sozialwissenschaften mir in all den Jahren ein leuchtendes Beispiel setzte. Beim Schreiben dieser Sätze ist mir schmerzlich bewusst, wie sehr ich John und David vermisse.
Seyla Benhabib
Alford, Massachusetts, und New York City im Dezember 2010
191 Einleitung: Kosmopolitismus ohne Illusionen
1. Kosmopoliten und tote Seelen
Im Frühjahr 2004 veröffentlichte der weitblickende, wenn auch oft Irritationen auslösende Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington den Text »Dead Souls. The Denationalization of the American Elite«.[1] Huntington, der erst ein Jahrzehnt zuvor die berühmte Wendung vom »Kampf der Kulturen« geprägt hatte, gelang es auch in diesem neuen Text von 2004, seiner Argumentation ein unvergessliches Bild anzuheften. Er zitiert aus Walter Scotts Das Lied des letzten Minstrels: »Lebt wohl ein Mensch, so todt an Geist,/Der voll Entzücken niemals preist,/Daß ihn gebar sein Vaterland!/Deß Herz nie heftig in ihm brannte,/Wenn er die Schritte heimwärts wandte/Vom Wandern an dem fernen Strand!«[2]
Huntington konstatiert, dass die Zahl der »toten Seelen«, solcher, die »tot an Geist« sind, »unter Amerikas geschäftlichen, fachlich qualifizierten, intellektuellen und akademischen Eliten« zunimmt. Einige von diesen Eliten sind Universalisten, die den amerikanischen Nationalismus und Exzeptionalismus ins Extrem treiben und die Demokratie auf der ganzen Welt verbreiten wollen, weil Amerika die »universelle Nation« sei.[3] Andere sind ökonomische Eliten, die in der Globalisierung eine transzendierende Kraft sehen, welche nationale Grenzen niederreißt und eine neue civitas maxima in Gestalt des globalen Marktes erstehen lässt. Eine dritte Gruppe toter Seelen sind aus Huntingtons Sicht die Moralisten, die den Patriotismus und Nationalismus lächerlich machen und argumentieren, dass »internationales Recht, internationale Institutionen, Regierungsformen und Normen denen einzelner Nationen moralisch überlegen sind«.[4] Im Gegensatz dazu sei der Nationalis20mus für die Mehrheit der gewöhnlichen Bürger der meisten Staaten eine starke Kraft, behauptet er, die noch immer ein Feuer in ihren Herzen entzündet und sie freudig heimkehren lässt »vom Wandern an dem fernen Strand«.
Sind Kosmopoliten also tote Seelen? Ist der Kosmopolitismus die bevorzugte Einstellung der Eliten, die als Weltenbummler und Weltverliebte den Sorgen gewöhnlicher Bürger enthoben sind? Ich behaupte, dass der »Kosmopolitismus« keine solche privilegierte Einstellung bezeichnet, sondern vielmehr ein Feld unaufgelöster Gegensätze: zwischen partikularistischen Bindungen und universalistischen Bestrebungen, zwischen der Vielfalt menschlicher Gesetze und dem Ideal einer rationalen Ordnung, die allen Städten der Menschen gemeinsam ist, und zwischen dem Glauben an die Einheit der Menschheit und den gesunden Agonismen und Antagonismen, die aus der menschlichen Verschiedenheit herrühren. Kosmopoliten werden nur dann zu toten Seelen, wenn sie diese Spannungen und Gegensätze vergessen und sich stattdessen zu übertriebenem Optimismus und unaufhörlicher Beteuerung der globalen Einheit und Einigkeit hinreißen lassen. David J. Depew trifft den Nagel auf den Kopf: Der »Kosmopolitismus, als ein positives Ideal gedacht, sei dieses nun formal oder materiell, erzeugt Antinomien, die seine innere Kohärenz untergraben […] Wird er jedoch als ein kritisches Ideal gedacht, verschwinden diese Schwierigkeiten weitgehend. Die daraus hervorgehende Konzeption von Kosmopolitismus [ist] ein negatives Ideal, das auf die Blockierung einer falschen Totalisierung abzielt.«[5]
Ich folge in den hier versammelten Texten dieser Konzeption des Kosmopolitismus als einem kritischen und in manchen Hinsichten »negativen Ideal, das auf die Blockierung einer falschen Totalisierung abzielt«, und untersuche die Spannungen im Inneren des Projekts. Dabei konzentriere ich mich auf die Einheit und Vielfalt der Menschenrechte, auf die Konflikte zwischen Demokratie und Kosmopolitismus, auf die Vision einer Welt mit durchlässigen Grenzen und auf die Geschlossenheit, die für demokratische Souveränität erforderlich ist. Dass ich für die Durchführung eines solchen Projekts den Begriff »Kosmopolitismus« wähle, mag manchen überraschen, denn bis vor kurzem spielte er eigentlich nur in der 21ideengeschichtlichen Erforschung des 18. Jahrhunderts eine Rolle. Spätestens im 19. Jahrhundert rangen die Historiker bereits mit dem Erstarken des Nationalismus. Der Kosmopolitismus schien lange ein verstaubtes Konzept aus der Zeit einer mittlerweile unglaubwürdig gewordenen europäischen und nordamerikanischen Aufklärung zu sein.[6]
In den letzten zwei Jahrzehnten hat es jedoch ein bemerkenswertes Wiederaufleben des Interesses am Kosmopolitismus gegeben, und zwar über eine große Vielfalt an Disziplinen, vom Recht bis zu den Kulturwissenschaften, von der Philosophie bis zur internationalen Politik und sogar in der Stadtplanung und der Urbanisierungsforschung.[7] Der wichtigste Grund für diesen Ein22stellungswechsel ist zweifellos das Zusammentreffen epochemachender Transformationen, die von vielen als »Globalisierung« und als Ende des »westfälisch-keynesianisch-fordistischen« Paradigmas bezeichnet werden,[8] von einigen auch als Ausbreitung des neoliberalen Kapitalismus und von noch anderen als Aufstieg des Multikulturalismus und das Ende der Vormachtstellung des »Westens« aufgefasst werden. Der Kosmopolitismus wurde zum Platzhalter für ein Denken, das sich über die verwirrende Gegenwart hinaus auf eine mögliche und machbare Zukunft richtet. Pheng Cheah charakterisiert diese Gegenwart mit den folgenden Worten:
Was an dem Wiederaufleben des Kosmopolitismus, der in den 1990er Jahren einsetzte, eindeutig neu ist, ist der Versuch, die normative Kritik am Nationalismus auf Analysen der zeitgenössischen Globalisierung und deren Folgen zu stützen. Studien zu unterschiedlichen globalen Phänomenen, etwa zu transkulturellen Begegnungen, Massenmigration und Bevölkerungstransfers zwischen Ost und West, Erster und Dritter Welt, Norden und Süden, zur Entstehung globaler Netzwerke für Handel und Finanzen, der Bildung transnationaler Unterstützer-Netzwerke, der Vervielfachung transnationaler Menschenrechtsinstrumente, wurden daher genutzt, um das allgemeine Argument zu erhärten, dass sowohl vergangene als auch gegenwärtige Globalisierungsprozesse objektiv verschiedene Formen des normativen, nichtethnozentrischen Kosmopolitismus verkörpern, weil sie die Grenzen eines regionalen und nationalen Bewusstseins und lokaler ethnischer Identitäten neu bestimmen, radikal verändern und sogar sprengen.[9]
In Anbetracht der genannte Entwicklungen wird der Begriff »Kosmopolitismus« dann, wenn er eine positive Normativität andeutet, verführerisch und zutiefst problematisch zugleich.[10] Es mag den Anschein haben, als reiche allein schon das Beschwören von Kräften aus, welche »die Grenzen des regionalen und nationalen Bewusstseins und lokaler ethnischer Identitäten sprengen« (Cheah), 23um diese auf ein kosmopolitisches Ideal hin zu transzendieren, dessen eigener Gehalt unbestimmt ist. Das ist zweifellos nicht so.
Dennoch möchte ich argumentieren, dass das Projekt des Kosmopolitismus, so irreführend es in manchen seiner Formulierungen auch sein mag, vor seinen nationalistisch-kommunitaristischen Kritikern auf der Rechten und seinen zynischen Verächtern auf der Linken[11] nicht minder gerettet werden muss als vor seinen postmodernen und dekonstruktivistischen Skeptikern. Hin- und hergerissen zwischen der Nostalgie für Gemeinschaften, die nicht durch Verschiedenheit zersplittert sind, und dem Zynismus, der den Kosmopolitismus auf den Griff nach der imperialen Herrschaft reduziert, entgeht dem heutigen Denken in weiten Teilen, was an der Entwicklung eines kosmopolitischen Menschenrechtsdiskurses neu ist.[12]
Um die Tiefe und Hartnäckigkeit dieser kontrastierenden Haltungen abschätzen zu können, wird es wichtig sein, einige Themen, die geschichtlich mit dem Kosmopolitismus in Verbindung standen, kurz zu untersuchen.
2. Eine kurze Geschichte
Der Begriff »Kosmopolit« setzt sich aus kosmos (Welt) und polites (der zur Stadt Gehörende) zusammen. Und die Spannung zwischen diesen Perspektiven ist bedeutsam.[13] Montaigne erinnert daran, dass Sokrates gefragt wurde,
24was seine Heimat sei. Er antwortete nicht: »Athen«, sondern: »Die Welt«. Er, dessen Geist reicher und ausgreifender war als der aller andern, umfing das Universum wie seine Vaterstadt, und seine Erkenntnisse, sein Wohlwollen und sein Gemeinsinn galten dem ganzen Menschengeschlecht – im Unterschied zu uns, die wir nur auf unsre Füße blicken.[14]
Ob Sokrates so etwas gesagt hat oder nicht, ist strittig, aber die Geschichte wird von Cicero in Tusculum Disputationes, von Epiktet in seinen Diatriben und von Plutarch in De Exilio wiederholt, wo er lobend sagt, »und noch besser hat es Sokrates ausgedrückt mit den Worten, er sei weder Athener noch Hellene, sondern ein Weltbürger«.[15]
Was bedeutet es, ein kosmopolites oder Weltbürger zu sein? Um außerhalb der Stadtmauer zu leben, heißt es bei Aristoteles, müsse man entweder ein wildes Tier oder ein Gott sein, da aber Menschen keines von beidem seien und da der kosmos nicht die polis sei, sei der kosmopolites überhaupt kein richtiger Bürger, sondern irgendein anderes Wesen.
Diese Schlussfolgerung war nicht sonderlich beunruhigend für Kyniker wie Diogenes Laertius, denn er behauptete, dass dem Kosmopoliten, anstatt in der Stadt beheimatet zu sein, alleStädtegleichgültig sind. Der kosmopolites sei ein Nomade ohne Zuhause, im Einklang mit der Natur und dem Universum, aber nicht mit der Stadt der Menschen, von deren Verrücktheiten er sich distanziere. Einige negative Konnotationen des Begriffs, mit denen wir in der modernen Geschichte vertraut sind, wie etwa der »heimatlose Kosmopolitismus«, auf den auch Huntington anspielt, haben ihre Wurzel in dieser frühen Phase der Geschichte des Kosmopolitismus, in der die Ablehnung und Verachtung der antiken Kyniker für die von Stadt zu Stadt verschiedenen Praktiken der Menschen ihren Ursprung hat.
Die negative Sicht des Kosmopolitismus als eine Form von Nomadentum ohne Bindungen an eine bestimmte Stadt, wie sie durch die Kyniker vertreten wird, wandelte sich bei den Stoikern. Die Stoiker lenkten die Aufmerksamkeit auf die absurde und unzuvereinbarende Pluralität der menschlichen nomoi – der Geset25ze ihrer einzelnen Städte – und argumentierten, dass das, was die Menschen miteinander gemein haben, nicht in erster Linie ihre nomoi sind, sondern der logos, kraft dessen sie vernunftfähig sind. Mark Aurel schreibt in seinen Meditationen:
Wenn uns das Denkvermögen gemeinsam ist, dann ist uns auch die Vernunft, durch die wir vernünftig sind, gemeinsam. Wenn dies zutrifft, dann ist auch die Vernunft, die bestimmt, was zu tun ist oder nicht, uns allen gemeinsam. Trifft dies zu, so ist auch das Gesetz uns allen gemeinsam. Wenn dies richtig ist, dann sind wir alle Bürger. In diesem Falle haben wir teil an einer Art von Staatswesen. Wenn dies zutrifft, dann ist der Kosmos gewissermaßen ein Staat.[16]
In den Jahrhunderten danach vermengte sich die Idee einer Ordnung, die über Unterschiede zwischen den Gesetzen verschiedener Städte hinausgeht und stattdessen in der rational verstehbaren Struktur der Natur wurzelt, mit der christlichen Lehre universeller Gleichheit.[17] Die stoische Lehre vom Naturrecht inspirierte das christliche Ideal des Gottesstaates im Gegensatz zur Stadt der Menschen und fand schließlich ihren Weg in die modernen Naturrechtstheorien von Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau und Immanuel Kant.
Die negativen und positiven Seiten des kosmopolites, denen wir zuerst im Denken der griechischen und römischen Antike begegnen, begleiten den Begriff durch die Jahrhunderte: Ein kosmopolites ist einer, der sich entweder in Gedanken oder in der Praxis von den Bräuchen und Gesetzen seiner Stadt distanziert und sie vom Standpunkt einer höheren Ordnung aus beurteilt, von der man oft meint, sie sei mit der Vernunft, mit der Natur oder irgendeiner anderen transzendenten Quelle der Geltung identisch. Und weil der Kosmopolit eine Perspektive einnimmt, welche die Stadt und die üblichen menschlichen Bindungen an sie transzendiert, war er oder sie denen, die ihre Städte lieben, verdächtig oder ein Ärgernis.
Das änderte sich, als Kant am Ende des 18. Jahrhunderts die stoische Bedeutung des Kosmopolitismus wiederbelebte, indem er 26dem Begriff eine neue Wendung gab, der ihn ins Zentrum des Aufklärungsprojekts stellte. Zudem wandelte sich der Ausdruck »Kosmopolit« mit Kant von einer Ablehnung der Staatsbürgerschaft zu dem Begriff einer »Weltstaatsbürgerschaft« und wurde mit einer neuen Konzeption der Menschenrechte als kosmopolitischen Rechten verknüpft. Um zu verstehen, warum sich der Kosmopolitismus sogar unter den derzeitigen Weltverhältnissen als eine positive, aber potentiell falsche Normativität anbietet – oder in meiner bevorzugten Terminologie »als ein negatives Ideal, das auf die Blockierung einer falschen Totalisierung abzielt« –, müssen wir also kurz auf Kant eingehen, aber auch über Kant hinausgehen. Lassen Sie mich diese doppelte Bewegung, zurück zu Kant, aber auch wieder weg von ihm, erklären.
Kants Vision von Kosmopolitismus ist trotz ihrer zweideutigen Verbindungen mit der imperialistischen Expansion des Westens wertvoll wegen des von ihr geschaffenen Raums, in dem internationales Recht jenseits des Staates als eine juristische Ordnung konzeptualisierbar wird, die nichtstaatliche Akteure ebenso umfassen kann wie Individuen. Kants begriffliche Initiative gipfelte später in den internationalen Menschenrechtsgesetzen, wie sie insbesondere nach 1948 entwickelt wurden. Diese Neuerungen bewirken zwar keine Lösung oder Auflösung der normativen Zweideutigkeiten des Kosmopolitismus, ermöglichen aber die Entstehung eines Raums der »Jurisgenerativität«, in dem die Einheit und Vielfalt der Menschenrechte über Grenzen hinweg durchdacht werden kann.
3. Kants Neubestimmung des Kosmopolitismus
In seinem berühmten Aufsatz »Zum ewigen Frieden« aus dem Jahr 1795 formulierte Kant drei »Definitivartikel«. Sie lauten: »Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein.« – »Das Völkerrecht soll auf einen Föderalismus freier Staaten gegründet sein.« – »Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein.«[18] Kant selbst bezeichnet 27also den dritten Artikel des ewigen Friedens mit dem Ausdruck »Weltbürgerrecht«. Wie ich an anderer Stelle bereits dargelegt habe, ist er sich zudem über die Kuriosität des Ausdrucks »Hospitalität« im Klaren; deshalb fügt er an, es sei dabei »nicht von Philanthropie, sondern vom Recht die Rede.«[19] Mit anderen Worten, unter der Hospitalität ist keine Tugend des Umgangs zu verstehen, wie die Freundlichkeit und Großzügigkeit, die man vielleicht Fremden erweisen mag, die ins Land kommen und durch Umstände gleich welcher Art auf die Freundlichkeit anderer angewiesen sind. Hospitalität ist vielmehr ein Recht, das allen Menschen zukommt, insoweit wir diese als potentielle Teilnehmer einer Weltrepublik betrachten. Wie Kant schreibt, bedeutet
Hospitalität (Wirtbarkeit) das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines andern wegen von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Dieser kann ihn abweisen, wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann; solange er aber auf seinem Platz sich friedlich verhält, ihm nicht feindlich begegnen. Es ist kein Gastrecht, worauf dieser Anspruch machen kann (wozu ein besonderer wohltätiger Vertrag erfordert werden würde, ihn auf eine gewisse Zeit zum Hausgenossen zu machen), sondern ein Besuchsrecht, welches allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde, auf der als Kugelfläche sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander dulden müssen, […].
Kants Forderung, dass erstens denen, die Einlass suchen, der Einlass nicht verwehrt werden darf, wenn dies zu ihrem Untergang führen würde, ist in das Genfer Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 als das Verbot der Zurückweisung (Art. 33) eingegangen. Dieses Prinzip verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, die Flüchtlinge und Asylsuchenden nicht zwangsweise in ihre Herkunftsländer zurückzuschicken, falls daraus eine klare Gefahr für ihr Leben und ihre Freiheit erwachsen würde. Natürlich ist es genau diese Bedingung, bei der der Hebel angesetzt werden kann, um das Zurückweisungsverbot zu umgehen. Denn dadurch, dass souveräne Staaten diesen Artikel manipulieren, indem sie Leben und Freiheit mehr oder wenig eng definieren, sehen sie sich dazu 28berechtigt, Flüchtlinge und Asylsuchende in sogenannten »sicheren Drittstaaten« unterzubringen. Viele europäische Länder verlegten sich in den 1990er Jahren, während der vom Jugoslawienkrieg ausgelösten Flüchtlingskrise, auf diese Praxis (siehe dazu Kapitel 6 in diesem Band).
In Kants Formulierungen bleibt ebenso wie in der späteren staatlichen Praxis ein Element der unkontrollierten souveränen Macht. Wie Jacques Derrida argumentiert hat, geht mit der Hospitalität immer ein Moment gefährlicher Unbestimmtheit einher. Weiß der Wirt, ob die Absichten des Gastes wirklich nicht feindselig sind? Wie kann man diese Absichten über große Kommunikationshindernisse hinweg beweisen? Beginnt die Hospitalität nicht oft mit einem gegenseitigen Misstrauen, das zerstreut werden muss? Und ist es nicht diese Unbestimmtheit, die auch die sprachliche Nähe der (lateinischen) Begriffe hostis und hospes – Feind und Fremder/Gast/Gastgeber – erklärt? Diese Unbestimmtheit veranlasste Derrida, den Ausdruck »hostipitality« zu prägen,[20] um jenen gefährlichen Moment einzufangen, in dem das kosmopolitische Projekt in der Feindseligkeit stecken bleiben kann, anstatt zu Hospitalität zu werden.
Kants Vermächtnis ist zweideutig: Auf der einen Seite wollte er die Expansion des Handel- und Seehandel treibenden Kapitalismus’ seiner Zeit rechtfertigen, insoweit diese Entwicklungen die Mitglieder der menschlichen Gattung in näheren Kontakt zueinander brachten; auf der anderen Seite sprach er sich nicht für den europäischen Imperialismus aus oder ermutigte ihn. Das kosmopolitische Recht der Hospitalität gibt einem das Recht eines friedfertigen zeitweiligen Aufenthaltes, es berechtigt aber nicht, wie Kants Kommentare zu den europäischen Versuchen, sich überall in Japan und China auszubreiten, deutlich machen,[21] diejenigen Völker und 29Nationen, bei denen man sich aufhalten will, zu erobern und zu überwältigen, auszuplündern und auszubeuten.
Wir verdanken Kant die folgenden Bestimmungen: Staatsbürgerrecht, das die Rechtsbeziehungen zwischen den Personen in einem Staat betrifft – im zweifachen deutschen Sinne von Recht und Rechten als den rechtlichen Ansprüchen von Personen; Völkerrecht, das die Rechtsverhältnisse zwischen den Staaten regelt; und »das Recht für alle Nationen« oder »Weltbürgerrecht« – ius cosmopoliticum –, das die Rechtsverhältnisse zwischen Personen betrifft, die nicht als Bürger festgelegter menschlicher Gemeinschaften gesehen werden, sondern als Mitglieder einer Zivilgesellschaft von Weltbürgern.[22] Mit der Behauptung, dass nicht nur Staaten und Staats30oberhäupter auf internationalem Gebiet bedeutsame Akteure sind, sondern auch Zivilisten und ihre verschiedenen Vereinigungen, die ihrerseits Gegenstand einer neuen Rechtssphäre sein könnten, gab Kant dem Ausdruck kosmopolites eine neue Bedeutung als Bezeichnung für den Weltbürger. Die Weltstaatsbürgerschaft beinhaltet eine utopische Vorwegnahme des Weltfriedens, der infolge der vermehrten Kommunikation zwischen den Menschen erreicht werden soll, unter anderem auch durch le doux commerce. Dadurch, dass die Menschen mehr Kontakt miteinander haben, auch über Ländergrenzen hinweg, kommt es dahin, »daß die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird«.[23] Die kosmopolitische Staatsbürgerschaft bedeutet vor allem die Schaffung einer neuen Weltrechtsordnung und einer Öffentlichkeit, in der die Menschen allein auf Grund ihres Menschseins Anspruch auf Rechte hätten.[24]
314. Das kosmopolitische Vermächtnis und die Menschenrechte
Der kantianische Kosmopolitismus ist nicht nur durch die dekonstruktivistische Kritik von Philosophen wie Derrida und Cheah unter Druck geraten, sondern auch durch Liberale in der Tradition von John Rawls, wobei Rawls selbst in Das Recht der Völker gewissermaßen den ersten Stein warf.[25] Diese Kritik wird in den folgenden Kapiteln (insbesondere in Kapitel 3 und 4) im Mittelpunkt meiner Diskussion stehen.
Rawls hat zur Genüge deutlich gemacht, welche Gründe er hatte, für das Nachdenken über internationale Gerechtigkeit eine staatszentrierte anstelle einer kosmopolitischen Perspektive zu wählen:
Wie willkürlich die Grenzen einer Gesellschaft von einem historischen Standpunkt aus gesehen auch sein mögen, es ist gleichwohl eine wichtige Aufgabe der Regierung eines Volkes, dieses zu vertreten und an seiner Stelle wirksam zu handeln, wenn es darum geht, Verantwortung für das eigene Territorium und dessen ökologische Unversehrtheit und für die Größe der eigenen Bevölkerung zu übernehmen.[26]
In der Fußnote zu dieser Passage fügt Rawls an, »dass ein Volk zumindest ein qualifiziertes Recht hat, die Einwanderung zu begrenzen. Auf die erforderlichen Qualifikationen gehe ich hier nicht weiter ein.«[27] Für die Entwicklung seiner Konzeption von nationaler und internationaler Gerechtigkeit wählt Rawls abgegrenzte politische Gemeinschaften als relevante Einheiten und weicht damit erheblich von Kant und dessen Lehre von kosmopolitischem Recht ab. Bestand Kants großer Fortschritt darin, einen Bereich von Beziehungen der Gerechtigkeit artikuliert zu haben, der für alle Individuen als moralische Personen in der internationalen Arena verbindlich sein könnte, so ist dies in Das Recht der Völker anders: Die Hauptakteure der Gerechtigkeit sind nicht die Individuen; diese sind vielmehr in Einheiten verpackt, die Rawls »Völker« nennt. Für Kant bildete die These, dass alle moralischen Personen Mitglieder 32einer Weltgesellschaft seien, in der sie potentiell miteinander interagieren könnten, den eigentlichen Kern des ius cosmopoliticum. Rawls hingegen sieht die Individuen als Mitglieder von Völkern und nicht als kosmopolitische Bürger. Von daher formulierte er die Prinzipien internationaler Gerechtigkeit eben nicht für Individuen, sondern für Völker und deren Repräsentanten; diese seien als Einheiten des gleichen moralischen Respekts und moralischer Rücksichtnahme in einer Weltgesellschaft zu betrachten.[28] Rawls hat aber nicht nur die kosmopolitische Alternative verworfen, sondern auch die Liste der Menschenrechte, die aus der Perspektive eines Rechts der Völker annehmbar wäre, auf einen Bruchteil dessen eingeschränkt, was die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aufzählt. Ich werde auf diese Diskrepanz zwischen den neueren philosophischen Diskussionen der Menschenrechte – deren Rechtfertigung und Umfang – und den international anerkannten Menschenrechtsdokumenten im Verlauf dieses Buches mehrfach zurückkommen (siehe Kapitel 2, 3 und 5).
Was den Platz der Menschenrechte in der Moralphilosophie und der politischen Philosophie angeht, gibt es eine verwirrende Vielfalt zeitgenössischer Positionen. Einige argumentieren, die Menschenrechte stellten den »Kern einer universellen dünnen Moral« dar (Michael Walzer), während andere behaupten, sie bildeten die »vernünftigen Bedingungen eines weltpolitischen Konsenses« (Martha Nussbaum). Wieder andere verengen das Konzept der Menschenrechte »auf einen Mindeststandard wohlgeordneter politischer Institutionen für alle Völker« (Rawls)[29] und mahnen an, es müsse ein Unterschied gemacht werden zwischen der Liste von Menschenrechten, die im Völkerrecht enthalten sei (und somit 33vom Standpunkt einer globalen öffentlichen Vernunft zu verteidigen ist), und den in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 aufgeführten Menschenrechten.
In »Ein anderer Universalismus« (Kapitel 2) argumentiere ich, dass es notwendig ist, sowohl in Bezug auf die Strategie derRechtfertigung von Menschenrechten als auch auf deren Inhalt vom Minimalismus Abschied zu nehmen und zu einem robusteren Menschenrechtsverständnis unter dem Aspekt des »Rechts, Rechte zu haben«, überzugehen. Den Ausdruck »das Recht, Rechte zu haben«, verdanke ich Hannah Arendt, wobei ich allerdings der Ansicht bin, dass dieses Recht in ihrem Werk prinzipiell als ein politisches Recht gesehen wird und sehr eng gefasst mit dem »Recht auf Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft« gleichgesetzt wird. Ich denke hingegen, dass das »Recht, Rechte zu haben«, viel breiter verstanden werden muss, nämlich als der Anspruch einer jeden menschlichen Person, von der Weltgemeinschaft als juristische Person anerkannt und geschützt zu werden. Diese Neukonzeption des »Rechts, Rechte zu haben«, in nicht staatszentrierten Begriffen ist entscheidend für die Phase seit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, in der wir uns von strikt internationalen Normen wegbewegt und dichteren kosmopolitischen Normen der Gerechtigkeit angenähert haben.
Für mich beinhaltet der Kosmopolitismus die Anerkennung, dass Menschen moralische Personen sind, die in gleicher Weise Anspruch auf rechtlichen Schutz haben, und zwar auf Grund von Rechten, die ihnen nicht als Staatsangehörige oder Mitglieder einer ethnischen Gruppe zukommen, sondern als Menschen als solche. Doch wie kann ein derart starker Anspruch rechtfertigt werden? Welche zwingenden Gründe können wir angeben, um eine solche moralische Anerkennung zu verteidigen? Und können die Gründe, die wir anführen, in einer Welt, in der zahlreiche Religionen, Kulturen und Weltanschauungen aufeinanderprallen, sich mischen, verdrängen und miteinander konkurrieren, Teil eines überlappenden Konsenses über die öffentlichen Vernunft sein? Ist nicht vielmehr ein Minimalismus der Rechtfertigung für die Menschenrechte als alternative Strategie wünschenswert und auch geboten?[30]34Joshua Cohen hat diesbezüglich die Unterscheidung zwischen »substanziellem« und »rechtfertigendem Minimalismus« entwickelt, die ich in Kapitel 4 unter die Lupe nehmen werde. Der substanzielle Materialismus betrifft die Inhalte der Menschenrechte und handelt von »den Normen globaler Gerechtigkeit im weitesten Sinne«. Beim »rechtfertigenden Minimalismus« hingegen geht es darum, wie »eine Konzeption der Menschenrechte als wesentliches Element einer Konzeption globaler Gerechtigkeit für eine ethisch pluralistische Welt – als ein Grundzug von […] globaler öffentlicher Vernunft« zu begründen ist.[31]
Ich vertrete den Standpunkt, dass weder ein substanzieller noch ein rechtfertigender Minimalismus überzeugend ist: Dem substanziellen Minimalismus, also dem mit Blick auf den Inhalt der Menschenrechte, gelingt es nicht, die politisch-institutionellen Entwicklungen im internationalen Menschenrechtsschutz des letzten halben Jahrhunderts ernst zu nehmen. In manchen dieser Debatten gibt es eine soziologische Realitätsferne, die aus der Nichtwahrnehmung von Veränderungen herrührt, welche durch die verschiedenen Menschenrechtserklärungen und -verträge seit 1948 in Gang gesetzt wurden. Der Minimalismus mit Blick auf die Rechtfertigung ist für viele Denker nicht nur deshalb attraktiv, weil er eine plausible Vision von Menschenrechten in einer ethisch pluralistischen Welt zu bieten scheint, sondern auch deshalb, weil das stärker kosmopolitische Projekt, das eine Alternative dazu wäre, aus ihrer Sicht hoffnungslos in einem philosophischen Universalismus versinkt, der sich nicht verteidigen lässt. Ich werde in Kapitel 2, »Ein anderer Universalismus«, noch näher auf die Varianten des Universalismus eingehen und hier zunächst zwischen dem essentialistischen, dem rechtfertigenden, dem moralischen und dem juristischen Universalismus unterscheiden.
Ein essentialistischer Universalismus ist die Überzeugung, dass es eine grundlegende menschliche Natur oder menschliche Wesensnatur gibt, die definiert, wer wir als Menschen sind. Manche sagen, so wie es die meisten Philosophen des 18. Jahrhunderts geglaubt haben, dass die menschliche Natur aus gleichbleibenden und vorhersagbaren Leidenschaften und Dispositionen, Instinkten und Emotionen besteht, die alle rational erforscht und analysiert 35werden können. Andere lehnen die empirische Psychologie, philosophische Anthropologie und rationale Ethik ab und behaupten, universell an der menschlichen Verfasstheit sei, dass wir in einem Universum, dem sinngebende Standards und Werte fehlen, dazu verurteilt sind, selbst zu wählen und Sinn zu stiften durch unser Handeln.
In den heutigen philosophischen Debatten wird der Universalismus in erster Linie als eine Strategie der Rechtfertigung verstanden. Hermeneutiker, starke Kontextualisten, postmoderne Skeptiker und Macht-/Wissenstheoretiker (zum Beispiel Michel Foucault, Jean-François Lyotard und der frühe Jacques Derrida) stellen ausnahmslos in Frage, dass es eine unparteiliche, objektive und neutrale philosophische Vernunft geben kann. Diesen kontextualistischen Kritikern stehen rechtfertigungsbezogene Universalisten gegenüber, von denen die meisten rein gar nichts mit dem Essentialismus am Hut haben. Zwar werden von einigen ein paar elementare Grundannahmen über die menschliche Natur und Psychologie anerkannt, aber gemeinsam sind ihnen vor allem starke Überzeugungen mit Blick auf den normativen Gehalt der menschlichen Vernunft; demnach gibt es gültige Verfahren der Untersuchung, Nachweisführung und Infragestellung, die spätestens seit der Aufklärung zum kognitiven Vermächtnis der westlichen Philosophie gehören (Karl-Otto Apel, Jürgen Habermas, John Rawls, Hilary Putnam und Robert Brandom sind neben vielen anderen in diesem Sinne Rechtfertigungsuniversalisten).
Noch andere argumentieren, der Universalismus sei gar nicht primär ein Begriff kognitiver Untersuchung, denn er habe eine moralische Bedeutung, die mindestens genauso wichtig sei. Von daher wird er oft als der Grundsatz definiert, nach dem alle Menschen – ungeachtet ihrer Rasse, Geschlechtszugehörigkeit, sexuellen Orientierung, körperlichen oder physischen Leistungsfähigkeit und ihres ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Hintergrunds – einen Anspruch auf gleichen moralischen Respekt haben.
Der Universalismus lässt sich schließlich auch in juristischen Begriffen verstehen. Viele, die hinsichtlich definitiver Darstellungen der menschlichen Natur und Rationalität skeptisch sind, möchten dennoch darauf bestehen, dass die folgenden Normen und Prinzipien von allen Rechtssystemen und politischen Systemen, die Legitimität für sich beanspruchen, respektiert werden sollten: Alle 36Menschen haben Anspruch auf bestimmte grundlegende Menschenrechte, darunter auf jeden Fall das Recht auf Leben, Freiheit, Sicherheit und körperliche Unversehrtheit, dazu das Recht auf irgendeine Form von Eigentum und persönlichen Besitz, auf ein ordentliches Gerichtsverfahren und auf Rede- und Vereinigungsfreiheit sowie Religions- und Bekenntnisfreiheit (siehe dazu Kapitel 5).
Ich werde hier die Auffassung vertreten, dass jedwede politische Rechtfertigung der Menschenrechte – das heißt der juristische Universalismus – einen rechtfertigenden Universalismus voraussetzt. Die Aufgabe der Rechtfertigung wiederum kann nicht ohne Anerkennung der kommunikativen Freiheit des anderen erledigt werden, das heißt, nicht ohne das Recht des anderen anzuerkennen, nur jene Normen als legitime Handlungsregeln zu akzeptieren, von deren Gültigkeit diese andere Person mit Gründen überzeugt worden ist. Der rechtfertigende Universalismus beruht also auf dem moralischen Universalismus oder, anders gesagt, auf dem gleichen Respekt für den anderen als ein Wesen, das der kommunikativen Freiheit fähig ist. Aber dieses »beruhen auf« ist kein begriffliches Implikationsverhältnis. Der moralische Universalismus bietet über den Schutz der kommunikativen Freiheit der Person hinaus keine spezielle Liste von Menschenrechten an oder diktiert diese; und auch der rechtfertigende Universalismus tut das nicht. Wie ich noch klären werde, folge ich hier nicht einer fundamentalistischen Rechtfertigungsstrategie, sondern befasse mich mit einer Präsuppositionsanalyse.
Diese Verteidigung des rechtfertigenden Universalismus als einer zentralen Säule des kosmopolitischen Projekts wird manchen als zu stark, anderen wiederum als nicht stark genug vorkommen. Im Lichte der Konzepte des »verallgemeinerten« und »konkreten Anderen«, die ich 1992 in meinem Buch Selbst im Kontext entwickelt habe,[32] verteidige ich den rechtfertigenden Universalismus als wesentliche theoretische Voraussetzung für eine Vision der Menschenrechte, die nichtessentialistisch, nichtreduktionistisch und mit dem demokratischen Projekt stark verzahnt ist. Implizieren aber der Rechtfertigungsuniversalismus und die kommunikative Sicht der Person eine endgültige Liste der Menschenrechte bezie37hungsweise zwingen sie uns, eine solche zu akzeptieren? Und wenn es sich so verhält, was für eine Liste wäre das dann? Und wie ist das Verhältnis zwischen einer solchen Darstellung der Menschenrechte und der Vielfalt an Menschenrechten, für die innerhalb eines Spektrums von politischen Regierungsformen, die wir als legitim erachten würden, eine Kodifizierung in unterschiedlichen Rechtsdokumenten erfolgt ist? Das sind die Fragen, die sich wie ein roter Faden durch die nachfolgenden Kapitel ziehen.
5. Moralische Ansprüche und Rechtsansprüche
Moderne Verfassungen integrieren kosmopolitische Ideale in der Form einer Liste von Grundrechten, die entweder wie bei der Verfassung der Vereinigten Staaten als eine Bill of Rights formuliert sind oder wie in der französischen Tradition als eine Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Diesem kosmopolitischen Vermächtnis kann außerdem durch eine Aufzählung der Grundrechte in den Artikeln 1 bis 19 entsprochen werden, wie es in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland – dem Grundgesetz – der Fall ist; die Charter of Fundamental Rights of the European Union, die einen Teil des Lissaboner Vertrags bildet, folgt diesem Modell. Gleichwohl kann es durchaus Spannungen geben zwischen den moralischen und rechtlichen Grundsätzen, die durch diese Grundrechte zum Ausdruck kommen, und anderen Artikeln derselben Verfassung, sowie zwischen der Interpretation dieser Grundrechte durch Organe der Justiz und der Konkretisierung dieser Grundrechte durch demokratische Legislativen in Form von spezifischen Gesetzen. Bei einem Großteil der Verfassungsdebatte geht es um solche rechtshermeneutischen Fragen. Die Interpretation von Grundrechten ist insofern ein politisches Projekt, als solche Interpretationen die Frage berühren, wie ein Volk, das nach bestimmten Prinzipien zu leben wünscht, die verbindlichen Grundsätze, unter denen es sich selbst als ein politisches Gemeinwesen begründet hat, im Licht des sich wandelnden Selbstverständnisses neuartikuliert. Anzunehmen, dass Rechte, die Grundsätze sind, ohne fortlaufende Interpretation und Artikulation selbstgesetzgebender politischer Gemeinwesen konkretisiert werden können, wäre ein schwerer Fehler (siehe dazu Kapitel 6 und 7). Für mein Verständnis 38des kosmopolitischen Projekts ist die Überzeugung entscheidend – und das unterscheidet meinen Ansatz von dem anderer –, dass der Kosmopolitismus keineswegs einen Menschen, der nicht Mitglied eines näher bestimmten Gemeinwesens ist, als Rechtssubjekt postulieren muss. Kosmopolitische Rechte lassen sich nicht ohne die Kontextualisierung und Artikulation durch sich selbst regierende Entitäten verwirklichen.
Hinzu kommt, dass die meisten Staaten heute in einer stark veränderten internationalen Rechtsumwelt operieren, in der sie in wachsendem Maße von vielen zwischenstaatlichen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und postnationalen Neuordnungen der Souveränität, für die die Europäische Union nur ein Beispiel ist, umgeben sind. Kosmopolitische Normen drücken diesen neuen Verhältnissen mittels vielen internationalen Verträgen ebenfalls ihren Stempel auf, was auch im Fall der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte so ist. Der demokratische Wille des Volkes hat sich auch in dieser Hinsicht im Einklang mit den internationalen Abkommen zu binden.
Wie ich in Kapitel 5, »Menschenrechte jenseits nationaler Grenzen?«, feststellen werde, ist nunmehr im Großen und Ganzen akzeptiert, dass die Entwicklung der globalen Zivilgesellschaft seit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte den Weg von internationalen zu kosmopolitischen Normen der Gerechtigkeit nimmt. Die Präambel dieser Erklärung besagt beispielsweise, dass die »Völker der Vereinten Nationen« ihren Glauben »an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau« bekräftigen.[33] Und weiter: dass alle Personen »ohne irgendeine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer und sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen« Anspruch auf würdevolle Behandlung haben, ungeachtet »der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört«.[34]
Solche Dokumente öffentlichen Rechts haben im internationalen Recht zu wesentlichen Veränderungen geführt. Es mag zwar 39überaus utopisch klingen, sie als Schritte zu einer »Weltverfassung« zu bezeichnen, gleichwohl sind sie mit Sicherheit mehr als bloße Verträge zwischen Staaten. Sie sind konstitutive Elemente einer globalen Zivilgesellschaft, in der Individuen nicht nur Rechteinhaber auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit sind, sondern primär auf Grund ihres Menschseins. Obwohl Staaten die mächtigsten Akteure bleiben, wird das Spektrum ihrer legitimen und legalen Aktivitäten zunehmend eingeschränkt.
Die Verbreitung einer kosmopolitischen Rechtsordnung bringt allerdings ihre eigenen Probleme mit sich. So könnte man sich beispielsweise fragen, ob es wirklich sinnvoll ist, eine kosmopolitische Position zu verteidigen, wenn eine Rechte habende Person zu sein vor allem bedeutet, Mitglied eines souveränen politischen Gemeinwesens zu sein, das jemandes »Recht, Rechte zu haben«, schützen kann. Meine Fragen in Kapitel 6, »Dämmerung der Souveränität oder das Aufstreben kosmopolitischer Normen?«, lauten dementsprechend: Ist die postwestfälische Rechtsprechung, auf die wir uns augenscheinlich zubewegen und die auf dem Niedergang des Nationalstaats und der Dämmerung der Souveränität basiert, eine fortschrittliche Entwicklung, wenn man sie vom Standpunkt der Menschenrechte und der Staatsbürgerschaftspraxis betrachtet? Oder erleben wir die Ausbreitung eines neoliberalen Imperiums, dem der Menschenrechtsdiskurs lediglich als Schutzschild oder Trojanisches Pferd dient, um die neoliberale Ökonomisierung und Monetarisierung in alle Winkel der Welt zu tragen? Was ist mit der »kontaminierten Normativität der Menschenrechte im globalen Kapitalismus«, wie es bei Pheng Cheah heißt?[35] Läuft nicht der Kosmopolitismus im Recht auf eine Rechtfertigung des moralischen Interventionismus und moralischen Imperialismus hinaus? Die Zurückhaltung, die sich neuerdings im zeitgenössischen Denken im Hinblick auf die Rechtfertigung von Menschenrechten in universalistischen Begriffen breitmacht, lässt sich gewiss in Teilen auf die Befürchtung zurückführen, dass man sie zu politischen Zwecken instrumentalisieren wird und dass man eine robuste Sprache der Menschenrechte dazu nutzen wird, den moralischen Imperialismus zu rechtfertigen (siehe dazu Kapitel 4, »Ein Menschenrecht auf Demokratie?«).
40Dieses zweideutige Erbe im Zentrum des Kosmopolitismus wirft außerdem die Frage auf, ob der Kosmopolitismus in Wahrheit nicht eine nur spärlich verhüllte Version des Imperialismus von gestern ist, der heute in Gestalt der neoliberalen Globalisierung daherkommt. Ist die Verbreitung der Menschenrechtsnormen tatsächlich eine Errungenschaft der Menschheit, die wir feiern und verteidigen sollten, oder nicht vielmehr ein zynisches Manöver der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, mit dessen Hilfe sie ihre eigenen starren Vorstellungen der menschlichen Person durch eine sogenannte Allgemeine Erklärung der Menschenrechte absichern?[36] Es ist ja bekannt, dass die ersten vehementen Einwände gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom Verband der amerikanischen Anthropologen kamen, der in diesem Dokument die illegitime Universalisierung westlicher Ordnungsvorstellungen für den Rest der Menschheit sah.[37]
41