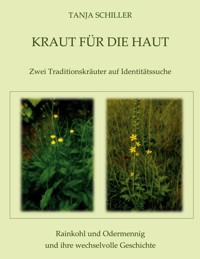
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Rainkohl und Odermennig - Zwei Pflanzen mit wechselvoller Geschichte. Kraut für die Haut ist eine Reise durch ein sprachliches und botanisches Abenteuer, durch alte Kräuterbücher und neue Möglichkeiten. Wie wurden Rainkohl und Odermennig einst genutzt - und wie lässt sich ihr überliefertes Wissen in zeitgemäße Anwendungen übertragen? Ein Buch über zwei Pflanzen und darüber, was verloren geht, wenn wir verlernen, hinzuschauen. Mit Rezepten für die Hautpflege.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
„Von der Lampsana kenne ich nur eine einzige Art.“ (Tournefort, 1700, S. 479)
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Vorwort
Rainkohl – ein widersprüchliches Kraut
Verwechslung – aber keine Gefahr
Lampsana – ein Name, viele Pflanzen
Antike Rätsel und ihre Folgen
Von Dodoens bis zur modernen Unterscheidung
Zwischen Lampsana und Lapsana
Der Rainkohl – eine Pflanze, viele Namen
Systematisierung unter Linné
Kritik an Linné und der Bedeutungsverlust des Rainkohls
Der Rainkohl als zugelassenes Heilmittel
Der Rainkohl als Nahrungsmittel
Unterschätztes Wildgemüse…
… oder eher Notnahrung?
Der Rainkohl als zu bekämpfendes Unkraut
Der Rainkohl und seine Bedeutung für die Tierwelt
Der Rainkohl im Volksglauben
Lasst Blumen sprechen
Zum Schluss ein Hauch von Gelb
Nachwort: Was bleibt vom Rainkohl?
Odermennig – auf der Jagd nach dem „echten“ Eupatorium
Namensgebung
Was dem Rainkohl verwehrt wurde, gelang dem Odermennig
Historische Anwendungen des Odermennigs
… beim Menschen
… und beim Tier
Odermennig-Aroma
… im Bierfass
… und als Tee
Die Sprache der Blumen
Die Lieblingspflanze des Aberglaubens
Nachwort: Was bleibt vom Odermennig?
Kraut für die Haut
Gesichtswasser
Tinktur
Kräuteröl
Salbe
Lippenpflege
Gedanken zum Schluss
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Rainkohl zur Blütezeit
Abb. 2: Kleinköpfiger Pippau
Abb. 3 und 4: Gegenüberstellung Rainkohl und Pippau
Abb. 5 und 6: Zwei Wuchsformen des Rainkohls
Abb. 7: Rainkohl und seine Blüten
Abb. 8: Benennungen des Rainkohls in verschiedenen Sprachen
Abb. 9: Rainkohl im Garten
Abb. 10: Rainkohl (Draufsicht)
Abb. 11: Der Rainkohl-Salat
Abb. 12: Rainkohl (Blätter)
Abb. 13: Rainkohl
Abb. 14: Odermennig auf derWiese
Abb. 15: Odermennig an einem Hang
Abb. 16: Agrimonia als eigene Gattung im Linnéschen System
Abb. 17: Odermennig
Abb. 18: Odermennig mit behaarten Kelchen
Illustration Vorder- und Rückseite: eigene Fotos, KI-bearbeitet (DALL·E, OpenAI, 2025).
Vorwort
Es gibt Pflanzen, die uns überall umgeben – und die doch kaum jemand wahrnimmt. So erging es mir mit dem Rainkohl. Er wächst unauffällig an Wegrändern, in Gärten, an Mauern oder im Wald – fast überall. Und trotzdem scheint er heute kaum noch jemandem ein Begriff zu sein. Dabei wurde er früher erstaunlich vielseitig genutzt: gegen Hautreizungen und Wunden, ja sogar als Gemüse oder Salat. Seine heutige Unsichtbarkeit steht in starkem Kontrast zu seiner bewegten Geschichte – und genau das macht ihn für mich so spannend.
Der Odermennig dagegen war mir von klein auf vertraut. Meine Großmutter hielt große Stücke auf ihn, und er gehörte zur Grundausstattung in ihrer Hausapotheke – äußerlich bei kleinen Blessuren, Entzündungen oder Verspannungen und innerlich bei Magen-Darm-Beschwerden als Tee.
Beide Pflanzen haben mich auf ihre eigene Weise berührt: der Rainkohl, weil er eine Außenseiterrolle innehatte und ich ihn dadurch immer mehr liebgewann, und der Odermennig, weil er sowohl eine gelebte Erinnerung ist, mich aber auch heute noch begleitet.
Wer sich ein Bild von diesen beiden Pflanzen machen will, stößt auf teils abenteuerliche Beschreibungen, wechselnde botanische Merkmale, widersprüchliche Bewertungen ihrer Wirksamkeit und eine Vielzahl an Namen, die teils verwirrend, teils poetisch sind. Doch gerade in dieser Vielfalt liegt der Reiz. Sie zeigt, wie sich das Wissen über Pflanzen wandelt, wie es weitergegeben, vergessen, angezweifelt und auch wiederentdeckt wird.
Kraut für die Haut rückt den Rainkohl und den Odermennig ins Rampenlicht - von der Antike über die Kräuterbücher der Frühen Neuzeit bis hin zur Volksmedizin des 19. Jahrhunderts. Welche Bedeutung hatten Rainkohl und Odermennig in diesen Zeiten? Wie wurden sie beschrieben, genutzt, geschätzt – oder missverstanden? Und was lässt sich daraus heute noch lernen?
Im zweiten Teil des Buches schlage ich die Brücke zur Gegenwart: Ich zeige, wie sich das alte Wissen auf einfache Weise in die moderne Kräuterpflege übertragen lässt, etwa durch selbstgemachte Öle, Salben oder Tinkturen. Denn obwohl Kraut für die Haut den Leser auf eine historische Zeitreise mit-nimmt, soll es auch praktisch anwendbar sein. Und das Schöne daran: Man braucht nicht gleich eine ganze Hausapotheke aus Kräutern. Zwei reichen völlig aus – einfach, praktisch und natürlich.
Der Begriff „Rainkohl“ wird in diesem Buch ausschließlich für den Gemeinen Rainkohl (Lapsana communis) verwendet. Andere Arten oder regionale Varianten werden nur dann berücksichtigt, wenn sie ausdrücklich genannt sind.
Der Begriff „Odermennig“ wird durchgängig für den Gemeinen Odermennig (Agrimonia eupatoria) verwendet, sofern nicht ausdrücklich eine andere Art gemeint ist. In der historischen Literatur wurde der Begriff nicht immer einheitlich verwendet; meist bezog er sich jedoch auf die heute verbreitete, nicht stark duftende Art.
Fremdsprachige Passagen und Bezeichnungen wurden mit Unterstützung durch ChatGPT (OpenAI, 2025) übersetzt.
Bei der Verwendung historischer Texte und Abbildungen habe ich ausschließlich auf Quellen zurückgegriffen, die in den jeweiligen Digitalbibliotheken als gemeinfrei markiert waren. Sollte sich dennoch trotz sorgfältiger Prüfung ein Rechteinhaber in seinen Ansprüchen betroffen sehen, bitte ich um Mitteilung. Es liegt nicht in meiner Absicht, bestehende Schutzrechte zu verletzen.
Dieses Buch ist ohne die Unterstützung eines professionellen Korrektorats oder Lektorats entstanden. Ich bitte um Nachsicht, falls sich trotz gründlicher Durchsicht noch der eine oder andere Schreibfehler eingeschlichen haben sollte.
Die in diesem Buch vorgestellten Rezepte und Anwendungen beruhen auf historischen Quellen und eigenen Erfahrungen. Sie ersetzen keine ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung. Die Anwendung erfolgt in eigener Verantwortung. Für mögliche Schäden oder unerwünschte Wirkungen wird keine Haftung übernommen.
Ich wünsche Ihnen Freude beim Lesen, Staunen beim Blick in die Geschichte und Inspiration, die alten Kräuter ganz neu für sich zu entdecken.
Tanja Schiller
im August 2025
Rainkohl – ein widersprüchliches Kraut
Die Geschichte des Rainkohls ist von Missverständnissen geprägt. Sein Name wurde über Jahrhunderte weitergereicht, oft ohne klare Vorstellung, welche Pflanze damit überhaupt gemeint war. So entstanden neue Bezeichnungen – und mit ihnen falsche Anwendungen.
Während er zum einen als Salat und Gemüse in der Küche oder als Wundkraut in der Hausapotheke genutzt wurde, taucht er in anderen Quellen als „überholt“ oder gar als „zu vertilgendes Unkraut“ auf. Heute spielt er als Heilkraut kaum noch eine Rolle.
In ihm zeigt sich, wie unterschiedlich unser Blick auf eine Pflanze sein kann. Was der eine als wertvoll erachtet, gilt dem anderen als störend. Seine Widersprüchlichkeit lädt dazu ein, genauer hinzuschauen und den oft übersehenen Schatz am Wegesrand neu zu entdecken.
Der Rainkohl ist eine zarte Wildpflanze, die man fast überall dort findet, wo der Boden locker und nährstoffreich ist – an Wegrändern, an Zäunen, zwischen Feldern, auf Schutthaufen und in lichten Wäldern. Er kann über einen Meter hoch werden, ja fast Mannshöhe erreichen. Sein dünner, grüner Stiel ist je nach Standort glatt oder behaart. Die Blätter sind an der Basis der Pflanze größer, gefiedert und lanzettlich-oval. Höher am Stängel sind die Blätter kleiner.
Von Juni bis September erscheinen die zartgelben Blüten: klein und locker verteilt an den verzweigten Spitzen des Stängels.





























