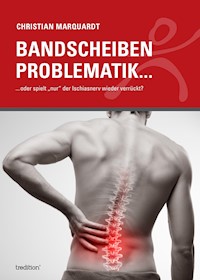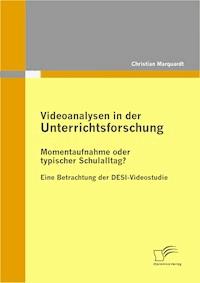25,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Prävention und Rehabilitation mit System Christian Marquardt ist Osteopath, Physiotherapeut, Autor, Referent, Heilpraktiker für Physiotherapie und Geschäftsinhaber des gleichnamigen Gesundheitszentrum. Darüber hinaus ist er offizieller FIFA-Physiotherapeut und somit ein erfahrener Experte bei der Betreuung von Leistungssportlern in Nationalmannschaften oder auch Profis der Fußball Bundesliga. Gerade bei Unfällen während des Trainings oder Wettkampfes, aber auch im Beruf oder Alltag ist ein Kreuzbandriss eine sehr häufige Verletzung mit einer relativ langen Rehabilitationszeit. Dann stellen sich jährlich mehrere Millionen Patienten und Sportler in Deutschland die Fragen: "Ich habe einen Kreuzbandriss …was nun?" "Wann kann ich endlich wieder laufen gehen?" "Wann kann ich wieder Fußball spielen?" Patienten sowie Sportler brauchen Zeit, wieder Vertrauen in die Belastbarkeit zu gewinnen. Schmerzen und Einschränkungen in der Bewegung wirken verunsichernd. Dieses Buch hilft, die Verletzung Kreuzbandriss und ihre Therapien zu verstehen und geeignete Übungen für die sichere Rückkehr in den Alltag und Sport auszuwählen. Ein Begleiter aus der Praxis - für die Praxis. In diesem Buch wird die Rehabilitation detailliert dargestellt: - Zahlreiche Fotos und Beschreibung der Ausgangs- und Endstellung aller Übungen unterstützen Sie, die Übungen Ihren Patienten zu erklären. - Jede Übung wird genau erklärt, genaue Angaben zu Wiederholungszahlen und Intensität. - Tipps für begleitende Maßnahmen. - Trainingsziele und beachtenswerte Besonderheiten. - Wichtige Aspekte beim Rehabilitationsprozess. Physiotherapeutische Beratung zu: Hilfsmitteln, Alltagstipps, dem richtigen Umgang mit Schmerz, Operationstechniken, Behandlungsmethoden, Untersuchungen und Kreuzbandtests "Erfolgsfaktoren für eine Operation sind eine gute mentale Vorbereitung des Patienten auf die Operation und die dafür notwendige etwa vier- bis sechsmonatige Rehabilitationsphase, die Auswahl eines professionellen Behandlungsteams mit einem erfahrenen Operateur und einer kompetenten Physiotherapie." - Christian Marquardt -
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
© 2022 Christian Marquardt
Coverdesign, Satz & Layout: Angela Herold (www.herolddesign.de)
Coverbild: GES-Sportfoto/ Marvin Ibo Güngor
ISBN Softcover: 978-3-347-62709-3
ISBN Hardcover: 978-3-347-70212-7
ISBN E-Book: 978-3-347-70213-4
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
CHRISTIAN MARQUARDT
Kreuzbandriss …was nun?
Ein Leitfaden zur Rehabilitationsstrategie für jeden Therapeuten, Patienten oder Sportler
INHALT
Der Autor
Einleitung
1. Unfallmechanismen
1.1. Typische Verletzungsmechanismen
1.2. Gefahr und Komplikationen nach einer VKB – OP
1.3. Struktur des vorderen Kreuzbandes
2. Optimale Erstversorgung nach einer Kreuzbandverletzung
2.1. Sofortmaßnahmen am Unfallort:
3. Verletzungsmechanismen und Risiko - „Screening“
3.1. Verletzungsmechanismen
3.2. Nicht trainierbare Risikofaktoren
3.3. Trainierbare Risikofaktoren
3.4. Drop Jump Screening Test
3.5. Risikoathleten
3.6. „Screening“ Tests
4. Was ist ein Functional-Movement-Screen?
4.1. Ziel des Functional-Movement-Screens
4.2. Wie wird beim Functional-Movement-Screen bewertet?
4.3. Bewertungsskala und Clearing-Tests
5. Die 7 Standardübungen des Functional-Movement-Screens
5.1. Die tiefe Überkopfkniebeuge (Deep Squat)
5.2. Über eine Hürde steigen (Hurdle Step)
5.3. Ausfallschrittkniebeuge mit beiden Füßen auf einer Linie (In-Line Lunge)
5.4. Schulterbeweglichkeit (Shoulder Mobility)
5.5. Gestrecktes Beinheben in Rücklage (Active Straight-Leg Raise)
5.6. Rumpfstabilitäts-Liegestütz (Trunk Stability Push-up)
5.7. Rotationsstabilität im Vierfüßler Stand (Rotary Stability)
6.0. Präventionsmaßnahmen
6.1. Aufklärung über Verletzungsmechanismen
7. Balance Training
8. Neuromuskuläres Training
9. Krafttraining
10. Lauf- und Beweglichkeitstraining
11. Effekt von speziellen Aufwärmprogrammen auf die Prävention von VKB-Rupturen und Knieverletzungen
12. Etablierte Präventionsprogramme
13. Anatomie des Kniegelenks
13.1. Aufbau des hyalinen Gelenkknorpels
14. Menisken
14.1. Aufbau der Menisken
14.2. Funktion der Menisken
15. Biomechanik des Kniegelenks
16. Ursache – Folge – Ketten
17. Diagnostik
17.1. Einfache Instabilität
17.2. Kombinierte Instabilitäten
17.3. Komplexe Instabilitäten
18. Untersuchung einer Kreuzbandverletzung
19. Arten des Kreuzbandrisses
19.1. Komplette Ruptur des Kreuzbandes
19.2. Teilruptur des Kreuzbandes
19.3. Ausriss an der knöchernen Verankerung des Kreuzbandes
19.4. Ruptur des hinteren Kreuzbandes
20. Das hintere Kreuzband
20.1. Anatomie des hinteren Kreuzbandes
20.2. Biomechanik
21. Hauptaufgabe des vorderen und hinteren Kreuzbandes
22. Dynamische Stabilisation
23. Funktion und Isometrie
24. Belastbarkeit und Reißfestigkeit
25. Physiotherapeutische Untersuchungstests zur Diagnostik eines Kreuzbandrisses
26. Lachman – Test
26.1. Durchführung stabilisierender Lachman – Test
27. Schubladen – Test (vorderes und hinteres Kreuzband) Durchführung
28. Pivot – Shift – Test (vorderes Kreuzband)
29. Umfangmessung Protokoll Vorlage
30. Gravity Sign
31. Indikation für eine operative Therapiemethode
32. Zusammenfassende Daten bei einer Kreuzbandruptur
33. Kernspintomographische Zeichen für eine VKB – Ruptur
34. Wichtige Protokolle für Patient und behandelnder Physiotherapeut
34.1. Nachbehandlungsprotokoll
34.2. Operationskontrollen
35. Operationstechniken
36. Operation gut überstanden was nun?
36.1. Ursachen von vorderen Knieschmerzen nach der Operation
36.2. Zusammenfassend die Ursachen des vorderen Knieschmerzen nach VKB – Plastik
36.3. Allgemeine Komplikationen nach Eingriffen im Kniegelenk
36.4. Spezielle Komplikationen nach VKB – Plastik
37. Ursachen von Bewegungseinschränkungen nach VKB – Plastik
38. Postoperative Rehabilitation
39. Frühfunktionelle Nachbehandlung
40. Grundsätzliches nach der Operation
41. Manuelle Lymphdrainage nach der Kreuzbandoperation
42. Schienenversorgung nach der Operation
43. Rehabilitation
43.1. Zeitliche Zuordnung der jeweiligen Rehabilitationsphasen
43.2. Akutphase 1. – 2. Tag
43.3. Postakute Phase 3. – 7. Tag
43.4. Phase der Belastungssteigerung 6. – 12. Woche
43.5. Sportaufbauphase 3. – 6. Monat
43.6. Tabellarische Übersicht der Therapieziele Phase I – III
44. Rehabilitationsstrategien nach Plan
44.1. Zusammenfassung Therapieziele
44.2. Therapeutische Verfahren
45. Die Psyche des Patienten im Selbstheilungsprozess
46. Trainingsregel in der Rehabilitation
47. Phase I der Rehabilitation
48. Knie kühlen – aber richtig
49. Wie reagiert die Muskulatur auf Immobilisation?
50. CAMOped® Bewegungsschiene
51. Physiotherapie nach der Operation
52. Übungen nach Kreuzband OP: Welche Kraftübungen zum Muskelaufbau?
52.1. Grundlagen des Kraft- und Muskelaufbautrainings
52.2. Isometrische Übungen für den Beginn
53. Die 6 Sicherheitsfragen Formular
54. Heimübungsprogramm für Patienten nach einer Kreuzband OP
54.1. Übung: Oberschenkel anspannen
54.2. Übung: Isometrische Quadrizeps Anspannung
54.3. Übung: Fersen auf der Unterlage gleiten
54.4. Übung: Bein gestreckt abspreizen
54.5. Übung: Vorfuß gegen Widerstand bewegen
54.6. Übung: Isometrische Quadrizeps – Sätze
54.7. Übung: Isometrische Hamstring Sätze
54.8. Übung: „Buttock Trucks“ – Isometrisch
54.9. Übung: „Ankle Pumps“ – Isometrisch
54.10. Übung: Hüftabduktion
54.11. Übung: Hüftadduktion
54.12. Übung: Fersen gleiten
54.13. Übung: „Sitting Knee“ – Extension
54.14. Übung: „Sitting Knee“ – Flexion
54.15. Übung: Straight Leg Raise (Gerades Beinheben)
54.16. Übung: Face Down Knee Flexion
54.17. Übung: Extension on a Bolster
54.18. Übung: Patellamobilisation
55. Dehnungsübungen der Achillessehne
55.1. Dehnübungen der Achillessehne im Sitz oder im Stand
56. Weitere Übungen mit dem Mini Band für die ersten Wochen nach der Operation
56.1. Übung: Becken heben mit dem Mini Band
56.2. Übung: Abduktion in Seitlage mit dem Mini Band
56.3. Übung Abduktion in Bauchlage mit dem Mini Band
56.4. Übung: Hüftrotation im Vierfüßler Stand mit dem Mini Band
56.5. Übung: Kniebeuge mit dem Mini Band
56.6. Übung: Seitliches Marschieren mit dem Mini Band
56.7. Übung: Beinbeuger mit dem Schlingentrainer in Rückenlage
56.8. Übung: Ausfallschritt mit dem Schlingentrainer
57. Weitere Übungen in der 2. Rehabilitationsphase
57.1. Übung: Lumbar Bridge Ausführung
57.2. Übung: Kniebeugung mit Pezziball
57.3. Übung: Prone Hangs
57.4. Übung: Prone Hangs – Stretch
57.5. Übung: Snow Angel – Prone
57.6. Übung: Leg Adduktion
57.7. Übung: Standing Leg Lifts
57.8. Übung: Mini Squats
57.9. Übung: Partial Lunge
57.10. Übung: Satic Wallsit
57.11. Übung: Wall Slide
57.12. Übung: Calf Raise
57.13. Übung: Calf Raise – Single Leg
57.14. Übung: Step Up – Forward
57.15. Übung: Step Down – Backward
57.16. Übung: Step – Overs
57.17. Übung: Backward Stepping
57.18. Übung: Toe Raise (Zehen heben)
58. Koordinationsübungen nach Belastungsfreigabe vom Arzt
58.1. Methodische Grundregeln eines effektiven Trainingsprogramm bzw. optimalen Ablaufs eines Propriozeptoren Trainings
58.2. Belastung und Erholung
58.3. Welche Trainingsgeräte benötigt man zur Rehabilitation
59. Weitere Trainingsmöglichkeiten zur Stabilisierung und Propriozeption auf unebenem Untergrund wie z.B. Airex Matte, BOSU Ball
59.1. Übung: Einbeinstand einüben
59.2. Übung: Laufen auf einer Airexmatte, Trampolin oder Wackelbrett
59.3. Übung: Ausfallschritte auf einem unebenen Untergrund (Bosu Ball oder Airexmatte)
59.4. Übung: Kniebeugen auf dem unebenen Untergrund (Bosu Ball oder Airexmatte)
59.5. Übung: Sprünge von rechts auf links mit Halten der Beinachse
59.6. Übung: Kniebeugen mit einem Bein auf einem unebenen Untergrund (Bosu Ball oder Airexmatte)
59.7. Übung: Seitliche Ausfallschritte mit dem Mini Band auf Airexmatte
59.8. Übung: Ausfallschritte nach vorne und nach hinten mit dem Mini Band auf einer Airexmatte
59.9. Übung: Ausfallschritte (Kreuzschritt) mit der Kettlebell auf einer Airexmatte
59.10. Übung: Sprünge auf der Matte in den Einbeinstand
60. Übungen an der Treppe
60.1. Lockerung und Kräftigung
60.2. Übung: Kräftigung und Wahrnehmung der Beinmuskulatur beim Treppenhinabgehen
60.3. Übung: Kräftigung der Beinmuskulatur und Wahrnehmung der Kniebalance
60.4. Übung: Kräftigung und bewusstes Wahrnehmen der Treppengehbewegung
60.5. Übung: Dehnung der Kniestrecker und des inneren Hüftlendenmuskels
60.6. Übung: Dehnung der Wadenmuskulatur und der Schienbeinmuskulatur
61. Ausdauertraining auf dem Laufband
61.1. Richtiges Training auf dem Laufband in der Kreuzband Reha
62. Rehabilitation nur mit Herzfrequenzmessung
62.1. Was ist der Belastungspuls und wie hoch darf er sein?
63. Formen des Krafttrainings
63.1. Bewegungsdefizite im Krafttraining
63.2. Statisches Krafttraining
63.3. Dynamisches Krafttraining
63.3.1. Konzentrisches Krafttraining
63.3.2. Exzentrisches Krafttraining
63.3.3. Reaktives Training
64. Isokinetisches Krafttraining
64.1. Isokinetik Auswertung: Beinbeuger mit Problematik
64.2. Isokinetik Auswertung: Beinbeuger ohne Probleme
64.3. Auswertung Isokinetik: Beinstrecker mit Problematik
68. Die kinematische Kette
68.1. Unterscheidung von offener und geschlossener kinematische Bewegungskette
68.1.1. Offene Bewegungskette
68.1.2. Geschlossene kinematische Kette
69. Transkutane Muskelstimulation
70. Trainingsinhalte
70.1. Inhalte eines Muskelaufbautrainings in der Rehabilitation
70.2. Einteilung in eine Tabelle der Krafttrainingsmethoden
71. Beispiele für Trainingsübungen für ein Krafttraining an Geräten
71.1. Einbeinextension
71.2. Einbeinabduktion
71.3. Beincurls
72. Weitere Trainingsbeispiele am Seilzug
72.1. Extension im Standbein
72.2. Flexion im Standbein (Mm. ischiocrurales)
72.3. Flexion im Stand (M. biceps femoris)
72.4. Flexion im Kniegelenk (M. semimembranosus + M. semitendinous)
72.5. Stabilisation der Beinachse (M. vastus medialis)
72.6. Reaktive Stabilisation der Beinachse (M. vastus medialis)
72.7. Dynamisches Beinachsentraining auf Airex Matte (mit Hantelstange)
72.8. Dynamisches Beinachsentraining (Mm. vastus lateralis + medialis)
73. Übungen mit dem Pezziball
73.1. Einbeinstand mit Propriomed und Pezziball
73.2. Kniestand mit Unterarmstüt7 auf Pezziball
73.3. Liegestütz auf zwei Pezzibällen
73.4. Vierfüßler Stand auf Pezziball
73.5. Einbeinstand mit Handstütz
73.6. Einbeinstand mit Pezziball
74. Beinachsen- und Rumpfstabilisationstraining
74.1. Übung zur Stabilisation der Beinachse im Knie- und Sprunggelenk
74.2. Übung zur Steigerung der Stabilisation der Beinachse im Knie- und Sprunggelenk
74.3. Übung zum Stabilisationstraining für die Beinstabilität
74.4. Übung zum Stabilisationstraining mit zwei Pezzibällen für Rumpfstabilisation und zur Verbesserung der Beinachsen
74.5. Übung zur Stabilisation mit Pezzibällen zur Verbesserung der dorsalen und lateralen Rumpf- und Beinmuskulatur
74.6. Übung zur Rumpfstabilisation auf dem Pezziball und mit einem Propriomed
74.7. Übung zur Kräftigung der ischiocruralen Muskulatur mit dem Pezziball
74.8. Übung zur Verbesserung der Stabilisation der Beinachse mit dem Pezziball
74.9. Übung: Stand auf dem Pezziball
74.10. Übung zur Verbesserung der Stabilisation der Beinachse auf dem Pezziball mit Hantelstange
75. Übungen mit dem Theraband
75.1. Kräftigung der dorsalen Beinkette + Verbesserung der Rumpf- und Schulterstabilisation
75.2. Verbesserung der Standbeinphase und Rumpfstabilisation auf einer Airexmatte
75.3. Verbesserung der Beinachsen- und Rumpfstabilisation auf einer Airexmatte und Bosu Ball
75.4. Stabilisation der Beinachsen in der geschlossenen Kette mit dem Theraband
75.5. Verbesserung von Beinachse, Rumpf und Schulter mit dem Theraband
75.6. Verbesserung der Beinachsen mit dem Theraband und Pezziball
75.7. Verbesserung der Beinachsenstabilität auf einer Airexmatte oder BOSU Ball
76. Übungen zur Stabilisation der Rumpf- und Beinachse auf dem TOGU Jumper
76.1. Stabilisation der Beinachse auf einem TOGU-Jumper
76.2. Verbesserung der Beinachsen- und Rumpfstabilität mit zwei TOGU-Jumper
76.3. Stabilisation der Rumpf- und Beinachse / Verbesserung der Kraft Mm. vastus medialis und lateralis auf zwei TOGU-Jumper
76.4. Verbesserung der Beinachsenstabilität auf einem TOGU-Jumper und Propriomed
77. Kniebeuge – Squat am TRX
78. Übungen an der Sprossenwand
78.1. Klettern an der Sprossenwand
78.2. Tiefe Kniebeugen an der Sprossenwand
79. Übungen zum Muskeltraining auf dem DIMOVE Wave Pro mit Langhantelstange
79.1. Ausfallschritte mit Langhantelstange auf dem DIMOVE Wave Pro
79.2. Ausfallschritte auf BOSU Ball mit dem DIMOVE Wave Pro
80. Fußballspezifisches Training auf dem BOSU Ball
80.1. Propriozeptives und koordinatives Training auf BOSU Ball mit Fußball
80.2. Fußballspezifische Übung zur Koordination und Propriozeption auf dem BOSU Ball und Fußball mit der Fußinnenseite flach
80.3. Fußballspezifische Übung zur Koordination und Propriozeption auf dem BOSU Ball und Fußball mit der Fußinnenseite hoch
80.4. Fußballspezifische Übung zur Koordination und Propriozeption auf dem BOSU Ball und Fußball mit Spann flach
80.5. Fußballspezifische Übung zur Koordination und Propriozeption auf dem BOSU Ball und Fußball mit Spann hoch
81. Muskelaufbautraining mit Langhantel und Plyobox
82. Kraft- und Koordinationstraining auf BOSU Ball und Medizinball
Literaturverzeichnis
Glossar
Quellenverzeichnis
Der Autor
Christian Marquardt, geboren 1978 ist Physiotherapeut, Osteopath, Referent und Heilpraktiker der Physiotherapie. Im April 2020 schloss er mit Erfolg den Studiengang „FIFA Diploma in Football Medicine“ ab und ist seither offizieller FIFA-Physiotherapeut.
Christian Marquardt absolvierte seine Ausbildung zum Masseur und medizinischen Bademeister in der VPT Berufsfachschule für Masseure und Physiotherapeuten in Bad Birnbach die er 1996 mit Erfolg abgeschlossen hat. Von 2005 - 2006 hat er sich weiterqualifiziert zum Physiotherapeuten ebenfalls bei der VPT Berufsfachschule für Masseure und Physiotherapeuten in Bad Birnbach.
Christian Marquardt ist seit 2008 Geschäftsinhaber des gleichnamigen Physiotherapie- und Rehazentrum mit medizinischem Trainingszentrum in Plattling/Niederbayern. 2021 wurde der Name samt Logo auf „Ihr Gesundheitszentrum Marquardt“ abgeändert. Neben seiner physiotherapeutischen Qualifikation betreute Christian Marquardt von 1999 – 2006 die Deutsche Taekwondo Nationalmannschaft während nationaler und internationaler Wettkämpfe. Er konnte so unter anderem durch die Weltmeisterschaft in Korea und Betreuung sämtlicher Olympiaqualifikationen für Sydney 2000 sowie Athen 2006 sein therapeutisches Wissen erweitern. Seine weiteren Tätigkeiten im Leistungssport setzte er im Profifußball fort. So betreute er von 2009 – 2013 als Physiotherapeut den damaligen Fußball Drittligisten SV Wacker Burghausen, bevor er 2014 ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Ingolstadt 04 wechselte wo er die physiotherapeutische Leitung aller U-Mannschaften innehatte. Von 2015 – 2017 war er bei der Profimannschaft des Karlsruher SC, in der 2. Bundesliga, wo er den Fußballprofis beim Training und an Spieltagen mit seinem fachlichen Wissen zur Seite stand.
Als Autor schrieb Christian Marquardt regelmäßig Bücher. Im Juli 2013 war er Autor des Buches „Gezielt behandeln – schneller wieder fit“. Außerdem veröffentlichte er im April 2016 das Lehrbuch „Faszienbehandlung – Spezielle Behandlungstechniken für Physiotherapeuten, Masseure und Bewegungstherapeuten“. Sein 3. Buch veröffentlichte er im September 2019 im Tredition Verlag mit dem Titel „Bandscheiben Problematik …oder spielt nur der Ischiasnerv wieder verrückt? Er ist außerdem Referent in der Pschick Akademie wo er in verschiedenen Kursstandorte für Physiotherapeuten über das Thema Bandscheiben referiert.
Weitere Informationen unter www.physiotherapie-marquardt.de
Einleitung
Ein Kreuzbandriss kann gleichermaßen als Ergebnis körperlicher Aktivität im Freizeitsport wie im Leistungssport auftreten. Er kann das Ergebnis von einem Unfall oder einer Überbelastung darstellen.
Für die meisten Patienten und Sportler ist dies längst keine Bagatellverletzung da mittlerweile der Sport oder die Freizeitaktivität für viele Menschen fast ebenso wichtig geworden ist wie die Berufstätigkeit. Sie erwarten eine möglichst effektive Behandlung, um ihrer liebgewordenen Freizeitbeschäftigung möglichst rasch wieder nachgehen zu können. In besonderem Maße sind Patienten sowie auch Amateur- und Leistungssportler auf die korrekte Diagnostik einer eventuellen Schädigung angewiesen, ebenso auf eine möglichst frühzeitige Behandlungs- bzw. Rehabilitationstrategie eines Kreuzbandrisses, die zur vollständigen Wiederherstellung führt. Für sie ist es wesentlich, nach Verletzungen ihr Training so rasch wie möglich wiederaufzunehmen, um ein Optimum an Ihrer eigenen Leistungsgrenze zu erzielen.
Selbst der weniger anspruchsvolle Gelegenheitssportler kann physisch und psychisch unter einem Kreuzbandriss leiden, wenn dieser ihn zur körperlichen Untätigkeit verdammt und dadurch in seinem Wohlbefinden und seiner Lebensqualität einschränkt.
Angesichts des raschen Fortschritts in der sportmedizinischen Diagnostik und in der Physiotherapie erschien es mir erforderlich, das vorliegende Buch zu schreiben, um meine Erfahrungen in der Rehabilitation auf den neuesten Stand zu bringen.
Nach Verletzungen ist eine sorgfältige Planung rehabilitativer Maßnahmen erforderlich. Aus diesem Grund war ich der Ansicht, dass eine detaillierte Beschreibung des rehabilitativen Trainings für dieses Buch von ganz besonderer Bedeutung ist.
Alle Knieübungen in diesem Buch „Kreuzbandriss …was nun? sind so gestaltet, dass sie als Patient und als Sportler eine Kombination aus Beweglichkeit, Koordination- und Kräftigungsübungen nach einer Kreuzband-OP im Kniegelenk darstellen.
Dieses Buch dient als Leitfaden zur Rehabilitationsstrategie nach einem Kreuzbandriss für jeden Therapeuten, Patienten und Sportler und ist ab dem ersten Tag der Knieverletzung oder Knieoperation einsetzbar. Außerdem eignet es sich ebenfalls für die konservative Behandlung (ohne Knie-OP) ab 1. Woche VKB-Ruptur (vordere Kreuzbandrupturen):
• Komplettes Trainingsprogramm für vordere Kreuzbandrisse wurde von mir als Physiotherapeut konzipiert und in meiner langjährigen Erfahrung in der Praxis und im Leistungssport an Profisportler getestet
• Schnelle Fortschritte durch einfache bebilderte Übungseinheiten, immer angepasst an den Rehabilitationsstand und Heilungsverlauf im verletzten Kniegelenk.
• Mit und ohne Geräte, nur mit dem eigenen Körpergewicht sicher und einfach Muskeln aufbauen. Das Knie Rehabilitationstraining nach dem Kreuzbandriss ist mit oder ohne Orthese (Schiene, Bandage) möglich.
Die Anleitung berücksichtigt, neben den zeitlichen Richtlinien, auch die kriteriengeleitete Rehabilitation. Dadurch gestaltet sich die Kreuzbandriss Rehabilitation individuell und hocheffektiv. Der Trainingsfortschritt stellt sich schneller ein, ohne die vordere Kreuzbandplastik oder den Heilungsprozess (auch bei konservativer Nachbehandlung) zu gefährden.
In diesem Buch Kreuzbandriss …was nun? fokussieren sich die Rehabilitationsübungen auf folgende Trainingsparameter:
• Verhinderung Muskelabbau im verletzten Bein (Krafttraining),
• Ganzheitlicher Kraftaufbau (Hüfte, Bein, Fuß und Rumpf),
• Beweglichkeit (Mobilisation) im Kniegelenk (ganzheitliches Knietraining),
• Muskuläre Kontrolle (Koordination, Balance und Stabilität im Knie),
• Muskelaufbau und Krafttraining sowie Verletzungsprävention (nach Rückkehr zum Sport)
• Propriozeptives Training
• Isokinetisches Training
Gerade bei einer so komplizierten und langwierigen Verletzung wie dem Kreuzbandriss sind gute Abbildungen von herausragender Bedeutung. Alle Basis- und Aufbauübungen nach Kreuzbandriss OP sind bebildert und mit Steigerungsformen und Hilfestellungen vom Physiotherapeuten versehen. Deshalb muss die Arbeit meiner Photographen Pauline Joachimsthaler, Enrico Saller mit Marina Hoeft, herausgehoben werden, die mich durch die Erstellung der Photographien für dieses Buch unterstützten.
Auf der Übersichtsseite wird klar, wann genau, welche Übungen für das jeweilige Verletzungsstadium nach dem Riss des Kreuzbandes passen.
Das Buch bietet folgende Hilfestellungen nach einer vorderen Kreuzbandverletzung:
• Klarheit: Ein Trainings- und Rehabilitationsplan, der speziell auf die Kreuzbandriss Reha-Phasen ausgerichtet ist.
• Effektivität: Knie-Übungen zum Muskelaufbau und Bewegungsmobilisation.
• Risiko-Verminderung: Verständliches Rehabilitationswissen nach einer vorderen Kreuzbandplastik.
• Mentale Sicherheit: Vergleichbarkeit und Einschätzung des Rehabilitationsniveaus ist aufgrund objektiver Kriterien gegeben.
• Fit und schmerzfrei: Stärkung von Fitness und Ausdauer durch optimales Knietraining nach dem Riss im vorderen Kreuzband oder nach einer vorderen Kreuzbandersatzplastik.
In besonderem Maße möchte ich mich bei weiteren folgenden Personen bedanken, die zum Gelingen dieses Buches beigetragen haben:
• Angela Herold (Umschlaggestaltung und Innenteil, www.herolddesign.de)
• Nicole Fischl (Korrekturlesung)
• Fabian Pettrich (Physiotherapeut – Kapitel: Functional Movement Screen)
• Celine Götz (Sporttherapeutin)
• Patrick Wiegers (Kreuzbandpatient, Profifußballer bei Dynamo Dresden)
• Andrew Schembri (Eishockeyspieler Eisbären Regensburg)
• Abed Mehani (Kreuzbandpatient)
• Franziska Vlach (Kreuzbandpatientin)
• Coverbild: GES-Sportfoto/ Marvin Ibo Güngor
Ich bin glücklich, dass dieses Buch bei Ihnen ein großes Interesse gefunden hat. Manches in ihm kann Widerspruch herausfordern. Ein Buch, wie das vorliegende, stellt zahlreiche Sachverhalte dar, gesehen und interpretiert durch die Brille unserer eigenen, ganz persönlichen Philosophie und Erfahrung. Dieses Buch ist ein perfektes Geschenk oder Mitbringsel für Rehabilitationspatienten im Krankenhaus oder Rehazentren. Denn nichts ist wichtiger als die Gesundheit und mentale Fitness. Mit diesem nützlichen Genesungswunsch für Kniepatienten zeigt man seinen Support und wünscht einfach nur „Gute Besserung“ und viel Erfolg beim Rehabilitations- bzw. Genesungsprozess.
Plattling, im August 2022
Der ehrgeizige Zweikampf beim Fußballmatch mit Freunden oder der kleine Schneehügel auf der Piste, der im Schusstempo übersehen wird. Gefahren für Knieverletzungen gibt es im Freizeitsport zur Genüge. Sind Drehbewegungen im Spiel, ist es meist das Kreuzband, das dann Schaden nimmt. Somit also lässt sich eine Folgekette feststellen: Knie verdreht – Kreuzbandriss – Meniskus verletzt! Operation, monatelange Reha, Trainingsausfall und die Ungewissheit, ob und wann das „Comeback“ gelingt. Eine schwere Knieverletzung ist für jeden Sportler, egal ob Profi oder Hobbysportler, eine lebensverändernde Erfahrung. Mit Hilfe moderner Operationstechniken kann das vordere Kreuzband zwar weitgehend wiederhergestellt werden, dennoch kann ein Kreuzbandriss aufgrund der Folgen von Begleitverletzungen oder einer persistierenden Instabilität des Kniegelenkes das Karriereende bedeuten.
Das muss nicht sein! Verschiedene sportmedizinische Studien konnten zeigen, dass das Risiko, für das Erleiden einer vorderen Kreuzbandruptur durch spezielle Trainingsübungen gesenkt werden kann. Diese Trainingsübungen sollten in ein Aufwärmprogramm integriert werden.
Die vordere Kreuzbandruptur zählt zu den häufigsten Sportverletzungen des Kniegelenks und tritt vor allem bei Risikosportarten wie Fußball, Handball, Basketball, Volleyball oder Skifahren auf. Es entstehen Verletzungen des vorderen Kreuzbandes in Spielsportarten überwiegend ohne direkte Einwirkung des Gegners. 72% - 95% der Kreuzbandrupturen entstehen in sogenannten Nicht – Kontakt – Situationen.
Das vordere Kreuzband ist bei einer Knieverletzung die am häufigsten betroffene Bandstruktur. Ihre Inzidenz wird auf 1: 3500 geschätzt. Aufgrund der spieltypischen Sprung- und Abbremsbewegungen kommen Kreuzbandrupturen im Ballsport vergleichsweise häufig vor. Da das vordere Kreuzband eine wichtige Funktion für die Kinematik des Kniegelenks hat, bedeutet eine Kreuzbandruptur ernste Konsequenzen für den betroffenen Sportler. Eine chronische Instabilität kann die sportliche Leistungsfähigkeit unmittelbar beinträchtigen. Langfristig führen rezidivierende Subluxationsereignisse zu Meniskus- und Knorpelschäden.
Im Ballsport entstehen Knieverletzungen oft bei der Landung nach einem Sprung und während schneller Richtungswechsel. Das Kniegelenk befindet sich zu dem Zeitpunkt der Verletzung meist in leichter Beugung mit einer Valgus- und Außenrotationsstellung. In dieser Knieposition ist die Spannung im vorderen Kreuzband am höchsten und die muskulären Agonisten des vorderen Kreuzbandes. Die ischiocruralen Muskeln, haben einen ungünstigen Hebelarm, um das Tibia Plateau zu sichern. Der Körperschwerpunkt liegt zum Zeitpunkt der Verletzung hinter dem Kniegelenk, so dass in dieser Körperposition die Hüfte schnell flektiert werden muss, um den Körperschwerpunkt nach vorne zu bringen. Bei dieser Bewegung kommt es zur schnellen Kontraktion des M. quadrizeps, dem muskulären Antagonisten des vorderen Kreuzbandes.
Durch die plötzliche Anspannung des M. quadrizeps kann es bei diesen Kraftverhältnissen durch den Hebelarm zu einer Ruptur des vorderen Kreuzbandes kommen.
Indirekte Kniegelenktraumen im Sport stellen bei weitem die häufigste Ursache für die Ruptur des VKB dar. Übertrieben lässt sich formulieren, dass VKB-Läsionen ohne den Sport so gut wie überhaupt nicht vorkommen würden. Aufgrund der zunehmenden sportlichen Freizeitaktivitäten und nicht zuletzt dank der deutlichen verbesserten diagnostischen Möglichkeiten wie z.B. die Kernspintomographie und die Arthroskopie, werden VKB-Läsionen mit zunehmender Häufigkeit festgestellt. Zusammen mit dem kürzeren, aber einem deutlich kräftigeren hinteren, bildet das vordere Kreuzband den für die Stabilität und auch die Kinematik des Kniegelenkes wichtigen zentralen Pfeiler.
Beide Kreuzbänder liegen zwar intraartikulär, aber auch retrosynovial, so dass sie dem intraartikulären Milieu entzogen sind. Die arterielle Versorgung der Kreuzbänder ist außerordentlich schlecht, weshalb sie über eine mangelhafte Heilungspotenz verfügen. Das vordere Kreuzband ist der wichtigste ventrale Stabilisator, es nimmt 86% der Kräfte auf, die sich einer ventralen Tibiakopf Transplantation widersetzen. Von großer Bedeutung ist ebenfalls, dass das vordere Kreuzband strecknah am wichtigsten für die ventrale Kniegelenkstabilität ist, weil die protektive Funktion der ischiocruralen Muskulatur fehlt.
Mit einem Trauma werden Propriozeptoren im vorderen Kreuzband zerstört, weshalb neben der mechanischen auch mit einer funktionellen Instabilität des Kniegelenks zu rechnen ist. Die Instabilität und die gestörte Kinematik führen sekundär zu degenerativen Veränderungen an den Menisken und am hyalinen Gelenkknorpel. Außerdem können sich sekundäre Instabilitäten durch Auslockerung des Kapsel-Bandapparates und durch den Verlust der Meniskusfunktion entwickeln. Letztlich wird ein Zustand erreicht, der in der Physiotherapie als Syndrom des VKB-insuffizienten Kniegelenkes bezeichnet wird.
Die Erfahrung im klinischen Alltag lehrt, dass bestimmte Unfallmechanismen zu typischen Verletzungs- und damit zu entsprechenden Instabilitätsmustern führen. Der Arzt hofft, von der Beschreibung des Unfallherganges auf den Umfang der Verletzung schließen zu können. Es stellt sich immer die Frage, ob das Trauma tatsächlich geeignet war, die vorliegende Verletzung zu verursachen. Jedoch gelingt es den Patienten oft nicht, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Bis zu einem Drittel der Verunfallten kann dazu überhaupt keine Angaben machen, so dass die Anamnese oft nicht die erwünschte Information über die zu erwartende Verletzung ergibt.
1. Unfallmechanismen
Die Erfahrung im klinischen Alltag lehrt, dass bestimmte Unfallmechanismen zu typischen Verletzungs- und damit zu entsprechenden Instabilitätsmustern führen. Der Arzt hofft, von der Beschreibung des Unfallherganges auf den Umfang der Verletzung schließen zu können. Es stellt sich immer die Frage, ob das Trauma tatsächlich geeignet war, die vorliegende Verletzung zu verursachen. Jedoch gelingt es den Patienten oft nicht, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Bis zu einem Drittel der Verunfallten kann dazu überhaupt keine Angaben machen, so dass die Anamnese oft nicht die erwünschte Information über die zu erwartende Verletzung ergibt.
MERKE
Der komplexe Stabilisierungsmechanismus des Kniegelenkes bedingt, dass nach einem Trauma nicht nur mit isolierten, sondern vielmehr mit kombinierten Läsionen synergetisch wirkender Stabilisatoren zu rechnen ist.
Charakteristisch, man kann fast sagen ein Leitsymptom ist, das bei einem Ruptur Ereignis ein begleitendes laut krachenden Geräusches einhergeht. Dies sollte von jedem Therapeuten, Trainer oder Arzt abgefragt werden!!!
1.1 Typische Verletzungsmechanismen sind:
Valgus – Außenrotations – Flexions – Stress
Varus – Innenrotations – Flexions – Trauma
Innenrotationstrauma
Verdreh Traumen
Hyperflexionstraumen – Rückwärtsfall maximale Quadrizeps Kontraktion
Hyperextensionstraumen – Vorwärtssturz
Bagatelltraumen
Sportverletzungen der Erwachsenen beschränken sich in der Mehrzahl auf den Kapselbandapparat und die Menisken, der Knochen hält in der Regel den Belastungen stand. Bei einem versagen des vorderen Kreuzbandes ist von einer Verschiebung der Gelenkpartner gegeneinander und von einer entsprechend hohen Krafteinwirkung auszugehen, sodass zwangsläufig weitere Läsionen auftreten müssen und man sich die Frage stellen muss, ob es eine isolierte VKB-Ruptur überhaupt geben kann.
Tabelle: Potentiell verletzte Strukturen beim Valgus – Außenrotations – Flexionstrauma
Innenmeniskus
Innenband
Dorsomediale Kapsel
Vorderes Kreuzband
Tabelle: Potentiell verletzte Strukturen beim Varus – Innenrotations – Flexionstrauma
Außenband
Dorsolaterale Kapsel
Vorderes Kreuzband
(Innenmeniskusvorderhorn)
Tabelle: Unfallmechanismen und ihre typischen Folgen
Unfallmechanismus
Unfallfolgen
Flexion-Valgus-Außenrotation
Anteromediale Instabilität
Flexion-Varus-Innenrotation
Anterolaterale Instabilität
Hyperextension
Isolierte VKB-Ruptur
Hyperflexion
VKB- u. Innenmeniskusruptur
Varus Trauma
Laterale Instabilität
Valgus Trauma
Mediale Instabilität
Die Kräfte, die in einem Kniegelenk auftreten um eine Ruptur des vorderen Kreuzbandes zu bewirken, sind so hoch, dass immer davon auszugehen ist das es zu Begleitschäden kommt.
Am meisten ist die VKB-Ruptur mit:
Meniskusläsionen
Innenbandrupturen
Osteochondrale Läsionen
Knochen-Knorpel-Schäden
begleitet, wobei sich letztere unter Umständen nur kernspintomographisch als sogenannte „bone bruises“ diagnostizieren lassen.
Begleitverletzungen werden mit einer Häufigkeit von bis zu 80% angegeben, sie sind in die Regel und stellen keine Ausnahme dar (Noyes et al. 1980, Iverson et al. 1989).
Die Diskussion über das physiotherapeutische Vorgehen – konservativ oder operativ – ist noch nicht definitiv abgeschlossen. Die konservative Therapie bietet sich bei sportlich wenig aktiven und älteren Patienten an, wo Faktoren wie:
Geringe Ansprüche
Unter Umständen eine sitzende berufliche Tätigkeit ausüben
Mit Hilfe der konservativen Therapie, wird das Kniegelenk in keiner Weise restabilisiert, es geht vielmehr darum, die Instabilität muskulär zu kompensieren. Dazu werden sowohl ein Kraft- als auch ein Koordinationstraining durchgeführt.
Langfristig muss man als Physiotherapeut aber auch als Patient an die Erhaltung eines altersentsprechenden Muskelstatus gedacht werden. Die Prognose wird sehr unterschiedlich beurteilt. Der konservativ versorgte Patient muss aufgeklärt werden, dass er Einschränkungen in der sportlichen Belastbarkeit im Kauf nimmt, Sportarten mit abrupten Richtungswechseln, Zick – Zack Bewegungen sind zu vermeiden.
Bei einer operativen Therapie bahnt sich eine gewisse Uniformität an. Neben der Restabilisierung und der Erhaltung der Gelenkfunktion gewinnt die Prophylaxe sekundärer Schäden als Folge der chronischen Instabilität an Bedeutung. Junge, sportlich aktive Patienten sollten meiner Meinung nach operiert werden.
Die VKB-Plastik stellt die bei weitem häufigste operative Maßnahme zur Restabilisierung des Kniegelenkes dar. Bewährt hat sich bei den Kniespezialisten ein autologes Sehnenmaterial. Die Patellar-, die 3- bis 4-fache Semitendinosus- und auch die Quadrizepssehne verfügen über die mechanische Reißfestigkeit, um als Bandersatz in Frage zu kommen. Synthetische Kreuzbänder haben nicht die in sie gesetzten Erwartung erfüllt, so dass man davon wieder abgekommen ist. Von herausragender Bedeutung ist die individuelle anatomische Platzierung der Bandplastik, die intraoperativ mit dem Bildwandler geprüft werden. Die primärstabile Verankerung des VKB-Transplantates von den Operateuren ist eine Grundvoraussetzung für uns Physiotherapeuten, da dadurch die heute geforderte beschleunigte frühfunktionelle Nachbehandlung durchgeführt werden kann.
Die Prognose nach der operativen Therapie nach der OP-Technik mit dem mittleren Patellasehnendrittel (Knochen – Sehnen – Knochen) ist sehr gut und es gibt langfristig, positive Ergebnisse.
1.2 Jeder Eingriff am Knie birgt natürlich die Gefahr von allgemeinen Komplikationen wie:
Schwellungs- und Reizzustände
Verwachsungen der Narbe
Arthrofibrosen
Bewegungseinschränkungen
Muskelatrophien
Infektionen
Thrombosen
Zyklopssyndrom*
Infrapatellare Kontraktursyndrom*
*Erklärung Zyklopssyndrom: Das Zyklopssyndrom (noduläre Narbenformation) ist eine Form der lokalisierten oder sekundären Arthrofibrose und als eine Komplikation nach Ersatz des vorderen Kreuzbands (VKB) beschrieben. Mögliche Ursachen und Risikofaktoren einer solchen Gewebeformation sind der Operationszeitpunkt im Verhältnis zum Trauma der Bandruptur, ein erhöhter peri- oder postoperativer Schmerz und zu intensive, schmerzhafte Rehabilitation. Klinisch äußert sich das Zyklopssyndrom als persistierendes und schmerzhaftes Streckdefizit am Kniegelenk.
*Erklärung infrapatellare Kontraktursyndrom: Dieses Syndrom ist eine gefürchtete, in ihrer Ätiologie weitgehend unaufgeklärte Gelenkerkrankung nach operativen Eingriffen oder Verletzungen, aus der eine mehr oder minder starke, teils schmerzhafte Einschränkung der Gelenkbeweglichkeit resultiert.
Unterschieden werden die:
Primäre Arthrofibrose, welche durch eine generalisierte Narbenbildung im Gelenk gekennzeichnet ist.
Sekundäre Arthrofibrose, bei der lokale mechanische Irritationen für eine Bewegungseinschränkung ursächlich sind
Das Transplantat unterliegt postoperativ einem Umbauprozess, damit die Sehne zu einem funktionstüchtigen Ligament heranreifen kann. Während dieser Umbauphase treten degenerative Veränderungen auf, die das Transplantat vorübergehend schwächen.
1.3 Struktur des vorderen Kreuzbandes
Die Kreuzbänder bestehen aus 90% aus funktionell ausgerichteten Kollagenfasern und zu 10% aus die in Grundsubstanz eingebetteten elastischen Fasern. Die Fibroblasten werden von einer extrazellulären Matrix umgeben, die sich in einem geordneten Gebilde von Matrixmolekülen und Wasser zusammensetzen. Es lassen sich vier unterschiedliche Klassen von Matrixmolekülen feststellen:
Kollagen
Elastin
Proteoglykan
Glykoproteine
Der überwiegende Anteil des vorderen Kreuzbandes besteht aus straffem Bindegewebe. Im ventralen Abschnitt des distalen Drittels weicht die Struktur des vorderen Kreuzbandes dort, wo es mit dem Vorderrand der Fossa intercondylaris in Kontakt steht, von der typischen Konfiguration eines Bandes ab. An dieser, der Fossa zugewandten Fläche fehlt dem vorderen Kreuzband der synoviale Überzug, das Gewebe ähnelt hier in seinem Aufbau dem vom Faserknorpel. Das vordere Kreuzband bildet einen Verbund von Faszikeln, der sich flach und fächerförmig zwischen den beiden Gelenkpartnern ausbreitet.
Ein großes Problem liegt in der äußerst schlechten arteriellen Versorgung des vorderen Kreuzbandes, das primär nur über ein einziges Blutgefäß, nämlich über die aus der A. poplitea stammende A. genicularis media ernährt wird. Dies bedeutet, dass nach einer VKB-Ruptur ein Teil des Ligamentes von der arteriellen Gefäß- und auch der Nervenversorgung, die parallel zu den Blutgefäßen verläuft, ausgeschlossen wird.
Die Vaskularisierung ist von klinischer Relevanz. Heilungsvorgänge laufen nur über diesen biologisch vorgegebenen Weg ab und setzen dessen Integrität voraus. Die ungünstige arterielle Versorgung bestimmt posttraumatisch das Schicksal des Bandes, therapeutisch wäre es ideal, wenn die rupturierten Fasern mit ihrem synovialen Überzug erhalten werden könnten.
WICHTIG FÜR DIE PHYSIOTHERAPIE