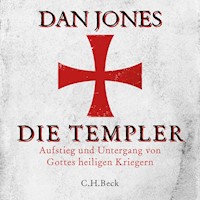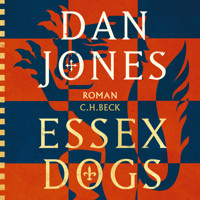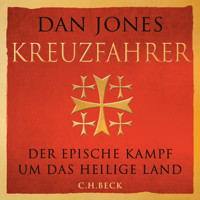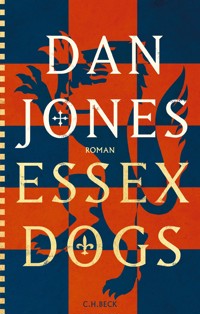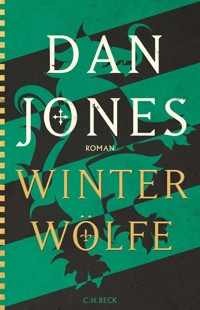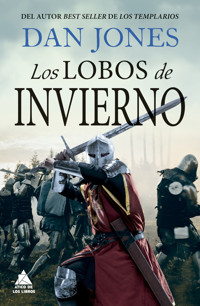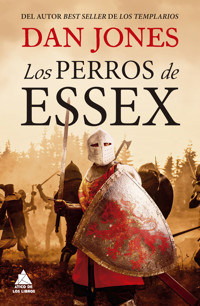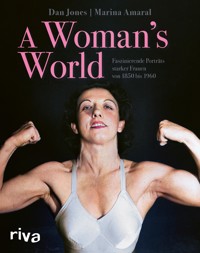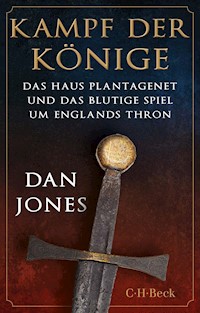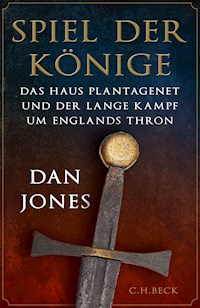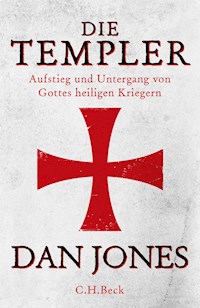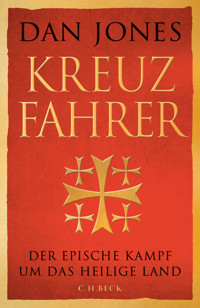
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der Kreuzzüge ist eines der blutigsten Kapitel der Menschheit, das unzählige Frauen und Männer muslimischen, christlichen oder jüdischen Glaubens erlebt und erlitten haben. Ihnen gibt Dan Jones eine Stimme – mit vielen bisher kaum wahrgenommenen Quellen, mit der Präzision des Cambridge-Historikers und mit einer beeindruckenden erzählerischen Kraft.
Die Kreuzfahrer, die zurück in ihre Heimatdörfer humpelten und vertrocknete Palmblätter aus dem Heiligen Land auf die Altäre der Kirchen legten, hatten 1099 gesiegt: Jerusalem war in christlicher Hand. Es war der vorläufige Höhepunkt einer Dynamik, die der Papst mit einem entschlossenen Aufruf entfacht und der byzantinische Kaiser mit populistischen Gräuelgeschichten aufgeheizt hatte. Die Angegriffenen waren von der Brutalität der Angreifer überrascht, die Angreifer überwältigt von der Schönheit der Städte und der Unwirtlichkeit von Klima und Natur. Doch das Blatt sollte sich im Lauf der Kreuzfahrerzeit mehrfach wenden und die Unstimmigkeiten nicht nur zwischen Christen und Muslimen zunehmen. Was zählte der gemeinsame Glaube, wenn es um Gold und Macht ging? Dan Jones erzählt die Geschichte aus Sicht der Päpste, Könige und Sultane, lässt arabische Dichter, byzantinische Prinzessinnen und sunnitische Gelehrte zu Wort kommen und vergisst nie die einfachen Menschen diesseits und jenseits der Frontlinien: ein faszinierend vielfältiges und zutiefst menschliches Bild einer blutigen Epoche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Dan Jones
Kreuzfahrer
Der epische Kampf um das Heilige Land
Aus dem Englischen von Heike Schlatterer und Karin Schuler
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Widmung
Motto
Tafelteil
Einleitung
TEIL I: Entscheidung durch Gottesurteil
1: Der Graf und Imam
2: Dichter und Kleinkönige
3: Ein Reich unter Belagerung
4: Deus vult!
5: Die Geschichte des Predigers
6: Der Marsch der Fürsten
7: Der längste Winter
8: Jerusalem
9: Die Beute wird verteilt
TEIL II: Das Himmelreich
10: Sigurd der Jerusalemfahrer
11: Blutfelder
12: Ein neuer Ritterorden
13: Melisende die Prächtige
14: Die Schwerter unserer Väter
15: Bekehrt oder ausgelöscht
16: Die Geschichte wiederholt sich
17: Der Wettlauf um Ägypten
18: Um unserer Sünden willen
TEIL III: Die Ernte der Erde
19: Löwinnen und Löwenherzen
20: Vom Feuer verschlungen
21: Feinde im Innern
22: Am Paradiesfluss
23: Immutator Mundi
24: Khane und Könige
25: Der Feind aus der Hölle
26: Fragmente und Träume
27: Schöne neue Welten
Epilog: Kreuzfahrer 2.0
Anhang
Dramatis Personae
Könige und Königinnen von Jerusalem
Päpste
Gegenpäpste sind nicht aufgeführt.
Kaiser
Byzantinische Kaiser
Lateinische Kaiser von Konstantinopel
Byzantinische Kaiser (nach der Rückeroberung)
Anmerkungen
Teil I: Entscheidung durch Gottesurteil
1 Der Graf und Imam
2 Dichter und Kleinkönige
3 Ein Reich unter Belagerung
4 Deus vult!
5 Die Geschichte des Predigers
6 Der Marsch der Fürsten
7 Der längste Winter
8 Jerusalem
9 Die Beute wird verteilt
Teil
II
: Das Himmelreich
10 Sigurd der Jerusalemfahrer
11 Blutfelder
12 Ein neuer Ritterorden
13 Melisende die Prächtige
14 Die Schwerter unserer Väter
15 Bekehrt oder ausgelöscht
16 Die Geschichte wiederholt sich
17 Der Wettlauf um Ägypten
18 Um unserer Sünden willen
Teil
III
: Das Himmelreich
19 Löwinnen und Löwenherzen
20 Vom Feuer verschlungen
21 Feinde im Innern
22 Am Paradiesfluss
23 Immutator Mundi
24 Khane und Könige
25 Der Feind aus der Hölle
26 Fragmente und Träume
27 Schöne neue Welten
Epilog: Kreuzfahrer 2.0
Quellen und Literatur
Primärquellen
Sekundärliteratur
Monografien und Sammelbände
Artikel und Dissertationen
Bild- und Kartennachweis
Personenregister
Zum Buch
Vita
Impressum
Widmung
Für Walter χαλεπὰ τὰ καλά
Motto
In jenen Tagen waren den Menschen Pelze ebenso wichtig wie ihre unsterblichen Seelen.
ADAM VON BREMEN, UM 1076
Tafelteil
Die GrabeskircheDie Grabeskirche ist auch heute noch eines der bekanntesten Wahrzeichen Jerusalems. Seit dem 4. Jahrhundert steht an der Stelle, wo Jesus der Überlieferung nach gekreuzigt und bestattet wurde, eine Kirche. Mit einem Gebet am Heiligen Grab war für mittelalterliche Pilger der sehnlichste Wunsch in Erfüllung gegangen.
Die Welt der KreuzfahrerEine typische mappa mundi aus dem 13. Jahrhundert zeigt Jerusalem als Mittelpunkt der Welt. Die Stadt, in der Christus wirkte, starb und wiederauferstand, hat wie kein anderer Ort die christliche Vorstellung im Mittelalter geprägt. Die Eroberung Jerusalems aus der Hand der Muslime war das oberste Ziel des Ersten Kreuzzugs.
Alexios KomnenosDer byzantinische Kaiser Alexios I. Komnenos ist hier mit seinem Sohn Johannes und seiner Frau Irene Doukaina abgebildet. Alexios’ Entscheidung, im Kampf gegen die Seldschuken um die Unterstützung des Westens zu bitten, war eine der treibenden Kräfte für den Ersten Kreuzzug. Auf dem Familienporträt fehlt Alexios’ brillante Tochter Anna Komnene, die Autorin der Alexias.
Papst Urban II.Papst Urban II. verband geistliche Argumente zur Erlangung des Seelenheils im Kampf gegen die Feinde Christi mit den großen politischen Überlegungen seiner Zeit. 1095 rief er den Ersten Kreuzzug ins Leben. Hier weiht der ehemalige Cluniazensermönch, der mit seinen Kreuzzugspredigten durch ganz Frankreich zog, den Altar der Abteikirche von Cluny.
Roger II. von SizilienDer erste gekrönte König von Sizilien (hier im Mosaik in einer Kirche in Palermo) herrschte über ein Reich, in dem sich arabische, griechische und lateinisch-christliche Einflüsse mischten. Rogers Vater wurde von einem muslimischen Chronisten als der Erste bezeichnet, der einen Kreuzzug nach Jerusalem vorschlug, doch das ist nicht ausreichend belegt.
Alfons VI. von Kastilien und LeónDie Kreuzzüge waren nicht nur auf den östlichen Mittelmeerraum ausgerichtet. Auch die Iberische Halbinsel war aufgrund der Konflikte zwischen christlichen und islamischen Herrschern ein Kriegsschauplatz, wo christliche Soldaten für ihr Seelenheil kämpfen konnten. Alfons VI., auch»El Bravo«genannt, war einer der ersten Anführer der Reconquista.
Das muslimische SpanienMit dem Bau des Torre del Oro in Sevilla wurde in den 1220er Jahren begonnen, als die Almohaden in der Stadt herrschten. Der Torre del Oro war ein Kettenturm, mit dessen Kette der Zugang zur Stadt über den Guadalquivir blockiert werden konnte. Die obere Konstruktion wurde ergänzt, nachdem Sevilla gegen Ende der Reconquista an die Christen gefallen war.
Das Wahre KreuzDieses Reliquiar enthält einen angeblichen Splitter des Kreuzes, an dem Jesus starb. Zur Zeit der Kreuzzüge gab es viele derartige Reliquien, das berühmteste Stück des Wahren Kreuzes befand sich in der Grabeskirche. In der Schlacht bei Hattin wurde es von Sultan Saladin erbeutet und ist seitdem verschollen.
Crac des ChevaliersVom Johanniterorden auf einem Berg zwischen Tripolis und der syrischen Stadt Homs erbaut, bewachte die Festung den Zugang zur Grafschaft Tripolis. Mit ihren dicken Mauern und gewaltigen Ausmaßen war die Festung ein wichtiger Bestandteil der Verteidigungsanlagen der Kreuzfahrerstaaten. In der Burg konnte eine Garnison mit mehreren Tausend Mann untergebracht werden. 1271 wurde sie von den Mamluken eingenommen.
Die Hochzeit Fulkos von Anjou mit Königin MelisendeGraf Fulko von Anjou wurde von Frankreich nach Jerusalem zurückbeordert, um Melisende zu heiraten, die Tochter von König Baldiun II. Nach dessen Tod wurde er König von Jerusalem. Die Hochzeit ist hier in einer spätmittelalterlichen Buchmalerei dargestellt. Die Ehe war anfangs schwierig, weil Melisende sich nicht zugunsten ihres Mannes aus der Politik zurückziehen wollte.
Eleonore von AquitanienEleonore von Aquitanien und ihr Mann Ludwig VII. brachen in den 1140er Jahren gemeinsam gen Osten auf, doch der Kreuzzug endete mit einer militärischen Niederlage und einem Skandal. Die Ehe wurde bald nach ihrer Rückkehr annulliert.
Hermann von SalzaZusammen mit den Tempelrittern und Johannitern gehörten die Deutschordensritter zu den wichtigsten geistlichen Ritterorden, deren Mitglieder sich dem Kreuzzug gegen Ungläubige verschrieben hatten. Hermann von Salza war einer ihrer erfolgreichsten Anführer: politisch gewitzt und ein unermüdlicher Diplomat, der mit dem Kaiser des Heiligen Römischen Reichs genauso gut umzugehen wusste wie mit dem Papst.
Friedrich II. und al-KamilDer Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und der Sultan von Ägypten unterhielten dank Friedrichs Offenheit und Interesse an der arabischen Kultur und Wissenschaft enge diplomatische Beziehungen. Gemeinsam handelten sie ein Friedensabkommen aus, durch das Jerusalem von 1229 bis 1244 wieder unter christlicher Herrschaft stand.
Die Belagerung von AkkonNach dem Verlust Jerusalems wurde Akkon zur Hauptstadt des Kreuzfahrerreichs. Das Bild zeigt die Belagerung von 1189 bis 1191, bei der die Kreuzfahrer versuchten, die Stadt von Saladin zurückzuerobern. Das Gerät vor der Mauer ist ein Trebuchet, ein riesiges Katapult, mit dem man große Steine und andere Geschosse über weite Strecken schleudern konnte.
Innozenz III.Während Innozenz’ Pontifikat wurde der Kreuzzugsgedanke auf alle Feinde und Gegner der Kirche ausgedehnt, wo immer man sie vermutete. Häretiker in Frankreich wurden genauso zur Zielscheibe wie Heiden im Baltikum und die griechischen Christen im Byzantinischen Reich. Innozenz prägte die Kreuzzugsbewegung mehr als jeder andere Papst seit Urban II.
SaladinSaladin machte eine glänzende Karriere beim Militär und stieg zum Sultan von Ägypten und Syrien auf. Er setzte sich leidenschaftlich für den Dschihad ein und errang 1187 seinen größten Sieg über die Kreuzfahrer im Heiligen Land, als er ein fränkisches Heer in der Schlacht bei Hattin vernichtete und Jerusalem wieder unter muslimische Herrschaft brachte.
Die Pferde von San MarcoUnter den Schätzen, die die venezianischen Plünderer unter dem Befehl Dandalos aus Konstantinopel in ihre Heimat mitnahmen, waren vier antike Bronzepferde. Auf der Loggia des Markusdoms stehen heute Replikate, die Originale sind im Dommuseum ausgestellt.
Die Eroberung Konstantinopels1204 plünderten und brandschatzten venezianische und französische Kreuzfahrer die byzantinische Hauptstadt Konstantinopel. Ein politisches Fiasko und peinlicher Zwischenfall für das Papsttum, der absolut nichts dazu beitrug, die Sache der Kreuzfahrer im Heiligen Land voranzubringen. Das Byzantinische Reich erholte sich nie wieder von diesem Überfall.
Die Seemacht VenedigVenedig entwickelte sich zur Zeit der Kreuzzüge zur führenden Seemacht der westlichen Welt, nicht zuletzt dank der Galeeren, die in den Werften der Stadt gebaut wurden. Die Schiffe, die die Kraft der Ruderer mit Segeln kombinierten, transportierten im gesamten Mittelmeerraum Waren, Geld und Truppen.
Mamluken gegen MongolenDie Mamluken waren ehemalige Sklavensoldaten, die 1250 die Kontrolle über Ägypten erlangten. Die Rivalität mit den Mongolen um die Vorherrschaft erreichte 1260 mit der Schlacht bei ’Ain Dschalut ihren Höhepunkt. Die Mamluken brachten den Mongolen eine vernichtende Niederlage bei und machten sich anschließend daran, die Kreuzfahrerstaaten zu überfallen und zu zerschlagen.
Das Wiederaufleben der KreuzzügeIm Verlauf des 14. Jahrhunderts wurden immer wieder Pläne zur Rückeroberung der verlorenen Kreuzfahrerstaaten geschmiedet. Die abgebildete Karte von Pietro Vesconte illustriert einen solchen Plan, den der venezianische Staatsmann und Händler Marino Sanudo der Ältere ausgearbeitet hat.
Ludwig IX.Der heiligengleiche König von Frankreich war ein begeisterter, wenn auch nicht sonderlich erfolgreicher Kreuzfahrer. Beim katastrophal verlaufenden Kreuzzug in Ägypten wurde Ludwig 1250 auf dem Rückzug gefangen genommen und musste freigekauft werden. Er starb 1270 auf seinem zweiten Kreuzzug in Nordafrika. Ludwig hatte eine Allianz mit den Mongolen gegen die Mamluken angestrebt, die jedoch im Sande verlief.
Die Mauern von AkkonDieses romantisierende Gemälde zeigt die Einnahme Akkons 1291 durch ein Heer der Mamluken. Rückblickend bedeutete der Fall Akkons auch das Ende aller Kreuzfahrerstaaten in Syrien und Palästina. Isoliert und überfordert mussten die Kreuzfahrer Akkon unter großen Verlusten räumen und errichteten ein Ersatzkreuzfahrerreich auf Zypern.
Einleitung
Ein Epos, geschrieben mit Blut …
Kurz vor dem Osterfest des Jahres 1188 begab sich der Erzbischof von Canterbury nach Wales, um dort Soldaten zu rekrutieren. Tausende Kilometer entfernt war im östlichen Mittelmeerraum ein Krieg ausgebrochen, und der Erzbischof, der den Namen Balduin von Forde trug, hatte den Auftrag erhalten, ein paar Tausend kampffähige Männer für eine Armee auszuheben, die dort zum Einsatz kommen sollte.
Keine leichte Aufgabe, sollte man meinen. Wer sich für die Armee entschied, musste für die Reise in den Osten und wieder zurück mindestens achtzehn Monate zu Wasser und zu Land einkalkulieren. Eine teure Angelegenheit. Die Wahrscheinlichkeit, Schiffbruch zu erleiden, ausgeraubt zu werden, in einen Hinterhalt zu geraten oder an einer Krankheit zu sterben, war hoch, lange bevor das Ziel – das christliche Königreich Jerusalem in Palästina – überhaupt erreicht war. Die Chancen, mit fetter Beute nach Hause zu kommen, waren verschwindend gering. Tatsächlich war die Aussicht, überhaupt nach Hause zu kommen, verschwindend gering.
Der feindliche Befehlshaber – der kurdische Sultan von Ägypten und Syrien, Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, besser bekannt als Saladin – war ein überaus fähiger Mann, der den Armeen der westlichen Christen, die allgemein als «die Franken» bekannt waren, bereits einige verheerende Niederlagen beigebracht hatte. Im vergangenen Sommer erst hatte er ein riesiges Heer auf dem Schlachtfeld vernichtend geschlagen, den König von Jerusalem gefangen genommen, die heilige Reliquie des Wahren Kreuzes Christi erbeutet und eine christliche Regierung aus der Stadt Jerusalem vertrieben. Die einzige sichere Belohnung für die Kreuzfahrer, die sich an Saladin rächen wollten, würde im Jenseits eingelöst werden, wo, wie man hoffte, Gott wohlwollend auf die Teilnehmer schauen und ihnen einen reibungsloseren und schnelleren Eintritt ins Paradies gewähren würde.
In einem religiösen Zeitalter, das davon besessen war, Sünden zu zählen und zu vergeben, war das eine weitaus verlockendere Aussicht als heute, und doch hatte Balduin alle Hände voll zu tun, als er sich mit seinem Gefolge von Stadt zu Stadt durch Wales schleppte: predigen, überzeugen und Begeisterung für einen Krieg gegen einen Feind wecken, den keiner seiner Zuhörer je gesehen hatte, in einem Land, in dem vernachlässigbar wenige jemals gewesen waren – außer vielleicht in ihrer Fantasie.
In der kleinen Stadt Aberteifi in Westwales kam es nach Balduins Ankunft zu einem Streit zwischen zwei jungen Eheleuten. Der Ehemann hatte beschlossen, sich zum Kreuzzug zu melden. Seine Frau beharrte darauf, dass er nirgendwo hingehen würde. Laut dem Schriftsteller Gerald von Wales, der mit Erzbischof Balduin reiste und einen lebendigen Bericht über die Reise verfasste (dabei allerdings leider die Namen des Paares unterschlug), hielt die Frau «ihren Mann fest an seinem Umhang und seinem Gürtel und hinderte ihn vor aller Augen daran, zum Erzbischof zu gehen».
Sie gewann den Kampf. Doch, erzählt Gerald weiter, konnte sie den Sieg nur kurz genießen: «Drei Nächte später hörte sie eine schreckliche Stimme sagen: ‹Du hast mir meinen Diener genommen, deshalb soll dir genommen werden, was du lieben musst.›» In jener Nacht wälzte sich die Frau unruhig im Schlaf und erstickte ihren kleinen Sohn, der mit ihr im Bett lag – eine Tragödie und, dessen wurde sie gewahr, ein Omen. Erzbischof Balduin war inzwischen weitergezogen, und so suchte das verzweifelte Paar den Diözesanbischof auf, um ihm von dem schrecklichen Unfall zu berichten und um Vergebung zu bitten. Es gab nur eine Lösung. Sie wussten es alle. Die Christen, die sich bereit erklärt hatten, gegen Saladin zu kämpfen, machten ihren Status als vereidigte, heilige Krieger in der Armee Christi durch ein Stoffkreuz auf dem Ärmel ihrer Kleidung für jeden sichtbar. Die Frau nähte das Kreuz ihres Mannes selbst an.
Dies ist ein Buch über die Kreuzzüge: die Kriege, die christliche, päpstlich sanktionierte Heere gegen die vermeintlichen Feinde Christi und der Kirche von Rom im Mittelalter führten. Der Titel Kreuzfahrer beschreibt sowohl das Thema als auch meinen Ansatz. Im Mittelalter gab es lange Zeit kein Wort, um «die Kreuzzüge» so zu beschreiben, wie wir sie heute verstehen: eine Reihe von acht oder neun großen Expeditionen von Westeuropa ins Heilige Land, ergänzt durch eine Reihe weiterer, indirekt damit verbundener Kriege, die von den sonnenverwöhnten Städten an der nordafrikanischen Küste bis zu den kältestarren Wäldern des Baltikums geführt wurden. Doch schon in den frühesten Tagen dieses Phänomens gab es ein Wort für diejenigen, die daran teilnahmen. Die Männer und Frauen, die in der Hoffnung auf spirituelle Erlösung in diese Bußkriege zogen, wurden im Lateinischen als crucesignati bezeichnet – als jene, die mit dem Kreuz gezeichnet waren. In diesem Sinne ging die Idee des Kreuzfahrers der Idee der Kreuzzüge voraus, und das ist einer der Gründe, warum ich mich für Kreuzfahrer entschieden habe. Noch wichtiger ist jedoch, dass der Titel Kreuzfahrer für die Art des Storytellings steht, mit der ich dieses Buch mit Leben füllen möchte. Das Buch ist komponiert als eine Folge von Episoden über Menschen, die in die Kreuzzüge verwickelt waren. Sie sind chronologisch geordnet, um ein Tableau zu erzählen, das den gesamten Zeitraum umfasst. Die Personen, die ich mit der Aufgabe betraut habe, uns auf die Reise mitzunehmen, sind die Kreuzfahrer vom Buchtitel, und sie bilden ein Ensemble, von dem ich hoffe, dass es uns in seiner Gesamtheit die Geschichte der Kreuzzüge aus erster Hand erzählen kann.
Bei der Auswahl dieser Kreuzfahrer habe ich mein Netz bewusst weit ausgeworfen. Ich habe Frauen und Männer ausgewählt, Christen der östlichen und westlichen Kirchen, sunnitische und schiitische Muslime, Araber, Juden, Türken, Kurden, Syrer, Ägypter, Berber und Mongolen. Es sind Menschen aus England, Wales, Frankreich, Skandinavien, Deutschland, Italien, Sizilien, Spanien, Portugal, dem Balkan und Nordafrika dabei. Sogar Wikinger. Einige spielen Hauptrollen, andere haben nur Gastauftritte. Aber dies ist ihre Geschichte.
Das Ergebnis ist, als Ganzes betrachtet, eine erklärtermaßen pluralistische Geschichte der Kreuzzüge, deren historiografischer Fokus nicht ausschließlich auf der Gründung, dem Überleben und dem Zusammenbruch der Kreuzfahrerstaaten in Palästina und Syrien und auf den Kriegen gegen Muslime in diesen Regionen liegt. Vielmehr wird dieser zentrale Strang der Geschichte eingebunden in den Kontext der gleichzeitigen Geschichte sowohl der offiziellen Kreuzzüge auf der Iberischen Halbinsel, im Baltikum, in Osteuropa, Südfrankreich, Sizilien und Anatolien als auch der Geschichte inoffizieller Volksbewegungen andernorts. Erzähltechnisch bedeutet dies, dass unsere Geschichte von einer Vielzahl von Menschen getragen wird, einem Kollektiv, das gemeinsam ein Kaleidoskop faszinierender und polychromer Perspektiven auf ihr gemeinsames Zeitalter bietet.
Das ist jedenfalls das Ziel. Natürlich bin ich mir, wenn ich dieses Buch vorlege, der vielen hervorragenden Studien über die Kreuzzüge, die in den letzten Jahren geschrieben wurden, sehr bewusst – und zutiefst dankbar dafür. Die vielleicht beste ist trotz ihres Alters Sir Steven Runcimans brillante dreibändige Chronik A History of the Crusades (1951–1954, dt.: Geschichte der Kreuzzüge, 1957–1960). Aber auch Publikationen jüngeren Datums sind ein Gewinn für den Leser: Christopher Tyermans God’s War: A New History of the Crusades (2006), Thomas Asbridges The Crusades: The War of the Holy Land (2010, dt.: Die Kreuzzüge, 2010), Jonathan Phillips’ Holy Warriors: A Modern History of the Crusades (2010, dt.: Heiliger Krieg, 2011), die dritte Auflage von The Crusades: A History (2014, dt.: Die Kreuzzüge, 2016) des verstorbenen, großen Jonathan Riley-Smith und Paul M. Cobbs The Race for Paradise: An Islamic History of the Crusades (2014, dt.: Der Kampf ums Paradies, 2015). Sie alle führen hervorragend durch diese Zeit, und obwohl ich mich in der vorliegenden Darstellung ausschließlich auf Zitate aus Primärquellen beschränkt habe, war es doch sehr beruhigend, diese beispielhaft modernen Werke in meinem Bücherregal zu wissen – neben Hunderten weiteren Büchern und Artikeln, sowohl allgemeiner als auch fachlicher Art, die andere Wissenschaftler geschrieben haben. Ohne die Arbeit von Generationen von Kreuzzugshistorikern und -historikerinnen in Vergangenheit und Gegenwart wäre dieses Buch schlicht nicht möglich gewesen.
Kreuzfahrer ist in drei Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt behandelt die Zeit, in der sich die vielen Denkweisen, Aktivitäten und Kriegstechniken, die die Kreuzzugsbewegung beeinflussten, ab den 1060er Jahren entwickelten. Er führt hin zur erstaunlichen Geschichte des Ersten Kreuzzugs und gipfelt im Fall Jerusalems im Juli 1099.
Der zweite Teil des Buches greift die Geschichte einige Jahre später, zu Beginn des 12. Jahrhunderts, wieder auf. Er zeichnet das Wachstum und die Entwicklung der Kreuzfahrerstaaten in Syrien und Palästina nach, behält die Kriege zwischen christlichen Herrschern und den islamischen Mächten in Spanien (bekannt als Reconquista) im Auge und untersucht die Ausbreitung der Kreuzzüge über diese beiden Schauplätze hinaus in ein neues Gebiet an der Ostseeküste. Die Erzählung dieses Abschnitts ist von zwei großen Krisen geprägt: dem Fall von Edessa im Jahr 1144, der den Zweiten Kreuzzug auslöste, und dem Verlust Jerusalems an Saladin im Jahr 1187, der den Dritten Kreuzzug provozierte.
Der letzte Teil des Buches beschreibt die verzweifelten Bemühungen der westlichen Christenheit, Jerusalem in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts zurückzuerobern, gefolgt vom Niedergang der Kreuzfahrerstaaten im Osten nach dem Aufstieg der mongolischen und mamlukischen Reiche. Es beschreibt auch die dramatische Ausbreitung und Politisierung der Kreuzzugsideologie und der Institutionen während und nach dem Pontifikat von Innozenz III. sowie den Prozess, als dessen Folge sich die Kreuzzüge gegen neue Feinde richteten: innerhalb und außerhalb der Kirche, real und imaginär. Das Buch erhebt den Anspruch, eine Geschichte ausführlich und umfassend zu erzählen, und deshalb endet Kreuzfahrer nicht 1291 mit dem endgültigen Zusammenbruch des Königreichs Jerusalem, sondern 1492 mit dem Abschluss der Reconquista und der Übertragung der Sehnsüchte und Energien der Kreuzzüge nach Westen in die Neue Welt. Ein kurzer Epilog skizziert die Überlieferung und den Wandel der Erinnerung an die Kreuzzüge bis in die Gegenwart.
Jedes Kapitel dieses Buches könnte eine vollständige Studie für sich sein und ist es in den meisten Fällen auch. Ich hoffe, dass das Buch die Leserinnen und Leser, die in das Thema neu einsteigen, dazu anregt, sich eingehender mit der Geschichte der Kreuzzüge zu befassen, und dass diejenigen, die schon einiges über diese Zeit gelesen haben, meine Vorgehensweise schätzen werden. Wie bei allen meinen Büchern ist es mir eine Herzensangelegenheit, dass Kreuzfahrer Wissensvermittlung und Entertainment gleichermaßen ist. Denn, wie Sir Steven Runciman einst schrieb: «Die romantische Geschichte der Kreuzzüge war ein Epos, das mit Blut geschrieben wurde.»
So war es, und so ist es. Lasst uns beginnen.
Dan Jones Staines-upon-Thames Frühjahr 2019
TEIL I
Entscheidung durch Gottesurteil
1
Der Graf und Imam
Er erkannte zwei Dinge, von denen er profitieren würde, eines für seine Seele und das andere für seinen materiellen Nutzen …
Graf Roger von Sizilien hob sein Bein und ließ einen Furz. «Bei der Wahrheit meiner Religion», rief er aus, «das nützt mehr als alles, was ihr zu sagen habt!»[1]
Seine Berater standen da wie begossene Pudel – ziemlich perplexe Pudel. Der Graf vor ihnen war Ende vierzig und bis auf die Knochen durchdrungen von den Erfahrungen seiner Feldzüge in Süditalien und auf den Inseln des zentralen Mittelmeers. Als junger Krieger war er von einem Schmeichler als «groß und gut gebaut, ein äußerst gewandter Redner, klug im Rat, weitblickend in der Planung der Dinge, die zu tun waren, heiter und angenehm zu jedermann» beschrieben worden.[2] Im mittleren Alter war er etwas härter geworden, und er war keiner, der seine Worte an Dummköpfe verschwendete.
Der Plan, den die Berater empfohlen hatten, klang eigentlich ganz gut, wie es bei Plänen von Höflingen oft der Fall ist, bevor sie durch die Kritik reizbarer Potentaten zerschmettert werden. Jenseits des Meeres, nicht weit von Sizilien – etwa 120 Kilometer am nächsten Punkt – lagen die Überreste dessen, was in der Antike Karthago, später als römische Provinz Africa und jetzt, im späten 11. Jahrhundert, Ifriqiya hieß.[*1] Seine Städte – darunter die Hauptstadt Mahdia (al-Mahdiyya) an der Küste und Kairouan (Qayrawan) im Landesinneren, wo die größten Philosophen und Naturwissenschaftler Nordafrikas seit vielen Generationen eine gewaltige Moschee und eine Schule besuchten – standen unter der wankenden Herrschaft einer zerfallenden Dynastie von muslimischen Berbern, die als Ziriden bekannt waren. Verschiedene arabische Beduinenstämme, die von Ägypten aus geschickt worden waren, um die Ziriden zu vertreiben, kontrollierten das Land. Die Lage war alles andere als stabil. Hier gab es warmes und fruchtbares Ackerland. Dort lagen wohlhabende Hafenstädte. Alles reif für die Eroberung? Rogers Berater sahen das so und empfahlen ihrem gereizten Oberherrn den Vorschlag eines Cousins, der in einer Quelle nur als «Balduin» bezeichnet wird.[3]
Dieser Balduin war in den Besitz eines großen Heeres christlicher Soldaten gekommen und sah sich nach einem gottlosen Ort um, den er erobern konnte. Er bat Roger um seinen Segen, nach Sizilien kommen und die Insel als Ausgangspunkt für eine Invasion nach Ifriqiya nutzen zu dürfen. «Ich werde Euer Nachbar sein», hatte er ausgerufen, als ob dies eine gute Nachricht wäre. Doch Roger von Sizilien hegte keine gutnachbarlichen Gefühle. Ifriqiya, so erwiderte er, werde zweifellos von verschiedenen Anhängern des Islam regiert, doch diese Ungläubigen seien zufällig eingeschworene Partner der Sizilianer in Abkommen, die den Frieden bewahrten und einen reichen Warenaustausch auf den Märkten und in den Häfen der Insel ermöglichten. Das Letzte, was er brauche, schimpfte er vor seinen versammelten Gefolgsleuten, sei ein Cousin, der seine Gastfreundschaft in Anspruch nehme und einen rücksichtslosen Krieg führe, der im Erfolgsfall den sizilianischen Handel stören und ihn im Misserfolgsfall viel Geld für militärische Unterstützung kosten würde.
Ifriqiya mochte tatsächlich verwundbar sein, aber wenn jemand das ausnutzen wollte, dann Roger selbst. Er hatte die letzten zweieinhalb Jahrzehnte – fast sein gesamtes Erwachsenenleben – damit verbracht, seine Herrschaft in der Region zu festigen, und es wäre in der Tat schwach gewesen, wenn er sie jetzt in Gefahr gebracht hätte, um irgendeinen dämlichen Plan zu verfolgen, ausgedacht von einem Verwandten, dessen Schweiß nie den Boden der Insel getränkt hatte.
Wenn dieser Balduin gegen Muslime kämpfen wolle, fand Roger, solle er sich einen anderen Teil des Mittelmeers suchen, um dort sein Unwesen zu treiben. Er könne aus dem Stand viele Orte nennen, die dem Einflussbereich Siziliens vorzuziehen wären. Also rief er Balduins persönlichen Gesandten zu sich und informierte ihn über seine Entscheidung. Wenn es seinem Herrn wirklich ernst sei, sagte er, dann sei es «die richtige Vorgehensweise, Jerusalem zu erobern».[4]
Und so fing alles an.
Roger, Graf von Sizilien, war der ultimative Selfmademan im Europa des 11. Jahrhunderts. Er wurde um das Jahr 1040 als jüngster von zwölf Söhnen eines kleinen Adligen aus der Normandie namens Tankred von Hauteville geboren. In Anbetracht des geltenden Erbrechts bedeutete schon die Geburt als zweiter Sohn eher eine lebenslange Belastung durch die Jagd nach Reichtum als ein leichtes Erbe: Elf Brüder vor sich zu haben, war eine Katastrophe. Doch gegen Ende des Jahrhunderts hatten die Normannen begonnen, sich ihren Weg durch Westeuropa zu bahnen. Im Jahr 1066 eroberten sie das sächsische England. Zur gleichen Zeit geriet Süditalien unter ihren Einfluss. Die Möglichkeiten für jüngere Söhne mögen in der Normandie selbst begrenzt gewesen sein, aber für den, der bereit war, seine Heimat hinter sich zu lassen, boten sie sich reichlich. Als junger Mann verließ Roger daher Frankreich und machte sich auf den Weg in ein Gebiet, das bereits viele seiner Verwandten und Landsleute angezogen hatte: die reichen, aber instabilen süditalienischen Regionen Kalabrien und Apulien.
Zehe und Ferse des italienischen Stiefels waren Gebiete mit reichen Ressourcen, aber unklaren Machtverhältnissen, in denen sich ein ehrgeiziger junger Mann mit Spaß an Politik und Kriegskunst einen Namen machen konnte. Andere Normannen aus dem Clan der Hauteville hatten hier bereits Erfolge im Kampf gegen die rivalisierenden Großmächte in der Region erzielt, vor allem gegen die byzantinischen Griechen und die römischen Päpste, die beide die Normannen mit Argwohn bis hin zur Besorgnis betrachteten. Zu den erfolgreichsten zählten Rogers Brüder Wilhelm Eisenarm, Drogo und der ungewöhnlich talentierte Robert Guiskard (das altfranzösische guischart bedeutet «listig» oder «verschlagen»). Als Roger eintraf, waren die beiden Ersteren bereits tot, und Robert Guiskard erhob Anspruch auf den Titel «Graf von Apulien und Kalabrien». Doch es gab noch viele andere Abenteuer zu erleben. Die Familie hatte sich die Menschen in Süditalien dadurch unterworfen, dass sie ihnen Nasen, Hände und Füße abhackte und die Augen ausstach.[5] Die Stammesgeschichte der Normannen erzählte von ihrer Abstammung von einem skandinavischen Kriegsherrn namens Rollo, der mit seiner Bekehrung zum Christentum vor allem sicherstellen wollte, dass die Männer aller möglichen Reiche vor ihm das Knie beugten.[6] Weder Roger noch Robert verloren jemals das Gespür der Wikinger für die Überzeugungskraft einer Schwertklinge.
Nicht alle waren von der normannischen Eroberung Süditaliens begeistert, was zu einem großen Teil auf ebendiesen Ruf übertriebener Brutalität zurückzuführen war. Nach Meinung eines bedeutenden Kirchenmannes jener Zeit waren die Normannen «das übelstriechende Gesindel der Welt … Söhne des Drecks, Tyrannen, die aus dem Pöbel aufgestiegen sind».[7] Doch ab der Mitte des Jahrhunderts wandelte sich diese Einstellung, da die späteren Päpste den Normannen nicht mehr so feindselig gegenüberstanden und sie allmählich als zwar grobschlächtige, aber praktisch nützliche potenzielle Verbündete betrachteten, die sie zur Förderung der Ziele Roms einsetzen konnten. Zu diesem Schluss kam das Papsttum teilweise unter Zwang: 1053 hatten die Normannen ein päpstliches Heer auf dem Schlachtfeld vernichtet und Papst Leo IX. gefangen genommen. Leos Nachfolger Papst Nikolaus II. übertrug der Familie Hauteville die Herrschaft über Kalabrien und Apulien und gestattete ihr, auf dem Schlachtfeld vor ihren Heeren ein päpstliches Banner[*2] zu hissen – eine Ehre, die er Robert Guiskard für ein Geschenk von vier Kamelen gewährte. Und dies war nicht nur eine Anerkennung des Status quo. Der Papst spekulierte darauf, dass eines Tages einer aus dem normannischen Clan «mit der Hilfe Gottes und des heiligen Petrus» auch Sizilien erobern und beherrschen könne: Die große, dreieckige Insel jenseits der Straße von Messina befand sich seit dem 9. Jahrhundert unter arabischer Herrschaft.[8] Eine normannische Inbesitznahme wäre ein großer Fortschritt in den päpstlichen Bestrebungen, ganz Süditalien sicher unter die Herrschaft der römischen Kirche zu bringen.[9] Wenn die Normannen das schaffen könnten, so die Überlegung, dann hätte sich all die Unruhe, die diese raubeinigen Nordmänner in den vielen Jahrzehnten seit ihrer Ankunft auf dem Festland verursacht hatten, womöglich tatsächlich gelohnt.
Auch Roger und sein Bruder Robert Guiskard waren sehr interessiert daran, Sizilien einzunehmen, wenn auch nicht aus denselben Gründen wie der Papst. Gott konnte man durchaus auch vor Ort etwa durch die Gründung und den Unterhalt von Mönchs- und Nonnengemeinschaften gefallen, die Christus lobten und die Feiertage der Heiligen hochhielten. Ein Expeditionskrieg zur Eroberung und Unterwerfung einer 2500 Quadratkilometer großen Insel mit einer fast 1500 Kilometer langen Küste und einer großen Vulkanregion in ihrem Zentrum war ein Akt der Frömmigkeit, der eine substanziellere, irdische Rechtfertigung erforderte.
Glücklicherweise lieferte Sizilien reichlich Gründe dafür. Die Insel, die im Winter feucht und im Sommer heiß war, verfügte über einige der besten Anbauflächen im Mittelmeerraum, auf denen mit den unter der Herrschaft der muslimischen Emire stark verbesserten landwirtschaftlichen Methoden gewaltige Mengen Getreide angebaut wurden. Reis, Zitronen, Datteln und Zuckerrohr gediehen prächtig. In sizilianischen Werkstätten wurden Baumwollstoffe und Papyri hergestellt. Fischer gingen in den ruhigen Gewässern ihrer Arbeit nach; Pilger aus dem muslimisch beherrschten Südspanien machten auf ihrem Weg zur Hadsch nach Mekka auf der Insel halt, um neue Kräfte zu sammeln. Küstenstädte wie Palermo, Syrakus, Catania, Messina und Agrigent waren wichtige Umschlagplätze im zentralen Mittelmeerraum, an denen Händler aus dem Nahen Osten und Nordostafrika ihre Geschäfte mit all jenen machen konnten, die auf den Handelsrouten durch Mittel- und Westeuropa unterwegs waren. Die einheimische Bevölkerung, die sich aus arabischen und berberischen Muslimen, griechisch-orthodoxen Christen und Juden zusammensetzte, bot eine lukrative Steuerbasis, wie die Emire durch die islamische Praxis bewiesen hatten, denjenigen Nicht-Muslimen, die nicht konvertieren wollten, eine als Dschizya bekannte Ungläubigensteuer aufzuerlegen.
Unter diesen Umständen fand das päpstliche Loblied auf die Eroberung Siziliens, dem Roger und Robert Guiskard 1059 lauschten, wohlwollendes Gehör. Der sizilianische Mönchschronist Gaufredus Malaterra berichtet:
Als dieser höchst angesehene junge Mann Roger … hörte, dass Sizilien in den Händen der Ungläubigen war … wurde er von dem Wunsch ergriffen, es zu erobern … Er erkannte zwei Dinge, von denen er profitieren würde, eines für seine Seele und das andere für seinen materiellen Nutzen, wenn er ein Land, das dem Götzendienst verfallen war, zur göttlichen Anbetung bringen könnte.[10]
Geld und Unsterblichkeit: Diese beiden zeitlosen Versuchungen erwiesen sich als absolut ausreichend, um Roger und Robert Guiskard in einer Reihe von Invasionen, mit denen sie in den frühen 1060er Jahren begannen, über die Meerenge von Messina zu locken. Die Übernahme Siziliens von den Arabern ging weder einfach noch schnell vor sich, doch als die normannischen Brüder sich ganz darauf konzentrierten, Seeblockaden zu errichten und zahlenmäßig kleine, aber im normannischen Kampfstil erfahrene Kriegerkontingente mit leichter Rüstung und schwerer Kavallerie, großen Holzschilden und Belagerungstürmen ins Land zu bringen, zeigte sich, dass man sich ihrer nur schwer erwehren konnte. Sie nutzten die Rivalitäten der verschiedenen islamischen Gruppierungen auf der Insel aus, die in der Vergangenheit gelegentlich christliche Söldner vom italienischen Festland angeheuert hatten und mehr als bereit waren, mit den normannischen Armeen zu kollaborieren, um ihre eigenen Ambitionen auf die politische Vorherrschaft zu fördern.[11] Und sie fanden Gefallen an einer niederträchtigen, aber effektiven psychologischen Kriegsführung: Sie vergewaltigten die Frauen ihrer Feinde oder schickten blutgetränkte Brieftauben, um ihre Siege zu verkünden. Palermo fiel schließlich 1072 nach fünfmonatiger Belagerung. Mitte der 1080er Jahre war der größte Teil der Insel unter normannischer Kontrolle. Der eingefleischte Abenteurer Robert Guiskard verließ die Insel, um im Byzantinischen Reich zu kämpfen und die normannische Herrschaft auf Dalmatien, Mazedonien und Thessalien auszudehnen, während sein jüngerer Bruder Roger als Graf von Sizilien mehr oder weniger nach Belieben regierte.
Im Jahr 1091 war die Eroberung Siziliens abgeschlossen und Roger genoss seine Rolle als einer der meistbewunderten christlichen Herrscher Europas: Für seine Töchter erhielt er Heiratsanträge von den Königen Frankreichs, des Römisch-Deutschen Reichs und Ungarns, errichtete auf der ganzen Insel Bistümer, die dem Papsttum (und nicht den östlichen Patriarchen der orthodoxen Kirche) unterstanden, und herrschte über eine Bevölkerung, die religiös und kulturell wie eh und je bunt gemischt war. Roger baute und förderte Kirchen und Klöster auf Sizilien – ein Akt konventioneller Frömmigkeit für jeden Herrscher dieser Zeit, insbesondere für einen, der eine unangenehme Menge menschlichen Blutes an seinen Händen hatte. Die Moschee in Palermo, die ursprünglich als byzantinische Basilika errichtet worden war, wurde erneut umgebaut, diesmal in eine Kirche, die dem lateinischen Ritus folgte. Gelegentlich scheint Roger besiegte muslimische Rivalen gezwungen zu haben, sich zum Christentum zu bekehren.[12] Das Dschizya-System wurde faktisch umgedreht, jetzt mussten nicht mehr die Christen, sondern die Muslime eine Steuer (das censum oder tributum) für das Recht auf ihren Unglauben zahlen.[13] Auch die Juden bekamen eine Abgabe auferlegt. Roger schuf jedoch keineswegs eine Theokratie. Kirchenmänner, die aus den europäischen Gebieten weiter im Norden nach Sizilien kamen, kritisierten, Roger erlaube Muslimen nicht nur, in seinen Armeen zu dienen, sondern (behaupteten sie zumindest) weigere sich aktiv, ihnen zu erlauben, sich zur Sache Christi zu bekehren.[14] Und der Graf selbst präsentierte sich seinen Untertanen gegenüber eher als Pragmatiker denn als Dogmatiker. Die als trifollari bekannten Kupfermünzen, die für seine christlichen Untertanen geprägt wurden, zeigten Roger als glorreichen christlichen Ritter zu Pferd mit Heiliger Lanze und trugen die lateinische Inschrift «Graf Roger» (roqerivs comes).[15] Doch jeder Gold-tari – eine Münze, die für seine muslimischen Untertanen geprägt wurde – trug die arabische Inschrift: «Es gibt keinen Gott außer Allah, Mohammed ist der Prophet Allahs.» Andere arabische Münzen Rogers sowie seine Urkunden in derselben Sprache bezeichnen ihn als imam, malik oder sultan: Herr, Souverän oder König.[16]
Was aber soll man von der verwirrenden Geschichte halten, dass Roger sich weigerte, seinen Erfolg in Sizilien durch einen Einfall in Ifriqiya zu mehren? Überliefert hat uns diese Information der Gelehrte Ibn al-Athir, der zwischen 1160 und 1233 in Mossul (im heutigen Irak) lebte und dessen Meisterwerk eine gelehrte Chronik mit dem selbstbewussten Titel al-Kamil fi t-ta’rih war: Das vollkommene Geschichtswerk.
Ibn al-Athir war ein seriöser Historiker, der sich mit mehreren Hunderttausend Wörtern einer Geschichte der Welt widmete, die mit der Schöpfung begann und sich bis zu den politischen und militärischen Kämpfen der größeren islamischen Welt – äußeren wie inneren – in seiner eigenen Lebenszeit fortsetzte, auf die er einen panoptischen und oft höchst aufschlussreichen Blick hatte. Angesichts der Zeit, in der er lebte, verfolgte er die Kreuzfahrer und ihre Motive natürlich mit großem Interesse, und er machte sich ernsthafte Gedanken über die Ursprünge der heiligen Kriege, die gerade spektakulär und immer wieder im Mittelmeerraum aufflammten. Seine Entscheidung, Roger von Sizilien (den er als grobschlächtig, stinkend und zynisch charakterisiert – der Archetyp des Kreuzfahrerfürsten schlechthin) die Verantwortung zuzuschieben, ist gewichtig, auch wenn sie nicht ganz für bare Münze genommen werden sollte.[*3]
Und seine Figur des «Balduin» ist wahrscheinlich als Hinweis auf Balduin I., den künftigen König von Jerusalem, zu verstehen, aber es gibt keine Belege dafür, dass dieser Austausch tatsächlich stattgefunden hat.
Möglicherweise vermischte Ibn al-Athir in seinem Bericht das, was er im Nachhinein über die Ursprünge der Kreuzzüge im Heiligen Land erfuhr, mit einer bestimmten Geschichte von eher lokalem Ursprung und Kolorit. Dem Chronisten Malaterra zufolge wurde Ifriqiya im Jahr 1087 von einem amphibischen Heer angegriffen, das Kaufleute aus Pisa aufgestellt hatten, «die sich auf den Weg gemacht hatten, um in Afrika Geschäfte zu machen, und dabei einige Verletzungen erlitten hatten».[17] In einer weit weniger grotesken und farbenfrohen Erzählung als der von Ibn al-Athir schreibt Malaterra in sachlichem Ton, dass die Pisaner Roger die Krone von Ifriqiya angeboten hätten, wenn er ihnen helfen würde, die Stadt Mahdia einzunehmen. Roger lehnte mit der Begründung ab, dass er erst vor relativ kurzer Zeit einen Friedensvertrag mit den dortigen Machthabern geschlossen hatte. Jerusalem erwähnte er nicht. Malaterra zufolge schlossen die Pisaner selbst einen Vertrag mit dem ziridischen Herrscher und akzeptierten eine Zahlung, damit sie Mahdia in Ruhe ließen.
Doch es steckt noch mehr dahinter. Ibn al-Athir stellt seine Geschichte über Graf Roger und den Staat Ifriqiya in einen breiten mediterranen Kontext. Etwa zur gleichen Zeit, als die Normannen Sizilien eroberten und die Küste von Ifriqiya bedrohten, «nahmen sie auch die Stadt Toledo und andere Städte Spaniens ein … Später sollten sie noch andere Teile erobern, wie ihr sehen werdet.»[18] Und das taten «sie» tatsächlich. In Spanien, Nordafrika, auf den Mittelmeerinseln und anderswo waren in den Jahrzehnten vor dem Ersten Kreuzzug Zusammenstöße zwischen rivalisierenden Herrschern, die verschiedenen Religionen angehörten, an der Tagesordnung.
Hier handelte es sich nicht um Glaubenskriege – die Religion spielte gegenüber kommerziellen und geopolitischen Erwägungen oft eine klar untergeordnete Rolle.[19] Aber es waren Kriege zwischen religiösen Menschen, und sie hatten generationenübergreifende Folgen, die noch zu Ibn al-Athirs Zeiten weithin sichtbar waren. Das Zusammentreffen von Kriegen, die um Territorien geführt wurden, und Kriegen, die auf der Grundlage von Glauben und Dogmen mit dem Ziel der spirituellen Vorherrschaft geführt wurden, sollte eine Schlüsselrolle in den mehr als 200 Jahren des Konflikts spielen, der sich in erster Linie als Kampf um den einen wahren Glauben darstellen sollte.
Fußnoten
*1 Heute der östliche Maghreb: jener Teil der nordafrikanischen Küste, der den Nordosten Algeriens, Tunesien und den nordwestlichen Teil Libyens umfasst.
*2 Einige Jahre später bekam ein weiterer normannischer Herrscher ein päpstliches Banner gesandt: Wilhelm der Bastard, Herzog der Normandie, ließ es vor seinen Truppen wehen, als er 1066 in England einfiel.
*3 Interessanterweise war Rogers demonstrative Flatulenz ein Detail, das nicht nur Ibn al-Athir auffiel. Gaufredus Malaterra berichtet von einem normannischen Heer, das 1064 Palermo belagerte und während dieses Feldzugs von Taranteln geplagt wurde. Jeder, der von ihnen gestochen wurde, fand sich mit Gas gefüllt und litt so sehr, dass er nicht verhindern konnte, dass dasselbe Gas mit einem ekelhaften Rasseln aus seinem Anus austrat. Kenneth B. Wolf (Übers.), The Deeds of Count Roger of Calabria and Sicily and of his Brother Duke Robert Guiscard: by Geoffrey Malaterra, Ann Arbor 2005, S. 114.
2
Dichter und Kleinkönige
Jetzt, da sie stark und dazu in der Lage sind, wollen die Christen mit Gewalt zurückgewinnen, was sie verloren haben …
Als Sizilien in den 1070er Jahren peu à peu von den Normannen eingenommen wurde und die Insel Stadt für Stadt den Angriffen der barbarischen Soldaten des Grafen Roger mit ihren Schilden, die wie riesige Tränentropfen aussahen, zum Opfer fiel, sammelte ein junger muslimischer Dichter seine Familie um sich und floh. Sein Name war Ibn Hamdis (ʿAbd al-Jabbar ibn Hamdis), er war gerade einmal vierundzwanzig Jahre alt. Im Jahr 1054 war er in Syrakus zur Welt gekommen und als Sohn einer wohlhabenden Familie in vornehmer Nachbarschaft aufgewachsen. Seine literarische Ausbildung gab ihm für sein Leben eine Gewandtheit in der beliebten arabischen Versdichtung mit, die zu jener Zeit ein Ausdruck der Hochkultur war. Dieses Talent ermöglichte es ihm, der Zerstörung, dem Schmerz und dem Verlust, die er in seinem langen und ereignisreichen Leben erfahren sollte, einen Sinn zu geben. Es verschaffte ihm Renommee und Zugang zu den vielen gelehrten Höfen des islamischen Mittelmeerraums.
Der Abschied von Sizilien war ein schwerer Schlag für seine Seele, und er trauerte sein Leben lang um die quirlige Insel, die doch seine Heimat war. «Ich bin aus dem Paradies verbannt worden», schrieb er einmal. Nostalgie und Heimweh durchdrangen seine Gedichte, die er bis weit über seinen achtzigsten Geburtstag hinaus verfasste.[1] Doch so schmerzhaft das Exil auch war – es hatte auch seine Vorteile. Ibn Hamdis ging nach Westen und ließ sich als Begleiter von Muhammad al-Muʿtamid ibn Abbad anstellen, dem König der taifa von Sevilla, einem der größten Kunstmäzene seiner Zeit. Al-Muʿtamid, der sich seinem vierzigsten Geburtstag näherte, als Ibn Hamdis eintraf, war selbst ein begnadeter Dichter; seine Wortgewandtheit hatte er von seinem brutalen, aber eloquenten Vater al-Muʿtadid geerbt, dessen unerbittliche Feldzüge Sevilla zu einem der mächtigsten Staaten der Region gemacht hatten und dessen Methoden im Umgang mit seinen Feinden geradezu tückisch waren – beispielsweise ließ er eine Gruppe von Diplomaten, die ihn besuchten, in seinem Palastbad ersticken.[2] Al-Muʿtamid war ein etwas weniger verschlagener Herrscher als sein Vater und ein begabterer Verseschmied.[3] Er nahm Ibn Hamdis als einen von mehreren poetischen Sparringspartnern auf und setzte ihn auf seine Gehaltsliste. So ließ sich der sizilianische Exilant an einem der intellektuellsten und sinnlichsten Höfe des Westens nieder, wo die eigentlich unerlaubten Vergnügungen des Weins und des zwanglosen Geschlechtsverkehrs frei zugänglich waren und das Leben, wie er schrieb, «nur dann entschuldbar ist, wenn wir an den Ufern des Vergnügens wandeln und jede Zurückhaltung aufgeben».[4] Ibn Hamdis sehnte sich ewig nach seiner Heimat, aber die Situation war, zumindest momentan, gut.
Die Vormachtstellung Sevillas war relativ neu. Hätte ein junger muslimischer Literat ein Jahrhundert zuvor in der Region Zuflucht gesucht, wäre er, ohne zu zögern, nach Córdoba, in die regionale Hauptstadt des Umayyaden-Kalifats, geeilt: eine Megacity mit einer halben Million Einwohnern und eine der fortschrittlichsten, ehrfurchtgebietendsten Metropolen der ganzen Welt, in der Naturwissenschaftler, Astrologen, Philosophen und Mathematiker die Geheimnisse des Universums erforschten, während Handwerker und Architekten die Grenzen der künstlerischen Perfektion ausloteten. Doch 1031 war das Umayyaden-Kalifat zusammengebrochen, und Córdoba war in geistigem Stillstand versunken, seine Bibliotheken waren geplündert, seine Bücher verbrannt und seine berühmten Werkstätten lahmgelegt.
Aus diesem Vakuum heraus entstanden mehrere Dutzend kleine, nominell unabhängige Königreiche – taifas –, von denen Sevilla das wichtigste war (die anderen waren Málaga und Granada, Toledo, Valencia, Denia, die Balearen, Saragossa und Lleida). Die taifa von Sevilla umfasste einen großen Teil des islamischen Südspaniens (al-Andalus). Die Stadt Sevilla, die der taifa ihren Namen gab, lag etwa 200 Kilometer nördlich der Straße von Gibraltar und war rund um einen alcazar (Burg oder Palast) am Ufer des Guadalquivir organisiert. Sevillas Herrschaftsgebiet erstreckte sich von Silves und der Algarve an der Atlantikküste des heutigen Portugal bis nach Murcia im Osten. Unter der Herrschaft von al-Muʿtamids Dynastie, den Abbadiden, hatte Sevilla viele der umliegenden taifas geschluckt und sich gutes Ackerland, geschäftige Hafenstädte und strategische Handelswege, die Nordafrika mit dem europäischen Festland verbanden, einverleibt. Die Stadt war berühmt für die Qualität ihrer Musikinstrumente, karmesinrote Farbstoffe, Zuckerrohr und Olivenöl. Die gängige Haltung der herrschenden Schicht hatte schon al-Muʿtamids Vater in Versen beschrieben: «Ich teile meine Zeit zwischen harter Arbeit und Freizeit auf,/die Morgenstunden für die Staatsgeschäfte, die Abende für das Vergnügen!»[5]
Die Herrschaft al-Muʿtamids markierte den Höhepunkt der Macht Sevillas, und wäre er ein glücklicherer Herrscher gewesen oder hätte er sich anderen Herausforderungen stellen müssen, hätte er möglicherweise die Grenzen Sevillas immer weiter ausgedehnt, bis er alle taifas zu einem Gebilde vereint hätte, das dem Kalifat der Umayyaden, das kurz vor seiner Geburt zusammengebrochen war, wieder ähnelte. Stattdessen lenkte er Sevillas Geschicke bei dessen kläglichem Zerfall, den vor allem ein König vom anderen Ende Hispaniens herbeiführte: Alfons VI. von Kastilien und León.
Rund 400 Kilometer nordnordöstlich von Sevilla liegen die hoch aufragenden, mit vielen Türmen gesicherten Mauern von Toledo. Die einst mächtige Hauptstadt des Westgotenreiches rühmte sich unter jetzt islamischer Herrschaft prächtiger Brücken und öffentlicher Bäder, Marktplätze und Moscheen. Toledo lag am Ufer des breiten, rauschenden Flusses Tagus (Tejo/Tajo) – der längsten Wasserstraße Iberiens, die in den Montes Universales entspringt und nach 1000 Kilometern bei Lissabon in den Atlantik mündet. Das Tal und das Becken des Tejo waren Grenzland, eine umkämpfte Zone, jenseits derer das von den christlichen Königen Nordspaniens kontrollierte Gebiet lag. Wie im Süden war das Land zwischen rivalisierenden Herrschern aufgeteilt, die zwar eine gemeinsame Religion hatten, sich aber ständig um die Vorherrschaft stritten. Galicien, León, Kastilien, Aragon, Navarra und Barcelona waren die bekanntesten dieser Staaten im Norden. Und genau wie im Süden überragten ein Staat und ein Herrscher die anderen an Macht und Einfluss.
Dieser Herrscher war von 1072 bis zu seinem Tod im Jahr 1109, an der Schwelle zu seinem siebzigsten Geburtstag, König Alfons VI. Er trug den Beinamen «El Bravo» und war entschlossen, diesem Namen Ehre zu machen. Als Inhaber der Kronen von Kastilien und León herrschte er auch über Galicien und Teile von Navarra. Gemessen am Territorium und an Ansehen war er der bedeutendste christliche Monarch südlich der Pyrenäen. Ein Chronist bewunderte ihn als «in jeder Hinsicht katholisch» und «so furchteinflößend für die Bösewichte, dass sie es nicht wagten, sich vor ihm zu zeigen».[6] Ein anderer schrieb, er sei «sowohl im Urteil als auch in den Waffen so stark, wie man es nur selten bei sterblichen Menschen findet».[7]
Dies war ein zweifellos konventionelles Lob (und Alfons hat in der Erinnerung der Spanier einen weitaus schwächeren und weniger romantischen Eindruck hinterlassen als sein zeitweiliger Gefolgsmann Rodrigo Díaz de Vivar, besser bekannt als El Cid), aber es spiegelt dennoch die Tatsache wider, dass Alfons den Norden etwa ebenso fest im Griff hatte wie al-Muʿtamid die taifas im Süden. Er war an die Macht gekommen, nachdem er, um Galicien zu erobern, seinen jüngeren Bruder García gestürzt hatte und anschließend vom gewaltsamen Tod seines älteren Bruders Sancho profitieren konnte, der während einer Belagerung heimtückisch ermordet wurde. Im Laufe seines langen Lebens hatte er fünf Ehefrauen und zwei Konkubinen, kämpfte in zahlreichen Schlachten gegen christliche und muslimische Feinde und sammelte eine beeindruckende Anzahl grandioser Titel, darunter ab 1077 den Beinamen imperator totius Hispaniae (Kaiser von ganz Spanien). Dieser Ehrentitel zeugte eher von Ehrgeiz als von Genauigkeit: Sein Reich erstreckte sich von der Atlantikküste Galiciens im Westen bis nach Barcelona im Osten und war jenseits des Tejo nie ganz gesichert, wo al-Muʿtamid und mehrere andere taifa-Könige Alfons massive finanzielle Tribute, die sogenannten parias, zahlten, um in Frieden gelassen zu werden. Auch wenn der Titel die politische Realität nicht ganz widerspiegelte, so gab er doch die Richtung vor, in die Alfons strebte. Er war fest entschlossen, die Grenzen seines Reiches zu erweitern, und es musste schon ein kühner Herrscher sein, der es wagte, sich ihm in den Weg zu stellen.
In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts förderte der päpstliche Hof die Ambitionen von Alfons und anderen christlichen Fürsten. Es gab natürlich uralte historische Verbindungen zwischen Rom und Spanien. Hispania war seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. bis zur Unterwerfung unter Augustus im Jahr 19 v. Chr. ein wichtiges Expansionsziel der Römischen Republik; die Provinz blieb danach fast ein halbes Jahrtausend lang Teil des Römischen Reiches. Im 11. Jahrhundert thronten Päpste dort, wo einst Konsuln und Tyrannen uneingeschränkt geherrscht hatten, und ihnen schwebte eine ähnliche Form der Eroberung vor. Seit den 1060er Jahren griff ein Papst nach dem anderen immer wieder die Idee auf, christliche Teile Spaniens unter den formellen geistlichen Gehorsam gegenüber Rom zu stellen: Sie drängten darauf, die mozarabische Liturgie, der viele arabisierte Christen in der Region folgten, zugunsten der lateinischen Liturgie abzuschaffen, und machten ihr Recht geltend, in religiösen Angelegenheiten zu bestimmen und von den christlichen Völkern dort finanzielle Tribute zu erheben.
Damit liefen die Päpste auch der Menge hinterher, denn das Interesse von Rittern, heiligen Männern und einfachen Pilgern aus ganz Westeuropa an der Situation südlich der Pyrenäen wuchs. Die Krieger erkannten die Möglichkeit, in den ständigen Kleinkriegen zwischen den vielen Herrschern der Königreiche und taifas viel Geld zu verdienen. Die Mönche, die der reformierten cluniazensischen Regel folgten (benannt nach ihrem Ursprung im burgundischen Cluny im 10. Jahrhundert), waren zunehmend bestrebt, ihre Ordensregel in den Klöstern einzuführen. Die frommen Laien, die ihre Seele von Sünden reinigen wollten, folgten dem Bußweg nach Galicien, dem Jakobsweg, der zum Heiligtum des Apostels in Santiago de Compostela führte, einem der heiligsten Orte der christlichen Welt. Das konnte eine gefährliche Reise sein: Anfang des 12. Jahrhunderts warnte ein französischer Reiseführer eindringlich vor der tödlichen Unreinheit des Flusswassers am Wegesrand und der lockeren Moral der dort lebenden Menschen, zum Beispiel der Bauern in Navarra, die mit ihren Maultieren und Stuten «unreine Unzucht treiben».[8] Aber die Reise war die Unannehmlichkeiten wert. Entlang des Weges wurde häufig von Wundern berichtet: Lanzen, die in einem Feld in der Nähe von Sahagún aufgesteckt worden waren, hatten Blätter getrieben; der heilige Jakobus hatte einen Reisenden wieder zum Leben erweckt, der zu Unrecht wegen Diebstahls gehängt worden war, und einen jungen Mann geheilt, der sich zur Sühne für die Sünde der Unzucht den Penis abgeschnitten hatte.[9] Zudem war Jakobus in ferner Vergangenheit – man munkelt, es sei im Jahr 834 oder 844 gewesen – angeblich in voller Rüstung in einer Schlacht gegen spanische Muslime erschienen und hatte den christlichen Truppen zum Sieg verholfen, was ihm den Beinamen Santiago Matamoros einbrachte: Jakobus der Maurenschlächter.
Es wäre geradezu fahrlässig von jedem Mann auf dem Stuhl Petri gewesen, diese Entwicklungen zu ignorieren, und seit den 1060er Jahren erschienen päpstliche Proklamationen, die die Bemühungen um eine Ausweitung des Einflusses der christlichen Fürsten in Spanien ausdrücklich unterstützten. Im Jahr 1063 bot Papst Alexander II. an, französische oder italienische Ritter, die «nach Spanien aufbrechen» wollten, von einigen ihrer Sünden zu befreien – aus anderen Briefen aus dieser Zeit geht hervor, dass Ritter «nach Spanien aufbrachen», um gegen die Muslime zu kämpfen.[10] Das Ziel der Kämpfer war letztlich die Stadt Barbastro, die dem muslimischen Herrscher von Saragossa treu ergeben war. Der Chronist Ibn Hayyan berichtete von einer vierzigtägigen Belagerung durch Ritter, die er allgemein als «die Christen» bezeichnete und die in Wirklichkeit sowohl aus dem nahen Katalonien wie auch aus so fernen Gegenden wie der Normandie und Süditalien stammten. Die Belagerung schien zunächst friedlich zu enden, als die Christen die Wasserversorgung von Barbastro unterbrachen, indem sie einen Aquädukt blockierten, und die verzweifelten, durstigen Bürger Sklaven und Geld für den Frieden anboten. Doch bald darauf begann ein allgemeines Plündern und Blutvergießen. «Bis zu sechstausend Muslime fielen durch die Schwerter der Christen», zählte Ibn Hayyan und berichtete von einem panischen Ansturm der Einwohner Barbastros auf die Stadtmauern und -tore, der dazu führte, dass viele von ihnen im Gedränge erstickten. Es folgten Gräueltaten, auch Vergewaltigungen von Mädchen und Frauen – oft vor den Augen ihrer Väter und Ehemänner. Ein erbarmungsloses Abschlachten von Zivilisten war dem Chronisten zufolge «unveränderlicher Brauch bei den Christen, wenn sie eine Stadt mit Waffengewalt einnahmen … die Verbrechen und Exzesse, die die Christen bei dieser Gelegenheit begingen, waren so groß, dass es keine Feder gibt, die beredt genug wäre, sie zu beschreiben».[11]
Mit seiner kosmopolitischen ritterlichen Präsenz, den spektakulär blutrünstigen Methoden und der ausdrücklichen Berufung auf eine religiöse Agenda nahm der Angriff auf Barbastro im Jahr 1063 viele Elemente vorweg, die später als wesentliche Bestandteile der christlichen «Kreuzzüge» angesehen werden sollten. Im Kontext Spaniens im späten 11. Jahrhundert war er von großer Relevanz, weil er den Übergang zu einer aggressiveren Expansionspolitik (die später als Reconquista oder «Rückeroberung» bezeichnet wurde) der christlichen Staaten des Nordens einläutete. Diese Expansion richtete sich unweigerlich gegen ihre muslimischen Nachbarn in den taifas und wurde von Rom kräftig gefördert. Nach dem Tod Alexanders II. im Jahr 1073 verlor der zu seinem Nachfolger gewählte Gregor VII. keine Zeit, seine Ansichten zur spanischen Eroberung kundzutun.
«Wir glauben …, dass das Königreich Spanien von alters her dem heiligen Petrus zu voller Souveränität gehörte», schrieb Gregor zu Beginn seines Pontifikats. Unabhängig vom eigenen Anspruch, Kaiser von ganz Spanien zu sein, reichte Alfons VI. schon diese Ermutigung aus. Als Alfons einen seiner Herren nach Granada entsandte, um den fälligen paria-Tribut von Abd Allah, dem König jener taifa, einzutreiben, gab dieser deutlich zu verstehen, dass er genau wusste, woher der Wind wehte. In einer Passage seiner brillanten Chronik, die als Tibyan bekannt ist, fasste Abd Allah die aktuelle Lage so zusammen: «Al-Andalus gehörte einst den Christen. Dann wurden sie von den Arabern besiegt … Jetzt, da sie stark und dazu in der Lage sind, wollen die Christen mit Gewalt zurückgewinnen, was sie verloren haben.»[12]
Abd Allah schrieb diese Zeilen erst in den 1090er Jahren, doch der Rückblick auf die Ereignisse trübte sein Urteilsvermögen nicht unbedingt. Auf das Massaker von Barbastro folgte eine Serie von konzertierten Feldzügen unter der Leitung des allgegenwärtigen Alfons VI. Im Jahr 1082 oder 1083 beschloss al-Muʿtamid von Sevilla nach einer Reihe von zunehmend erpresserischen Geldforderungen, Alfons keine parias mehr zu zahlen. Um seinen Standpunkt zu unterstreichen und die schlimmsten Exzesse seines Vaters heraufzubeschwören, ließ er den Gesandten hinrichten, den Alfons geschickt hatte.[13] Alfons startete daraufhin im Sommer 1083 Angriffe auf Sevilla. Seine Soldaten schlugen eine Schneise mitten durch das Herrschaftsgebiet al-Muʿtamids, und Alfons selbst ritt bis nach Tarifa und trabte mit seinem Pferd in die sich am Strand brechenden Wellen, hinter denen sich die zerklüftete Küste Nordafrikas abzeichnete. «Dies ist das Ende Spaniens, und ich habe meinen Fuß daraufgesetzt», erklärte er.
Ein Jahr später nahm er ein Ziel ins Visier, das näher lag: die Stadt Toledo, deren unfähiger muslimischer Herrscher al-Qadir von seinem aufgebrachten Volk abgesetzt worden war. Vorgeblich in dem Bestreben, einem enteigneten Monarchen-Kollegen Recht zu verschaffen, begann Alfons die Belagerung und nahm die Stadt schließlich am 6. Mai 1085 ein. Doch al-Qadir kam nicht zurück an die Macht, sondern wurde in Toledos einstige Kolonie Valencia verfrachtet und dort als Marionettenherrscher eingesetzt. In Toledo übernahm Alfons die direkte Kontrolle über eine der bis vor Kurzem noch mächtigsten Städte des muslimischen Spaniens. Die Eroberung markierte daher einen politischen wie symbolischen Wendepunkt und war ein Schock für die gesamte islamische Welt.[14] «Wir haben es mit einem Feind zu tun, der uns nicht in Ruhe lässt: Wie kann man mit Schlangen in einem Korb leben?», klagte ein muslimischer Beobachter.[15] Alfons kontrollierte nun einen großen Teil des Tejo-Tals, und sehr viele Muslime innerhalb und außerhalb der Mauern von Toledo lebten nicht mehr in einer taifa, sondern unter einem christlichen König.
Alfons vermied ein bedauernswertes Gemetzel, wie es zwei Jahrzehnte zuvor in Barbastro stattgefunden hatte; er garantierte die Freiheit der islamischen Religionsausübung gegen eine jährliche Steuer und ließ die zentrale Moschee Toledos in muslimischer Hand. Aber ein Ausbund an Toleranz war er dann doch nicht: 1086 rechtfertigte er seine Eroberung Toledos vor einem geistlichen Publikum mit den Worten, er habe gewusst, «dass es dem Herrn gefallen würde, wenn ich, Alfons, der Kaiser, unter der Führung Christi den Anhängern seines Glaubens die Stadt zurückgeben könnte, die die bösen Menschen unter der verderbten Führung ihres Führers Mohammed den Christen genommen haben».[16] Und er fügte seinem selbstherrlichen Titel «Kaiser von ganz Spanien» einen weiteren hinzu: den ebenso hochtrabenden «Kaiser der beiden Religionen». Die Durchsetzung von Alfons’ kühnen Ansprüchen sollte die christlichen Herrscher Spaniens die nächsten vier Jahrhunderte lang beschäftigen.
Alfons hatte den Dichterkönig al-Muʿtamid, der mit dem Fall der taifa von Toledo nun sein direkter Nachbar wurde, aufs Schärfste gedemütigt. Um sich zu schützen, blickte al-Muʿtamid deshalb nach Süden, über die Meerenge von Gibraltar hinweg nach Marokko und Westalgerien, wo die Macht in den Händen einer notorisch grausamen, puritanischen Sekte von Berbern lag, die als Almoraviden (al-murabitan) bekannt waren. Die Almoraviden folgten einer äußerst strengen Auslegung des Korans, verhüllten ihre Gesichter mit Schleiern, residierten in befestigten Klöstern, den sogenannten Ribats, und hatten herzlich wenig Zeit für die sinnlichen Vergnügungen an al-Muʿtamids Hof, wo, wie der König selbst sagte, «ich inmitten von Scharen schöner Frauen wandle, die dem hohen Rang Glanz verleihen. Und durch die Waffen meiner Krieger zerstreue ich die Dunkelheit, der von jungen Frauen gereichte Wein erfüllt uns mit Licht.»[17] Der Almoraviden-Anführer Yusuf ibn Taschfin nannte sich selbst Emir der Muslime (amir al-muslimin) und war genauso felsenfest von sich überzeugt wie der verhasste Alfons. Die Eroberungen der Almoraviden in Nordafrika ließen keinen Zweifel an ihren kriegerischen Fähigkeiten, aber sie in al-Andalus um Hilfe zu bitten, bedeutete per definitionem, Ärger zu riskieren. Doch al-Muʿtamid hatte kaum eine Wahl. Nach dem Fall Toledos bat er Yusuf ibn Taschfin, einzumarschieren, und rechtfertigte dies mit überaus düsterem Humor: Lieber würde er Kamele für die Männer aus dem Süden hüten als einen Schweinestall für die Ungläubigen bewachen.
Damit gab er im Grunde sein Königreich auf. Im Frühsommer des Jahres 1086 überquerten die Almoraviden die Meerenge und marschierten, mit großzügigen Geschenken des schwachen Kleinkönigs von Sevilla bedacht, auf Alfons’ Heere zu, denen sie am 23. Oktober in der Schlacht von Sagrajas (Zallaqa) eine dramatische Niederlage zufügten. Alfons wurde schwer verletzt, als ihm ein afrikanischer Soldat im Nahkampf einen Dolch so tief in den Oberschenkel rammte, dass er Alfons’ Bein an die Polsterung seines Sattels heftete.[18] Der «Kaiser von ganz Spanien» verlor 300 Ritter und etwa die Hälfte seines 2500 Mann starken Heeres, noch schlimmer war der Prestigeverlust. Ein späterer marokkanischer Chronist nannte die Schlacht «einen der gefeiertsten Siege in al-Andalus … durch den Gott … Alfons’ Ambitionen zunichte machte».[19] Yusuf schickte die abgetrennten Köpfe der besiegten Christen in die Städte von al-Andalus, in großen, grausigen Stapeln auf hölzerne Karren geladen.[20] Dann kehrte er nach Hause zurück und ließ Alfons Toledo. Beide hatten eine Menge zu überdenken.
Als al-Muʿtamid nach den Almoraviden schickte, wusste er, dass er einen Pakt mit dem Teufel einging, und 1090 wurden die dramatischen Folgen seiner Strategie nur zu offensichtlich. Yusuf war zweifellos bestrebt, die islamische Heiligkeit und Einheit von al-Andalus zu wahren, doch nachdem er Rechtsexperten in Marokko konsultiert hatte, kam er zu dem Schluss, dass ihn dies nicht dazu verpflichtete, die Throne der schwachen und hilflosen kleinen Könige der taifas zu sichern. Die Bereitschaft dieser Könige, den ungläubigen Monarchen des Nordens Tribut zu zollen, hatte sie unwiderruflich kompromittiert, und deshalb – so Yusufs Schlussfolgerung – durfte jemand, der besser geeignet war, den Islam zu verteidigen, an ihre Stelle treten.
Als die Almoraviden im September al-Muʿtamids Nachbarkönige in Málaga und Granada angriffen und absetzten, zeichnete sich erschreckend deutlich ab, was als Nächstes kommen würde. Im Sommer 1091 wandte sich Yusuf gegen al-Muʿtamid und belagerte Sevilla. Die Ironie des Schicksals wollte es, dass al-Muʿtamid einen Hilferuf an König Alfons sandte, der weit weg gegen einen anderen taifa-König in Saragossa kämpfte. Alfons erhörte den Ruf, aber es war zu spät. Im November fiel Sevilla. Al-Muʿtamids Söhne wurden gezwungen, die Schlüssel zum Alcázar zu übergeben, und der Dichterkönig wurde per Schiff in ein Gefängnis in Marokko gebracht. Er hatte nicht nur das Schicksal seines Königreichs, sondern auch das aller anderen taifa-Staaten besiegelt, die sich bis zum Ende des Jahrhunderts fast alle den Almoraviden unterwarfen, um Teil eines nordafrikanischen Reiches zu werden, das (zumindest theoretisch) dem weit entfernten Kalifen der Abbasiden in Bagdad religiösen Gehorsam schuldete. Die christlichen Staaten des Nordens hatten kaum Territorium eingebüßt, forderten aber immerhin keine parias mehr. Ansonsten war al-Muʿtamids Politik ein totaler Fehlschlag gewesen.
Beim Auszug aus seinem Reich muss al-Muʿtamid einen bedauernswerten Anblick geboten haben. Der Dichter Ibn al-Labbana, ein Zeitgenosse und Freund Ibn Hamdis aus dem inzwischen aufgelösten Kreis der Literaten, die sich einst am Hof von Sevilla getummelt hatten, schrieb:
Ich werde alles vergessen,
außer jenem Morgen
am Guadalquivir,
als sie auf die Schiffe gebracht wurden
wie die Toten zu ihren Gräbern …[21]
Das Wehklagen war offensichtlich berechtigt, denn auch al-Muʿtamid beklagte sich bitterlich über seinen Untergang, während er in Aghmat im Gefängnis saß:
Ich sage zu meinen Ketten:
Versteht ihr denn nicht?
Ich habe mich euch unterworfen.
Warum habt ihr denn kein Mitleid,
keine Zärtlichkeit?[22]
Er wurde im Jahr 1095 ermordet. Sein Rivale Alfons VI. starb 1109 bei der Verteidigung Toledos gegen die Almoraviden. Um sich bei den unter seiner Herrschaft lebenden Muslimen beliebt zu machen, hatte er sich zwar eine Frau namens Zaida, eine Schwiegertochter al-Muʿtamids, als Konkubine genommen. Doch war damit sein Entgegenkommen gegenüber dem Islam auch schon erschöpft.
Ibn Hamdis wurde unterdessen erneut vertrieben. Dreizehn Jahre nachdem er von Sizilien nach Sevilla gekommen war, musste er mit ansehen, wie seiner Wahlheimat dasselbe Unglück widerfuhr wie seinem Geburtsort: Sie wurde durch Kriege zerrissen und von einem fremden Eindringling erobert – wenn auch in diesem Fall von einem islamischen und nicht von einem christlichen. Ibn Hamdis floh, als al-Muʿtamid 1091 gefangen genommen wurde, und zog für den Rest seines Lebens zwischen den Höfen in Ifriqiya, Algerien und Marokko umher, wo er von seiner Feder lebte, bevor er seine Tage in Mallorca beschloss. Er starb 1133, blind, allein und voller Reue im Alter von fast achtzig Jahren. In seinen Versen riet er anderen, es ihm auf keinen Fall gleichzutun: «Kettet euch an das Land, das eure geliebte Heimat ist, und sterbt in eurem eigenen Haus.»[23]