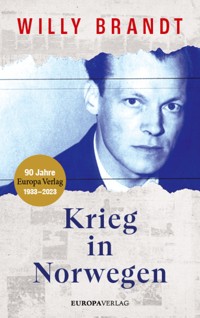
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 an die Macht kommen, leistet Herbert Frahm sofort Widerstand. Um sich vor der Verfolgung durch die Nazis zu schützen, benennt er sich um in Willy Brandt. 1933 verlässt er Deutschland und geht ins Exil nach Norwegen, um von dort aus den sozialdemokratischen Widerstand gegen Hitler zu organisieren. Er lernt im Handumdrehen Norwegisch und geht auf Vortragsreise durch das Land, um vor dem Nazi-Regime zu warnen. wegen, um vor dem Nazi-Regime zu warnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Willy Brandt
Krieg
1. eBook-Ausgabe 2024
© 1942 by Europa Verlag AG Zürich
4. Auflage 2024 by Europa Verlag,
ein Imprint der Europa Verlage GmbH, München
Umschlaggestaltung:
Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Layout & Satz: Robert Gigler, München
Aus dem Schwedischen übersetzt von Benedict Christ
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-626-6
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Europa-Newsletter:
Mehr zu unseren Büchern und Autoren kostenlos per E-Mail!
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Willy Brandt
Krieg in Norwegen
9. April — 9. Juni 1940
Vorwort zu dieser Ausgabe
Das vorliegende Buch von Willy Brandt erschien 1942 im deutschen Original im Europa Verlag Zürich. Ursprünglich erschien das Buch in schwedischer Sprache, da Brandt es in seinem schwedischen Exil in Stockholm verfasste und dort zuerst publizierte. Brandt war inzwischen offiziell Norweger, da er von der norwegischen Exilregierung die Staatsbürgerschaft erhalten hatte, nachdem er nach der Besetzung durch die Nationalsozialisten aus seinem Exil in Norwegen fliehen musste.
Der spätere deutsche Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger beschreibt in dem Buch erstaunlich nüchtern und objektiv die Okkupation Norwegens durch die deutsche Wehrmacht. «Krieg in Norwegen» gibt vor allem einen Bericht über die Kriegshandlungen in den verschiedenen Gegenden des Landes. Brandts Buch ist von den nazikritischen Zeitgenossen dankbar aufgenommen worden. Es ist keine militärische Abhandlung, es berücksichtigt vielmehr genau das, was der Laie zum richtigen Verständnis der inneren Zusammenhänge und der äußeren Ereignisse braucht. Der Verleger des Europa Verlags, Emil Oprecht, ist von Seiten des Dritten Reiches heftigst für die Veröffentlichung dieses Buches kritisiert worden. Was letztlich bleibt, ist ein spannendes historisches Dokument, welches der Biographie Willy Brandts einen fast vergessen Teil hinzufügt.
Lars Schultze-Kossack
Vorwort zur schwedischen Auflage
Dieses Buch möchte eine zusammenhängende Übersicht über die militärischen Ereignisse in Norwegen geben — von der deutschen Okkupation am 9. April bis zur norwegischen Kapitulation am 9. Juni 1940. In Anbetracht der nach dem 9. Juni entstandenen Lage hat bis jetzt keiner der norwegischen militärischen Befehlshaber das Tatsachenmaterial über den gesamten Kriegsverlauf vorlegen können. Dies wird auch kaum möglich sein, solange der Krieg der Großmächte dauert. Diese Darstellung versucht, vom Verlauf der Geschehnisse ein möglichst objektives Bild zu geben; sie fußt sowohl auf norwegischen als auch auf deutschen und englischen Quellen.
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass mehrere wichtige Angaben nicht zugänglich gewesen sind.
über die Rolle, welche der norwegische Krieg in diesem Weltkrieg gespielt hat, wird man sich erst später ein bestimmtes Urteil bilden können. Aber jetzt schon sind diejenigen Faktoren, welche den Sieg der deutschen Wehrmacht in Norwegen entschieden haben, deutlich erkennbar. Gleichfalls ist es jetzt schon möglich, den eigenen militärischen Einsatz Norwegens zu beurteilen. Der Zustand der norwegischen Landesverteidigung bei Kriegsausbruch hat viele glauben lassen, dem norwegischen Volk fehle die militärische Einsatzbereitschaft Eine solche Auffassung ist unrichtig: die Ereignisse zwischen dem 9. April und dem 9. Juni — und vieles, was sich seitdem ereignet hat — beweisen größtenteils das Gegenteil.
W Brandt
Der Blitzangriff am 9. April 1940
Der deutsche Plan, alle strategisch wichtigen Punkte in Norwegen am 9. April zu besetzen, gehört zu den kühnsten Kapiteln der neueren Kriegsgeschichte. Durch eine kombinierte Operation der Marine, der Landungstruppen und der Luftwaffe wurden außer Oslo die Küstenstädte Moß, Horten, Arendal, Kristiansand, Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim und Narvik am 9. April früh am Morgen oder im Laufe des Tages besetzt. Die Flugplätze in Südnorwegen, die meisten Mobilmachungsplätze und militärischen Depots fielen ebenfalls gleich in die Hände der deutschen Wehrmacht. Dadurch war nicht der ganze, aber auf jeden Fall der halbe Sieg gewonnen.
Man steht vor dem Problem: wie konnte dieser verwegene Plan gelingen? Vor allem deshalb, weil die deutsche Aktion gründlich und sorgfältig vorbereitet war. Bei der propagandistischen Behauptung, die deutsche Okkupation Norwegens sei eine Antwort auf die am 8. April erfolgte alliierte Minenauslegung in norwegischen Hoheitsgewässern gewesen, braucht man nicht zu verweilen. In der deutschen Darstellung der Ereignisse wird sonst vor allem hervorgehoben, dass die deutsche Wehrmacht zur Aktion schritt, um einer englischen Besetzung zuvorzukommen. Die Dokumente, welche zum Beweise eines solchen englischen Planes vorgelegt worden sind, stammen jedoch aus der Zeit des finnisch-russischen Krieges. Damals war tatsächlich die Rede davon, ein alliiertes Expeditionskorps über Narvik zu entsenden. Bis jetzt liegt hingegen kein Beweis vor, dass England eine Okkupation von norwegischem Territorium beabsichtigte. Wie einmal die Antwort auf diesen Fragenkomplex lautet, wenn alle Geheimakten zugänglich sind, — das wissen wir jetzt noch nicht.
Indes ist offenbar, dass die deutsche Aktion mehrere Monate im voraus vorbereitet worden ist. Der Ausdruck Blitzangriff will nicht sagen, dass die Zeit für die Vorbereitung der Operationen knapp bemessen wird. Im Gegenteil, gerade diese Form der Offensive verlangt Entwürfe und Vorbereitungen bis in die letzte Einzelheit, besonders wenn der Blitzangriff — wie in Norwegen — von den Basen weit entfernte Landungsoperationen vorsieht. Es braucht nicht nur eine eingehende Kenntnis der militärischen Ziele, sondern auch peinlich genaue Pläne für das Zusammenwirken der Seestreitkräfte, der Transportflotte, der Luftwaffe und derjenigen Teile der Landstreitkräfte, welche sich an den Operationen beteiligen sollen. Dazu kommt die technische Vorbereitung, welche allem nach in den Ostseehäfen mehrere Monate im voraus betrieben worden ist. Endlich muss auch in Betracht gezogen werden, dass zur Erreichung der anbefohlenen militärischen Ziele eine gewisse Zeit erforderlich ist. Zwischen den deutschen Verschiffungshäfen und Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Narvik liegen Entfernungen von 650, resp. 720, 890, 1390, 2000 km. Die österreichischen Gebirgsjäger, die für Narvik bestimmt waren, wurden am 6. April in Bremerhaven an Bord der deutschen Zerstörer gebracht. Am 5. April verließen fünfzehn bis zwanzig Truppen- und Transportschiffe Stettin.
Die deutschen Schiffe hatten vom Befehlshaber der deutschen Marine, Großadmiral Raeder, einen versiegelten Tagesbefehl erhalten, welcher nach dem Auslaufen aus den deutschen Häfen erbrochen werden sollte. Darin stand u. a.: «Die Erfahrung lehrt, dass Glück und Erfolg auf der Seite desjenigen stehen, der höchste Verantwortungsfreudigkeit mit Kühnheit, Zähigkeit und Geschicklichkeit verbindet. Überraschung und schnelles Handeln sind die Voraussetzung für das Gelingen der Operation. Ich erwarte, dass die Führer aller Gruppen und alle Kommandanten von dem unbeirrbaren Willen beherrscht sind, den ihnen befohlenen Zielhafen trotz aller auftretenden Schwierigkeiten zu erreichen, dass sie beim Einlaufen in die Ausschiffungshäfen mit größter Entschlossenheit auftreten und sich nicht durch Anhalte- und Abwehrmaßnahmen örtlicher Befehlshaber oder durch Wachfahrzeuge und Küstenbefestigungen von der Erreichung ihres Zieles abschrecken lassen. Alle Versuche, den Vormarsch der Streitkräfte aufzuhalten oder zu verhindern, sind abzuwehren. Widerstand ist nach Maßgabe der in den Operationsbefehlen erteilten Weisungen mit rücksichtsloser Entschlossenheit zu brechen.»
Wie sorgfältig das deutsche Unternehmen vorbereitet worden war, ging auch aus einer Menge Anordnungen hervor, welche die Okkupationstruppen nach ihrem Eintreffen in Norwegen ins Werk setzten. Für eine genaue Vorbereitung spricht auch die Tatsache, dass in Oslo, Trondheim und Narvik Lastdampfer lagen, die sich glücklich der Zollkontrolle entzogen hatten und an deren Bord sich deutsches Kriegsmaterial und deutsches Militär befanden bereit, am Morgen des 9. April an der Okkupation teilzunehmen. Auch in Tromsö lag ein solches Schiff, welches jedoch durch norwegische Schießübungen scheu gemacht wurde und am 7. April in See stach. Das Schiff wurde am 9. April als Prise genommen.
In deutschen Marinekreisen ist eine Okkupation Dänemarks und Norwegens seit Jahren erörtert worden. Vizeadmiral Wolfgang Wegener befürwortete eine solche in einer Schrift, die er bereits 1926 unter ältere Seeoffiziere austeilen ließ. Die Darstellung erschien 1929 in Buchform unter dem Titel «Die Seestrategie des Weltkrieges». Lord Strabolgi hebt in «Narvik and alter» hervor, dass dieses Buch auch in England bekannt war. Korvettenkapitän Stig Hison Ericson hat die Grundgedanken im Buche Wegeners in Svensk Tidskrift, Heft 7, 1940, wiedergegeben. Der deutsche Admiral kritisiert die defensive Strategie, welche die deutsche Flotte im letzten Weltkrieg einschlug. Die deutsche Flotte hätte sich zum Ziel setzen müssen, die Blockade zu brechen und den Handelskrieg gegen die Alliierten zu verschärfen. Um diese Aufgabe meistern zu können, wäre es notwendig, das von den deutschen Basen aus erreichbare Gebiet zu erweitern. Das geschlossene Tor zum Atlantischen Ozean müsste geöffnet und die Besetzung der atlantischen Häfen Norwegens vollzogen werden. Was die Nordsee vor hundert Jahren für Deutschland bedeutete, schrieb Admiral Wegener, das bedeutet jetzt für unser Land der Atlantische Ozean. Um leben zu können, muss Deutschland die Weltmeere ausnützen, und um die maritimen Verbindungen schützen zu können, sind strategische Positionen am Atlantik erforderlich.
Des weitern vertrat Wegener die Auffassung, es sei im letzten Weltkrieg ein großer Fehler gewesen, auf die Neutralität Dänemarks und Norwegens Rücksicht zu nehmen Bei einem Kriege der Großmächte müssen neutrale Kleinstaaten damit einverstanden sein, dass ihr Territorium benützt wird, wenn dies zu einem beschleunigten Siege und zur Verkürzung des Krieges führen kann. Deutschland hätte sich die geographischen Voraussetzungen schaffen sollen, um England die Blockadewaffe zu entwinden und sie darauf gegen die britischen Inseln zu richten. Ein Vorschieben der Basen über Dänemark nach Norwegen hätte eine Verschärfung des U-Bootkrieges ermöglicht. Die deutsche Flotte hätte größere Bewegungsfreiheit erlangt. Weiter wären die Verbindungen der Westmächte mit Russland via Skandinavien unterbrochen worden. Endlich hätte eine energische Kriegsführung zur See hemmend auf Amerika eingewirkt.
Dies wurde also vor vierzehn Jahren niedergeschrieben und elf Jahre vor der Okkupation Norwegens veröffentlicht. Gleichwohl ist es nicht schwierig, zwischen der Situation, welche Admiral Wegener behandelte, und derjenigen, welche Deutschland vor der Aktion im April 1940 vorfand, Ähnlichkeiten aufzudecken. Die Blockade gegen Deutschland sollte gebrochen, U-Bootbasen — und Flugbasen! — gegen Großbritannien vorgeschoben, die Verbindung zwischen England und dem Norden zum Aufhören gebracht werden.
Dies von den Hintergründen zur deutschen Aktion. Um die Geschehnisse in Norwegen richtig beurteilen und bewerten zu können, muss man die Situation vor Augen haben, wie sie am 8. und 9. April vorlag. Man versteht dann, welche Rolle das Überrumpelungsmoment bei der Durchführung der deutschen Besetzung Norwegens gespielt hat.
Am Vormittage des 8. April wurde in einem Telegramm aus Kopenhagen berichtet, dass deutsche Seestreitkräfte von über hundert Kriegs- und Transportschiffen den Belt mit Richtung Norden passiert hätten. Zur Mittagszeit desselben Tages wurde der Hamburger Dampfer Rio de Janeiro durch ein britisches U-Boot außerhalb Lillesand versenkt. Das Schiff war mit Soldaten beladen und hatte auch Pferde an Bord. Eine Anzahl Soldaten retteten sich an Land. Diese zwei Nachrichten waren deutliche Anzeichen, dass Norwegen binnen kurzem in den Krieg der Großmächte hineingerissen werden könnte. Es darf angenommen werden, dass das norwegische Auswärtige Amt bereits einige Tage vor dem 8. April vor der bevorstehenden deutschen Aktion gewarnt worden ist.
Am 8. April entstand außerdem ein neues Problem: es wurde mitgeteilt, dass die Westmächte in den norwegischen Hoheitsgewässern Minenfelder gelegt hatten. Früh am Morgen war Außenminister Koht vom britischen und vom französischen Gesandten in Oslo aufgesucht worden; sie überreichten ihm eine Note mit dem Bescheid, dass außerhalb der Küste drei Minenfelder gelegt worden waren. Die Maßnahme der Alliierten wurde mit der rücksichtslosen Kriegsführung Deutschlands motiviert, welche nicht zuletzt die neutrale Schifffahrt getroffen habe. Außerdem erklärten die Westmächte, dass sie während des Krieges den Missbrauch der norwegischen Hoheitsgewässer durch Deutschland nicht weiter dulden könnten. Diese Note war es, welche am 8. April die norwegischen Staatsgewalten am meisten beschäftigte; sie veranlasste gleich nachdrückliche norwegische Proteste.
Unterdessen waren die ersten deutschen Schiffe an ihren Bestimmungsort herangekommen. Unmittelbar vor Mitternacht wurden zwischen deutschen Kriegsschiffen und Bolaerne und Rauer, den Befestigungen im äußeren Oslofjorde, die ersten Schüsse gewechselt. Um Mitternacht erhielt die Regierung die Mitteilung, dass fremde Kriegsschiffe Färder im Oslofjorde passierten. Um zwei Uhr nachts traf in Oslo die Nachricht ein, dass fünf Kriegsschiffe an den äußeren Befestigungen Bergens vorbeifuhren. Um 3.30 Uhr wurden zwei deutsche Kriegsschiffe gemeldet, welche Agdenes im Trondheimfjorde passiert hatten. Zur gleichen Zeit hatten die in den Oslofjord eingedrungenen Schiffe — vier große Kriegsschiffe und eine Anzahl kleinerer — Filtvet erreicht. Gleich darauf begann der Kampf zwischen ihnen und der Festung Oscarsborg am Dröbaksund. Zwischen drei und vier Uhr kam es auch außerhalb Bergen zu Kämpfen.
Die militärische Aktion Deutschlands war also in vollem Gang, als der deutsche Gesandte in Oslo, Dr. Bräuer, um 4.30 Uhr am Dienstagmorgen Außenminister Koht aufsuchte. Dr. Bräuer führte ein Memorandum der deutschen Regierung mit sich, welches geltend machte, dass die Reichsregierung Dokumente in ihre Hände bekommen habe und dadurch den Beweis besitze, England und Frankreich hätten gemeinsam beschlossen, den Krieg auf das Gebiet der nordischen Staaten auszudehnen, u. a. durch die Besetzung Narviks und anderer Punkte in Norwegen. Die deutsche Regierung hielt sich zur Annahme berechtigt, dass die norwegische Regierung gegen solche Unternehmungen keinen Widerstand leisten würde. Aber hätte sie auch Gegenmaßnahmen treffen wollen, so wäre sie nicht stark genug, um sich einer englisch-französischen Aktion mit Erfolg zu widersetzen. Die deutsche Regierung glaubte nicht dulden zu dürfen, dass die Westmächte Skandinavien in einen Kriegsschauplatz gegen Deutschland verwandelten. Deshalb hatte sie militärische Operationen eingeleitet, welche in der Besetzung aller strategisch wichtigen Punkte in Norwegen resultieren sollten, wodurch die Reichsregierung den Schutz Norwegens übernahm. Des weitern wurde in dem deutschen Memorandum darauf hingewiesen, dass jeder Widerstand «von den deutschen Streitkräften mit allen Mitteln gebrochen werden» sollte und deshalb nur zu einem vollkommen nutzlosen Blutvergießen führen würde. Schließlich wurde festgestellt, dass Deutschland nicht beabsichtige, «jetzt oder in Zukunft die territoriale Integrität und die politische Unabhängigkeit des Königreiches Norwegen anzutasten». Neben diesem Memorandum legte der deutsche Gesandte eine Liste mit denjenigen Maßnahmen vor, welche die norwegische Regierung, auf Begehren der Reichsregierung, unmittelbar treffen sollte. Die norwegische Regierung solle vor allem einen Aufruf an Volk und Heer erlassen, damit jeglicher Widerstand gegen die deutschen Okkupationstruppen vermieden würde. Die norwegische Armee solle mit den einrückenden deutschen Truppen in Verbindung treten und für eine loyale Zusammenarbeit die notwendigen Übereinkommen mit den deutschen Befehlshabern treffen. Auf allen militärischen Anlagen, denen sich die deutschen Truppen näherten, solle neben der Nationalflagge eine weiße Parlamentärflagge gehisst werden.
Ein gemeinsames Kommando solle gebildet werden und zur Aufgabe haben, eine reibungslose Zusammenarbeit zu sichern und Zusammenstöße zwischen deutschen und norwegischen Truppen zu verhindern. Die militärischen Einrichtungen und Anlagen, welche die deutschen Truppen benötigten, um Norwegen gegen einen äußeren Feind zu schützen, sollen in unbeschädigtem Zustande ausgeliefert werden usw.
Die norwegische Regierung, welche die ganze Nacht hindurch im Außenministerium versammelt gewesen war, stellte sich auf den Standpunkt, ein unabhängiges Land könne die deutschen Forderungen nicht annehmen. Der Außenminister unterrichtete den deutschen Gesandten davon.
Völkerrechtlich gesehen herrschte zwischen Deutschland und Norwegen noch kein Kriegszustand. Erst am 24. April traf die Mitteilung ein, das Deutsche Reich befinde sich mit Norwegen im Kriege. Dies veranlasste die norwegische Regierung, am 26. April eine Bekanntmachung zu erlassen, worin festgestellt wurde, dass sie seit der Nacht auf den 9. April vom Kriegszustande gewusst habe. Die Bekanntmachung des Kriegszustandes war für die Norweger keine Neuigkeit. Der Krieg sollte nicht enden, bevor Norwegen seine Freiheit wieder erlangt hätte.
Der erste Abschnitt in diesem Kriege, die Landungsoperation selbst und die Besetzung der strategisch wichtigen Punkte in Norwegen, wurden im Laufe des 9. April abgeschlossen. Vieles deutet darauf hin, dass die deutsche Reichsregierung glaubte, einem Ultimatum, hinter dem die deutsche Wehrmacht stand, würde die norwegische Regierung nachgeben. Diese Auffassung basierte jedoch auf falschen Informationen und auf einer falschen Beurteilung und Bewertung der norwegischen Neutralitätspolitik. Diese Politik hatte immer die Friedensbestrebungen mit dem Anspruche auf nationale Unabhängigkeit und Freiheit vereinigt.
Die Pläne der deutschen Wehrmacht berücksichtigten jedoch auch die Möglichkeit, dass Norwegen Widerstand leisten würde. Man war entschlossen, diesen Widerstand mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu brechen. Den Widerstand nahm man zum ersten Male wahr, als man mit der norwegischen Küstenverteidigung in Fühlung trat. An manchen Orten, wie Narvik, Trondheim und Bergen, kam es zu keinerlei Kämpfen von Bedeutung. An anderen Stellen, so im Oslofjorde, wurde hartnäckiger Widerstand geboten, der jedoch niedergerungen werden konnte. Der empfindlichste Verlust, den die Deutschen im Kampfe mit der norwegischen Küstenverteidigung erlitten, war die Versenkung des schweren Kreuzers Blücher von 10 000 t im inneren Oslofjorde. Auf diesem Schiffe befanden sich nicht nur Elitetruppen, sondern auch führende Militär- und Verwaltungspersonen. In Anbetracht der auf Oslo gerichteten, drohenden Kanonen des Kreuzers hatte man geglaubt, die noch in Oslo befindliche norwegische Regierung würde davon abstehen, den Widerstand zu organisieren. Die Versenkung der Blücher schenkte den norwegischen zentralen Behörden eine Frist von acht Stunden; in dieser Zeit konnten sie einige Vorbereitungen für den Widerstand treffen.
Sieht man von der Küstenverteidigung ab, so muss man sich vor Augen halten, dass der militärische Widerstand Norwegens erst mobilisiert oder, besser gesagt, improvisiert wurde, als sich die Deutschen bereits im Lande festgesetzt hatten. Wir beschäftigen uns hier nicht mit der Frage, wie wirksam die norwegische Landesverteidigung — trotz ihrer schwachen materiellen Unterlage — sich hätte erweisen können, wenn sie zum vollen Einsatz gekommen wäre. Tatsache ist, dass Norwegen vollständig überrumpelt wurde. Gewiss waren seit dem Kriegsausbruche im September 1939 die Marine und die Küstenverteidigung mobilisiert gewesen, aber nicht in vollem Umfang. Im Übrigen verfügte man nur über einige wenige Bataillone, welche die Neutralitätswacht versahen. Gerüchte, die Regierung habe von den bevorstehenden Ereignissen Mitteilungen erhalten, sind von seiten der Regierung entschieden dementiert worden. Die Tatsachen, die der norwegischen Regierung bekannt waren, veranlassten jedenfalls keine militärischen Maßnahmen. Auch wurde kein Mobilmachungsbefehl erlassen, als man am Montag dem 8. April die Nachricht erhielt, die deutsche Flotte befände sich auf der Fahrt nordwärts. Die Mobilmachung wurde in der Nacht auf den 9. April beschlossen und konnte erst beginnen, als die Deutschen bereits die meisten Mobilmachungsplätze in Südnorwegen in ihre Gewalt gebracht hatten. Die Legung von Minensperren im Oslofjorde wurde ebenfalls erst spät am Abend des 8. April anbefohlen. Es erwies sich als technisch nicht durchführbar, nachts Minen zu legen; dies hatte zur Folge, dass überhaupt keine gelegt wurden. Hingegen wurde der Befehl des kommandierenden Admirals, der Küste entlang alle Leuchttürme zu löschen, am späten Montagabend durchgeführt.
Dass die deutsche Aktion in geplantem Umfang durchgeführt werden konnte, beruhte vor allem auf dem Einsatz der deutschen Luftwaffe. Die norwegische Küstenverteidigung war schwach und veraltet; Fliegerabwehr gab es sozusagen überhaupt keine. Bei der Besetzung Norwegens besaßen die Deutschen nicht nur die Überlegenheit in der Luft — sie waren die unumschränkten Alleinherrscher. Flugplätze wie Fornebu und Sola wurden nach kurzem Kampfe von der Luft aus genommen Transportflugzeuge konnten Reserven von Mannschaft und Material an diejenigen Punkte heranbringen, wo die Deutschen am isoliertesten oder durch große, während der Überfahrt erlittene Verluste geschwächt waren. Die Bombenflugzeuge konnten praktisch genommen ohne eigenes Risiko den letzten Widerstand der Küstenbefestigungen brechen und sich dann mit der Störung der norwegischen Mobilmachung beschäftigen. Oslo wurde am 9. April kaum bombardiert; einige Bomben wurden zwar abgeworfen, forderten jedoch keine Opfer an Menschenleben. Die Maschinengewehre ratterten über den Hausdächern, doch auch sie fügten befehlsgemäß niemandem ein Leid zu. Gleichwohl war die Wirkung der deutschen Bomber gewaltig groß; die Bevölkerung der Stadt fühlte sich in eine hoffnungslose Lage versetzt und zitterte vor dem Gespenst einer Bombardierung.
Die sorgfältigen deutschen Vorbereitungen für die Besetzung Norwegens, der überlegene Einsatz deutscher Streitkräfte von der See her und aus der Luft und die mangelhaften militärischen Vorbereitungen der Norweger waren für die Ereignisse des 9. April 1940 entscheidend.
Aber damit ist über den mächtigen Gegner Deutschland noch nichts gesagt worden. Bevor die deutschen Seestreitkräfte mit den Landungstruppen die norwegischen Fjorde erreichten, mussten sie zwangsweise ein Meer passieren, auf dem sie mit einiger Sicherheit mit überlegenen britischen Marinestreitkräften zusammenstoßen konnten. Es war keineswegs ausgeschlossen, dass der englische Nachrichtendienst vor der deutschen Okkupation dies oder jenes in Erfahrung gebracht hatte. Und als das deutsche Expeditionskorps die schwache norwegische Küstenverteidigung forciert hatte, durfte man immer noch erwarten, dass die englische Flotte gegen die von den Deutschen besetzten, aber noch nicht befestigten Häfen eine Gegenaktion unternehmen würde. Erst als diese Gegenaktion ausblieb, konnte die deutsche Wehrmacht behaupten, die erste Schlacht gewonnen zu haben.
Nach der Lösung der ersten militärischen Aufgaben setzten sich die Deutschen ein politisches Ziel: durch Verhandlungen oder auf andere Weise sollte die Widerstandskraft der Norweger zunichte gemacht werden. Am Nachmittage des 9. April fuhr unter Leitung des deutschen Luftattachs in Oslo — eine Abteilung deutscher Soldaten in norwegischen Autobussen nach Hamar, wo sich das Storting versammelt hatte, nachdem seine Mitglieder zusammen mit dem König und der Regierung Oslo verlassen hatten. Südlich von Hamar stießen die Autos auf norwegische Streitkräfte, die jedoch ohne Widerstand entwaffnet wurden. Von Hamar aus rückte die deutsche Abteilung weiter gegen Elverum vor, weil der König, die Regierung und das Storting sich dorthin geflüchtet hatten. Bei Midtskogen außerhalb Elverum stießen die Deutschen in der Nacht auf den 10. April auf den ersten ernsthaften Widerstand: norwegische Streitkräfte, bestehend aus Rekruten der Garde, Militärarbeitern und Freiwilligen, setzten sich hier zur Wehr. Die deutsche Abteilung, welche offenbar den König und die Mitglieder der Regierung gefangen nehmen sollte, erlitt Verluste und wurde zum Rückzuge gezwungen.
Am nächsten Tage, Mittwoch dem 10. April, kam es zu neuen Verhandlungen mit dem deutschen Gesandten, in Übereinstimmung mit einem am Dienstagnachmittag eingereichten Begehren. Der König, der Außenminister und ein vom Storting gewählter Ausschuss nahmen an diesen Verhandlungen teil, welche ergebnislos verliefen. Denn die deutschen Forderungen waren dieselben, welche die Regierung tags zuvor abgewiesen hatte. In einzelnen Punkten waren die Forderungen sogar verschärft worden. So sollte der König Major Vidkun Quisling zum Staatsminister ernennen. Nach Bekanntgabe des norwegischen Standpunktes unternahmen deutsche Bombenflugzeuge am nächsten Tage Angriffe auf Elverum und Nybergsund. König Haakon, der Kronprinz und die Regierung hielten sich zu diesem Zeitpunkt in Nybergsund auf. Die Absicht dieser Bombardemente, welche in Nybergsund die zentralen Quartiere dem Erdboden gleich machten und ungefähr fünfzig Menschen töteten, konnte nur sein, die Regierung über die Grenze nach Schweden zu treiben oder sie ihrer Handlungsfreiheit zu berauben. Als dieses Resultat nicht erreicht wurde, da wussten die Befehlshaber der deutschen Wehrmacht genau, dass sie in Norwegen einen Feldzug zu führen hatten.
Luftwaffe gegen Marine
Als man in London von der Landung der deutschen Truppen an der norwegischen Küste benachrichtigt wurde, da war man dort sehr geneigt, diese Landung als «Hitlers größten strategischen Fehler» zu charakterisieren. Gewiss fühlte man sich durch den neuen Handstreich des Gegners überrascht; aber man weigerte sich, die deutsche Besetzung Norwegens ernst zu nehmen. Hatten sich auch die deutschen Schiffe auf ihrer Fahrt nach Norwegen listig an der britischen Flotte vorbeigemacht, so lag es doch auf der Hand, dass sich die Deutschen in ein hoffnungsloses Unternehmen eingelassen hatten. Die überlegene britische Flotte würde in der allernächsten Zeit die Verbindung zwischen dem feindlichen Expeditionskorps und Deutschland entzweischneiden, was zum Zusammenbruch der deutschen Aktion führen musste, weil der Nachschub an Mannschaft und Material nicht aufrecht erhalten werden konnte. England beherrschte ja die Meere. Zur Zeit der deutschen Okkupation Norwegens wurden die englischen Seestreitkräfte in den Heimgewässern berechnet wie folgt: so Schlachtschiffe, 3-4 Flugzeugträger, ungefähr 30 Kreuzer und eine große Zahl Zerstörer. Dazu kam ein Teil der französischen Flotte. Gegen diese Streitkräfte konnte Deutschland einsetzen: 2 Schlachtkreuzer, 2 Panzerkreuzer, 8 Kreuzer und ungefähr 50 Zerstörer. Das Kräfteverhältnis war 1 : 5 zu Englands Vorteil. Deutschland hatte sich also auf einen Kampfplatz gewagt, wo ihm die Engländer eine vernichtende Niederlage zufügen konnten.
Sicher ist nicht, ob alle militärischen Befehlshaber in England die Lage so optimistisch beurteilten. Es herrscht jedoch kein Zweifel, dass die öffentliche Meinung durch Optimismus gekennzeichnet war und dass diese Stimmung durch Äußerungen von seiten der Regierung gefördert wurde.





























