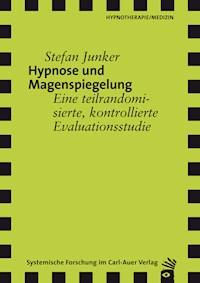Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die Welt ist in ziemlicher Unordnung. Und der Nachschub an neuen Krisen wird vorerst nicht abreißen, sondern weiter zunehmen. Denn die Menschheit steckt inmitten einer gigantischen 'Metakrise'. Der Krisenmanager Stefan Junker zeigt auf, was das bedeutet - und was jeder selbst tun kann, um erfolgreich durch diese unruhigen Zeiten zu navigieren. Er zeigt, wie man sowohl mit den großen Krisen der Gegenwart gut zurechtkommt, als auch die eigenen Krisen bewältigen kann. Eine Handreichung für jeden, der das eigene Denken nicht aufgeben möchte: * Leben in einer irren Welt, ohne den eigenen Verstand zu riskieren * Mentales Rüstzeug für chaotische Zeiten * Halt finden, wenn alte Selbstverständlichkeiten erodieren * Knowhow für das Management von Krisen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Die Welt ist in ziemlicher Unordnung. Und der Nachschub an neuen Krisen wird vorerst nicht abreißen, sondern weiter zunehmen. Denn die Menschheit steckt inmitten einer gigantischen „Metakrise“. Der Krisenmanager Stefan Junker zeigt auf, was das bedeutet – und was jeder selbst tun kann, um erfolgreich durch diese unruhigen Zeiten zu navigieren. Er zeigt, wie man sowohl mit den großen Krisen der Gegenwart gut zurechtkommt, als auch die eigenen Krisen bewältigen kann. Eine Handreichung für jeden, der das eigene Denken nicht aufgeben möchte:
Leben in einer irren Welt, ohne den eigenen Verstand zu riskieren
Mentales Rüstzeug für chaotische Zeiten
Halt finden, wenn alte Selbstverständlichkeiten erodieren
Knowhow für das Management von Krisen
Der Autor
Stefan Junker, Dr. phil., geboren 1975, studierte einige Semester Mathematik und internationale Politik und wurde schließlich Psychologe. Seit 2004 schult er Menschen darin, wie man sich vor Manipulation und Beeinflussung schützen kann. Als Wissenschaftler galt seine Leidenschaft Forschungen zu Hypnose und Suggestionen. 2005 wurde er mit dem Georg-Gottlob-Studienpreis für angewandte Psychologie ausgezeichnet. Heute lebt und arbeitet er bei Heidelberg und lehrt dort bei der Internationalen Gesellschaft für Systemische Therapie (IGST). Er berät politische Institutionen, Unternehmen, Organisationen und Entscheidungsträger in Fragen des Umgangs mit Krisen. Daneben ist er als Psychotherapeut und Coach niedergelassen.
Für meine Kinder.
Inhalt
Vorwort
Gefangen im Kreislauf von Fortschritt und Krise
Woran man echte Krisen erkennt
Die Geschichte vom Ende der Geschichte
Darf man auf den menschlichen Verstand hoffen?
Was ist nur los mit der Welt?
„Mir wird schwindelig.“
Komplexität, Dynamik und verborgene Wechselwirkungen
„Das konnte keiner ahnen!“
Das Ende der Intuition
„Warumhat uns niemand gewarnt?“
Die Illusion der Vorhersehbarkeit
„Das ist doch alles nicht mehr normal!“
Diagnose: ‚Metakrise‘
Angst!
Die emotionale Fieberkurve steigt an
Kollektive Sucht nach Sicherheit
Von hilflosen Kontrollversuchen und Kontrollverlust
Die Identität – ein bedrohtes Wesen
Sicherheit finden in einer unsicheren Welt
Typische Denkfehler in Krisenzeiten – und wie man sie vermeidet
Wenn man denkt man denkt dann denkt man nur man denkt
Wenn man nur sieht, was man schon denkt
Wenn andere Gedanken Hausverbot haben
Wenn man denkt die Anderen werden schon recht haben
Gefangen in Suggestionen und Trance
Krisentugenden: hilfreiche Haltungen für chaotische Zeiten
Zweifeln und Respektlosigkeit
Mut zu Abschied und Trauer
Achtsamkeit und Wagemut
Verrücktsein und Kreativität
Mut zu Entscheidungen
Fehlertoleranz
Verantwortungsbereitschaft
Selbstfürsorge: gesund bleiben in Zeiten der Veränderung
Nachwort
Anmerkungen
Vorwort
Was ist das nur für eine Zeit! Kriege, Elend, Flüchtlingsströme, Autokraten und Populisten, Nationalisten und Terroristen – die Symptome der Instabilität nehmen zu und pirschen sich immer näher an die bürgerlichen Komfortzonen heran. Demokratie, Klima, Weltwirtschaft, Kapitalismus, Staatshaushalte, internationale Zusammenarbeit, die EU ... kaum etwas, was in diesen Jahren nicht immer tiefer in die Krise zu geraten scheint. Und dann wären da noch die eigenen, ganz persönlichen Krisen.
Krisen überall. Sie entstehen manchmal plötzlich, manchmal schleichend, häufig unvorhersehbar, dieser Tage oftmals gleichzeitig, immer schneller, mit atemberaubender Dynamik. Sie stellen sich nicht brav in einer Reihe an, um zu warten, bis die vorhergehende beendet ist. Sie scheren sich nicht um Belastungsgrenzen, nehmen keine Rücksicht auf Menschenrechte und universelle Werte. Dass demokratische Gesellschaften Zeit zum Nachdenken, Reden und Abwägen brauchen, interessiert Krisen nicht die Bohne. Sie haben keine Moral und keine Empathie. Ihr Timing ist äußerst schlecht – sie kommen prinzipiell ungelegen. Außer für Populisten. Die behandeln Krisen sehr fürsorglich, verstehen sich in ihrer Aufzucht. Dabei sind Krisen per se schon sehr fruchtbar und potent, begatten sich gegenseitig, sorgen ungehemmt für zahllosen Nachwuchs. Wenn man sie nicht rechtzeitig einhegt und bewältigt, rotten sie sich zu gigantischen Katastrophen zusammen.
Die Gegenwart fühlt sich eigenartig an. Wir stehen irgendwo zwischen alter, klebriger Routine, gepflegter Alltagsidylle und dem gefühlten Vorabend einer unaufhaltsam hereinbrechenden Katastrophe. Zahllose vertraute Selbstverständlichkeiten scheinen ihrem Ende entgegenzugehen und sich, vorerst, in ein chaotisches Etwas aufzulösen. Es ist, als ob man die Sprengung eines Gebäudes in Zeitlupe betrachtet. Die gesellschaftliche Luft ist heiß, flimmert, vibriert vor unbestimmter Bedrohlichkeit. Luftspiegelungen verwirren die Sinne und trüben die Orientierung. Jenseits des Horizonts lauert das Unerwartete geduldig auf seine Auftritte. Dort haben die »schwarzen Schwäne1« ihr Nistgebiet. Sie sind ein Synonym des Unwahrscheinlichen, das plötzlich in die Wirklichkeit einbricht und die alte Normalität gnadenlos in Frage stellt.
Wie ist die Sache bei Ihnen persönlich gelagert? Sind Sie dieser Tage gelegentlich beunruhigt? Oder sogar aufgebracht und verärgert? Oder doch meist entspannt, gelassen und mit Abstand zu den Ereignissen? Sehen Sie Krisen als etwas, das meist nur andere betrifft – oder fühlen Sie sich persönlich bedroht?
Immer mehr Menschen fragen sich, welchen Reim Sie sich auf die Ereignisse in der Welt machen sollen. Wie man mit dieser seltsamen Gesamtlage souverän umgehen soll. Wie man es schafft, sich nicht der allgegenwärtigen Katastrophenstimmung auszuliefern. Aber woher gewinnt man Orientierung, wenn die Zukunft im Nebel verschwindet und immer mehr Zeitgenossen Angst haben, dass alles zusammenbrechen könnte?
Ich werde einen Weg skizzieren, wie das gehen kann.
Beginnen wir mit der Frage, woran man Krisen überhaupt erkennt, und ob wir es gegenwärtig überhaupt mit echten Krisen zu tun haben. Denn nicht überall wo „Krise“ draufsteht, ist auch eine drin. Vielleicht steigern sich viel zu viele da nur in etwas hinein – oder doch nicht?
Gefangen im Kreislauf von Fortschritt und Krise
Woran man echte Krisen erkennt
Denken Sie, dass Sie eine Krise sicher erkennen können? Und können Sie eine solche von einer problematischen Lage unterscheiden? Das ist ein sehr wichtiger Unterschied, will man sich in der gegenwärtig unübersichtlichen Welt sicher orientieren und die richtigen Schlüsse für das eigene Leben ziehen können. Aber der Reihe nach.
„Krise“ ist heutzutage ein äußerst inflationär gebrauchter Begriff. In unserem Informationszeitalter, in dem alles um Aufmerksamkeit kämpft und das „Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom“ zur häufigsten Kinder- und Jugendkrankheit geworden ist, muss man schon mächtig die Alarmglocken klingenlassen, um wahrgenommen zu werden. Heute wird fast alles rasch zur Krise verklärt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Hinzu kommt, dass verschiedenste Wissenschaftsdisziplinen – Medizin, Psychologie, Volkswirtschaft, Physik, Geschichte, Soziologie, Politik – den Begriff Krise mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen belegen. Das macht es nicht einfacher. Deswegen werden wir uns hier gar nicht erst mit den entsprechenden fachlichen Besonderheiten beschäftigen – es würde nur Verwirrung stiften und doch nichts zur Klärung beitragen. Doch wer mit den vermeintlichen Krisen in unserer Welt gut zurechtkommen will, sollte dennoch wissen, wann er es womöglich mit einer zu tun hat, und wann nicht. Wir brauchen eine alltagstaugliche Arbeitsdefinition für den Begriff „Krise“. Hier eine Annäherung:
Krisen zeichnen sich im Kern dadurch aus, dass eine Not besteht, die bisherigen, etablierten Vorgehensweisen nicht mehr funktionieren und keiner eine wirkliche Ahnung hat, was jetzt nachhaltig helfen könnte. Im besten Fall gibt es zwar einige Ideen und Theorien, aber die vermeintlichen Experten sind sich völlig uneins, welche die richtige ist. Die alten Routinen machen häufig alles nur noch schlimmer und die Lage entgleitet immer mehr. Es ist vergleichbar mit einem Auto, das im Schlamm steckengeblieben ist und sich immer tiefer eingräbt, je mehr der Fahrer versucht, durch den entschlossenen Tritt auf das Gaspedal herauszukommen.
Im Kontrast zu Krisen steht der Begriff des „Problems“. Probleme oder problematische Situationen sind nichts weiter als Herausforderungen, die durch Ist-Soll-Differenzen gekennzeichnet sind. Etwas ist nicht, wie es sein sollte, aber man weiß schon recht genau, wo die Reise hingehen soll. Und es bestehen bewährte, von nahezu allen Experten anerkannte Routinen, die verlässlich helfen, den Istzustand zu überwinden und in den Sollzustand zu überführen – wenngleich diese „Lösungswege“ mit gewissen Schwierigkeiten verbunden sein mögen. Probleme haben mithin immer eine Lösung, sonst wären sie keine. Autopannen, Blinddarmentzündungen, brennende Häuser, überflutete Keller, randalierende Hooligans nach einem Fußballspiel – alles nur Probleme, für die Lösungen längst erfunden wurden und prinzipiell verfügbar sind.
Nicht so bei Krisen. Hier sind die bisherigen Lösungsversuche bestenfalls unwirksam. In schlimmeren Fällen gießen sie sogar Öl ins Feuer. Wenn man mitten in einer Krise steckt, gibt es keine sicher identifizierbaren Lösungen, sonst wäre sie nur ein normales Problem. In Krisen gibt es bestenfalls begründete Vorgehensweisen, welche die Ereignisse hoffentlich hilfreich voranbringen werden und in eine neue, stabile Normalität hineinführen. Krisen verlangen das Navigieren auf Sicht. Das ist für viele Menschen nicht einfach auszuhalten. Überprüfen Sie sich selbst: Was hilft Ihnen persönlich üblicherweise, Unklarheit erst einmal auszuhalten, die Ruhe zu bewahren und sich lediglich stückweise vorwärts zu tasten?
Tückisch: Man kann, gerade in der Anfangszeit von Krisen, häufig kaum entscheiden, ob man es wirklich mit einer zu tun hat. Vielmehr ist es zu Beginn nur eine vage Ahnung: „Irgendetwas läuft hier grundlegend anders als sonst, oder?“ Gewissermaßen bekommt die alte Normalität zunehmend Risse, gerät ins Stocken. Natürlich: manchmal bricht die bekannte Normalität auch plötzlich zusammen und die Krise ist deutlich da, so wie die Krisen, die durch die Reaktorkatastrophen von Tschernobyl oder Fukushima hervorgerufen wurden.
Krisen, die schleichend heraufziehen, die also nicht plötzlich durch singuläre Ereignisse entstehen, sind hingegen nicht immer leicht zu erkennen. Es gibt dennoch einige Indizien, die auf Krisen hindeuten können und dazu einladen sollten, den bisherigen Blick auf die Dinge zu hinterfragen: Denn bei aufziehenden Krisen entsteht bei vielen der Eindruck, dass alles immer schneller auf wichtige, schicksalhafte Entscheidungen zuläuft. Diffuse Stimmungen von ›was jetzt passiert, hat weitreichenden, prägenden Einfluss auf die weitere Zukunft‹ können sich ausbreiten. Werden Krisen chronisch und über längere Zeiträume nicht bewältigt, grassieren immer extremere Ansichten, Verschwörungstheorien und Misstrauen. Obskure, stark vereinfachende Erklärungen für den Ursprung der Misere machen dann die Runde und Sündenböcke werden gesucht. Immer lauter und emotionaler erklingen Rufe nach einer raschen Lösung für die vermeintlichen Probleme. Ethische Standards und moralische Bedenken werden im Klima der Verunsicherung und Angst erschreckend schnell im Handstreich vom Tisch gewischt.
Letzend Endes wird bei der Entscheidung der Frage, ob man es in bestimmten Fällen mit Krisen zu tun hat oder nicht, jeder auf seine eigene Einschätzung zurückgeworfen. Denn es gibt keinen gottgleichen, völlig objektiven Blick von außen auf die Welt. Es gibt kein eindeutiges, hinreichendes Kriterium, sondern immer nur Hinweise. Somit lässt sich auch nie objektiv bestimmen, ob man es wirklich mit einer Krise zu tun hat. „Krise“ ist keine objektive Feststellung, sondern immer nur eine mehr oder weniger gut gestützte Annahme. Erst im Rückspiegel, nach erfolgreicher Überwindung einer Krise, oder auch dann, wenn die Krise in einer Katastrophe geendet ist, wird man mit Fug und Recht sagen können: „Oh ja, das war offensichtlich eine Krise!“ Aber wenn man mittendrin steckt? Unmöglich. Und auch erst im Rückspiegel wird man sagen können »dieses oder jenes hat zur Lösung der Krise beigetragen« oder auch »dieses oder jenes hätten wir besser nicht tun sollen«.
Es ist wie in einer Parabel des irischen Philosophen Charles Handy: Er erzählt von einem Frosch und was geschieht, wenn man ihn in einen Topf mit kochendem Wasser hineinwirft. Ahnen Sie es?
Er springt einfach wieder heraus und flüchtet in angenehmere Gefilde. Unglaublich schnell, entschlossen, vielleicht auch mit ein paar Blessuren, aber doch weitgehend unbeschadet. Was aber geschähe, wenn man einen Frosch in einen Topf mit zimmertemperiertem Wasser hineinsetzen würde? Und das Ganze dann sanft, Grad für Grad, erwärmen würde? Nichts würde geschehen. Das Tier bliebe sitzen. Bei 30 Grad würde es vielleicht denken: „Angenehm warm hier.“ Bei 40 Grad: „Ordentlich warm sogar. Am besten ich mache es mir jetzt so richtig bequem, entspanne und schalte mal schön ab.“ Bei 50 Grad: „Schon sehr warm heute. Aber das geht bestimmt vorbei.“ Bei 60 Grad: „Jetzt wird`s aber wirklich langsam heiß. Vielleicht sollte ich mal nachschauen, was da los ist? Oder einfach abwarten? Meine Glieder sind gerade so schlaff, ich warte mal noch …“ Bei 70 Grad: „Heiß! Heiß! Heiß! Da stimmt doch was nicht! Ich würde jetzt sofort hier rausspringen und mal nachschauen. Wenn ich noch könnte … Aber woher die Energie nehmen?“ Bei 90 Grad: „–“. Da war`s das dann.
Das Normalitätsmodell des Frosches hat offensichtlich versagt. In seiner Annahme entsprechen Temperaturveränderungen, solange die nur langsam vonstattengehen, der Normalität, und erfordern keine überstürzte Flucht. Als der Frosch dann doch skeptisch wird, ist es zu spät zum Gegensteuern. Der Frosch hat eine krisenhafte Zuspitzung mit vermeintlicher Normalität verwechselt.
Dreierlei Dinge wären hilfreich gewesen, die Katastrophe abzuwenden: ein besseres Normalitätsmodell, neugierige Skepsis, und rechtzeitige Handlungsbereitschaft. Menschen reagieren auf langsame Veränderungen von Natur aus träge. Übermäßiger Alarmismus wird von Artgenossen nicht sonderlich geschätzt. Das ist durchaus sinnvoll, denn wer würde andauernde Warnrufe noch ernst nehmen? Somit ergibt sich im Angesicht möglicher krisenhafter Entwicklungen ein scheinbares Dilemma: Immer wieder beschwichtigen und dadurch im Krisenfall nicht rechtzeitig reagieren – oder zu früh Alarm schlagen und dadurch nicht ernstgenommen werden.
Nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten waren beide Tendenzen zu beobachten. Der Spiegel eröffnete seine erste Ausgabe nach dem Ereignis mit dem Titel »Das Ende der Welt (wie wir sie kennen)« und ließ damit die Alarmsirenen erklingen. Manche anderen Medien, wie auch der scheidende Präsident Obama in seiner ersten Pressekonferenz nach der Wahl, übten sich hingegen vor allem in beschwichtigenden Äußerungen. Trump sei ein Pragmatiker, er werde sein Bestes tun, um die Nation zu einen, und er werde an Verpflichtungen gegenüber der NATO festhalten. Tenor: Wird schon alles seinen normalen Gang gehen.
Alarmiert sein oder lieber ruhig bleiben? Was soll man tun, wenn nicht genau klar ist, ob noch alles klar ist oder sich möglicherweise gerade eine Krise heranpirscht? Man kann durchaus etwas tun, um nicht als gekochter Frosch zu enden. Denn soviel lässt sich sagen: Gönnen Sie sich stets eine ordentliche Portion Ambivalenz. Halten Sie vieles für möglich, ohne vorschnell das eine oder andere zu glauben.
Seien Sie chronisch wissbegierig, interessiert und skeptisch. Nehmen Sie Perspektivwechsel vor, auch wenn es Anstrengungen mit sich bringt. Bewegen Sie sich heraus aus den (immer wärmeren?) Komfortzonen, aber ohne zu großes Geschrei. Gewinnen Sie Distanz zum Geschehen und schauen Sie Situationen in Ruhe mit Abstand an. Betrachten Sie aktuelle Entwicklungen in längeren zeitlichen Verläufen. Unterhalten Sie sich mit Dritten, die andere Sichtweisen anzubieten haben. Das alles kann Muster offenbaren und Hinweise auf Zusammenhänge geben. Hinterfragen Sie von Zeit zu Zeit die Dinge um sich herum, selbst wenn es scheinbar keinen Anlass dazu gibt. Natürlich: Das kann auch nerven. Aber was soll`s? Wenn man dafür nicht gargekocht wird?!
*
»Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und
warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein
großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten
gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen
wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr
gibt.«
Jean-Claude Juncker
ehemals Ministerpräsident von Luxemburg und Vorsitzender der
Eurogruppe, ab 2014 EU-Kommissionspräsident
(zitiert nach D. Koch: Die Brüsseler Republik. Spiegel 52/99)
Die Geschichte vom „Ende der Geschichte“
Wenden wir den Blick nun erst einmal zurück in die Vergangenheit, um die Gegenwart besser verstehen zu können. Denn auch schon früher herrschten immer wieder Krisenstimmungen und Menschen stellten sich die bange Frage: Bricht alles zusammen?
*
1899, die westliche Welt. Eine Zeit geprägt von Aufbruchstimmung und Zukunftseuphorie. Ich sitze in meinem Lieblingssessel, blättere mal wieder in Geschichtsbüchern, wische mich durchs Internet. Entdecke Unterschiede zu heute, staune noch mehr über Ähnlichkeiten. Durch den rapide angestiegenen Austausch von Waren, Geld und Informationen war die Welt einerseits näher zusammengerückt und scheinbar kleiner geworden – andererseits aber auch komplexer und unübersichtlicher. Manche sprechen heute von einer ersten Hochphase der Globalisierung. Die Wissenschaft feierte grandiose Erfolge. Das Ingenieurwesen war unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Die Technik hielt Einzug in jedermanns Leben. Die letzten weißen Flecken auf den Landkarten verschwanden. Überall wurden Pläne geschmiedet und Utopien gezimmert. Dennoch machten sich mancherorts Endzeitstimmungen und Zukunftsängste breit. Die Industrialisierung hatte zu großen sozialen Verwerfungen geführt. Für die Zeitgenossen schien es, als stehe kein Stein mehr auf dem anderen. Das Tempo der technischen und gesellschaftlichen Veränderungen war atemberaubend. Der Zeitgeist schwankte zwischen Dekadenz, sozialen Ängsten, überzogenem Patriotismus, Lebensüberdruss und sozialdarwinistischer Überheblichkeit. Nervöse Geister und findige Geschäftemacher schürten mit Hilfe der Medien die Angst vor einem Kometeneinschlag. Astronomen hatten für Mitte November 1899 den Vorbeiflug eines Kometen berechnet. Bei vielen breitete sich daraufhin eine fatalistische Krisenstimmung aus.
Es kam, trotz der Befürchtungen mancher flattrigen Zeitgenossen, nicht zum vorhergesagten Weltuntergang. Die Dinge entwickelten sich völlig anders. Über die Jahre kamen Krisenstimmungen und auch manche echte Krise, und sie gingen wieder, viele von selbst. Die Alarmisten hatten häufig Unrecht gehabt. Größeres Unglück blieb (vorerst) aus. Im Windschatten der Umwälzungen dieser Jahre hatte allerdings eine kontinuierliche militärische Aufrüstung stattgefunden. Nationalismus und allerlei extreme Ideologien fanden einen hervorragenden Nährboden – bis sich das Gemisch schließlich in der Urkatastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts, dem Ersten Weltkrieg, Dieses zuvor unvorstellbare Inferno biblischen Ausmaßes zog in den Folgejahren noch vielerlei Krisen nach sich, bis das Unheil seine Fortsetzung im Zweiten Weltkrieg erfuhr.
In den Jahrzehnten nach den Weltkriegen durfte man den Eindruck gewinnen, dass sich durch die schrecklichen Erfahrungen in der ersten Hälfte des Jahrhunderts zunehmend der Geist von Aufklärung und Humanismus durchsetzte. Was gab es nicht alles an Fortschritten! Die Vereinten Nationen wurden gegründet. Mit der Menschenrechtscharta wurde 1948 ein – vermeintlich – universelles Wertesystem etabliert. Die Genfer Flüchtlingskonvention garantierte Verfolgten und Vertriebenen ab 1954 einen einheitlichen, verbindlichen Rechtsstatus. Zahlreiche politische Krisen konnten zu einem guten Ende geführt werden. Man denke nur an die Kubakrise 1962, welche die Welt an den Rand eines Atomkrieges geführt hatte. Hungerkatastrophen wurden gemildert, Infektionskrankheiten wie die Pocken praktisch ausgerottet. Ein Sieg von Kooperation und menschlicher Vernunft.
In Europa sicherte die stetig zunehmende, konstruktive Zusammenarbeit der Länder erstmals Wohlstand und Frieden. Die EU wurde auf den Trümmern des alten Kontinents aufgebaut, Grenzen wurden geöffnet, Waren und Kultur fanden freien Austausch. Das gemeinsame Interesse am Wohle aller schien dauerhaft über den kurzsichtigen Egoismus der Nationalstaaten gesiegt zu haben. Die Zauberformeln, mit denen Menschen wie Willy Brandt, Hans-Dietrich Genscher, Michail Gorbatschow, Nelson Mandela, Jitzchak Rabin und andere sich anschickten, die Welt Stück für Stück zu einem besseren Ort zu machen, lauteten Kommunikation und Kooperation. Und dann fiel sogar noch die Mauer, der Warschauer Pakt brach zusammen, der Kalte Krieg fand ein Ende. Frieden, Freiheit, demokratische Grundwerte und Wirtschaftsliberalismus schienen das natürliche Reifestadium der menschlichen Kultur zu sein. Dies veranlasste den Politologen Francis Fukuyama 1992 dazu, mit seinem gleichnamigen Weltbestseller das »Ende der Geschichte« auszurufen. Seiner Ansicht nach würden sich nach dem Zusammenbruch des Ostblocks liberale Grundsätze in Form von Demokratie und Marktwirtschaft überall durchsetzen. Er begründete dies damit, dass kein anderes Modell das menschliche Streben nach sozialer Anerkennung besser befriedige, und somit entfalle das Antriebsmoment der Geschichte. Die alte Hegelsche Vorstellung von These und Antithese führe tatsächlich zu einer letzten großen Synthese in Gestalt der Auflösung weltpolitischer Widersprüche.
Schön, dass Menschen so fest an etwas wie den menschlichen Verstand glauben können. Aus heutiger Sicht, zweieinhalb Jahrzehnte später, wirken Fukuyamas damalige Ansichten wie Naivität im Endstadium. Geschichte geht weiter. Immer. UN, NATO und EU sind heute keine Beschützer vor Krisen und Bewahrer des Weltfriedens mehr. Sie stecken selbst in den tiefsten Krisen seit ihrer Gründung, genau wie die Demokratie westlicher Prägung als Ganzes. Der Zustand der meisten internationalen Organisationen ist besorgniserregend. Auch nichtstaatliche Träger des Friedensgedankens wie zum Beispiel das Internationale Olympische Komitee und die FIFA sind, verglichen mit ihren Gründungsmythen, nur noch Ruinen. Heute prägen die Erdogans, Orbans, LePens, Trumps und Putins die Szenerie. Sie drängen ins Licht – nicht um besser zu sehen, sondern um strahlender zu glänzen. Sie vergiften das Klima zwischen den Ethnien, reißen im Handstreich Brücken ein, die andere mühevoll über Jahrzehnte errichtet hatten. Machttrunken und egoman wird das Ideal der Zusammenarbeit und die dafür notwendige Tugend der Kompromissbereitschaft zu Grabe getragen. Die radikalen Kräfte der entfesselten globalen Ökonomie haben ganze Gesellschaften mit ihrer neodarwinistischen »Winnertakes-all-Logik« infiziert. Willfährig entsorgen die Anhänger der neuen Alphatiere die in ihren Augen altmodischen und bemitleidenswert schwachen Kooperationsmodelle der Demokratie. Man schreit nach Stärke und Durchsetzungsfähigkeit, bejubelt den scharfmachenden, entschlossenen Monolog, zieht das rasche, machtvolle, unreflektierte Handeln dem gemeinsamen, behutsamen Vorwärtstasten vor. Pubertäre Lust an der Zerstörung verdrängt das Abwägen und die menschenfreundliche Vernunft.
War die zweite Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts etwa nur ein unwahrscheinliches Zwischenspiel in der Geschichte der Menschheit? Alles Positive schien einem natürlichen Wachstumspfad zu folgen: Verstand, Frieden, Wohlstand, Aussöhnung, Vernunft, Kultur. Aber selbst in der Wirtschaftswunderzeit äußerte der ehemalige deutsche Kanzler Konrad Adenauer Zweifel: »Ist es nicht schrecklich, dass der menschlichen Klugheit so enge Grenzen gesetzt sind und der menschlichen Dummheit überhaupt keine?«.
Die Lehre aus der Geschichte? Gehen Sie nie davon aus, dass alles gut ist und nichts mehr neu betrachtet und gedacht werden muss. Gehen Sie auch nie davon aus, dass dieser Zeitpunkt jemals kommen könnte. Es gibt kein Menschsein ohne Krisen. Man sollte sich besser entspannt damit abfinden. Und gehen Sie erst recht niemals davon aus, dass in der Vergangenheit einmal alles gut gewesen sein könnte und es deshalb erstrebenswert ist, die Zeit zurückzudrehen. Die Tatsache, dass es immer Krisen gab und geben wird, verlangt nach Vorwärtsverteidigung und dem verantwortungsvollen Einsatz des Verstandes, und nicht nach Geschichtsvergessenheit.
Darf man auf den menschlichen Verstand hoffen?
Dezember 2015, Paris: Laurent Fabius, der Außenminister Frankreichs, ist sichtlich gerührt. Seine Stimme ist brüchig, er hat Tränen in den Augen. Die versammelten Repräsentanten der Weltgemeinschaft blicken erwartungsvoll auf ihn, den Konferenzleiter der UN-Klimakonferenz. Sie kleben förmlich an seinen Lippen. Er hält ein flammendes Plädoyer für die Annahme des nun vorliegenden, völkerrechtlich bindenden Vertragsentwurfs. Der sieht erstmals vor, dass alle Staaten sich verpflichten, die Erderwärmung auf deutlich unter 2°C, möglichst sogar 1,5°C zu begrenzen. Er sagt Sätze wie diese: »Unsere Kinder würden uns nicht verstehen, noch würden sie uns vergeben.« Am nächsten Tag ist klar: Der Vertrag wird von allen angenommen. Den Anwesenden ist bewusst, dass sie einen historischen Moment miterleben. In den Jahren zuvor hatten Aktivisten und Experten unermüdlich auf die drohende Klimakatastrophe hingewiesen. Und trotz der vielen erfolglosen Vorgängerkonferenzen hatten sie nie aufgegeben.
Ohne den emsigen Fleiß und das Denkvermögen der Fachleute wäre es nie so weit gekommen. Ihre Daten, Modelle und Hochrechnungen waren die notwendige Grundlage für diesen ersten großen Erfolg, der immerhin auch ein Jahr später bei der Folgekonferenz in Marrakech ambitioniert fortgeschrieben wurde. Erst die Gemeinschaft der Wissenschaftler hatte aufzeigen können, was da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit komme, wenn nicht gegengesteuert werde. Ihr Alarm war wesentlich.