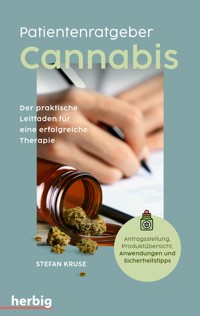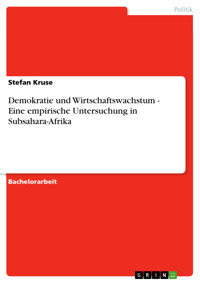Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Seit September 2011 ist das neue Zertifizierungssystem KTQ-Rettungsdienst auf dem Markt und ergänzt damit die bereits etablierten Zertifizierungsverfahren der Kooperation für Transparenz im Gesundheitswesen (KTQ®) für Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen/Pflegedienste sowie Praxen und Medizinische Versorgungseinrichtungen/MVZ. Das KTQ-Handbuch Rettungsdienst beschreibt nicht nur den Weg zu einer KTQ-Zertifizierung durch ein für das Gesundheitswesen spezifisch entwickeltes Verfahren, sondern bietet zudem eine optimale Unterstützung zur Vorbereitung und zum Aufbau eines individuellen Qualitätsmanagements. In anschaulichen, an der Praxis orientierten Beispielen werden Möglichkeiten und Wege aufgezeigt, die Arbeitsabläufe im Rettungsdienst im Sinne der Patienten und Mitarbeiter zu optimieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Seit September 2011 ist das neue Zertifizierungssystem KTQ-Rettungsdienst auf dem Markt und ergänzt damit die bereits etablierten Zertifizierungsverfahren der Kooperation für Transparenz im Gesundheitswesen (KTQ®) für Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen/Pflegedienste sowie Praxen und Medizinische Versorgungseinrichtungen/MVZ. Das KTQ-Handbuch Rettungsdienst beschreibt nicht nur den Weg zu einer KTQ-Zertifizierung durch ein für das Gesundheitswesen spezifisch entwickeltes Verfahren, sondern bietet zudem eine optimale Unterstützung zur Vorbereitung und zum Aufbau eines individuellen Qualitätsmanagements. In anschaulichen, an der Praxis orientierten Beispielen werden Möglichkeiten und Wege aufgezeigt, die Arbeitsabläufe im Rettungsdienst im Sinne der Patienten und Mitarbeiter zu optimieren.
Stefan Kruse, Konzernbereich Qualität, Asklepios Kliniken. Ronald Neubauer, Projektleiter Rettungsdienst KTQ-GmbH. Gesine Dannenmaier, Geschäftsführerin KTQ-GmbH.
Stefan Kruse Ronald Neubauer Gesine Dannenmaier
KTQ-Handbuch Rettungsdienst
Ein Praxisleitfaden mit Tipps für den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems
Verlag W. Kohlhammer
Wichtiger Hinweis Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfi lmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind. Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde ausschließlich die männliche Form (z. B. Mitarbeiter) verwendet und auf die zusätzliche Benennung der weiblichen Form (z. B. Mitarbeiterin) verzichtet. KTQ®, KTQ-Visitor®, KTQ-Berater®, KTQ-Coach® sind eingetragene Warenzeichen der KTQ-GmbH. Der Begriff „KTQ-Modell“ ist urheberrechtlich durch die KTQ-GmbH geschützt.
1. Auflage 2013
Alle Rechte vorbehalten © 2013 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
ISBN 978-3-17-024795-6
E-Book-Formate
pdf:
978-3-17-024796-3
epub:
978-3-17-024797-0
mobi:
978-3-17-024798-7
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Qualitätsmanagement im Rettungsdienst
2 KTQ® im Rettungsdienst
2.1 Inhalte von KTQ-Rettungsdienst
2.2 Welchen Nutzen hat die Rettungsdienstorganisation durch Qualitätsmanagement?
2.3 Das KTQ-Verfahren
3 Aufbau und Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems
3.1 Projektablauf festlegen
3.2 Lenkungsgremium festlegen
3.3 Ist-Analyse und Maßnahmenplan
3.4 Schulung von Mitarbeitern zu qualitätsmanagementrelevanten Themen
3.5 Optimierungsphase
3.6 Evaluationsphase
3.7 Überarbeitung des Selbstbewertungsberichts
3.7.1 Erstellung des Strukturerhebungsbogens
3.7.2 Erstellung des KTQ-Qualitätsberichts
3.8 Vorbereitung und Anmeldung zur Zertifizierung
3.9 Kosten einer KTQ-Zertifizierung
3.10 KTQ-Visitation
3.11 Zertifikatsvergabe
4 KTQ-Systematik – Aufbau und Punkteverteilung
5 Anleitung zur Erstellung des Selbstbewertungsberichts
5.1 Erstellung des Selbstbewertungsberichts
5.2 Kriterienbewertung
6 Umsetzung der Anforderungen aus dem KTQ-Katalog Rettungsdienst
Kategorie 1: Patientenorientierung
1.1 Einsatzvor- und -nachbereitung
1.1.1 Sicherung der Einsatzbereitschaft
1.2 Rettungsmittelzuführung zum Patienten
1.2.1 Alarm und Ausrücken der Rettungsmittel
1.2.2 Anfahrt zum Patienten
1.3 Patientenversorgung an der Notfallstelle
1.3.1 Ersteinschätzung der Notfallsituation
1.3.2 Anwendung von Leitlinien und Vorgabedokumenten
1.4 Patiententransport
1.4.1 Auswahl der Zielklinik
1.4.2 Patientenversorgung während des Transports
1.5 Übergabe des Patienten
1.5.1 Versorgung am Einsatzort
1.5 Übergabe des Patienten
1.5.2 Übergabe des Patienten an die Zielklinik
1.5.3 Übergabe in andere Einrichtungen
1.6 Sondersituationen
1.6.1 Sterben und Tod
1.6 Sondersituationen
1.6.2 Technische Rettung
1.6 Sondersituationen
1.6.3 Spezielle Patienten
1.6.4 Massenanfall von Verletzten – Erkrankten (MANV)
1.6.5 Sekundärtransport
Kategorie 2: Mitarbeiterorientierung
2.1 Personalplanung und Personalentwicklung
2.1.1 Planung des Personalbedarfs
2.1.2 Personalentwicklung/Qualifizierung
2.1.3 Einarbeitung von Mitarbeitern
2.1.4 Ausbildung
2.1.5 Fort- und Weiterbildung
2.1.6 Psychosoziale Kompetenzen
2.2 Sicherstellung der Integration von Mitarbeitern
2.2.1 Mitarbeiterorientierter Führungsstil
2.2.2 Geplante und gesetzliche Regelung der Arbeitszeit
2.2.3 Mitarbeiterideen, -wünsche und -beschwerden
Kategorie 3: Sicherheit
3.1 Schutz- und Sicherheitssysteme
3.1.1 Arbeitsschutz
3.1.2 Brandschutz
3.1.3 Umweltschutz
3.1.4 Nichtmedizinische Notfallsituationen
3.2 Patientensicherheit
3.2.1 Schutz des Patienten vor Eigen- und Fremdgefährdung
3.2.2 Hygienemanagement
3.2.3 Arzneimittel
3.2.4 Behandlung und Transport
3.2.5 Umgang mit Medizinprodukten
Kategorie 4: Informations- und Kommunikationswesen
4.1 Informations- und Kommunikationstechnologie
4.1.1 Aufbau und Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie
4.2 Einsatz- und Patientendaten
4.2.1 Regelung zur Führung, Dokumentation und Archivierung von Einsatz- und Patientendaten
4.3 Informationsmanagement
4.3.1 Information der Rettungsdienstleitung
4.3.2 Informationsweitergabe intern/extern
4.3.3 Organisation der Kommunikation zwischen Rettungsdienst und Leitstelle
4.4 Datenschutz
4.4.1 Regelungen zum Datenschutz
Kategorie 5: Führung
5.1 Unternehmensphilosophie und -kultur
5.1.1 Vision, Philosophie und Leitbild
5.1.2 Durchführung vertrauensbildender Maßnahmen
5.1.3 Ethische und kulturelle Aufgaben, weltanschauliche und religiöse Bedürfnisse
5.2 Strategie und Zielplanung
5.2.1 Entwicklung, Vermittlung und Umsetzung
5.2.2 Gesellschaftliche Verantwortung, Partnerschaften und Kooperationen
5.3 Organisationsentwicklung
5.3.1 Festlegung einer Organisationsstruktur
5.3.2 Effektivität und Effizienz der Arbeitsweise der Führungsgremien
5.3.3 Innovation und Wissensmanagement
5.4 Marketing
5.4.1 Externe Kommunikation
5.5 Risikomanagement
5.5.1 Aufbau und Entwicklung des Risikomanagementsystems
Kategorie 6: Qualitätsmanagement
6.1 Qualitätsmanagementsystem
6.1.1 Organisation des Qualitätsmanagements
6.1.2 Vernetzung, Prozessgestaltung und Prozessoptimierung
6.2 Befragungen
6.2.1 Patienten- und Angehörigenbefragung
6.2.2 Befragung externer Einrichtungen
6.2.3 Mitarbeiterbefragung
6.3 Beschwerdemanagement
6.3.1 Umgang mit Wünschen und Beschwerden
6.4 Qualitätsrelevante Daten
6.4.1 Erhebung und Nutzen von qualitätsrelevanten Daten
6.4.2 Methodik und Verfahren der freiwilligen externen Qualitätssicherung
Vorwort
Sehr geehrte Leser,
seit September 2011 ist das neue Zertifizierungssystem KTQ-Rettungsdienst am Markt und ergänzt damit die bereits etablierten Zertifizierungsverfahren der Kooperation für Transparenz im Gesundheitswesen-KTQ® für Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen/Pflegedienste sowie Praxen und Medizinische Versorgungseinrichtungen/MVZ.
KTQ-Rettungsdienst wurde, gemäß der KTQ-Philosophie „von der Praxis-für die Praxis“ von Praktikern in einer Arbeitsgruppe aus Experten des Rettungsdienstes und des Qualitätsmanagements unter Leitung der KTQ-Geschäftsstelle erarbeitet. Es ist ein verständliches und an der täglichen Arbeitspraxis orientiertes Zertifizierungsverfahren, das dem Gesundheitswesen in seinen intersektoralen Strukturen ganz im Sinne der Patienten- und Mitarbeiterorientierung umfassend gerecht wird.
Qualitätsmanagement bedeutet insbesondere einen strukturierten Umgang mit den Prozessen der täglichen Arbeitspraxis – dies ist gerade im Rettungsdienst eine hohe Herausforderung.
Dieses KTQ-Handbuch Rettungsdienst beschreibt somit nicht nur den Weg zu einer KTQ-Zertifizierung durch ein für das Gesundheitswesen spezifisch entwickeltes Verfahren, sondern bietet auch eine optimale Unterstützung zur Vorbereitung und zum Aufbau eines individuellen Qualitätsmanagements. Mögliche Fragen in diesem Zusammenhang werden mit viel Praxisorientierung beantwortet, Beispiele motivieren und zeigen Wege auf, damit Qualitätsmanagement kein Fremdwort für alle Beteiligten/Mitarbeiter ist.
Zwischenzeitlich konnte bereits ein breites Spektrum mit unterschiedlichen Rettungsdiensteinrichtungen erfolgreich nach KTQ® zertifiziert werden. Dabei waren Hilfsorganisationen, kommunale und private Einrichtungen sowie auch die Luftrettung vertreten. Die nach dem KTQ-Verfahren zertifizierten Einrichtungen können Sie auf der Homepage unter www.ktq.de einsehen.
Bedanken möchte ich mich bei Herrn Stefan Kruse, der mit sehr viel Engagement und Praxiserfahrung an der Umsetzung dieses Handbuchs, basierend auf dem KTQ-Manual, gearbeitet hat.
Herrn Ronald Neubauer, dem Projektleiter des KTQ-Verfahrens Rettungsdienst, danke ich für die sehr engagierte Arbeit auch in Form der Begleitung der ersten Zertifizierungen vor Ort und bei der Erstellung dieses Handbuches.
Somit ist ein Handbuch von Praktikern für Praktiker entstanden. Wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und sind interessiert an Ihren Rückmeldungen zu diesem Handbuch und dem KTQ-Verfahren!
Berlin, den 27. September 2013
Gesine Dannenmaier
Geschäftsführerin der KTQ-GmbH
1 Qualitätsmanagement im Rettungsdienst
Zahlreiche Rettungsdienstorganisationen befassen sich seit vielen Jahren mit dem Thema Qualitätsmanagement. Grundlage dafür sind die in den einzelnen Bundesländern unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen, beziehungsweise die freiwillige Verpflichtung einiger Organisationen für ein umfassendes Qualitätsmanagement. Viele Organisationen sehen durch die Umsetzung und Zertifizierung ihres Qualitätsmanagementsystems einen Wettbewerbsvorteil.
In einigen Landesrettungsdienstgesetzen finden sich klar definierte gesetzliche Forderungen zum Qualitätsmanagement, in einigen Ländern sind diese jedoch nur indirekt, oder es sind gar keine Vorschriften zu finden. Überwiegend werden Begriffe wie Qualitätssicherung oder Qualitätskontrolle verwendet, weniger der Begriff eines umfassenden Qualitätsmanagements. Ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung ist die gesetzliche Verankerung der Funktion des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst (ÄLRD), dem diese Aufgabe in der Regel zugeordnet ist.
Insgesamt existieren für Rettungsdienste wenige geeignete Systeme zur Zertifizierung, so dass in der Regel die DIN EN ISO 9001 ff angewandt wird.
Der Stand der zertifizierten Rettungsdienste in Deutschland zeigt deutlich, dass hier noch kein gemeinsamer Konsens gefunden wurde, die Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen flächendeckend durchzusetzen.
Seit Januar 2004 sind Einrichtungen des Gesundheitswesens gemäß § 135 Abs. 2 Nr. 2 SGB V verpflichtet, ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagementsystem einzuführen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Diese Pflicht und weitere Maßnahmen haben in den letzten Jahren bundesweit zu einer deutlichen Verbesserung der medizinischen Ergebnisqualität im Gesundheitswesen geführt.
Es ist an der Zeit, diesen Nutzen auch Rettungsdienstorganisationen transparent zu machen. Die KTQ-GmbH hat sich dieser Aufgabe angenommen und mit Fachleuten aus dem Rettungsdienst ein praxisorientiertes Zertifizierungssystem entwickelt, welches sich nicht an Industrienormen, sondern an der täglichen Berufspraxis des Rettungsdienstes und den geltenden Normen eines funktionierenden Qualitätsmanagementsystems orientiert.
Die von der Gesundheitsministerkonferenz angekündigte Verankerung des Rettungsdienstes als Krankenbehandlung in das Sozialgesetzbuch V stellt eine wichtige Basis für einheitliche Regelungen zum einheitlichen und verpflichtenden Qualitätsmanagement für Rettungsdienstorganisationen dar.
Es ist zu beachten, dass Qualitätsmanagement nicht als Mittel zur Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit und Marktvorteilen betrachtet wird oder möglicherweise als notwendiges Übel, sondern als hervorragende Chance für ein Unternehmen verstanden wird, beste Versorgungsqualität für den Patienten zu garantieren und kontinuierlich zu verbessern. Zudem können, z. B. durch Prozessoptimierungen, die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter verbessert werden. Vor dem Hintergrund evtl. auftretender juristischer Auseinandersetzungen ist ein funktionierendes Qualitätsmanagement, gerade in Fällen mit Beweislastumkehr, ein geeignetes Mittel, um die eigene Position abzusichern.
Qualitätsmanagement darf also nicht nur der Zertifizierung dienen und danach keinesfalls auf einer Stelle stehen bleiben, sondern es muss im Unternehmen aktiv umgesetzt und gelebt werden, damit es den Patienten, dem Unternehmen selbst, den Partnern und weiteren Kunden einen sinnvollen Nutzen bringt. Hierzu sind alle Beteiligten (Gesetzgeber, Behörden, Aufsicht, Kostenträger, Unternehmen und Mitarbeiter) gefordert, an der Zukunft des Qualitätsmanagements im Rettungsdienst mitzuarbeiten, um geeignete Konzepte und Empfehlungen für ein einheitliches, patientenorientiertes und zukunftsfähiges Qualitätsmanagementsystem im Rettungsdienst zu entwickeln. Dadurch soll im Rettungsdienst ein adäquater Qualitätsmanagementstandard gesichert werden.
2 KTQ® im Rettungsdienst
Seit 2001 existiert das Verfahren der „Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen“ (KTQ®) im Routinebetrieb. Die KTQ® ist im ständigen Dialog mit den Einrichtungen des Gesundheitswesens, den KTQ-Visitoren und den Zertifizierungsstellen. Das KTQ-Verfahren wird kontinuierlich den aktuellen Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens angepasst. An der Entwicklung des Zertifizierungsverfahrens „KTQ-Rettungsdienst“ wurden erfahrene Spezialisten des Rettungsdienstes und Experten des Qualitätsmanagements einbezogen sowie 10 Jahre Erfahrungen mit dem bewährten KTQ-Zertifizierungsverfahren berücksichtigt. Die KTQ-GmbH stellte das neue Zertifizierungsverfahren für den Rettungsdienst erstmalig im September 2011 auf dem 11. KTQ-Forum in Berlin der Öffentlichkeit vor.
Die Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen (KTQ®) wurde im Jahr 2001 gegründet und besteht aus folgenden Gesellschaftern:
Bundesärztekammer – Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern
Verbände der Kranken- und Pflegekassen auf Bundesebene
Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V.
Deutscher Pflegerat e. V.
Hartmannbund – Verband der Ärzte Deutschlands e. V.
Das KTQ-Verfahren hat sich als ein bewährtes Verfahren kontinuierlich weiterentwickelt und wird von ca. 25 % der deutschen Krankenhäuser erfolgreich umgesetzt. In Rehabilitationseinrichtungen ist das von der Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation (BAR) anerkannte KTQ-Verfahren eine Möglichkeit, die gesetzliche Zertifizierungspflicht gemäß der Vereinbarung zum internen Qualitätsmanagement nach § 20 Abs. 2a SGB IX umzusetzen. Auch im Bereich der niedergelassen Ärzte (Praxen, MVZ, Pathologische Institute, etc.) sowie in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen, Hospizen, alternativen Wohnformen, etc. ist das KTQ-Verfahren etabliert.
Unser Tipp:
Es ist abzusehen, dass die Kostenträger im Rettungsdienst zukünftig definierte Qualitätsstandards von Rettungsdienstorganisationen fordern. Deshalb müssen Qualitätsmanagementmaßnahmen und Qualitätsergebnisse für Dritte transparent dargestellt werden.
Auch Patienten und Patientenorganisationen stellen Gesundheitsleistungen aller Art immer mehr in den Fokus der Transparenz.
Noch haben Rettungsdienstorganisationen die Möglichkeit, freiwillig und ohne Zeitdruck ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem umzusetzen. Diese Zeit sollte genutzt werden, ein System einzuführen, das dem Unternehmen sowie den Patienten und Kunden nutzt.
2.1 Inhalte von KTQ-Rettungsdienst
Auch andere Zertifizierungsverfahren verlaufen ähnlich. Es beginnt immer mit einer Selbstbewertungsphase, gefolgt von einer Optimierungsphase und letztendlich – als externe Bescheinigung der Qualitätsfähigkeit – die Fremdbewertungsphase, die durch unabhängige Auditoren/Visitoren erfolgt.
KTQ-Rettungsdienst ist ein praxisorientiertes Zertifizierungssystem, in dem die Patientenorientierung im Vordergrund steht. In anderen Systemen wird an dieser Stelle gerne von Kundenorientierung gesprochen, worauf hier aus Gründen der Verständlichkeit in Bezug auf den Patienten verzichtet wird. Allerdings ist der Begriff „Kunde“ ein gebräuchlicher Begriff in jedem Zertifizierungssystem, denn auch beim Rettungsdienst spielt die Kundenorientierung eine große Rolle, z. B. im Umgang mit Praxen, Einweisern, Kostenträgern, Partner, etc. Selbstverständlich ist auch die Mitarbeiterorientierung ein Teil des KTQ-Kataloges für den Rettungsdienst.
Der Regelkreis der ständigen Verbesserung wird auch als Deming-Zyklus (nach William Edwards Deming, 1900-1993) bezeichnet. Im Modell der „Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen“ (KTQ®), werden die einzelnen Schritte des Deming-Zyklus mit PLAN, DO, CHECK und ACT bezeichnet. Unter „PLAN“ werden die Prozesse definiert und ihre Umsetzung sowie die Verantwortlichkeiten festgelegt. Im „DO“ wird die Umsetzung der Prozesse dargestellt. Der Schritt „CHECK“ beschreibt die Schritte der Überprüfung der Prozesse. Hier wird nach Überprüfung die Ergebnisqualität dargestellt, aus der sich erforderliche Verbesserungsmaßnahmen ableiten lassen. Im „ACT“ werden die erforderlichen Korrekturmaßnahmen festgelegt, die zu einer Optimierung der Prozesse führen sollen. Dieser Regelkreis der kontinuierlichen Verbesserung, der im KTQ-Modell PDCA-Zyklus genannt wird, muss immer wieder durchlaufen werden, um Prozesse kontinuierlich zu überprüfen und bei Bedarf zu optimieren.
Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ist ein unverzichtbares Kernelement in jedem Qualitätsmanagementsystem. Alle Mitarbeiter tragen täglich dazu bei, im Unternehmen einen Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung zu leisten. Dieser Prozess der kontinuierlichen Verbesserung wird im System der KTQ® mit dem P-D-C-A-Zyklus benannt. PLAN, DO, CHECK und ACT sind die Begriffe, die dahinter stehen. Die Einhaltung dieses Prozesses wird vorausgesetzt, um ein Qualitätsmanagementsystem praxisorientiert und aktiv zu gestalten.
PLAN :
Hierbei geht es um die nachweisbare Prozessplanung.
Die Verantwortlichkeiten sind hier geregelt.
DO :
Im DO wird die Umsetzung der Planungen in die Praxis beschrieben.
CHECK :
Dieser Schritt beinhaltet die regelhafte Überprüfung der im PLAN festgelegten und im DO umgesetzten Prozesse.
ACT :
Im ACT werden die durchlaufenden Phasen des kontinuierlichenVerbesserungsprozesses reflektiert und nach Analyse der Ergebnisse werden adäquate Korrekturmaßnahmen definiert und dokumentiert, um eine Verbesserung einzuleiten und nachzuweisen.
Dieser PDCA-Zyklus stellt den Regelkreis des Qualitätsmanagements dar. In der täglichen Praxis des Qualitätsmanagements ist immer wieder zu beobachten, dass teilweise nur PLAN und DO berücksichtigt werden. Damit ist das Qualitätsmanagementsystem nicht umsetzbar. Wer nicht bereit ist, diesen Regelkreis des Qualitätsmanagements kontinuierlich zu leben, der wird kein erfolgreiches Qualitätsmanagementsystem umsetzen können.
Die Umsetzung des PDCA-Zyklus beginnt bei der Führung eines Unternehmens und muss von dieser auch langfristig unterstützt und getragen werden.
Bei KTQ-Rettungsdienst sprechen wir übergreifend von drei Arten der Qualität, der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität.
Die Strukturqualität beinhaltet unter anderem die Rahmenbedingungen des Leistungsprozesses im Rettungsdienst, insbesondere die personelle, räumliche und sachliche Ausstattung. Unter Prozessqualität versteht man die eigentlichen Leistungsprozesse im Rettungsdienst, z. B. im Rahmen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes. Die Ergebnisqualität ist als Zielerreichungsgrad der Maßnahmen aus der Notfallrettung und dem qualifizierten Krankentransport zu verstehen. Zu vergleichen ist der Ist- Zustand mit den angestrebten Zielen unter Berücksichtigung des Befindens und der Zufriedenheit des Patienten, der Angehörigen, Mitarbeiter, Kunden, etc.
Dieses Buch soll Ihnen helfen, Ihr Qualitätsmanagementsystem auch ohne kostenaufwendige Begleitung durch externe Unterstützung aufbauen zu können. Ein guter KTQ-Berater®1 kann Ihnen ganz sicher viele Tipps aus der Praxis geben, aber auch ohne externe Hilfe sind Sie in der Lage Ihr Qualitätsmanagement zu organisieren. Voraussetzung ist, die Unternehmensführung steht in diesem Prozess kontinuierlich dahinter und erklärt Qualitätsmanagement zur Chefsache!
Der KTQ-Katalog Rettungsdienst bietet Ihnen einen roten Faden zur Umsetzung Ihrer Prozesse. Die darin aufgezählten Beispiele sind sicher nicht zu 100 % so umzusetzen, aber sie dienen der Orientierung und stellen die umfassenden Aufgaben einer Rettungsdienstorganisation in einer strukturierten Form dar.
Unser Tipp:
Orientieren Sie sich an diesem Buch und dem KTQ-Manual für den Rettungsdienst, um eine strukturierte Vorgehensweise für den Aufbau und die Weiterentwicklung Ihres Qualitätsmanagementsystems zu erzielen.
Ein ernannter Verantwortlicher für Qualitätsbelange (z. B. Qualitätsbeauftragter) im Unternehmen ist für die Koordination aller qualitätsverbessernden Maßnahmen zuständig. Für die Qualität in Ihrem Unternehmen sind alle Mitarbeiter zuständig.
KTQ-Rettungsdienst ist kein unflexibles Zertifizierungsverfahren, in dem auf einzelne Formalismen Wert gelegt wird, sondern es dient primär der optimalen Patientenversorgung. Es wurde von Praktikern für Praktiker auf der Grundlage der über 12-jährigen Erfahrungen im KTQ-Verfahren und bereits mehr als 2000 erfolgreichen KTQ-Zertifizierungen entwickelt und berücksichtigt nun auch die rettungsdienstlichen Besonderheiten in der Patientenversorgung. Niemand schreibt Ihnen vor, wie Ihre internen Qualitätsstandards aussehen sollen, dies entscheidet jede Rettungsdienstorganisation selbst unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen Regelungen. Sie entwickeln Ihre individuellen Qualitätslösungen unter Berücksichtigung des PDCA-Zyklus, und KTQ-Rettungsdienst bietet Ihnen den Rahmen dafür. So steht Ihnen mit dem KTQ-Katalog ein praxisorientierter Leitfaden für Ihr Unternehmen zur Verfügung, der Ihnen ein optimales Management ermöglicht und nebenbei noch Qualitätssteigerungen erzeugt. Hierbei müssen keine rettungsdienstfremden Industrienormen übersetzt werden, die Mitarbeiter bekommen vielmehr ein verständliches System, mit dem sie sich eher identifizieren werden. Ziel ist es, die Mitarbeiter zu motivieren, mit dem Qualitätsgedanken täglich zu arbeiten und die dazu erforderlichen Aktivitäten ohne großen Zusatzaufwand umzusetzen.
Um dem Rettungsdienstunternehmen eine Struktur zu bieten, mit der die Prozesse systematisch bearbeitet werden können, sind die wichtigen Themen bei KTQ-Rettungsdienst in einzelnen Kategorien aufgeteilt. Diese unterteilen sich zudem in einzelne Subkategorien und Kriterien.
Kategorien:
Kategorie 1
Patientenorientierung
Kategorie 2
Mitarbeiterorientierung
Kategorie 3
Sicherheit
Kategorie 4
Informations- und Kommunikationswesen
Kategorie 5
Führung
Kategorie 6
Qualitätsmanagement
2.2 Welchen Nutzen hat die Rettungsdienstorganisation durch Qualitätsmanagement?
Die Rettungsdienstorganisation wird durch KTQ-Rettungsdienst systematisch dabei unterstützt, das Managementsystem zu analysieren und qualitätsverbessernde Maßnahmen festzulegen. Dies bedeutet in einigen Prozessen garantiert eine Veränderung für alle Beteiligten. Nicht immer werden die Vorteile von allen Mitarbeitern und auch Führungspersonen sofort erkannt.
Folgende Vorteile ergeben sich durch eine aktive Umsetzung von Qualitätsmanagement:
Für Ihre Patienten, Kooperationspartner, sonstige Kunden und für die Mitarbeiter werden Strukturen, Prozesse und Ergebnisse transparent dargestellt.
Bei der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems findet in der Regel eine umfassende Prozessoptimierung statt, die als Gesamtergebnis letztendlich eine Steigerung in der Leistungserbringung erzeugt. Dies wird monetär vielleicht nicht sofort messbar sein, aber langfristig neben einer Qualitätsverbesserung auch oft eine Kosteneinsparung erzeugen.
Durch Standardisierung einzelner Prozesse steigt die Arbeitszufriedenheit bei den Mitarbeitern. Gerade in Zeiten hoher Mitarbeiterfluktuation sind standardisierte Prozesse zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter ein hilfreiches Instrument.
Die Patienten- und Mitarbeitersicherheit wird bei der Anwendung eines Qualitätsmanagementsystems deutlich verbessert.
Die Rettungsdienstorganisation entwickelt sich positiv weiter, was heute besonders wichtig ist und einen wichtigen Marktvorteil, z. B. bei Ausschreibungen durch den Rettungsdienstträger, darstellen könnte.
Die Ergebnisqualität wird systematisch ermittelt und dadurch transparent. Dies trägt dazu bei, dass man nach innen und außen über das Erreichte gut reden kann, ganz unter dem Motto „Gutes tun und darüber reden“.
2.3 Das KTQ-Verfahren
Im Rahmen des KTQ-Verfahrens werden mehrere Schritte durchlaufen.
Zunächst führt die Rettungsdienstorganisation anhand des KTQ-Katalogs „Rettungsdienst“2 eine umfassende Selbstbewertung aller unternehmensrelevanten Prozesse durch. Dabei orientiert sich die Organisation an den 6 KTQ-Kategorien mit ihren Subkategorien und Kriterien. Basis für die Selbstbewertung bildet der PD-CA-Zyklus. Anhand des KTQ-Katalogs sind die Fragen jeweils unter PLAN, DO, CHECK und ACT zu beantworten. Hierbei werden alle Prozesse differenziert betrachtet und Verbesserungspotenziale abgeleitet. Es wird empfohlen, hierzu schon in der Selbstbewertungsphase eine Lizenz der Software „KTQ-Zert Rettungsdienst“ zu nutzen. Hiermit können alle Fragen beantwortet und bewertet werden. Bei der ersten Selbstbewertung ist es nicht das Ziel, alle Fragen vollumfassend zu beantworten, sondern es geht eher darum, die Verbesserungspotenziale zu erkennen und adäquate Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten.
Hier bietet es sich an, dass eine interdisziplinäre Bearbeitung und Beantwortung der Fragen, moderiert durch den Qualitätsbeauftragten in Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Mitarbeitern, durchgeführt wird. Als geeignete Methode wird das Interviewverfahren empfohlen, d. h., es werden zu bestimmten Kriterien die betreffenden Mitarbeiter hinzugezogen, um die Beantwortung aus erster Hand zu ermöglichen.
Nach anschließender Bewertung der Kriterien kann eine Punktzahl von maximal 1026 Punkten erreicht werden. Für eine erfolgreiche Zertifizierung muss eine Mindestpunktzahl von 55 % je Kategorie erreicht werden. Daraus resultiert, dass eine Anmeldung zur Zertifizierung erst erfolgen sollte, wenn eine Einrichtung diesen Mindestpunktwert in der Selbstbewertung erreicht hat. Es wird empfohlen, einen etwas höheren Mindestpunktwert in der Selbstbewertung zu erreichen, da in der Fremdbewertung auch mit einer Punktreduzierung gerechnet werden muss. Das bedeutet, dass die Optimierungsmaßnahmen und Ergebnisse nicht knapp auf die 55 % Erreichungsgrad ausgerichtet sein sollen, sondern schon ein guter Mindeststandard umgesetzt sein soll, bevor eine Anmeldung zur Zertifizierung erfolgt.
Die Selbstbewertung erfolgt unabhängig von Fristen, es wird jedoch empfohlen, den gesamten Analyse-, Optimierungs- und Zertifizierungsablauf in einem Projektplan vor Projektbeginn festzulegen. Bei konsequenter Umsetzung benötigt eine Einrichtung ca. 1 Jahr für das gesamte Projekt vom Zeitpunkt der Entscheidung zur Umsetzung bis zur Zertifizierung der Rettungsdiensteinrichtung. Dies ist jedoch vom Umfang der Optimierungsarbeiten abhängig.
Nachdem der Optimierungsprozess weitgehend abgeschlossen ist, erfolgt eine Ergänzung und Neubewertung des Selbstbewertungsberichts. Stellt die Rettungsdienstorganisation fest, dass sie mindestens 55 % je Kategorie sowie je Kernkriterium in der Selbstbewertung erreicht hat, kann sie sich bei einer unabhängigen und von der KTQ-GmbH zugelassenen Zertifizierungsstelle (www.ktq.de) zum Zertifizierungsverfahren anmelden. Zum Antrag für die Anmeldung müssen die Selbstbewertung, ein Strukturerhebungsbogen und ein KTQ-Qualitätsbericht in Dateiformat aus der Software „KTQ-Zert Rettungsdienst“ bei der Zertifizierungsstelle eingereicht werden.
Nach Prüfung der Antragsunterlagen beauftragt die Zertifizierungsstelle zwei externe Prüfer (KTQ-Visitoren) mit der differenzierten Prüfung der Unterlagen. Diese Prüfung ist der erste Teil der Fremdbewertung. Hierbei werden alle Kriterien durch die Visitoren unabhängig voneinander bewertet und wieder zurück an die Zertifizierungsstelle geschickt. Das Ergebnis aus der Antragsüberprüfung durch die Zertifizierungsstelle und der Ersteinschätzung durch die beiden Visitoren ergibt dann die Aussage zur Zertifizierungsreife. Fällt diese Aussage positiv aus (mind. 55 % je Kategorie sowie mind. 55 % je Kernkriterium), dann erfolgt die Planung des Visitationstermins. Die Dauer der Visitation richtet sich nach der Größe der Rettungsdiensteinrichtung (mind. 2 Tage). Geregelt wird dies in den Dokumenten „Visitationsdauer“ und „Preise“ (www.ktq.de).
Die Visitation vor Ort erfolgt durch 2 Visitoren. Diese KTQ-Visitoren sind ausschließlich leitend in der Funktion als „Ärztlicher Leiter Rettungsdienst“ und in einer Rettungsdiensteinrichtung aktiv beschäftigte Rettungsassistenten in leitender Funktion als „Leiter Rettungsdienst/Wachenleiter/QM-Rettungsdienst“. Die Visitoren verfügen über eine Zusatzqualifikation im Bereich Qualitätsmanagement, das den Anforderungen des Curriculums der Bundesärztekammer entspricht, und haben ein spezielles KTQ-Training® inklusive Prüfung mit Personenzertifizierung absolviert.
In jeder Visitation werden sogenannte kollegiale Dialoge mit den Mitarbeitern der Rettungsdiensteinrichtung geführt, es erfolgen zudem Begehungen verschiedener Bereiche. Nur so können die Visitoren auch feststellen, wie die Umsetzung des Qualitätsmanagementsystems in der gelebten Praxis erfolgt. Dies ist ein ausgesprochen positives Verfahren, an dem die Mitarbeiter aktiv beteiligt sind.
Während der Visitation bewerten die KTQ-Visitoren die von der Rettungsdiensteinrichtung tatsächlich umgesetzten Strukturen und Prozesse sowie die Ergebnisse aus dem vor Ort nachgewiesenen Optimierungsprozess.
Nach erfolgter Visitation erhält die Rettungsdiensteinrichtung bezüglich der Zertifizierung direkt eine Rückmeldung zur Empfehlung der Visitoren, die über die Zertifizierungsstelle an die KTQ-GmbH weitergeleitet wird.
In der Regel sind nach Korrektur durch die Visitoren noch einige Anpassungen am KTQ-Qualitätsbericht durch die Rettungsdiensteinrichtung vorzunehmen. Der korrigierte Qualitätsbericht wird dann wieder zurück an die Zertifizierungsstelle geschickt.
Innerhalb von 4 bis 6 Wochen nach Eingang der Unterlagen durch die Zertifizierungsstelle erstellt die KTQ-GmbH nach erfolgter Prüfung des Visitationsberichts und des Qualitätsberichts das KTQ-Zertifikat und stellt den Qualitätsbericht der Rettungsdiensteinrichtung auf der KTQ-Website www.ktq.de der Öffentlichkeit zur Verfügung. Dort ist der Qualitätsbericht dann für die Dauer der Zertifikatsgültigkeit (3 Jahre) abrufbar. Die Rettungsdiensteinrichtung erhält nun ihr KTQ-Zertifikat und das KTQ-Logo, welches sie auf Briefköpfen oder Fahrzeugen öffentlichkeitswirksam platzieren kann.
Die KTQ-Rezertifizierung erfolgt innerhalb der Gültigkeitsdauer des Zertifikates drei Jahre nach Ausstellung des KTQ-Zertifikats. Es wird empfohlen, die Visitation zur Rezertifizierung ca. 10 Wochen vor Ablauf des Gültigkeitsdatums des aktuellen Zertifikats zu planen, um einen lückenlosen Übergang zum neuen Zertifikat sicherzustellen.
Unser Tipp:
Planen Sie Ihr Projekt mit verbindlichen Zeitfenstern für die einzelnen Projektschritte. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, aber wirtschaften Sie sorgsam mit dieser Zeit. Sie haben keinen Nutzen, wenn der Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems „mit der heißen Nadel gestrickt“ wird. So erreichen Sie keine Nachhaltigkeit in Ihrem Qualitätsmanagement.