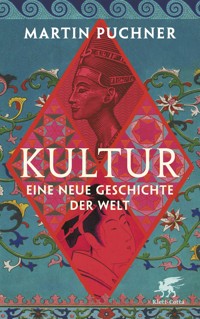
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine triumphale Neuerzählung der Menschheitsgeschichte »Und so ist in dieser anderen Art der Kulturgeschichte auch eine zeitgemäße kleine, rebellische Kulturtheorie eingeschmuggelt, die uns vor dem Irrtum bewahren kann, dass mit der Kultur etwas nicht stimmt.« Thorsten Jantschek, Deutschlandfunk Kultur Auf einer Reise von der Chauvet-Höhle in Frankreich durch Nofretetes Ägypten, das klassische Griechenland, die Bibliotheken der Azteken, Ashokas Indien, das China der Tang-Dynastie und weitere Epochen: Diese leicht verständliche und unterhaltsame Big History des deutschamerikanischen Literaturwissenschaftlers Martin Puchner enthüllt die Entstehung und Gründe menschlicher Kultur – und wie kulturelle Aneignung dies ermöglichte. Wozu brauchen wir Kunst und Kultur überhaupt? Warum sollten wir uns mit unserer Vergangenheit beschäftigen? Martin Puchner erzählt mitreißend, warum wir nur durch Kultur in der Lage waren, unsere Fähigkeiten zu entwickeln, und wie sie durch unsere Begegnungen, kollektiven Verluste und Wiederentdeckungen, Innovationen, Nachahmungen und Übernahmen Gesellschaften über die Jahrhunderte vorangetrieben und unser Überleben gesichert hat. Kultur kann daher nicht als Ressource einer einzelnen Gruppe gesehen werden, sondern entsteht im Austausch mit anderen, als geliehene Form und Verschmelzung von Ideen – durch Zeichnen, Sprechen, Speichern von Wissen. Wie ein riesiges Recyclingprojekt werden kleine Fragmente aus der Vergangenheit hervorgeholt und neu genutzt. Anhand bisher unbekannter Beispiele ermöglicht Puchner einen spannenden, neuen Blick auf die Menschheit und liefert ein wichtigen Beitrag zur Debatte über Originalität und kulturelle Aneignung. »Eine deutliche Absage an diejenigen, die behaupten, dass Kultur Eigentum von Gruppen, Nationen, Religionen oder Ethien sein kann.« The New York Times »Dieses Buch ... ist ein Geschenk, das man genießen sollte.« The Boston Globe »Ein bemerkenswertes Buch.« Kwame Anthony Appiah »Ein halsbrecherischer, äußerst fesselnder Überblick über die Wege kultureller Überlieferung - wie Ideen, Geschichten und Lieder überleben, sich verändern, verschwinden, geliehen, verfeinert, übernommen und verbessert werden. Die Lektüre dieses Buches war wie ein Kurs in Geschichte der Geisteswissenschaften bei einem Weltklasse-Professor ... Ich habe auf jeder Seite Sätze unterstrichen.«Anthony Doerr
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Martin Puchner
Kultur
Eine neue Geschichte der Welt
Aus dem Amerikanischen von Enrico Heinemann
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »CULTURE« bei W. W. Norton & Company, 500 Fifth Avenue New York, New York 10110.
© 2023 by Martin Puchner
Für die deutsche Ausgabe
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH,
gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text
und Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg unter Verwendung der Daten des Originalverlags © 2024
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
Lektorat: Eckard Schuster, München
ISBN 978-3-608-96659-6
E-Book ISBN 978-3-608-12400-2
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Wie Kultur zu Werke geht
Einführung
In der Chauvet-Höhle 35 000 v. Chr.
Kapitel 1
Königin Nofretete und ihr gesichtsloser Gott
Du sollst neben mir keine anderen Götter haben
Kapitel 2
Platon verbrennt seine Tragödie und erdichtet eine Historie
Kapitel 3
König Ashoka sendet eine Botschaft in die Zukunft
Delhi, 1356
Kapitel 4
Eine südasiatische Göttin in Pompeji
Kapitel 5
Ein buddhistischer Pilger auf der Suche nach uralten Spuren
Kapitel 6
Das
Kopfkissenbuch
und manche Tücke der Kulturdiplomatie
Kapitel 7
Als Bagdad zu einem Speicher der Weisheit wurde
Kapitel 8
Die Königin von Äthiopien heißt die Diebe der Bundeslade willkommen
Kapitel 9
Eine christliche Mystikerin und die drei Renaissancen Europas
Kapitel 10
Die aztekische Hauptstadt blickt ihren europäischen Feinden und Bewunderern ins Auge
Tenochtitlán, 1519
Nürnberg – Brüssel, 1520
Tenochtitlán, 1519
Kapitel 11
Ein portugiesischer Seefahrer verfasst ein weltumspannendes Epos
Kapitel 12
Aufklärung in Saint-Domingue und in einem Pariser Salon
Paris, 1755
Kapitel 13
George Eliot fördert die Wissenschaft der Vergangenheit
Kapitel 14
Eine japanische Welle erobert im Sturm die Welt
Kapitel 15
Das Drama der nigerianischen Unabhängigkeit
Epilog
Gibt es 2114 n. Chr. noch eine Bibliothek?
Dank
Tafelteil
Anmerkungen
Einführung: in der Chauvet-Höhle 35 000 v. Chr.
Kapitel 1: Königin Nofretete und ihr gesichtsloser Gott
Kapitel 2: Platon verbrennt seine Tragödie und erdichtet eine Historie
Kapitel 3: König Ashoka sendet eine Botschaft in die Zukunft
Kapitel 4: Eine südasiatische Göttin in Pompeji
Kapitel 5: Ein buddhistischer Pilger auf der Suche nach uralten Spuren
Kapitel 6: Das Kopfkissenbuch und manche Tücke der Kulturdiplomatie
Kapitel 7: Als Bagdad zu einem Speicher der Weisheit wurde
Kapitel 8: Die Königin von Äthiopien heißt die Diebe der Bundeslade willkommen
Kapitel 9: Eine christliche Mystikerin und die drei Renaissancen Europas
Kapitel 10 : Die aztekische Hauptstadt blickt ihren europäischen Feinden und Bewunderern ins Auge
Kapitel 11: Ein portugiesischer Seefahrer verfasst ein weltumspannendes Epos
Kapitel 12: Aufklärung in Saint-Domingue und in einem Pariser Salon
Kapitel 13: George Eliot fördert die Wissenschaft der Vergangenheit
Kapitel 14: Eine japanische Welle erobert im Sturm die Welt
Kapitel 15: Das Drama der nigerianischen Unabhängigkeit
Epilog: Gibt es 2114 n. Chr. noch eine Bibliothek?
Register
For the one to be loved
Vorwort
Wie Kultur zu Werke geht
Eine Sichtweise zur Kultur lautet: Auf der Erde leben Volksgruppen, die durch gemeinsame Praktiken zusammengehalten werden. Und jede dieser Kulturen mit ihren bestimmten Bräuchen und Kunstformen gehört den Leuten, die in sie hineingeboren wurden. Deshalb muss sie vor äußerer Einmischung geschützt werden. Demnach ist Kultur eine Art Eigentum, das diejenigen besitzen, die sie mit Leben erfüllen. Das Positive an dieser Sichtweise besteht darin, dass sie Menschen dazu ermuntert, ihr Kulturerbe(1) zu pflegen, und ihnen die Mittel an die Hand gibt, es auch zu verteidigen: zum Beispiel durch Druck auf Museen, Kulturgüter, die unter dubiosen Umständen erworben wurden, an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Die Anschauung, wonach Kultur besessen werden kann, wird von einer überraschend breiten Koalition verfochten, darunter Nativisten, die sich ihren nationalen Traditionen verpflichtet fühlen, und diejenigen, die kulturelle Aneignungen(1) dadurch zu unterbinden hoffen, dass sie das Kulturgut einer Gruppe zur Verbotszone für Außenstehende erklären.
Eine andere Sichtweise lehnt die Vorstellung ab, dass Kultur wie ein Besitz behandelt werden kann. Als ein beispielhafter Vertreter kann der chinesische Reisende Xuanzang(1) gelten, der sich nach Indien aufmachte und mit buddhistischen Handschriften in die Heimat zurückkehrte. Übernommen wurde sie auch von arabischen und persischen Gelehrten, die Werke griechischer Philosophie übersetzten. Sie wurde von zahllosen Schriftkundigen, Lehrern und Künstlern praktiziert, die sich aus Quellen weit außerhalb der eigenen Kultur inspirieren ließen. Und in der Ära nach dem europäischen Kolonialismus(1) schlossen sich ihr neben dem nigerianischen Schriftsteller und Nobelpreisträger Wole Soyinka(1) auch zahlreiche weitere Künstler an.
Für sie entsteht Kultur nicht nur aus den Ressourcen einer Gemeinschaft, sondern auch aus Begegnungen mit anderen Kulturen. Sie wird nicht allein durch die Erlebnisse von Individuen geprägt, sondern ebenso durch entliehene Formen und Ideen, die sie darin unterstützen, eigene Erfahrungen auf neuartige Weise zu verstehen und auszudrücken. Durch die Brille einer Sichtweise betrachtet, die Kultur als Eigentum begreift, mögen diese Kulturschaffenden als Eindringlinge erscheinen, die sich Fremdes aneigneten oder gar Diebstahl begingen. Aber sie verfolgten ihre Arbeit mit Demut und Hingabe, weil sie intuitiv erkannten, dass sich Kultur dadurch weiterentwickelt, dass sie in Umlauf kommt. Sie wussten, dass die irrige Vorstellung von Eigentum und Urheberschaft der Kultur Grenzen setzt und ihr Zwänge auferlegt, die ihre Ausdrucksformen verarmen lässt.
Dieses Buch ist keine Festrede auf die hohe Literatur und auch keine Verteidigungsschrift für den abendländischen Kanon. Es vertritt eine Sicht der Kultur, die chaotischer und meines Erachtens interessanter ist: eine der von weit her stammenden Einflüsse, die durch Kontakte zustande kommen, und der Innovation, die dadurch voranschreitet, dass die Scherben untergegangener Zivilisationen ausgegraben und zu etwas Neuem zusammengekittet werden. Viele der Figuren, die federführend für diese Sichtweise standen, erhielten für ihr Werk niemals die verdiente Anerkennung, und manche kennt auch heute noch niemand, wenn man von einem kleinen Kreis von Spezialisten absieht. Auch mir waren viele unvertraut, bis ich über die etablierten Kanons hinausblickte und mich den Protagonisten dieses Buchs zuwandte. Sie führten mich auf weniger ausgetretene Pfade und durch verborgene Seitenstraßen. Und das habe ich von ihnen gelernt: Wenn wir die Auswüchse des Tourismus begrenzen, einen respektlosen Umgang mit fremden Kulturen vermeiden und bedrängte Traditionen schützen wollen, müssen wir eine Sprache finden, die sich nicht um Besitz und geistiges Eigentum dreht, sondern sich eher an dem orientiert, wie Kultur wirklich zu Werke geht.
Aus der Arbeit dieser Kreativen ergibt sich eine neuartige Erzählung zur Kultur, eine des Engagements, das die Hürden von Zeit und Raum überwindet, von überraschenden Verbindungen und unterschwelligen Einflüssen – eine Kulturgeschichte, die nicht nur schöne Seiten hat und so auch nicht dargestellt werden sollte. Aber sie ist die einzige, die wir haben: die Geschichte von uns Menschen als einer kulturschaffenden Spezies. Unsere Geschichte.
Einführung
In der Chauvet-Höhle(1) 35 000 v. Chr.
Lange bevor der Homo sapiens auf der Erde auftauchte, stand die Chauvet-Höhle(2) im Süden Frankreichs unter Wasser. Die Fluten fraßen tiefe Schluchten in den spröden Kalkstein, flossen ab und hinterließen hoch über der Ardèche ein System aus Hohlräumen, das immer wieder Besucher anlockte. Über Jahrtausende zogen sich Bärenfamilien in ihre entlegenen Kammern zum Winterschlaf zurück. Als sie verschwunden waren, kam und ging ein Wolf. Ein Steinbock verirrte sich bis tief in ihr finsteres Inneres hinein, vollführte einen Sprung, landete auf hartem Boden und rutschte einen engen Schacht hinab.[1] In der Sackgasse geriet er in Panik, machte jäh kehrt und gelangte auf demselben Weg in die Freiheit zurück, drehte sich um und blieb für einen Augenblick wie angewurzelt stehen.
Als die Bären, der Wolf und der Steinbock die Höhle endgültig verlassen hatten, wagten sich erstmals Menschen in sie hinein.[2] Mit Fackeln erleuchteten sie die Kammern mit ihren überraschend ebenen Böden und den bizarren Säulen, die über Jahrtausende herabtropfendes Wasser von der Decke und vom Boden hatte herab- und hinaufwachsen lassen.[3] Im flackernden Lichtschein tauchten Spuren der vormaligen Höhlenbewohner auf. Als Jäger und Sammler waren die neuen Besucher kundige Fährtenleser. Die gut 350 Kilogramm schweren ausgewachsenen Bären hatten an ihren Schlafplätzen Kuhlen in den matschigen Untergrund gedrückt und mit ihren scharfen Krallen die Wände angekratzt. Andere Spuren stammten vom Wolf, und der verwirrte Steinbock hatte sein Missgeschick mit jedem aufgeschreckten Schritt im weichen Lehmboden verewigt.
Die Menschen lasen die Spuren dieser Tiere nicht nur, sondern fügten ihnen auch eigene hinzu – der Beginn eines langen Prozesses, in dessen Verlauf sich die Höhle in eine neue Umgebung verwandelte.[4] Wie vor ihnen die Bären, kratzten sie an manchen Stellen die mit Lehm überkrusteten verwitterten Kalksteinwände an und malten mit Fingern oder ritzten mit einfachen Werkzeugen Figuren oder Szenen in die Oberfläche.[5] Vielleicht als eine Hommage an die einstigen Bewohner zeichneten sie Umrisse von Bären, Wölfen und Steinböcken, beschworen aber auch die Präsenz von anderem Getier herauf: Panther und Löwen, Mammuts und Auerochsen, Rentiere und Nashörner – vereinzelt oder in flüchtenden Herden mit reißenden Bestien auf den Fersen.
Zusätzlich zu den Ritztechniken nutzten Menschen Holzkohle aus erloschenen Feuern, um aufwendigere Figuren und Szenen zu zeichnen, und füllten deren Umrisse zuweilen mit einem Gemisch aus Lehm und Kohle aus. Dabei bezogen sie auch Unebenheiten an den Höhlenwänden mit ein und überraschten Betrachter mit einer Pferdeherde, die hinter einer Ecke auftauchend plötzlich auf sie zu galoppierte. Manche verfeinerten ihre kunstvolle Komposition im Verlauf der Entstehung und erfassten eine Löwenschnauze oder Pferdemähne mit immer schärferer Präzision. Ihre Zeichnungen platzierten sie an strategisch günstigen Orten, oft hoch oben an den Wänden, um sie bestmöglich zur Geltung zu bringen, wenn sich Besucher im matten Schein ihrer Fackeln einzeln und Schritt für Schritt durch die Räumlichkeiten tasteten.[6]
Anders als die Bären nutzten die Menschen die Höhlen nie als eine dauerhafte Behausung. (In keiner Feuergrube kamen Tierknochen oder andere Hinweise darauf zum Vorschein, dass in ihnen Speisen gegart worden wären.) Die Feuer dienten ihnen lediglich dazu, die Räume zu erhellen und Holzkohle für ihre Ausschmückung zu erzeugen. Sie hatten dieses Werk vor über 37 000 Jahren begonnen und führten es über Jahrtausende weiter, geleitet von einem gemeinsamen Geschmack, wie eine bestimmte Tierart – ein Nashorn, ein Steinbock oder ein Mammut – dargestellt werden sollte.
Vor 34 000 Jahren schüttete dann ein Bergrutsch den Eingang der Höhle zu.[7] Auch wenn sich zu diesem Zeitpunkt keiner der Künstler in deren Innerem aufhielt, bedeutete dies für sie eine Katastrophe. Sie schnitt sie von einem Werk ab, das über zahlreiche Generationen fortgeführt worden war. Für uns erwies sich dies dagegen als Glücksfall, weil die Versiegelung in der Folgezeit verhinderte, dass die Malereien durch eine kontinuierliche Nutzung der Höhle durch Menschen oder Tiere umgestaltet oder zerstört wurden.
Die Chauvet-Höhle(3) offenbart die zentrale Dynamik in der Wirkweise von Kultur. Hatten sich die Menschen durch die zufällig entstandenen Kratzspuren der Bären anfangs dazu anregen lassen, ihre Arbeit an der Höhle zu beginnen, so überführten sie diese Markierungen mit der Zeit in ein planvolles künstlerisches Projekt, das sie mit bemerkenswerter Kontinuität von einer Generation zur nächsten weiterreichten. Darin liegt der grundlegende Unterschied zwischen Bär und Mensch: Die Bären hatten sich (wie die übrigen Tiere in der Höhle) über den – erstmals von Charles Darwin(1) skizzierten – schleichenden Prozess der Evolution(1) entwickelt, der sich in Zeiträumen von Hundertausenden, ja Millionen von Jahren bemisst.
Natürlich unterliegt diesem auch die Menschheit, aber im Gegensatz zum Tierreich durchläuft sie eine weitere Entwicklung, die auf Sprache und anderen kulturellen Techniken beruht. Diese zweite Art der Evolution(2) beruht auf der Fähigkeit, Informationen und Fertigkeiten von einer Generation an die nächste weiterzureichen, ohne dass dafür Genmutationen notwendig sind. Diese Weitergabe verändert nichts oder so gut wie nichts an der biologischen Verfassung der Menschen, ermöglicht es ihnen aber, Wissen anzuhäufen, es zu bewahren und mit anderen zu teilen. Weil dieser zweite Prozess unendlich schneller als der biologische abläuft, schuf er die Voraussetzungen dafür, dass der Homo sapiens zu einer der am weitesten verbreiteten Spezies aufstieg (neben den Mikroben und Regenwürmern, die mehr Biomasse auf die Waage bringen.)
Kultur zu speichern und weiterzugeben, stellt die Menschen vor die Aufgabe, Wissen festzuhalten und Methoden zu entdecken, um es den Nachgeborenen zu übermitteln, ohne eine DNA als Medium. Dazu entwickelten sie Techniken zur Aufzeichnung und zur Weitergabe über Schulung und mithilfe externer Medien. Als ein solcher Wissensspeicher fungierte gewissermaßen die Chauvet-Höhle(4), als ein Ort, an den Generation um Generation immer wieder Menschen zurückkehrten, um ein Gemeinschaftsprojekt weiterzuführen, das keiner alleine hätte bewerkstelligen können. Jede Generation von Künstlern erlernte die Techniken, um die Arbeit der vorangegangenen fortzuführen, und bewahrte und verbesserte dabei das von den Vorgängern Erschaffene. Für uns ist der Gedanke, dass Menschen in einem Höhlensystem über Jahrtausende ein Werk in einem einheitlichen Stil erschufen, schier unvorstellbar. Dennoch waren sich diese frühen Menschen der Bedeutung des Speicherns und Bewahrens von Wissen und der Weitergabe von Ideen in hohem Maße bewusst.
Was wurde durch eine generationsübergreifende Zusammenarbeit an Orten wie der Chauvet-Höhle(5) übermittelt? Zunächst einmal gaben Menschen Know-how, eine Kenntnis der natürlichen Welt und ein Wissen weiter, wie sich diese beeinflussen ließ, einschließlich der Kunst, Werkzeuge herzustellen und Feuer zu entzünden. Im Verlauf der Zeit kamen auch der Anbau von Nahrungspflanzen und am Ende schließlich eine auf Wissenschaft beruhende Technik hinzu. Damit dieses Wissen weiterwachsen konnte, brauchte es komplexer organisierte Einrichtungen wie Tempel, Bibliotheken, Klöster und Universitäten mit der Aufgabe, es zu bewahren und es anderen beizubringen.
Aber die Darstellungen an den Wänden der Chauvet-Höhle(6) dienten nicht der Vermittlung von Know-how: Sie ähneln eher dem, was wir heute als eine Verquickung von Kunst und Religion beschreiben würden. In einer der Kammern platzierten die Höhlenkünstler einen Bärenschädel auf einem herabgefallenen Steinblock wie auf einen Altar, ein Hinweis darauf, dass hier ein Ritual vollzogen worden sein könnte. Eine Malerei stellt den Unterleib einer Frau dar, umschlungen von einer menschenähnlichen Gestalt mit Stierkopf. Klar mit dem Motiv der Fruchtbarkeit verbunden, gibt dieses Paar nicht die reale Erfahrungswelt seiner Schöpfer wieder wie andere Höhlenmalereien mit ihren vor Raubtieren fliehenden Herden. Es steht für einen Mythos, verweist auf eine Erzählung mit spezieller Bedeutung. Und eine andere Gruppe von Zeichen besteht aus abstrakten Symbolen. Vielleicht bezogen auch sie ihren Sinn aus einem Ritual oder aus Geschichten, über die sie in eine symbolische Ordnung einbezogen waren, die sich stark von der Alltagsrealität außerhalb der Höhle unterschied.
Der Schädel, die mythische Gestalt und die abstrakten Symbole deuten allesamt darauf hin, dass diese Höhle eine besondere Erfahrung vermittelte, die rituelle Handlungen, Lichteffekte, Erzählungen und Musik einschloss.[8] In prähistorischen Höhlen tauchten die Reste von Flöten und Schlaginstrumenten auf, während bestimmte Zeichen an den Wänden Stellen mit besonderer akustischer Wirkung markiert haben könnten, als Anweisung an Sänger und Musiker, wo sie sich zu positionieren hatten.[9]
Die Menschen suchten Orte wie die Chauvet-Höhle(7) auf, um sich eine eigene Version der Realität zu erschaffen und sich einen Reim auf das Leben in der Außenwelt zu machen, mit seinem ständigen Kampf gegen die Raubtiere, die auch an den Wänden abgebildet waren. Was die Menschen in diese Höhlen zog, war nicht die Hoffnung, hier ihr Wissen zu erweitern. Es waren mögliche Antworten auf die Grundfragen des Seins: Warum lebten sie auf dieser Erde? Welche Beziehung verband sie mit den anderen Geschöpfen? Fragen um Geburt und Tod, um Anfang und Ende. Und warum sie die Fähigkeit und das Bedürfnis hatten, ihre Beziehung zum Kosmos zu verstehen. Die Höhle war für die Menschen ein Ort der Sinnfindung. Sie suchten nicht nach einem Know-how, sondern nach einem Know-why, wie man es bezeichnen könnte: nach einem Wissen von den Urgründen.
Im Verlauf der Zeit entwickelte sich das, was in Höhlen mit Zeichnungen, Symbolen und Ritualen begonnen hatte, zu anderen Praktiken weiter. Die Mehrung des Know-how versetzte die Menschen in die Lage, sich ein künstliches Obdach zu schaffen, Behausungen und Bauten, von denen einige der Unterkunft dienten, während andere nur zu besonderen Anlässen aufgesucht wurden: für Rituale (Tempel und Kirchen), Aufführungen (Theater und Konzertsäle) oder zum Erzählen von Geschichten. Bei der Erweiterung unserer Fertigkeiten entwickelten wir Menschen auch neue Wege, um unseren Platz im Universum zu verstehen, um unserer Existenz einen Sinn abzugewinnen.
Aus heutiger Perspektive dreht sich das Know-how um Werkzeuge, Wissenschaft und Technik, um die Fähigkeit, die natürliche Welt zu verstehen und in ihre Abläufe einzugreifen. Dagegen betrifft das Know-why die Geschichte von Kultur als einer sinnstiftenden Aktivität. Es ist das Hoheitsgebiet der Geisteswissenschaften.
Vielleicht war es einem erneuten Bergrutsch zu verdanken, dass Jahrtausende nach der Versiegelung Menschen erneut Zugang zur Chauvet-Höhle(8) erhielten. Nach der langen Zeit, die seit den Besuchen der ursprünglichen Höhlenkünstler vergangen war, entstammten sie einer anderen Kultur mit völlig anderen Mythen, Erzählungen, Ritualen, Symbolen und einem völlig verschiedenen Weltverständnis. Als Spätgeborene reagierten sie auf die erlesenen Malereien ihrer fernen Vorgänger wahrscheinlich ebenso verblüfft wie wir heute. Aber die Höhle zog sie an. Sicher haben sie sich auf diese unverständlichen Überbleibsel aus der fernen Vergangenheit einen Reim zu machen versucht und dabei ihr eigenes kulturelles Verständnis mit eingebracht. Wahrscheinlich setzten sie das Werk in der Höhle sogar fort und fügten eigene Ausschmückungen hinzu.
Dann verschloss ein erneuter Erdrutsch die Höhle für die nächsten 28 000 Jahre. Ihre Schätze gerieten in Vergessenheit, wurden aber auch vor der Zerstörung bewahrt – bis zu ihrer Wiederentdeckung 1994 durch ein Team von Amateurforschern unter der Leitung ihres Namensgebers Jean-Marie Chauvet.
Der Erdrutsch erinnert an die Zerbrechlichkeit der Weitergabe von Kultur, die in der Regel von einer kontinuierlichen Kommunikationslinie abhängt, die jede Generation mit der nächsten verbindet. Im Gegensatz zur biologischen Evolution(3), die sich langsam vollzieht und anpassungsbedingte Veränderungen dauerhafter in der DNA abspeichert, hängt die kulturelle Weitergabe von menschengemachten Speichertechniken und Lehrmethoden ab. Sie und die Institutionen, innerhalb derer sie praktiziert werden, verfallen nur allzu rasch, wenn das Interesse der Menschen an ihnen schwindet. Oder sie werden sogar durch äußere Gewalt vernichtet. Wenn die übermittelnde Verbindungslinie abreißt, ob durch einen Erdrutsch, durch Klimawandel oder Krieg, geht Wissen verloren. Es verschwindet für immer, wenn nicht von ihm, wie im Fall der Höhlenmalereien, eine Spur erhalten bleibt, ein materieller Überrest, der der Nachwelt eine Ahnung davon vermittelt, was einstmals an spätere Generationen hätte weitergegeben werden sollen. Die Ausschmückungen in der Höhle sind nur Fragmente einer umfassenderen Kultur, Bruchstücke ohne Erklärung. Was ihnen fehlt, ist die von Person zu Person laufende Überlieferung von Erzählungen, von Aufführungen, Ritualen und Mythen, die ihnen ihre volle Bedeutung gibt. Aber Relikte sind besser als nichts. Sie ermöglichten dieser zweiten Gruppe von Menschen – und gewähren uns Heutigen als einer dritten – kleine Einblicke in eine frühere Zeit.
In einigen Fällen hinterließen die Höhlenkünstler an den Wänden mit Lehm oder Pigmenten Abdrücke ihrer Hände – vielleicht angeregt durch die vorgefundenen Kratzspuren der Bären. In anderen »übersprühten« sie eine an die Felswand angelegte Hand mit Farbe und ließen ihren Umriss zurück, der sich klar vom Untergrund abhob. Einige dieser Handnegative sind so deutlich zu erkennen, dass sie sich einer einzelnen Person zuordnen lassen. Sie drücken etwas Individuelles aus: Ich war hier. Ich habe zur Schöpfung dieser symbolischen Welt beigetragen. Ich hinterlasse dieses Zeichen der Nachwelt.
Ein in Sprühtechnik ausgeführtes Handnegativ in der Chauvet-Höhle(9). Es ist die Signatur eines Individuums. (Foto: Claude Valette)
Die Erfahrung, mit der die Menschen dieser zweiten Gruppe konfrontiert wurden, als sie Zugang zur Chauvet-Höhle(10) erhielten, ist beispielhaft für einen weiteren Aspekt der kulturellen Übermittlung: die Wiederentdeckung: Seit der damaligen Zeit wurden zahllose Höhlen, Tempel und Bibliotheken zerstört, ob durch Naturkatastrophen oder durch Menschenhand. Durch jedes dieser Ereignisse riss eine Linie der kulturellen Weitergabe ab, die häufig – wenn überhaupt – erst nach langer Unterbrechung wiederaufgenommen wurde. Ähnlich wie die zweite Gruppe der Besucher in der Chauvet-Höhle wurden Menschen immer wieder mit den Überbleibseln einer verschollenen Kultur konfrontiert. In der Kulturgeschichte erwies sich dies als ein weit verbreitetes Phänomen, mit dem überraschend kreativ umgegangen wurde: Ein Großteil der Kultur Altägyptens stand im Schatten der großen Pyramiden, die in ferner Vergangenheit errichtet worden waren. Die chinesischen Literati feierten die Zhou-Dynastie als ein zurückliegendes goldenes Zeitalter. Die Azteken(1) verehrten die Ruinen von Tempeln, die sie im Tal von Mexiko entdeckt hatten. Die Italiener der Neuzeit begeisterten sich für die Stadt Pompeji(1), die der Vesuv zerstört, aber auch unter seinen Ascheschichten konserviert hatte. Der Blick in die Vergangenheit und der Versuch, sie zu enträtseln und sogar zu neuem Leben zu erwecken, führten häufig zu erstaunlichen Innovationen und Revolutionen. Der letztgenannte Begriff bedeutete ursprünglich sogar »Rückkehr«.
Und so gingen die Human- und Geisteswissenschaften im modernen Verständnis denn auch aus einem Bedürfnis hervor, einer – mehr als einmal – wiederentdeckten Vergangenheit zu neuem Leben zu verhelfen. In China wandte sich der Dichter und Gelehrte Han Yu(1) (768–824) gegen den Buddhismus(1) und verfocht stattdessen die Rückbesinnung auf die konfuzianischen Klassiker, deren erlesenes Beispiel aufgegeben worden sei.[10] Diese alten Schriften wiederzuerwecken, war für ihn und andere mit der Gründung einer umfassenden neuen Disziplin des Kommentierens, Interpretierens und Lehrens verbunden. In Zentral- und Vorderasien wirkte der Philosoph Ibn Sina(1) (980–1037) alias Avicenna als Teil einer Bewegung, die sich der Übersetzung und Auslegung vorislamischer Schriften, auch von griechischen Philosophen, verschrieb und so eine neuartige Synthese aus verschiedenen Formen des Wissens im Umfeld des Islam(1) hervorbrachte.[11]
Ähnliches geschah in Europa(1), als ein kleiner Kreis von italienischen Dichtern und Gelehrten dazu überging, nach antiken Schriften zu fahnden, von denen einige über arabische Kommentatoren den Weg nach Italien gefunden hatten. Auf dieser Suche und bei der Herausgabe alter Manuskripte kamen diese Neugierigen nach und nach einer (wohlgemerkt für sie) verschollenen Welt auf die Spur und erwarben sich Kenntnisse, die sie zur Weiterentwicklung der eigenen Kultur nutzten. Und diese Zwischenzeit, in der die Antike mit ihrem Wissen aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden war, charakterisierten spätere Gelehrte als das »Mittelalter(1)«, auf das die Wiedergeburt des Altertums, die sogenannte Renaissance(1), gefolgt sei. Allerdings verschleiern diese Begriffe, dass die italienische Renaissance keine außergewöhnliche Zeit der Wiedergeburt, sondern nur eine Wiederbegegnung mit dürftig verstandenen Bruchstücken aus der Vergangenheit war. Tatsächlich hatten derlei Rückbesinnungen sogar während des sogenannten »finsteren Mittelalters« stattgefunden. Der Wechsel von Untergang und Wiederentdeckung zieht sich wie ein roter Faden durch die Kulturgeschichte.
Dieses Buch erzählt die Geschichte der Kultur vornehmlich als ein Wechselspiel aus Bewahrung, Verlust und Rückgewinnung, weshalb sein Fokus zwangsläufig auf den besonderen Orten und Einrichtungen der Sinnfindung liegt: von den frühesten menschlichen Spuren an Orten wie der Chauvet-Höhle(11) über Kult- und Kulturstätten wie die ägyptischen Pyramiden und griechischen Theater, die buddhistischen und christlichen Klöster, die Inselstadt Tenochtitlán(1) (Mexiko), die italienischen studioli und die Pariser Salons(1) bis zu den Sammlungen, Kuriositätskabinetten und Museen, die wir heute besuchen können, wenn uns nach Vergangenheit zumute ist. Alle dienten als Institutionen, in denen Kunst und humanistisches(1) Wissen gewonnen, bewahrt, verändert und an die nächste Generation weitergereicht wurden.
Sie wurden auf verschiedenartigen Speichertechniken begründet, von der Bildhauerei und Malerei über das Geschichtenerzählen, die Musik und das Ritual bis zu der wohl mächtigsten von allen: dem Schrifttum. Durch die Entwicklung verschiedener Schreibtechniken entstanden die mesopotamischen und altägyptischen Schreibschulen, die arabischen Bibliotheken, die mittelalterlichen Skriptorien (»Schreibstätten«), die Renaissance(2)-Sammlungen, die Enzyklopädien der Aufklärung(1) und das Internet. Der Buchdruck, erstmals entwickelt in China und neu erfunden in Mitteleuropa, wurde zu einem herausragenden Vehikel, um schriftlich niedergelegte Erzählungen wie auch Bilder breiter verfügbar zu machen. Aber neben dem Schrifttum und dem Buchdruck wurden mündliche Überlieferungen und Netzwerke informellen Wissens bis in unsere Zeit weiterhin gepflegt und stellten eine zweite bedeutende Methode dar, um der nächsten Generation Wissen zu übermitteln.
Aber so gut diese Techniken des Bewahrens und Speicherns auch sein mochten, Kulturgüter und kulturelle Praktiken gingen weiterhin unter, wurden zerstört oder aufgegeben und stellten die Nachwelt vor die Aufgabe, Formen des kulturellen Ausdrucks zu enträtseln, die nicht mehr verstanden wurden, weil sie nur teilweise oder unzulänglich gepflegt worden waren. Das unvermeidliche Ergebnis solcher Art von Vernachlässigung und Verlust waren unter jeder neuen Generation weitverbreitete Missverständnisse und irrige Anschauungen über die Vergangenheit.
Unterbrechungen und Fehler in der Überlieferungskette, so beklagenswert sie sein mochten, konnten die Kultur allerdings nicht an ihrer Weiterentwicklung hindern. Vielmehr erwiesen sie sich mitunter sogar als ziemlich produktiv und brachten neue und originelle Schöpfungen hervor. So wie die biologische Anpassung durch (zufällige) Abweichungen in den Gen-Sequenzen voranschreitet, so kommt auch die kulturelle Anpassung durch Fehler in der Überlieferung voran. Sie ermöglichen der Kultur zu experimentieren, wenn neue Generationen in die Vergangenheit eigene Anliegen hineinprojizieren und so eine Dringlichkeit sehen, diese weiter fortzuführen.
Während sich ein Drama der kulturellen Übermittlung um Bewahrung, Verlust und (fehleranfällige) Rückgewinnung drehte, handelte ein anderes vom wechselseitigen Austausch zwischen den Kulturen. Solche Zusammenspiele wurden durch Krieg und Invasion, aber auch durch Handel und Reisen angestoßen und brachten neue kulturelle Ausdrucksformen hervor. Einige der bedeutendsten Zivilisationen erlebten dadurch eine Entwicklung, dass sie sich am Kulturgut anderer bedienten: Ein König in Indien importierte aus Persien die Kunst, Pfeiler zu errichten, die Römer führten Literatur, Theater und Götter aus Griechenland bei sich ein, und die Chinesen suchten in Indien nach buddhistischen Schriften, während sich japanische Gesandte nach China aufmachten, um das dortige Schrifttum, Baustile und neue Formen des religiösen Kults zu erkunden. Derweil ersannen die Äthiopier einen Gründungsmythos, der sie mit der hebräischen und christlichen (1)Bibel verband, und die Azteken(2) übernahmen Elemente aus früheren Kulturen, auf deren Reste sie im Tal von Mexiko stießen.
Als sich die Vorteile kulturübergreifender Interaktion zeigten, wurde sie von vorausschauenden Herrschern aktiv gefördert, unter anderem von japanischen Kaisern, die diplomatische Missionen nach China entsandten, oder vom Kalifen Harun ar-Raschid(1) in Bagdad(1), dessen Sohn al-Ma’mun das Wissen aus dem gesamten Mittelmeerraum und dem Nahen und Mittleren Osten zusammentragen und zu dem vereinen ließ, was er das Haus der Weisheit nannte. Begleitet wurden alle diese Beispiele für kulturelle Anleihen von Missverständnissen und Irrtümern, aber sie wirkten oftmals produktiv und brachten neue Formen der Erkenntnisse und der Sinnfindung hervor.
Eher beunruhigend ist, dass kulturelle Begegnungen auch zu Zerstörung, Diebstahl und Gewalt führten, so insbesondere während des Aufstiegs der europäischen Kolonialreiche, bei dem verschiedene Teile der Welt in einen Kontakt zu Fremden gezwungen wurden, die es darauf abgesehen hatten, Arbeitskräfte und Ressourcen, auch die kulturellen, auszubeuten. Aber trotz der weitverbreiteten Gewalt, die mit diesem Aufeinandertreffen in der Regel einherging, entwickelten die angegriffenen Kulturen erstaunliche Strategien, um Widerstand zu leisten, und zeigten mit ihrer Resilienz, dass kulturelle Anpassung, anders als die zäh verlaufende biologische Evolution(4), in rasantem Tempo voranschreitet.
Die in diesem Buch umrissene Kulturgeschichte hält für uns Heutige eine Fülle von Lehren bereit. In gewisser Hinsicht sind wir begieriger denn je darauf, Wissen aus der fernen Vergangenheit aufzuspüren und zurückzugewinnen, während andererseits bedeutende Denkmäler immer häufiger durch Umweltschäden, durch Vernachlässigung und vorsätzliche Zerstörung verloren gehen. Neue Speichertechniken ermöglichen es, mit geringsten Kosten Texte, Bilder und Musik für die Nachwelt zu konservieren, während ihnen soziale Medien wie Facebook, X und YouTube größere Reichweite denn je bescheren. Noch nie waren vormals geschaffene Kulturgüter und -praktiken für so viele Menschen so frei verfügbar wie heute.
Aber inmitten dieser Fülle an digitalisierten kulturellen Inhalten werden ältere Dateiformate, Websites und ganze Datenbanken in erschreckendem Tempo unlesbar, womit sich die Frage stellt, ob wir beim Bewahren der Vergangenheit wirklich so viel besser als unsere Vorfahren sind. Und während sich die Techniken der kulturellen Speicherung und Verbreitung verändert haben, sind die Gesetze, die das Funktionieren der Kultur bestimmen, nach wie vor dieselben: wie sie bewahrt, übermittelt, wechselseitig verbreitet und zurückgewonnen wird. Das Zusammenspiel zwischen Erhalt und Zerstörung, zwischen Irrtum und Anpassung setzt sich in einer Welt, in der inzwischen fast alle Kulturen fast ständig in Kontakt zueinander stehen, ungebrochen fort. Mehr denn je ringen wir um die Vergangenheit, ihre Deutung und auch darum, wem die Kultur gehört und wer zu ihr Zugang hat.
In unseren Debatten über Originalität und Integrität, über Aneignung(2) und Vermischung vergessen wir zuweilen, dass Kultur kein Besitz, sondern als Gemeingut dazu bestimmt ist, weitergegeben zu werden, damit es andere auf ihre Weise verwenden können. Kultur ist ein gewaltiges Recycling-Projekt, das Fragmente aus der Vergangenheit aufsammelt, um neue und überraschende Mittel der Sinnfindung zu erschaffen. Dieses Buch erzählt von einem Sultan, der sich einen antiken Pfeiler aneignete, der für die Nachwelt errichtet worden war; von einem arabischen Archäologen, der die Büste einer ägyptischen Königin ausgrub, deren Andenken aus der Geschichte getilgt werden sollte; von einem Kalifen, der Wissen zusammentrug, egal von wem es stammte; von einem Griechen, der Griechenland mit einem falschen Gründungsmythos ausstattete, von einem Römer, der eine erfundene Geschichte um den Ursprung Roms(1) in die Welt setzte; und ebenso von einer äthiopischen Königin, die mit den Zehn Geboten(1) in Verbindung gebracht wurde, um ihrem Reich so eine neue Abstammung anzudichten. In all diesen exemplarischen Episoden aus der Kulturgeschichte tauchen Menschen auf, die sich bei der schwierigen Arbeit der Sinnfindung an der Kultur die Hände schmutzig machten. Wie sollen wir sie in Erinnerung behalten und beurteilen?
Vor allem mit Demut. Seit der Chauvet-Höhle(12) wurde so vieles erschaffen und blieb so weniges erhalten, oftmals wegen der Arroganz späterer Generationen, die Kulturschätze und kulturelle Praktiken vernachlässigten, weil sie mit ihren gegenwärtigen religiösen, gesellschaftlichen, politischen oder ethischen Idealen nicht im Einklang standen. Werden wir es besser machen? Werden wir einem breiteren Spektrum an kulturellen Ausdrucksformen Raum zum Gedeihen geben?
Die wichtigste Lektion aus der Kulturgeschichte lautet, dass wir uns engagiert auf die Vergangenheit und auf uns untereinander einlassen müssen, damit Kulturen ihr volles Potenzial ausschöpfen können, trotz der Fehler, des Unverständnisses und der Zerstörung, die mit einem solchen Engagement häufig einhergehen. Wenn wir die Kulturen von der Vergangenheit abschneiden oder sie gegeneinander abschotten würden, nähmen wir ihnen den Sauerstoff, der sie am Leben hält.
Alle Schöpfer setzen auf die Zukunft im Vertrauen darauf, dass ihre Werke erhalten bleiben, wohl wissend, dass sie sich damit dem Urteil einer anders denkenden Nachwelt aussetzen. Kultur. Eine neue Geschichte der Welt von Höhlenmalerei bis Hollywood möchte den Lesern und Leserinnen die atemberaubende Vielfalt kulturellen Schaffens nahebringen, die wir als Spezies hervorgebracht haben, in der Hoffnung, dass wir unser gemeinsames Erbe als Menschheit bis in die nächste Generation und darüber hinaus weitertragen können.
Kapitel 1
Königin Nofretete(1) und ihr gesichtsloser Gott
Mohammed es-Senussi(1) nahm sie als Erster in Augenschein. Gleich nach der Mittagspause hatten er und seine Arbeiter die schwer angeschlagene Büste eines Königs freigelegt und Hinweise entdeckt, dass in der Nähe weitere zerbrechliche Stücke verschüttet lagen. Alles deutete darauf hin, dass sie es hier mit etwas Außergewöhnlichem zu tun hatten. Als der sorgfältigste und kundigste Ausgräber schickte es-Senussi(2) alle anderen Arbeiter weg aus Sorge, sie könnten die empfindlichen Skulpturen in dem ein Meter hohen Schutt im Raum beschädigen. Wie schon so oft, räumte er die Brocken vorsichtig mit einer Hacke beiseite. In seinem weiten, einstmals weißen und jetzt ziemlich zerschlissenen Gewand und mit der Mütze auf dem großen Kopf mit dem kurzgeschorenen schwarzen Haar arbeitete er sich mühselig weiter zur Ostwand vor. Und dabei stieß er immer wieder auf Bruchstücke einer Skulptur.[1]
Nach über einem Jahr der Grabungen in diesem Areal hatte er mit seinen Arbeitern Reste eines großen Gebäudekomplexes gefunden, der sich als eine Schatzkammer mit Skulpturen, Figurinen und Reliefs erwies. Der kleine Raum, in dem er nun zu Werke ging, barg offenbar ungewöhnlich viele solcher dicht beieinander liegenden Stücke. Nachdem er im getrockneten Lehm und Sand kleinere Fragmente entdeckt hatte, blickte er auf den Hals einer lebensgroßen Büste mit erstaunlich leuchtenden Farben.
Senussi legte die Hacke beiseite und grub mit bloßen Händen weiter. Obwohl sie nicht eben zart, sondern die eines imposanten und korpulenten Mannes waren, zeigte Senussi sich vollendet behutsam, wenn es um zerbrechliche Funde ging. Im Staub knieend, tastete er sich mit den Fingern zum oberen Teil der Skulptur vor. Langsam kam eine Krone in Form eines Kegelstumpfs zum Vorschein.
Die Freilegung erwies sich als schwierig. Dicht bei ihr im Schutt lagen weitere Stücke, die zunächst entfernt werden mussten, aber am Ende blickte Senussi auf die Büste einer Frau herab, die mit dem Gesicht nach unten vor ihm lag. Als er sie heraushob und umdrehte, sah er ihr Antlitz – als der erste Mensch nach 3244 Jahren. Ein Tagebucheintrag vom 6. Dezember 1912 vermerkt: »Farben wie eben aufgelegt. Arbeit ganz hervorragend. Beschreiben nützt nichts, ansehen.«[2]
Was Senussi sah, war ein erstaunlich symmetrisches Antlitz mit einem aufgemalten bronzefarbenen Teint, vorspringenden Wangenknochen, ovalen Augen und vollen, aber scharf gezogenen Lippen. Zarte Fältchen an den Mundwinkeln schienen ein Lächeln anzudeuten. Die Büste war wunderbar erhalten, mit einem kleinen Schaden an den Ohren, und ein Auge fehlte. Ein Name stand nicht auf ihr, aber der Krone nach zu urteilen, hielt Senussi eindeutig eine Königin in den Armen. Ein Foto mit den anderen Ausgräbern, die er herbeigerufen hatte, um seinen Fund zu inspizieren, zeigt ihn, wie er die Königin mit der einen Hand hält, während er mit der anderen vorsichtig ihren großen Kopf abstützt und höchst stolz und fürsorglich auf sie herabsieht. Anstatt seinen Blick zu erwidern, schaut die Königin gelassen in die Ferne, scheinbar unbeeindruckt von der Aufregung um sie herum und ohne zu ahnen, dass ihr Gesicht bald zum berühmtesten des Altertums werden sollte.
Die Skulptur war Teil einer laufenden Puzzlearbeit. Tell el-Amarna, wo sie aufgetaucht war, lag ungefähr auf halber Strecke zwischen den beiden großen altägyptischen Städten Memphis im Norden und Theben im Süden. Und diese Ruinenstätte war lange Zeit vernachlässigt worden, weil sie verglichen mit den großen Pyramiden von Gizeh bei Memphis oder den Palästen und Tempeln von Theben bedeutungslos erschien. Aber im Verlauf des vorherigen Jahrhunderts waren schrittweise Fundamente von Bauten sowie Gräber entdeckt worden, in denen Archäologen die Überreste einer einst großen Stadt vermuteten, auch wenn niemand wusste, wie sie geheißen hatte.[3] Grabstätten und Skulpturen wie die von Senussi ausgegrabene deuteten darauf hin, dass in der Stadt ein König und eine Königin residiert hatten. Nach Jahren der Suche tauchten schließlich Inschriften mit einem Namen auf. Die Büste stellte Königin Nofretete(2) dar: »Die Schöne ist gekommen«, »Groß an Gunst«, »Herrin von Ober- und Unterägypten«, die Gemahlin von König Amenophis IV(1). Wer war diese geheimnisvolle Frau?
Senussi mit der Büste Nofretetes(3), die er soeben auf dem Anwesen des Bildhauers Thutmosis(1) geborgen hat. (Universitätsarchiv, Universität Freiburg)
Die Ägypter hatten zu ihren Königen und Königinnen Verzeichnisse geführt, aber weder Nofretete(4) noch Amenophis IV.(2) konnten in ihnen klar identifiziert werden. Während die Grabungen fortliefen, tauchten weitere Rätsel auf. Die Stadt war ganz offenbar rasch aus Lehmziegeln errichtet worden. Deshalb war von ihr so wenig erhalten. Und ihre Erbauer hatten sie anscheinend wieder verlassen. Ebenso mysteriös war, dass ihre Bildhauerwerke wie die Büste der Nofretete(5) einen Stil aufwiesen, wie er aus Altägypten nirgendwo sonst zum Vorschein gekommen war. Und warum fehlte diesem sonst so vollkommenen Gesicht ein Auge? Auf seinen Fund wurde eine Belohnung ausgesetzt, aber weder Senussi noch sonst jemand spürte es jemals auf.
Eines wurde ziemlich schnell klar: Senussi war beim Graben auf den Lagerraum eines Bildhauers gestoßen. In Altägypten signierten diese Künstler ihre Werke nicht, aber der Name auf einer elfenbeinernen Scheuklappe, die in dieser Werkstatt gefunden wurde, wies deren Inhaber als einen Thutmosis(2) aus, der so zu einem der seltenen namentlich bekannten Künstler aus dem Altertum wurde. Nach der Größe seines Anwesens zu urteilen, war er gut im Geschäft gewesen. Vollständig von einer Umfriedungsmauer umschlossen, war es durch ein einziges Tor erreichbar, an dem wahrscheinlich Wachen gestanden hatten. Der Komplex umfasste mehrere Gebäude, die von einem weiträumigen Hof aus zugänglich gewesen waren, darunter Werkstätten und enge Unterkünfte, vermutlich für Lehrlinge. Am eindrucksvollsten waren die Gemächer von Thutmosis(3) und seiner Familie, die auf einen Garten mit einem großen Brunnen hinausgingen, wichtig in dieser dürren Einöde. In einem Kornspeicher direkt neben dem Atelier kamen vier Behälter für Gerste und Weizen zum Vorschein. Dieses Getreide hatte nicht nur den Jahresbedarf der Familienmitglieder und der Werkstatt gedeckt, sondern in der geldlosen Wirtschaft wie Gold auch als ein Zahlungsmittel gedient, das sich gegen so gut wie alles eintauschen ließ.[4]
Als ein weiteres Zeichen für Thutmosis(4)’ herausragende Stellung lag sein Anwesen weit vom Nilufer entfernt, an dessen geschäftigen Kais sich Lagerhallen für herangeschiffte Güter wie Weizen, Gerste, Bier und Vieh anschlossen. Dahinter erstreckte sich ein Viertel vorwiegend mit Werkstätten. Thutmosis(5)’ Anwesen war dagegen im ruhigeren Wohnbereich weiter abseits, fast am Rand der Stadt, angesiedelt. Jenseits seiner Werkstatt in einiger Entfernung lagen die Dörfer der Arbeiter, an den Steinbrüchen, in denen die Schwerstarbeit verrichtet wurde. Dass in Thutmosis(6)’ Atelier weitere Skulpturen Nofretetes(6) auftauchten, deutete darauf hin, dass er bei der Königin in besonderer Gunst gestanden hatte. Die geduldige Arbeit von Ausgräbern wie Senussi brachte eine der ungewöhnlichsten Epochen in der altägyptischen Geschichte ans Licht.
Nofretete(7) und Amenophis(3) waren im über dreihundert Kilometer weiter südlich gelegenen Theben (heute Luxor) aufgewachsen, mit rund 80 000 Einwohnern damals eine der größten Städte der Welt. Theben markierte das südliche Zentrum des ägyptischen Kernlands, das sich von der Nilmündung im Norden über mehr als 1200 Kilometer flussaufwärts bis hierher erstreckte. Vormals eine Handelsniederlassung für Geschäfte mit dem heutigen Sudan, war es schon mehrere Generationen vor Nofretete(8) zur Hauptstadt des Reichs aufgestiegen und trumpfte mit riesigen Tempeln samt gewaltigen Pfeilern und einer von Sphingen gesäumten Prozessionsstraße auf. Auf der anderen Nilseite lag das Tal der Könige, in dem seit Jahrhunderten die Pharaonen und Adligen bestattet wurden. Nofretete(9) und Amenophis(4) wuchsen inmitten uralter Monumente und somit als Spätgeborene im Schatten der Geschichte auf.
Diese Allgegenwart der fernen Vergangenheit in Theben war allerdings nichts im Vergleich zu Gizeh im äußersten Norden des Landes. Hier hatten die Könige des Alten Reichs schon tausend Jahre zuvor drei gigantische Pyramiden errichten lassen, von denen eine von einer riesigen Sphinx bewacht wurde. Tatsächlich war in Ägypten(1) fast alles dazu angetan, die Menschen die ganze Last der Vergangenheit spüren zu lassen. Mehr als jede andere Kultur hatte Altägypten gigantische Ressourcen darin investiert, der Vergänglichkeit zu trotzen. Nicht nur Pharaonen, sondern auch Adlige und wirklich alle, die es sich leisten konnten, richteten ihren Blick auf die Ewigkeit. (Über die Sehnsüchte der einfachen Arbeiter, die die Tempel und Begräbnisstätten bauten, ist wenig bekannt.) Die tief im Inneren der Pyramiden verborgenen Grabkammern und die in den Felsen gehauenen Grüfte wurden mit allem ausstaffiert, was in der jenseitigen Zukunft dienen konnte, von Speisen bis zu nackten Gespielinnen.[5] Tote zu bestatten und ihrer zu gedenken, ist natürlich in allen Kulturen verbreitet, aber die Ägypter konservierten ihre Leichname überdies für die Ewigkeit.
Amenophis’ Vater Amenophis III.(1) war ein typischer Vertreter dieses Vergangenheitskults. Er hatte das geeinte Ägypten(2) mit zahlreichen Vasallenstaaten geerbt, die sich bis nach Mesopotamien(1) erstreckten. Mit gewaltigen Mitteln hatte er ehrgeizige Bauprojekte in Angriff genommen, die um den großen alten Tempelkomplex von Karnak herum realisiert wurden.[6] Anstatt sich damit zu begnügen, Teile dieser Bauwerke einfach instand zu setzen – die Notwendigkeit von Restaurierungen war die Erblast der Vergangenheit in der Gegenwart –, baute Amenophis III.(2) auch weitere Tempel wieder auf, darunter den alten Luxor-Tempel mit seiner gewaltigen Kolonnade, und in deutlich grandioserem Stil.
Nach dem Tod Amenophis’ III.(3) 1351 v. Chr. musste sein Sohn, der künftige Amenophis IV. (5), vor der Thronbesteigung den Ritualen der Mumifizierung und Bestattung seines Vaters vorstehen. Anschließend heiratete er Nofretete(10) und designierte sie zu seiner Hauptgemahlin. Da Pharaonen nach politischen Gesichtspunkten heirateten, hatten zahlreiche Vorgänger Schwestern oder Verwandte zu ihrer »Großen Königsgemahlin« erkoren und ausländische Prinzessinnen als Nebenfrauen geheiratet, um vorteilhafte Bündnisse zu schließen. Dagegen stammte Nofretete(11) nicht aus der königlichen Verwandtschaft, war aber wohl als Pflegetochter oder sogar als Tochter des einflussreichen Schreibers und Beamten Eje aufgewachsen.[7] Am Königshof war man starke Frauen gewohnt: Amenophis’ Mutter hatte mitregiert und übte auch nach dem Tod ihres Gatten immer noch Einfluss aus. Mit der Thronbesteigung Amenophis’ IV(6). und seiner Heirat mit Nofretete(12) war der Fortbestand der Dynastie gesichert.
Aber Nofretete(13) und Amenophis(7) hatten kein Interesse an Kontinuität. Vielmehr strebten sie einen Bruch mit der Tradition an, zumindest was die Bauten und Institutionen anging. Zunächst vernachlässigten sie aus strategischen Gründen eines der sichtbarsten Monumente: den restaurierten Tempelkomplex von Karnak, der dem Hauptgott Amun geweiht war.[8] Die mit der Instandhaltung befassten Priester waren der Bedeutung des Gottes entsprechend einflussreich. Dessen Residenz keine Beachtung zu schenken, bedeutete einen Angriff auf ein Machtzentrum. Als einen weiteren Affront erkoren Nofretete(14) und Amenophis IV.(8) den relativ unbedeutenden Gott Aton(1) zum Hauptgott. Binnen weniger Jahre stellten sie so die alte Ordnung Thebens mit dem Gott Amun und seinen gigantischen Kultstätten im Zentrum auf den Kopf und stellten die Verehrung des neuen Gottes in den Mittelpunkt.
In der polytheistischen Welt Altägyptens war es nicht ungewöhnlich, dass sich Götter wandelten. (Auch Amun war aus einer Verschmelzung zweier früherer Götter hervorgegangen.) Aber derlei Veränderungen mussten schrittweise und behutsam herbeigeführt werden, nicht auf die brachiale Art, mit der Amun gestürzt und Aton(2) in den höchsten Rang erhoben wurde. Dabei war Nofretete(15) und Amenophis(9) diese abrupte Zeitenwende noch nicht genug. Sie vernachlässigten sämtliche anderen Götter und sahen ihren Aton(3) zunehmend als den einzig bedeutenden an. Nicht überraschend, fühlten sich alle Anhänger der alten Ordnung – neben den zahlreichen Amun-Priestern auch der Großteil der herrschenden Elite – vor den Kopf gestoßen und holten zum Gegenschlag aus.
Inmitten des entstandenen Machtkampfs trafen Nofretete(16) und Amenophis(10) die radikale Entscheidung, alles hinter sich zu lassen: die Tempel, die Grabstätten der Ahnen, die Stadt als Ganzes mit ihren überall verstreuten Baudenkmälern aus der Vergangenheit, von denen viele Amun geweiht waren. Sie verfrachteten den gesamten Hofstaat, auch den Bildhauer Thutmosis(7), auf Nilbarken und segelten für einen Neuanfang knapp über dreihundert Kilometer weit flussabwärts nach Norden.[9]
Als Nofretete(17) und Amenophis IV.(11) am Ort ihrer Wahl eintrafen, fanden sie dort keine Unterkünfte, sondern nur einen Streifen Wüste vor, der auf der einen Seite vom Nil und auf der anderen von drei imposanten Felsformationen begrenzt wurde.[10] Hier sollte etwas Außergewöhnliches entstehen: eine Stadt, von Grund auf neu geplant und aus dem Boden gestampft.
Die Residenz würde frei sein von den Lasten der Vergangenheit, mit dem Fokus ganz auf dem neuen Gott, nach dem sie benannt wurde: Achet-Aton(1), »Horizont der Sonne«. (Der heutige Name Amarna geht auf einen sich dort später ansiedelnden Stamm zurück.) Die Stadt entstand um den Großen und den Kleinen Aton-Tempel(4) herum, zwischen denen der Große Palast platziert wurde. An dieser symbolträchtigen Linie richtete sich alles andere aus. Achet-Aton(2), der Horizont der Sonne, war eine Neuheit, angelegt mit geradlinig verlaufenden geometrischen Achsen, schachbrettartig angeordneten Tempeln und Regierungsgebäuden sowie klar umrissenen geplanten Werkstätten und Arbeiterdörfern. Es war eindeutig: Nofretete(18) und ihr Gemahl hatten zwar die alte Hauptstadt, nicht aber die Begeisterung für gewaltige Bauvorhaben hinter sich gelassen. Ihr Plan, eine ganze Stadt zu errichten, war in jeder Hinsicht ein ebenso gigantisches Unternehmen wie der Bau der großen Pyramiden von Gizeh.
Mit einem bedeutenden Unterschied: Alles musste schnell geschehen und wurde in Eile, billig und zur sofortigen Nutzung erstellt.[11] Das Ergebnis waren Bauten aus Lehmziegeln, während Stein nur für Pfeiler und große Tempel zum Einsatz kam. Die Paläste waren deswegen keineswegs unelegant. Die Wände der Residenz wurden kunstvoll ausgeschmückt, auch die des königlichen Schlafgemachs. Nofretete(19) war nicht nur insofern eine besondere Königin, als sie nicht von königlichem Geblüt war, sondern auch, weil sie und ihr Gemahl offenbar im selben Raum nächtigten. Vielleicht war auch dies ein Teil der Revolution, die sie angestoßen hatten und die das Land erschütterte.[12] Ihr Palast stand ganz nahe am Nil, sodass Nofretete(20) und ihr Gatte in den Genuss jedes Lüftchens gekommen sein dürften, die diesen wüstenhaften Landstrich erfrischte. (Wie viele altägyptische Königinnen ließ sich Nofretete(21) den Kopf kahlscheren, weil sie zu verschiedenen Anlässen unterschiedliche Perücken trug und so weniger unter der Hitze litt.)[13] Um die Revolution zur Vollendung zu führen, legte Amenophis IV.(12) den Namen seiner Vorfahren ab und nannte sich fortan Echnaton(13). Nofretete(22) behielt ihren Namen, ergänzte ihn jedoch um das Wort für Sonne oder Scheibe (Aton(5)) als Beinamen, Neferneferuaton, »Schön sind die Schönheiten des Aton(6)«.[14] Das Königspaar gelobte, die neue Stadt mit den neu errichteten Tempeln für ihren Gott, jetzt der alleinige, niemals wieder zu verlassen.
Als Teil ihres Bruchs mit der Vergangenheit forderten Nofretete(23) und Echnaton(14) Bildnisse von sich in einem neuen Stil an und bescherten so Bildhauern wie Thutmosis(8) willkommene Aufträge. Auch wenn visuelle Darstellungen in Altägypten keineswegs unveränderlich gewesen waren, hatten sie über Jahrhunderte eine bemerkenswerte Kontinuität gezeigt. Pyramiden, Sphingen, Obelisken und die schmückende Ausgestaltung von Sarkophagen und Grabkammern waren Teil eines ererbten Repertoires. Pharaonen wurden als dreidimensionale Skulpturen mit einem Ausfallschritt nach vorn oder im zweidimensionalen Relief seitlich in ihrem charakteristischen Profil dargestellt. Bildhauer und Maler wurden nicht zur Innovation ermuntert. Originalität war kein Wert, sondern ein Versagen.
Dies alles änderte sich in der neuen Stadt, wo Thutmosis(9) und seine Kollegen mit der Tradition brachen und neue Wege beschritten, um den Betrachtern zu signalisieren, dass Nofretete(24) und Echnaton(15) eine andere Art Herrscher als ihre Vorgänger waren. Dies musste sich auch in einem neuen Kunststil widerspiegeln. Heutigen Betrachtern fällt er zuweilen als exaltiert und fremdartig auf.
Im Profil wurden beide mit verlängertem Kinn und Mund dargestellt, was ihre Gesichter fast wie Hundeschnauzen wirken ließ. Ihre Köpfe wurden auf unnatürlich langen und nach vorn geneigten Hälsen abgebildet. Am merkwürdigsten waren ihre unnatürlich langgezogenen Hinterköpfe. Selbst Thutmosis(10)’ bemalte Büste der Nofretete(25), die Senussi ausgegraben hatte, zeigte Spuren dieser Züge, einschließlich der ausladenden Krone – wer weiß, welche Art Kopf sich darunter verbarg – und des langen, nach vorn abgewinkelten Halses. Eine weitere Neuerung war die androgyne Darstellung Echnatons(16), der häufig mit Brustansätzen und breiten Hüften abgebildet wurde. Die Archäologen des 19. Jahrhunderts hielten seine Bildnisse zuweilen für die einer Frau.[15]
Probestück für Darstellungen Echnatons(17), Kalkstein, mit dem typischen verlängerten Kopf und dem an eine Hundeschnauze erinnernden Gesicht der Amarna-Zeit. (Metropolitan Museum of Art, New York)
Die ägyptischen Bildhauer und Maler gaben ihre Motive nicht naturalistisch wieder, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass Nofretete(26) und Echnaton(18) tatsächlich so wie wiedergegeben ausgesehen hatten. Auch dürften sich die Ägypter entgegen dem Anschein in den Darstellungen nicht seitwärts voran bewegt haben.[16] Altägyptens Bildende Künste waren in gewisser Hinsicht fast schon eine Art Schrift, ein hochabstraktes System visueller Kommunikation. Hieroglyphen waren ebenfalls standardisierte Bilder, die für Begriffe und Lautkombinationen standen, sodass die damaligen Menschen daran gewöhnt waren, Malereien, Reliefs und Statuen als Symbole zu lesen. So konnten Nofretetes(27) und Echnatons(19) ausladende Köpfe und ihre verlängerten Gesichter beispielsweise als passend zur Gestalt ihrer Krone gesehen werden, als seien sie zu deren Trägern prädestiniert. Oder die kronenartige Gestalt sollte ausdrücken, dass ihnen das Königtum zur zweiten Natur geworden war, die sie über alle anderen erhob. (Ebenfalls unrealistisch war die Hautfarbe. Ägyptische Künstler nutzten verschiedene Tönungen, von hellbraun bis fast schwarz, ohne dass dies viel über die tatsächliche Hautfarbe der dargestellten Person aussagte. Schon deshalb nicht, weil die alten Ägypter die Landeszugehörigkeit nicht mit der Vorstellung einer biologischen Rasse in Verbindung brachten. Menschen waren Ägypter, wenn sie Ägyptisch sprachen und wie Ägypter lebten.)[17]
Die neuartigen Darstellungen waren auch deshalb bedeutsam, weil sie eine Verbindung zum neuen Gott Aton(7) herstellten. Hatten die anderen Götter gewöhnlich als Bindeglied zwischen den Welten gegolten, so brachen Nofretete(28) und Echnaton(20), die jetzt in ihrer neuen Stadt fest im Sattel saßen, mit diesem System und präsentierten sich als die einzigen Mittler zwischen ihrem Gott und den übrigen Sterblichen.[18] In zahlreichen Darstellungen sonnen sie sich in Atons(8) Strahlen, als die alleinigen unmittelbaren Empfänger von dessen Leben spendender Kraft. Für die damalige Kunst ebenfalls eher ungewöhnlich, tauchen oftmals auch ihre Kinder in anrührenden Familienszenen auf. Wahrscheinlich dienten viele dieser Bildnisse, die in Häusern von Adligen zum Vorschein kamen, als Objekte einer kultischen Verehrung, an die Gebete gerichtet und vor denen Riten vollzogen wurden.[19]
Auch wenn der von Thutmosis(11) geschaffene Kopf der Nofretete(29) einem ähnlichen Zweck gedient haben mochte, wurde diese Büste mit größerer Wahrscheinlichkeit als ein Modell genutzt, anhand dessen er seinen Gehilfen und Lehrlingen zeigte, wie die Königin dargestellt werden musste. Dies würde das Fehlen des einen Auges als eine Gelegenheit erklären, seine Handwerkskunst zu demonstrieren. Senussi entdeckte auf Thutmosis(12)’ Anwesen zahlreiche weitere Beispiele für Modelle und unvollendete Werke. Sie zeigen uns, wie diese steinernen Skulpturen entstanden. Der Künstler formte aus Wachs oder Lehm zunächst ein Gesicht, fertigte von ihm einen Gipsabguss an, um ihn vielleicht Nofretete(30) begutachten zu lassen, und meißelte erst dann die Figur aus Stein.[20]
Flachrelief in Kalkstein: Echnaton(21), Nofretete(31) und ihre drei Töchter sonnen sich in den Strahlen des Gottes Aton(9). (Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Neues Museum, Berlin, Foto: Gary Todd, WorldHistoryPics.com)
Dass Nofretetes(32) Büste als Modell diente, erklärt auch die vollkommene Symmetrie dieser Skulptur, die schon so viele Betrachter als ein Zeichen vollendeter Schönheit berührt hat. Aber sie unterscheidet sich sehr deutlich von den anderen Darstellungen der Nofretete(33), die Thutmosis(13) und weitere Bildhauer anfertigten. Sie maßen Proportionen anhand der Breite eines Fingers ab, und Nofretetes(34) Bildnis entspricht perfekt diesem Maßsystem.[21] Dies legt nahe, dass die Büste so eine Art Abstraktion darstellt, ein Demonstrationsmodell, bei dem all die Besonderheiten und symbolträchtigen Charakteristika weggelassen wurden, die oftmals bei anderen Abbildungen der Königin die Deutung erschweren. Wie dem auch sei, die neuartigen Bildnisse Nofretetes(35) und Echnatons(22) dienten mit dazu, Aton(10) als einen neuen, aber auch neuartigen Gott zu etablieren, der als ein solcher ebenfalls auf neue Weise dargestellt werden musste. War Aton(11) zunächst als eine Götterfigur mit Falkenkopf aufgetaucht, hatte er schrittweise eine scheibenförmige Gestalt entsprechend der Sonne angenommen. Anschließend wurde er von den Künstlern in einer weitergehenden Vertiefung des Konzepts zur Verkörperung des Lichts sublimiert.
Da sich dieser Abstraktionsprozess nicht mehr über Bilder vermitteln ließ, musste die erhabenste Verkündigung des neuen Gottes anstatt über die Bildhauerei über das Schrifttum erfolgen: mit dem »Aton-Hymnus« oder dem »Großen Sonnengesang«. Eine Inschrift mit diesem Text fand sich in einer Grabkammer in Achet-Aton(3), wo anderenorts Auszüge aus dem altägyptischen Totenbuch platziert wurden, um den Übergang der Verstorbenen in die Unterwelt zu gewährleisten. (Einige Privatgräber in der Stadt enthalten Auszüge aus Kapitel 151 dieser Sammlung von Zaubersprüchen.)[22] Der Hymnus beginnt mit einem Lobpreis auf Aton(12) in der Art, wie früher ein Sonnengott in einem solchen Text angerufen wurde, insbesondere mit einer Beschwörung des Siegs über die Finsternis, des Schauspiels des Sonnenaufgangs und der Schwermut des Sonnenuntergangs. Aber der »Große Sonnengesang« geht sogleich dazu über, Aton(13) zu dem Gott zu erhöhen, der alles auf Erden, von Pflanzen und Tieren bis hin zum Menschen, am Leben erhält. Aton(14) ist ein Gott,
Der du den Samen sich entwickeln lässt in den Frauen,der du »Wasser« zu Menschen machst,der du den Sohn am Leben erhältst im Leib seiner Mutterund ihn beruhigst, sodass seine Tränen versiegenDu Amme im Mutterleib!– der du Atem spendest,um alle Geschöpfe am Leben zu erhalten.[23]
Dieser Gott als das Prinzip, das jeden einzelnen Atemzug ermöglicht, erhält das Wachstum und mithin das Leben schlechthin aufrecht.
Dabei beschränkt sich der Hymnus nicht auf Abstraktion und Konzentration. Er erhebt diesen Gott nicht nur zum Bewahrer allen Lebens, sondern auch zum Schöpfer. »Du hast die Erde erschaffen nach deinem Herzen, der du allein warst, mit Menschen, Herden und jeglichem Wild […].« Aton(15) ist ein Schöpfergott, der alles vollständig allein, ohne jedwedes Zutun eines anderen Gottes, in die Welt gesetzt hat. Wir, die wir so sehr an den Monotheismus(1) gewöhnt sind, können uns kaum vorstellen, wie radikal diese Anschauung war. In einer Gesellschaft, die an zahlreiche Götter gewöhnt war, die nebeneinander und in einer komplexen Beziehung zueinander existierten, muss sie als Schock, fast völlig unverständlich gewirkt haben.
Als Urheber des »Großen Sonnengesangs« wird mitunter Echnaton(23) genannt, was angesichts seiner engen Verbundenheit mit Aton(16) einleuchtend erscheint. Aber ebenso könnte er von Nofretete(36) stammen, die Ägyptens bedeutendstem Schreiber nahestand. Hatten in der Vergangenheit Königsgattinnen in der Götterverehrung eine untergeordnete Rolle gespielt, so war ihre Rolle im Aton-Kult(17) gleichrangig mit der ihres Gatten.[24] Interessanterweise rückt der »Große Sonnengesang« eingangs den Frauenkörper in den Fokus, der das ungeborene Leben nährt und erhält. Er beschwört sogar den Akt des Gebärens: »Kommt (das Kind) aus dem Mutterleib heraus, um zu atmen / am Tag seiner Geburt, / dann öffnest du seinen Mund vollkommen / und sorgst für seine Bedürfnisse«. Und so endet der Große Sonnengesang mit einer Anrufung Nofretetes(37) als der »Große[n] Königsgemahlin […], Herrin beider Länder, Nofretete(38), die lebendig und verjüngt ist für immer und ewig«.
Die kulturelle Revolution, die sich in Achet-Aton(4) vollzog, erinnert an die enge Beziehung zwischen Kunst und Religion als verbündete Formen der Sinnfindung. Wenn wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen, projizieren wir gern gegenwärtige Ideen und Kategorien in Gesellschaften hinein, die sich in diesen fast sicher nicht wiedererkannt hätten. Die Unterscheidung zwischen Kunst und Religion – mit der Unterstellung, die eine ließe sich von der anderen trennen – ist eine solche Projektion. Wie die Revolution in Achet-Aton(5) zeigt, ist Sinnfindung in der fernen Vergangenheit und tatsächlich auch in vielen heutigen Gesellschaften eine Suche nach Orientierung mit grundlegenden Fragen, die die fein säuberlich gezogenen Grenzen zwischen Kunst und Glauben sprengen.
Die Umwälzung in Achet-Aton(6) endete fast so abrupt, wie sie begonnen hatte. Nofretete(39) und Echnaton(24) waren der Ausbau ihrer neuen Stadt, ihr neuer Götterkult und die Beschaffung neuer Bildwerke wichtiger, als ihr Reich zusammenzuhalten. Immer verzweifelter suchten Vasallen von überall in der Region in Schreiben, häufig in Akkadisch, der damaligen Verkehrssprache des Nahen und Mittleren Ostens, oder auf Tontafeln in Keilschrift um militärischen Beistand nach. Und aus dieser Vernachlässigung des Reiches dürften die Erzfeinde in Theben sicherlich Kapital geschlagen haben.[25]
Verschärft wurde der Druck durch grassierende Krankheiten: Tuberkulose, Malaria und namenlose weitere Seuchen hatten sich als Ergebnis der größeren Bevölkerungsdichte längst in Ägyptens Städten eingenistet. Spekulationen zufolge soll Nofretetes(40) und Echnatons(25) Entscheidung, eine neue Stadt zu gründen, sogar ein Fluchtversuch angesichts der Krankheiten gewesen sein. Aber diese folgten ihnen nach und suchten bald auch die neue Stadt heim.[26] Das änderte jedoch nichts daran, dass das Königspaar seinem Schwur treu blieb, Achet-Aton(7) niemals zu verlassen. Nach seinem Tod wurde Echnaton(26) zeremoniell in seinem vorbereiteten Königsgrab beigesetzt. Er hatte nicht vollständig mit der Vergangenheit gebrochen und an den traditionellen Anschauungen zum ewigen Leben festgehalten. Vielleicht hatte er sogar geglaubt, dass die Stadt nach ihrer Gründung dereinst für einen dauerhafteren Bestand neu aufgebaut würde.
Wie immer nach dem Tod eines Pharaos war die Regelung der Nachfolge von entscheidender Bedeutung. Auf Echnaton(27) folgten zwei Regierungszeiten, von denen keine ein volles Jahr währte. Wie spekuliert wurde, soll eine von Nofretete(41) ausgefüllt worden sein. Mehr Stabilität kehrte erst wieder ein, als Echnatons(28) Sohn Tutanchaton, unter der Anleitung des hochrangigen Schreibers und Wesirs Eje (der später selbst Pharao wurde), noch im Kindesalter den Thorn bestieg.
Diese Stabilität erforderte allerdings, alles rückgängig zu machen, was seine Eltern eingeführt hatten. Tutanchaton nahm den Namen Tutanchamun(1) an als ein Signal, dass er dem Glauben seines Vaters abschwor und zum Gott Amun zurückkehrte. Noch wichtiger war, dass er mit dem gesamten Hofstaat und allem, was dazugehörte, nach Theben zurückzog. Er ging indes nicht so weit, den Aton(18)-Kult vollständig zu verbieten: Als im frühen 20. Jahrhundert auf spektakuläre Weise sein Grab entdeckt wurde, kam darin sogar eine Darstellung Atons(19) zum Vorschein, als hätte er an das außergewöhnliche Experiment seines Vaters erinnern wollen. Aber die Zeit des neuen Sonnengotts war in jeder Hinsicht zu Ende gegangen.
Nach der Abwanderung des Hofs wurde die Stadt Achet-Aton(8) schrittweise aufgegeben, weil in dieser schroffen Wüstenebene alle Aussichten auf ein auskömmliches Leben schwanden. Dies galt sicher für Thutmosis(14), dessen Existenz von Aufträgen aus dem Königshaus abhing. Er machte sich nicht Hals über Kopf davon, sondern wählte zunächst sorgfältig aus, was er mitnehmen oder zurücklassen würde.[27] Die Gipsabgüsse als Vorlage für seine Werke waren überflüssig geworden. Sie unter hohen Kosten nach Theben oder Memphis zu transportieren, wäre nutzlos gewesen. Alle unfertigen oder vollendeten Skulpturen und Reliefs Echnatons(29) und seines Gottes hatten jegliche Bedeutung verloren und durften ebenfalls dort bleiben.
Dasselbe galt für die als Modell dienende schöne Büste der Nofretete(42). Die Zeit war vorbei, da Thutmosis(15) seinen Lehrlingen an ihr demonstrierte, wie man mit der Fingermethode Proportionen abmaß oder ein Auge in ihr Gesicht einfügte. Zu Ehren seiner Jahre im Dienst dieses revolutionären Königspaars ließ er alle Bildwerke in einem Lagerraum verstauen und ihn zumauern. Auch wenn der Hof die Stadt mitsamt allem, wofür sie stand, im Stich ließ, wollte er nicht zulassen, dass Plünderer seine Werke schändeten. Geschützt vor Störungen, blieb die Büste in dem versiegelten Raum zurück. Als irgendwann das Holzregal zusammenbrach, auf dem sie stand, landete sie auf dem Boden und wurde in der nachfolgenden Zeit vom Nil bei Überschwemmungen von Schlamm bedeckt – und so zum Glück für die nächsten dreitausend Jahre konserviert. Dann legte Senussi sie mit seinen großen, behutsamen Händen fein säuberlich frei, hob sie aus ihrem Lehmbett heraus, drehte sie zu sich her und blickte ihr erstaunt ins Gesicht.
Die Vergangenheit lässt sich nicht so leicht abschütteln, auch wenn wir es immer wieder versuchen. Manchmal wartet sie im Untergrund über Jahrtausende darauf, wieder ausgegraben zu werden.
Du sollst neben mir keine anderen Götter haben
Die ägyptischen Herrscher und Schreiber schenkten den Bewohnern an der Peripherie ihres Reichs eher wenig Beachtung. Umgekehrt galt dies nicht: Verschiedene halbnomadisch lebenden Gruppen war durchaus bewusst, dass ihre Geschicke eng mit denen ihrer ägyptischen Oberherren verknüpft waren. Unter einer kursierte eine Erzählung über die eigene Geschichte als Volk, in der Ägypten(3) eine herausragende Rolle spielte. Sie rankt sich um den Hirten Joseph, Sohn des Jakob, der als Arbeitssklave nach Ägypten verkauft worden sein soll. Fleißig und tüchtig, steigt dieser Joseph im Verwaltungsapparat des Reichs auf und bekleidet schließlich einen der höchsten Posten des Landes. Wegen seiner vorausschauenden Bewirtschaftung von Ressourcen zieht er die Aufmerksamkeit des (unbenannten) Pharaos auf sich.
Die Erzählung um Josephs Nutzung des Kornspeichers ist bemerkenswert, denn wie historisch verbürgt ist, verdankte Ägypten(4) seinen Aufstieg auch einer Revolution in der Vorratshaltung. Deren Grundlage war die Landwirtschaft, die den Menschen die Sesshaftigkeit und ein Leben in dicht besiedelten städtischen Räumen ermöglicht hatte. Das Land am Nil, der Ägypten nicht nur mit Wasser, sondern auch mit nährstoffreichem angeschwemmten Boden versorgte, war für diese neue Lebensweise perfekt geeignet.
Die Einlagerung von Getreide und anderer Nahrungsmittel ermöglichte eine weitere Form der Bewahrung, nämlich die von Wohlstand. Die vormaligen Nomadenvölker hatten vergleichsweise egalitär gelebt. Auch wenn sie Führern unterstanden, beschränkten sich Unterschiede im persönlichen Reichtum auf das, was die Menschen auf dem eigenen Rücken oder dem ihres Pferds (oder mehrerer) abtransportieren konnten. Aber jetzt, mit der Revolutionierung des Speicherwesens, waren dem Wohlstandsgefälle im Prinzip keine Grenzen mehr gesetzt.[28] Personen, die eine Herrschaft über Boden und Arbeitskräfte ausübten, häuften gewaltige Reichtümer an und lagerten sie in Speichern ein.
Der genannten Erzählung zufolge hatte Joseph die Vorzüge des Speicherwesens erkannt und den Pharao dazu bewogen, dass er in guten Jahren Getreide einlagern ließ, um Hungersnöten vorzubeugen. So konnte Ägyptens Herrscher seine Bevölkerung auch dann noch mit Nahrung versorgen, als eine Dürre die Region heimsuchte, und festigte dadurch seine Macht. In dieser schweren Zeit führte Joseph seinen Hirtenstamm von Kanaan auf ein Gebiet im ägyptischen Kernland, weil er die Erlaubnis erhalten hatte, sich dort anzusiedeln. Nach seinem Tod wurde sein Leichnam standesgemäß nach ägyptischem Brauch einbalsamiert und bestattet.
Als auch der Joseph gewogene Pharao gestorben war, wandte sich Ägypten(5) gegen die Fremden. Zum Glück hatte der neue Pharao einen von ihnen namens Moses(1) adoptiert und ihm die Privilegien und die Bildung zuteilwerden lassen, die Mitglieder des Königshauses genossen. Moses konnte den Pharao nach langem Hin und Her überreden, seine Leute in ihr angestammtes Heimatgebiet in Kanaan zurückkehren zu lassen. Und dorthin führte er sie, mit ihrer Religion, die auf einem einzigen Gott beruhte.





























