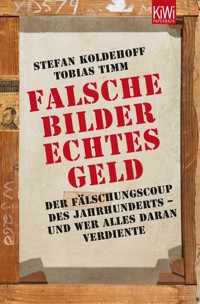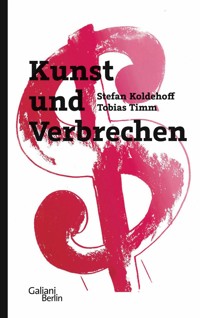
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fälschungen, Geldwäsche, Steuerbetrug, Plünderung antiker historischer Stätten. Die Liste der Verbrechen, die in Zusammenhang mit Kunst begangen werden, ist lang. Mit dem enormen Anstieg der Preise und der Globalisierung des Kunstmarktes hat die Kriminalität jedoch eine neue Qualität erreicht – so ist etwa Artnapping, bei dem ein Kunstwerk als Geisel genommen und erst gegen Lösegeld wieder zurückgegeben wird, heute keine Seltenheit mehr. Die Kunstexperten Stefan Koldehoff und Tobias Timm nehmen vom Kleinganoven bis zum schwerreichen Meisterfälscher all jene in den Fokus, die sich illegalerweise an Kunst bereichern wollen. Und denen es selbst, wenn sie geschnappt werden, gelegentlich gelingt, sich als genial-charmante Trickser zu inszenieren. Wie hoch der materielle und immaterielle Schaden ist, den sie in den Duty-Free-Zonen und Dark Rooms des globalen Kunstbetriebs anrichten, kommt nur selten ans Tageslicht. Doch »Kunst und Verbrechen« sammelt nicht nur spannende, erschreckende und irrwitzige Geschichten – die beiden Autoren liefern auch eine fundierte Analyse, was sich am System Kunstmarkt und in den Museen ändern muss. Ein fundiert recherchiertes, brisantes und hochaktuelles Buch, dessen einzelne Kapitel sich so spannend lesen wie kleine Krimis vom Autorenduo des Bestsellers »Falsche Bilder, echtes Geld« zum Fall Beltracchi.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Stefan Koldehoff / Tobias Timm
Kunst und Verbrechen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Stefan Koldehoff / Tobias Timm
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Stefan Koldehoff / Tobias Timm
Stefan Koldehoff und Tobias Timm arbeiteten bereits bei dem von der Presse gefeierten Bestseller Falsche Bilder, echtes Geld (2012) zum Fall Beltracchi zusammen. Das Buch wurde mit dem Prix Annette Giacometti und dem Otto-Brenner-Preis ausgezeichnet.
Koldehoff, geboren 1967, ist Kulturredakteur beim Deutschlandfunk und schreibt u.a. für die ZEIT und art. Bei Galiani erschienen Die Bilder sind unter uns. Das Geschäft mit der NS-Raubkunst und der Fall Gurlitt (2014) und Ich und Van Gogh. Bilder, Sammler und ihre abenteuerlichen Geschichten (2015).
Timm, geboren 1975 in München, studierte in Berlin und New York. Er schreibt als Autor von Berlin aus für die ZEIT über Kunst, Architektur und Verbrechen.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ein Buch, dessen einzelne Kapitel sich so spannend lesen wie kleine Krimis: Die Kunstexperten Stefan Koldehoff und Tobias Timm spüren anhand ausgewählter Fälle und beispielhafter Figuren den Verflechtungen von Kunst und kriminellen Machenschaften nach.
Fälschungen, Geldwäsche, Steuerbetrug, Plünderung antiker historischer Stätten: Die Liste der Verbrechen, die in Zusammenhang mit Kunst begangen werden, ist lang. Mit dem enormen Anstieg der Preise und der Globalisierung des Kunstmarktes hat die Kriminalität jedoch eine neue Qualität erreicht – so ist etwa Artnapping, bei dem ein Kunstwerk als Geisel genommen und erst gegen Lösegeld wieder zurückgegeben wird, heute keine Seltenheit mehr.
Stefan Koldehoff und Tobias Timm nehmen vom Kleinganoven bis zum schwerreichen Meisterfälscher all jene in den Fokus, die sich illegalerweise an Kunst bereichern wollen. Und denen es selbst, wenn sie geschnappt werden, gelegentlich gelingt, sich als genial-charmante Trickser zu inszenieren. Wie hoch der materielle und immaterielle Schaden ist, den sie in den Duty-Free-Zonen und Dark Rooms des globalen Kunstbetriebs anrichten, kommt nur selten ans Tageslicht.
Doch Koldehoff und Timm sammeln nicht nur spannende, erschreckende und irrwitzige Geschichten – sie liefern auch eine fundierte Analyse, was sich am System Kunstmarkt und in den Museen ändern muss.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen, Berlin
Covermotiv: © The Andy Warhol Foundation
Lektorat: Wolfgang Hörner
ISBN978-3-462-32119-7
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Licht und Schatten – ein Vorwort
Die dunkle Seite des Marktes
Kein Generalverdacht
Globalisierung der Fälschung
Die Kunst als Geisel
Kapitel 1 Gestohlen, geraubt, entführt
Von legendären Museumsdiebstählen, Artnapping und einer 100-Kilo-Münze aus purem Gold
Das Verschwinden der Mona Lisa
Zwei, drei, sechs Mona Lisas
Mit abgesägtem Gewehr ins Munch-Museum
Artnapping – Erpressung mit Kunst
Ein Goya fürs Fernsehen
Schatten und Dunkelheit im Rotlichtviertel
Ein Polaroid für eine Million Pfund
Nebelschwaden in Hamburg
Der Bruch im Bode-Museum und die Riesengoldmünze
Eine Münze aus weichem Gold
Mit Axt und Rollbrett
Eine Tat von Banausen?
Ein verdächtiger Museumsflyer und Tipps von V-Leuten
Zugriff in Neukölln und ein langer Prozess
Der kulturpolitische Skandal
Die »Meltdown Mobs« gegen die Kunst
Die Wiederholung als Farce: der Diebstahl der goldenen Toilette von Maurizio Cattelan
Kapitel 2 Das Verschwinden des Originals
Der zweite Niedergang der Avantgarde
Warum die russische Moderne Fälscher lockt
Ein Antiquitätenjäger eröffnet seine Galerie
Experten in Gefahr
Wie Händler eine Gutachterkammer finanzieren
Erfundene Provenienzen
Das Ende der SNZ Galeries
Das Verschwinden der Originale
Der Modigliani-Mythos – wie die Klassische Moderne systematisch gefälscht wird
Der Tod als Beginn
Frühe Fälschungsflut
Freundschaftsdienste
Neuanfang nach dem Krieg
Der Wettstreit der Experten
Entdeckungen sind möglich
Kampf der Giganten
Wissen und Wissenschaft
Konkurrierende Kataloge
Neue Fälschungsstrategien
Restrisiko
Hitlers Telefon und Thoraks Pferde – das Geschäft mit echten und gefälschten Nazi-Reliquien
»… ohne bösen Hintergrund«
»Wissenschaftliches Interesse«
Absurde Fälschungen
Ein Nazi-Museum unter der Ostsee
Eberswalde – Wilmersdorf – Bad Dürkheim
»Rechtmäßig erworben«
Vom Safeknacker zum Auktionator
Gefälschter Fälscher
Hitler und Schneewittchen
Lenin und Hitler beim Schach
Staatlich angeordnete Verknappung
Eine Frage des Glaubens
Vormittags Picasso, nachmittags Dalí – der Massenbetrug mit kopierten Druckgrafiken
Mit der Aura der Auktion
Original aus Galerieauflösung, mit Zertifikat
Teurer Rahmen, billige Kopie
Paletten voll Kopien
Indische Tinte und italienischer Rotwein – der Handel mit den gefälschten Büchern
Neues Konzept des Universums
Der Heilige Gral der Bibliophilen
Zweifel in Atlanta
»Der Chef ist ein Krimineller«
250 Grad im Backofen
Kapitel 3 Die zerstörte Kulturgeschichte
Das internationale Geschäft mit Schmuggel und illegal ausgegrabenen Antiken
Ein Museum vor Gericht
Geheimes Antiquitätennetzwerk
Kriegsbeute aus den Museen
Weltweiter Handel
Kein Freispruch für den Handel
Nur 2,1 Prozent unbedenklich
Goldhut ohne Herkunft
Zerstörung der Geschichte
Wenn der Staat mit Raubgut handelt
Behörden sahen keinen Gesetzesverstoß
Kapitel 4 Wenn Diktatoren sammeln
Der Kunstmarkt, die internationale Kleptokratie und die Moral
Verräterische Rechnung
Falsche Altmeistergemälde
Geschäfte mit dem Waffenhändler
Rückkehr mit den gestohlenen Schätzen
Wie verkauft man einen 35-Millionen-Monet?
Zweite Karriere der Diktatorengattin
Die anderen
Kapitel 5 Kunstanlage als Betrug
Helge Achenbach und die Aldi-Connection
Der Menschenfänger und die Korruption
Gefälschte Rechnungen für Kokoschka, Picasso und Lichtenstein
Kunst als Anlageklasse
Der Pharmaunternehmer und die Kunst des Schreibens von falschen Rechnungen
Von der Ersten Klasse in die Zelle
Der Prozess
Das Urteil
Neuanfang eines Narzissten
Kapitel 6 Schmutziges Geld und saubere Kunst
Van Gogh im Keller, Basquiat in der Kiste – wie der Kunstmarkt der internationalen Geldwäsche dient
14 Milliarden Schulden
»Kunst ist attraktiv für Geldwäsche«
Picasso, Matisse und Damien Hirst
Verkäufe über Panama
Undurchsichtige Transaktionen
Kunst einkaufen wie Herr Low
Geld stammt nicht aus Familienvermögen
Die Geheimnisse des Marktes
Fehlendes Bewusstsein
Profiteurin: die organisierte Kriminalität
Die Hollywood-Connection
Marlon Brandos Oscar
Ein Prozent für Deutschland
Widerstand gegen mehr Kontrolle
Gesellschaftlicher Schaden
Freihäfen – die Dark Rooms des globalen Kunstbetriebs
Geschichte der Freihäfen
Antiken aus Raubgrabungen und NS-Raubkunst im Genfer Freilager
Der König der Freihäfen: Yves Bouvier
Bouviers Off-Shore-Firma und die Beltracchi-Fälschung
Festnahme in Monaco
Die Geschichte des Salvator Mundi: ein Kunstwrack für 450 Millionen Dollar
Ein titanischer Rechtsstreit auf drei Kontinenten
Verlorene Bilder von Picassos Stieftochter
Das Schicksal einer Milliarden-Sammlung
Und die Konsequenzen?
Zehn Fragen zu Kunst und Verbrechen
Zehn Fragen zur Befreiung der Kunst
Dank
Licht und Schatten – ein Vorwort
Der internationale Kunstmarkt zwischen New York und Peking, London und Moskau, Berlin und Monaco hat zwei Seiten – eine helle und eine dunkle. Beide sind das Ergebnis einer Entwicklung der vergangenen zwei Jahrzehnte in Galerien, Auktionshäusern und dem Internet, in denen die Preise für Gemälde und Plastiken geradezu explodiert sind: 250 Millionen Dollar für Paul Cézannes Kartenspieler aus einer Privatsammlung in Genf, 300 Millionen Dollar für Paul Gauguins Tahiti-Bild Nafea Faa Ipoipo, 157 Millionen bei einer Auktion in New York für einen Liegenden Akt von Amedeo Modigliani, 141 Millionen für Alberto Giacomettis Skulptur L’homme au doigt – und natürlich die schon legendären 450 Millionen Dollar, die ein muslimischer Staatschef im November 2017 bei Christie’s im Rockefeller Center an der Fifth Avenue für das Christusbild Salvator Mundi bezahlt hat – obwohl sich die Experten bis heute nicht darüber einig sind, ob die kleine Holztafel tatsächlich maßgeblich von Leonardo da Vinci bemalt worden ist. Insgesamt werden am internationalen Kunstmarkt laut TEFAF Global Art Market Report weltweit jährlich mehr als 60 Milliarden Dollar umgesetzt.
Und das sind nur die Preise, die an die Öffentlichkeit gedrungen sind – auf der hellen Seite des Marktes. Hier gibt es vornehme Auktionshäuser, die ihren Kundinnen und Kunden inzwischen Beratungsangebote machen, die denen der großen Investmentbanken in nichts nachstehen – selbstverständlich diskret und wenn es sein muss, auch über Off-Shore-Firmen in Steuerparadiesen, wie der Fall des geplünderten malaysischen Staatsfonds 1MDB zeigt. Von den Hunderten Millionen Dollar, die hier einer ganzen Nation gestohlen wurden, haben die Beteiligten unter anderem Kunstwerke von Pablo Picasso und Vincent van Gogh ersteigert. Die Geschäftsräume international agierender Großgalerien sehen wie Luxusboutiquen exklusiver Modehäuser aus – und sie haben auch genau diesen Anspruch: Hier wird für Millionenbeträge nicht Kulturgut, hier werden Lifestyle und Sozialprestige verkauft. Wer bei der nächsten Party im New Yorker Meatpacking District ein marktfrisches Bild von Jeff Koons an der Wand hängen hat, ist nicht nur reich: Er oder sie gehört nicht nur zu einer kleinen globalen Klasse von Wohlhabenden, deren Reichtum seit vielen Jahren extrem wächst, sondern auch zur vermeintlichen globalen Kulturelite, zu der man sich über Kunst den Zugang erkaufen kann.
Wer es sich leisten kann, bezahlt dafür einen »Art Advisor«, der gegen üppige finanzielle Entlohnung die Suche nach passenden Werken übernimmt – und praktischerweise auch gleich erklären kann, welche Künstlerinnen und Künstler in der aktuellen Saison gerade angesagt sind und was ihre Arbeiten wollen. Dass auch dieser Ansatz schiefgehen kann – weil Vereinbarungen nicht eingehalten werden und Künstler mit großen Namen wie Picasso, Kirchner oder Lichtenstein auch schlechte Bilder gemalt haben –, wurde im spektakulären Fall des Kunstberaters Helge Achenbach deutlich. »Der Eintritt der Investmentbanker, Börsenspekulanten und Broker in den Kunstmarkt führte zu einer kompletten Verrohung«, sagte er 2019 in einem Interview[1]: »An der Börse ist alles kontrolliert. Wenn du mit Insiderinformationen Aktien kaufst, dann steht sofort die Aufsichtsbehörde vor deiner Tür und nimmt dich fest. Der Kunstmarkt ist leichter zu manipulieren.« Achenbach weiß, wovon er redet: Bevor er 2015 wegen millionenschweren Betrugs bei Kunstgeschäften zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde, hatte er als Kunstberater mit Banken zusammengearbeitet und versucht, einen Kunstfonds anzubieten.
Die dunkle Seite des Marktes
Das nämlich ist die andere, die dunkle Seite des lukrativen Geschäfts mit der Kunst: Wo so viel Geld zu verdienen ist wie am Kunstmarkt, sind schnell auch die vor Ort, die auf fragwürdige Weise beim großen Spiel mitmachen wollen.
Da wird dann in einer Villa im Rheinland eine ganze Sammlung angeblicher Russischer Avantgarde-Kunst mithilfe eines selbst gedruckten Katalogs angeboten, auf dessen Umschlag das Logo eines Internet-Fotobuchherstellers prangt. Und einen westdeutschen Unternehmer hält das ebenso wenig von teuren Käufen ab wie der Umstand, dass die mitgelieferten Expertisen mindestens Anlass zu Fragen gegeben hätten.
Da gibt es eine andere Expertin, die das Werkverzeichnis für einen der gesuchtesten und teuersten europäischen Künstler der Klassischen Moderne führt – und offenbar ganz selbstverständlich von einem deutschen Auktionshaus eine laut unabhängigem Prüfbericht inhaltlich nicht begründbare Provisionszahlung in Höhe von 91000 Euro annimmt.
Und da findet ein Sachverständiger, der seit vielen Jahren naturwissenschaftliche Gutachten zu Kunstwerken erstellt, offenbar nichts merkwürdig daran, dass ihm auf Leinwand gemalte Kunstwerke, die eigentlich mehrere Millionen Dollar wert sein sollten, wie Poster in Rollen von Kurierdiensten ins Haus geschickt werden. Jedes Museum, jeder seriöse Kunsthandel würde solche Bilder selbstverständlich gerahmt und in hochsensiblen Klimakisten von Fachspeditionen transportieren lassen.
All das ist Folge der rasanten Entwicklung des Kunstmarktes im 21. Jahrhundert, über die schon viel gesagt und geschrieben wurde: über Hedgefonds-Milliardäre in Manhattan und auf Long Island, die das Kunstsammeln praktischerweise gleichzeitig zu ihrem Hobby und zum lohnenden Investment machten. Über immer neue Preisrekorde, über Kunst als neues Statussymbol der Superreichen, über neue Käufer- und Verkäufermärkte in Hongkong, Indien, Russland und Südamerika, über steigende Nachfrage und sinkendes Angebot durch leer gefegte Märkte.
Dass die sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte aber vor allem dazu geführt haben, dass Kunstwerke zu Investments geworden sind, und welche Folgen das für den seriösen Umgang mit diesen Kulturgütern hat, ist bislang kaum systematisch untersucht worden. Für diese Entwicklung, die niemand mehr ernsthaft leugnen kann, gibt es eine Reihe von Gründen, die – zusammen mit ihren Folgen – dieses Buch an konkreten Beispielen beschreibt.
Nach wie vor ist der Kunstmarkt einer der zugleich globalisiertesten wie intransparentesten Märkte der Welt. Wechselt ein Werk von Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Alberto Giacometti oder Jackson Pollock den Besitzer, erfahren davon meist nur die wenigen direkt Beteiligten. Wie der Preis zustande kam, von wem er an wen gezahlt wurde, welche Mittelsleute oder Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen beteiligt waren, wird in aller Regel nicht bekannt.
Nach wie vor beansprucht der Kunstmarkt für sich Sonderrechte, die wie vor über hundert Jahren mit der Einzigartigkeit der gehandelten Ware begründet werden. Während Bargeldtransfers ab einer relativ geringen Höhe ebenso wie Immobiliengeschäfte meldepflichtig sind, stellen Kunstwerke unter bestimmten Voraussetzungen nach wie vor eine Möglichkeit dar, Gewinne aus illegalen Geschäften wie Erpressung oder Drogenhandel in den legalen Geldkreislauf einfließen zu lassen.
Und der Kunsthandel ist die reinste Form der Marktwirtschaft. Bei der Ware handelt es sich – jedenfalls im hochpreisigen Bereich – um Unikate, deren Wert objektiv nicht bestimmt werden kann. Der Preis eines Gemäldes von Rembrandt, Roy Lichtenstein oder Gerhard Richter wird nicht nach Gewicht, verwendetem Material und unter Umständen nicht einmal nach der Größe festgelegt. Es sind allein Angebot und Nachfrage, die schließlich zu einem Preis führen: Eine Künstlerin, ein Händler oder eine Sammlerin muss bereit sein, sich von einem Kunstwerk zu trennen. Und ein anderer Sammler – oder besser noch zwei – müssen dieses Werk unbedingt haben wollen. Wenn dann sehr wenige Menschen sehr viel Geld besitzen und bereit sind, es für Kunst auszugeben – sei es aus Leidenschaft, Kennerschaft, Prestigegründen oder als Investment –, ist zurzeit jeder noch so hohe Preis denkbar. Und es sieht nicht so aus, als würde sich daran bald etwas ändern.
Kein Generalverdacht
Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Betrug mithilfe von Kunst, Folgen der Globalisierung, die Verbindung zwischen Kunstdelikten und Clankriminalität, Fälschungen in großen und kleinen Galerien, die geheimen Bilderverstecke in abgeschirmten, steuerbefreiten Zollfreilagern, der zweifelhafte Markt für echte und falsche Relikte aus der Zeit des Nationalsozialismus und Geschäfte mit gestohlenen und gefälschten Büchern, die erst durch die Möglichkeiten der Digitalisierung lukrativ geworden sind: Das sind einige der Themen dieses Buches. Es will nicht eine ganze Branche unter Generalverdacht stellen. Der überwiegende Teil des Kunsthandels agiert seriös, hält sich an Vorschriften und Regeln und setzt sich leidenschaftlich für die Sache der Kunst ein.
Das Interesse dieser Unternehmen müsste aber viel stärker als bisher sein, die schwarzen Schafe der Branche zu benennen, ihre Aktivitäten aufzudecken, zu beenden und für die Zukunft zu verhindern. Ein seltsamer Corpsgeist, wie er aus manchen Verbandspapieren zu sprechen scheint, das Beharren auf überkommenen Traditionen wie Handschlaggeschäfte, Anonymisierung von Geschäftspartnern oder einem angeblichen branchenspezifischen Geschäftsgeheimnis wirkt nicht nur zweifelhaft. All dies schadet dem gesamten Markt und hat im Zeitalter der Digitalisierung und der weltweiten Vernetzung von Daten auch international keine Zukunft. Statt trotzig auf in Wahrheit längst Vergangenem zu beharren, statt hier die konstruktive Mitarbeit zu verweigern und immer wieder für Gutachten mit vermeintlichen Gegenargumenten zu bezahlen, wäre es so viel sinnvoller, genau diese Zukunft der Branche aktiv mitzugestalten.
Die Verbindung von Kunst und Verbrechen, für die in den folgenden Kapiteln einige besonders aufsehenerregende Beispiele beschrieben werden, betrifft aber bei Weitem nicht nur den Kunsthandel. Auch Museen auf der ganzen Welt müssen sich mit dem Thema befassen, weil sie – wie der Fall der gestohlenen Berliner 100-Kilo-Goldmünze und der Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden zeigen – immer noch viel zu schlecht gesichert sind, technisch wie personell. Sogenannte »Inside Jobs« – Diebstähle, an denen das häufig von Fremdfirmen gestellte und viel zu schlecht bezahlte Hilfspersonal beteiligt war – gab es in der jüngeren Vergangenheit unter anderem in Rotterdam, Paris, Amsterdam, Istanbul, Kairo und möglicherweise in London.
Im Sommer 2006 wurde bekannt, dass aus der Russischen Abteilung der Eremitage in St. Petersburg 221 Objekte vermisst werden – vor allem Ikonen und Emailarbeiten aus dem 15. bis 18. Jahrhundert in einem geschätzten Gesamtwert von rund vier Millionen Euro. Man vermutet, dass sie Richtung Fernost und nach Südamerika verschwunden sind. Nach Recherchen der Moskauer Online-Tageszeitung Gaseta sind aus russischen Museen seit der wirtschaftlichen Öffnung des Landes 1990 angeblich insgesamt mehr als 50 Millionen Kunstgegenstände gestohlen worden, darunter 3,4 Millionen Gemälde und 37000 Ikonen. Den Gesamtwert der Werke aus ehemals russischem Museumsbesitz auf dem grauen Markt schätzt das Blatt auf mehr als eine Milliarde Dollar. Auch in vielen Bibliotheken, Archiven und Grafikabteilungen von Museen sind die Bestände nicht einmal inventarisiert, geschweige denn digitalisiert. Wenn – wie in Neapel geschehen – wertvolle Bücher gestohlen oder aus Folianten Illustrationen und frühe Landkarten herausgeschnitten werden, fällt das noch nicht einmal auf. Solange die privaten wie öffentlichen Träger von Kultureinrichtungen nicht bereit sind, auch für die Sicherheit der Bestände zu sorgen, wird sich an diesen Verhältnissen auch nichts ändern.
Globalisierung der Fälschung
Wie international die Täterinnen und Täter auch im Bereich Kunstfälschungen inzwischen vernetzt, wie global die Wege sind, die ihre Fakes innerhalb kürzester Zeit nehmen können, zeigten zwei spektakuläre Fälschungsfälle: Die New Yorker Galerie Knoedler hatte zwischen 1994 und 2011 Werke von weltberühmten und entsprechend teuer gehandelten Künstlern wie Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Barnett Newman, Clyfford Still und Franz Kline verkauft, die sich später als Fälschungen herausgestellt haben. Involviert waren ein spanischer Kunsthändler, Sammler aus Italien und Belgien und ein in New York lebender Maler aus China – der einer Festnahme durch die Ausreise in die Heimat zuvorkam.
Schließlich sind da die verschiedenen Altmeister-Gemälde, die in den vergangenen Jahren über Frankreich und Italien auf den Markt kamen und sich nach und nach als nicht authentisch herausstellten. Wegen der aufwendigen Beschaffung von Holz oder Leinwand als Malgrund, den passenden Pigmenten und Bindemitteln und den Alterungsspuren, die jahrhundertealte Bilder aufweisen müssen, gelten sie im Vergleich zu den Werken der Klassischen Moderne als deutlich schwerer zu kopieren. Vielleicht auch deshalb gelangte ein angebliches Herrenbildnis des gesuchten niederländischen Malers Frans Hals ohne allzu kritische Nachfragen über einen britischen Kunsthändler und einen 2011 von Sotheby’s vermittelten Privatverkauf für 11,2 Millionen Dollar an einen Sammler. Expertinnen und Experten des Louvre in Paris und der königlichen Kunstsammlungen im Mauritshuis in Den Haag hatten das Bildnis vorher als eigenhändiges Meisterwerk bestätigt. Als sich nach Materialuntersuchungen herausstellte, dass es das nicht war, gab der Käufer, ein US-Immobilienunternehmer und Kunstsammler aus Seattle, das Gemälde zurück. Der Händler hatte es gemeinsam mit einer Londoner Firma erworben und 3,2 Millionen Dollar dafür bezahlt – an den französischen Händler Giuliano Ruffini. Seither stehen einige weitere Gemälde, die dieser verkauft hat, unter Fälschungsverdacht: Ein dem Umkreis von Parmigianino zugeschriebener und auf 1527 datierter Heiliger Hieronymus hing eine Zeit lang im New Yorker Metropolitan Museum of Art – und enthält das erst 1938 auf den Markt gekommene Pigment Phtalocyaningrün. Bei einer Auktion 2012 in New York erzielte er 842000 Dollar. Eine angeblich 1531 von Lucas Cranach gemalte Venus mit dem Schleier hatte der Regent Hans-Adam Prinz von Liechtenstein für sieben Millionen Euro bei der Galerie Bernheimer erworben. Es wurde im März 2015 im französischen Aix-en-Provence als Fälschung beschlagnahmt; die französischen Gesetze lassen so etwas zu. Im September 2019 wurde ein mit Ruffini verbundener Maler aus Norditalien kurzfristig verhaftet, angeblich wurde auch gegen den Händler selbst ein Haftbefehl in Frankreich erlassen; beide beteuern ihre Unschuld, ein Gericht soll über die Auslieferung von Italien nach Frankreich entscheiden. Dem französischen Fälschungsexperten Vincent Noce sagte Ruffini, dass die Zuschreibungen zu den jeweiligen Malern nie durch ihn erfolgt seien: Er sei nur ein Sammler, kein Experte. Alle von ihm verkauften Bilder seien erst von Experten und Kuratoren den jeweiligen Künstlern zugeschrieben worden. Der Verteidiger des Malers wiederum sagte vor Gericht, sein Mandant sei nur durch eine Leihgabe an ein Museum fälschlicherweise in den Skandal hineingezogen worden.[2]
Es ist aufschlussreich, nicht nur hier endlich auch einmal die internationalen Verflechtungen zu untersuchen: Auch die Kopien und Nachempfindungen, die der Fälscher Wolfgang Beltracchi jahrelang unerkannt verkaufen konnte, fanden sich in Privatsammlungen in den USA und in Ausstellungen in Frankreich. Die Expertisen stammten von Expertinnen und Experten aus ganz Europa. Und es gibt den Fall der Wiesbadener SNZ Galeries, in dem Spuren nach Israel, Großbritannien und Russland führen.
Außerdem sind da noch jene, die Spuren aufnehmen, die ins Spiel kommen, wenn das Verbrechen geschehen ist. Italien beispielsweise verfügt über eine hocheffektive Spezialabteilung, die Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (CTPC), die allein 2016 gestohlene Werke im Wert von 53 Millionen Euro wiedergefunden hat. Das Generalsekretariat von Interpol in Lyon sammelt Informationen zu Kunstdelikten aus allen Mitgliedsländern und veröffentlicht sie in einer Internet-Datenbank, die nach Anmeldung allgemein zugänglich ist. In den Vereinigten Staaten ist neben den Strafverfolgungsbehörden auch das Holocaust Claims Processing Office der Bankenaufsicht an der Suche nach gestohlener Kunst beteiligt. Und in Großbritannien gibt es nach wie vor die einst legendäre, inzwischen nach zahlreichen Reformen nicht mehr ganz so schlagkräftige Art and Antiques Unit, die schon an der Suche nach dem 1961 aus der Nationalgalerie gestohlenen Goya-Porträt des Duke of Wellington beteiligt war. Der Fall sorgte damals für so großes Aufsehen, dass er im Jahr darauf Eingang in den ersten James-Bond-Film Dr. No fand. Und er stand früh für das sogenannte »Artnapping«, den Versuch, gestohlene Kunst gegen Lösegeld zurückzugeben, der sich in kriminellen Kreisen seit einigen Jahren steigender Beliebtheit erfreut – weil beteiligte Versicherungsunternehmen in der Vergangenheit durchaus zahlungswillig waren. Auch auf diesen Aspekt geht dieses Buch ein.
Bei den deutschen Ermittlungsbehörden sind Fachabteilungen für Kunstkriminalität nach wie vor die Ausnahme. In gerade einmal drei Landeskriminalämtern und im Bundeskriminalamt gibt es sie überhaupt. Die Arbeit der speziell geschulten Ermittlerinnen und Ermittler dort, die immer den Schutz und das Bewahren von Kulturgut zum Ziel hat, endet allerdings nicht selten dann, wenn aus den Ermittlungen eine Anklage und dann ein Urteil werden soll. Häufig scheuen – das haben Fälle wie der Prozess gegen die Eigentümer der SNZ Galeries in Wiesbaden oder gegen den Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi in Köln gezeigt – die Kammern Mühe oder haben spürbar wenig Interesse, tief in die Materie einzusteigen. Verfahren, in denen es um Hunderte oder Tausende von mutmaßlich gestohlenen oder gefälschten Kunstwerken gehen müsste, werden auf eine Handvoll reduziert – um den Prozess allein zeitlich nicht ausufern zu lassen. Und selbst dann gibt es häufig sogenannte »Verständigungen«: Deals zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung, die nichts anderes besagen als Strafminderung gegen Geständnis. Kriminelle Strukturen, internationale Verflechtungen, das System »Kunst und Verbrechen« werden auf diese Weise immer wieder auf singuläre Einzelfälle reduziert. Ihren gesellschaftlichen und ökonomischen und vor allem globalen Strukturen will man offenbar nicht auf den Grund gehen.
Die Kunst als Geisel
Meist sind es einzelne Expertinnen, Rechtsanwälte, Galeristen, Auktionatorinnen oder Ermittler, die sich gegen große Widerstände und teilweise sogar unter persönlicher Gefahr für die Kunst einsetzen und die Betrüger und Fälscher entlarven. Betroffen sind von den Verbrechen, die in diesem Buch beschrieben werden, nicht nur Milliardäre aus Monaco und Long Island, sondern auch normalverdienende Angestellte aus Oberbayern. Manche Opfer stört die Tatsache, dass sie eine Fälschung gekauft haben, nicht weiter. Andere werden durch einen solchen Betrug in ihrer Existenz bedroht. Verliererin ist aber in jedem Fall immer die Kunst. Sie wird als Geisel genommen, in modernen Räuberhöhlen versteckt, durch Fälschungen beschmutzt.
Deshalb wäre über das Thema »Kunst und Verbrechen« noch viel mehr zu sagen und zu erzählen. Über jene Sammler zum Beispiel, deren Kollektionen mit Geld gekauft wurden, das aus mehr als fragwürdigen Geschäften stammte. Griechische Reeder etwa, deren Familien heute noch einige der weltweit bedeutendsten Sammlungen von impressionistischen und postimpressionistischen Werken besitzen, arbeitete eng mit dem faschistischen Obristenregime in seiner Heimat zusammen. Hauptwerke daraus von van Gogh, Picasso und anderen Klassikern der Kunstgeschichte sind seit Langem zum Beispiel im Kunsthaus Zürich zu sehen – mit Schildern, auf denen nur diskret »Privatsammlung« steht. Die Sammlung Thyssen-Bornemisza, die seit 1992 in einem eigenen Museum in Madrid gezeigt wird, stammt aus einer Unternehmerfamilie, die auch durch Rüstungsgeschäfte mit den Nationalsozialisten reich geworden ist. Und der Rechtsanwalt und Finanztreuhänder Herbert Batliner, der im Juni 2019 in seiner Heimat Liechtenstein gestorben ist, verwaltete nicht nur das Vermögen von zahlreichen Unternehmerinnen und Unternehmern, gegen die wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe ermittelt wurde. Zu seinen Kunden zählten auch der US-Rohstoffhändler Marc R., der illegale Geschäfte mit dem Irak abgewickelt haben soll, das nicht eben demokratisch agierende saudische Königshaus, der togolesische Diktator Eyadéma und diverse deutsche CDU-Politiker, die über das Büro Batliner und die »Stiftung Zaunkönig« unter anderem schwarze Parteikassen im Rahmen der hessischen Spendenaffäre organisierten. Auch ein Drogenboss aus Ecuador, ließ Ermittlungsunterlagen zufolge durch seine Ehefrau bei Batliner vier Stiftungen einrichten. Er wurde inzwischen verhaftet und des Drogenschmuggels, der Geldwäsche, der Steuerhinterziehung und der Ermordung eines Richters überführt. Nach Herbert Batliner und seiner Sammlung ist ein ganzer Flügel im Wiener Museum Albertina benannt, dem er Kunstwerke stiftete. Darunter befinden sich auch sieben Werke der Russischen Avantgarde – die meisten in derselben Galerie in der Schweiz gekauft –, bei denen es sich nach Auskunft des Museums um Fälschungen handelt. Manchmal schließen sich Kreise.
Dieser Band konzentriert sich auf Verbrechen, die vor Augen führen, wie weit in der Kunstwelt Anspruch und Wirklichkeit oft auseinanderklaffen. Dass um das Gute, Schöne, Wahre häufig mit schmutzigen Methoden gekämpft wird. Dass oft nur noch der materielle und nicht mehr der ästhetische oder aufklärerische Wert im Vordergrund steht, wenn über Kunst gesprochen wird. Es will anhand von ausgewählten Fällen und beispielhaften Figuren versuchen, strukturelle Probleme der Kunst mit dem Verbrechen aufzuklären – und so auch eine Analyse liefern, was heute im System Kunstmarkt und Kunstbetrieb falsch läuft. Nur wer die Notwendigkeit einer solchen Analyse nicht verweigert, kann ernsthaft dazu beitragen, dass der Blick auf die Kunst selbst wieder frei wird.
Dezember 2019
Stefan Koldehoff / Tobias Timm
Kapitel 1Gestohlen, geraubt, entführt
Von legendären Museumsdiebstählen, Artnapping und einer 100-Kilo-Münze aus purem Gold
Das Verschwinden der Mona Lisa
Museen wurden als Tempel für die Kunst gebaut – und mussten immer auch als deren Tresore dienen. Die Erzählungen von den großen Einbrüchen, Raubzügen und »art heists« in diesen Tempeltresoren sind Stoff für Legenden. Leonardo da Vincis Mona Lisa etwa wurde erst so richtig berühmt, nachdem sie im August 1911 aus dem Louvre gestohlen worden war.
Der Diebstahl war damals ein Inside-Job: Vincenzo Peruggia, ein italienischer Anstreicher, der im Museum als Glaser gearbeitet hatte und deshalb die Sicherheitsvorkehrungen kannte, ließ sich an einem Sonntagnachmittag mit zwei Kumpanen im Louvre einsperren. Die drei versteckten sich in einer kleinen Kammer, in denen Kopisten normalerweise ihre Malutensilien lagerten. Am Montagmorgen, als der Louvre für Besucher geschlossen war, betraten die drei Männer in weißen Kitteln den Salon Carré, nahmen die Mona Lisa einfach von der Wand und verschwanden mit ihr durch einen Seiteneingang. In ihren Kitteln fielen sie zwischen den Angestellten, die montags das Museum reinigten, nicht weiter auf.
Zwei Jahre lang blieb das Bild verschollen. Die Polizei fahndete, Privatdetektive versuchten, seinen Verbleib zu klären. Pablo Picasso und Guillaume Apollinaire wurden als Diebe verdächtigt, verhört – und wieder freigelassen. Eine französische Zeitung setzte schließlich sogar eine Belohnung von 5000 Franc für Hellseher aus. Die Mona Lisa aber blieb verschwunden.
Wer hinter dem Diebstahl steckte, blieb lange Zeit unbekannt. Die Medien glaubten die Geschichte, die der Dieb später erzählte: Er habe das Bild aus patriotischen Gründen gestohlen – um es nach Italien zurückzubringen, wo es schließlich hingehöre. Tatsächlich aber handelte Peruggia auf Anweisung. Der Mann, der ihn und seine Komplizen Vincenzo und Michele Lancelotti beauftragt und bezahlt hatte, war der gebürtige Argentinier Eduardo de Valfierno. Über diesen Auftraggeber, der sich »Marqués« nennen ließ, ist bis heute kaum etwas bekannt.
Zwei, drei, sechs Mona Lisas
Valfierno hat das Bild, das er aus dem Louvre stehlen ließ, nie wirklich interessiert. Was der Mann hinter dem größten Kunstcoup vor dem Krieg wollte, war nicht das berühmteste Gemälde der Welt, sondern nur die Schlagzeilen, die weltweit bewiesen, dass er es theoretisch haben könnte. Geboren in Buenos Aires, lebte der Sohn wohlhabender Eltern eine Zeit lang davon, jene Kunstgegenstände zu verkaufen, die er von seinen zahlreichen Verwandten geerbt hatte. Irgendwann aber begann er dann damit, Gemälde auf Bestellung zu beschaffen – ganz gleich, wem sie eigentlich gehörten. Oft erhielten seine Kunden dabei allerdings keine Originale; Valfierno verkaufte ihnen, ohne dass die es bemerkten, einfach Kopien, die der Restaurator Yves Chaudron für ihn angefertigt hatte.
In Buenos Aires unterhielten die beiden eine regelrechte Werkstatt für gefälschte Murillo-Gemälde. Der einzige Journalist, der es je schaffte, ein Interview mit Valfierno zu bekommen, war der Amerikaner Karl Decker. Ihm erzählte der Marqués, es gebe durch seine Aktivitäten in Argentinien inzwischen mehr Murillos als Kühe: »Ich habe dieses Land ungemein bereichert.« Selbst wenn seine Kunden den Betrug bemerkten, bestand für Valfierno kein Risiko: Niemand, der einen Kunstraub in Auftrag gegeben hatte, würde ihn dafür schließlich anzeigen.
Und genauso verfuhr Valfierno auch mit dem berühmtesten Gemälde der Welt. Er bot die Mona Lisa schon vor dem Diebstahl gleich mehreren Sammlern an, von denen die meisten in den USA lebten, und ließ Chaudrons Fälschungen einzeln als Amateurkopien in die USA schaffen. Als dann die Schlagzeilen vom Raub der Mona Lisa kamen, verkaufte er dort seinen verschiedenen Kunden insgesamt sechs Kopien des Bildes, die Yves Chaudron bereits ab dem Winter 1910, also schon vor dem Diebstahl, wahrscheinlich im Louvre zu malen begonnen hatte, jeweils als Original und kassierte dafür angeblich je 300000 Dollar – nach heutigem Kurs rund 40 Millionen Euro. Die echte Mona Lisa hatte Paris nie verlassen. Sie befand sich nach wie vor knapp fünf Kilometer vom Louvre entfernt bei Vincenzo Peruggia.
Valfierno genoss nach dem gelungenen Coup seinen Reichtum unter anderem in Nordafrika und im Nahen Osten. Als Karl Decker ihn zum Interview in Casablanca traf, beschrieb er den Argentinier als groß gewachsenen Mann mit weißer Löwenmähne und elegantem weißem Schnurrbart. »Die Mona Lisa zu stehlen«, erzählte Valfierno dort, »war so einfach, wie ein Ei zu kochen. Alles war eine Frage der Psychologie. Unser Erfolg hing von einer Sache ab: der Tatsache, dass ein Arbeiter in einem weißen Kittel im Louvre so unverdächtig ist wie ein ungelegtes Ei.« Als allerdings der Mann, der für Valfierno den weißen Kittel trug, auch zwei Jahre nach dem Coup gar nichts mehr von seinem Auftraggeber hörte, glaubte er zunächst an ein Versehen, dann an Tarnung – und begann schließlich, seine eigenen Pläne zu schmieden.
Peruggia fuhr mit dem Bild nach Florenz, bot es über einen Galeristen dem Direktor der Uffizien an und wurde bei der Übergabe am 12. Dezember 1913 verhaftet. In seinem Heimatland wurde er zu einer erstaunlich niedrigen Strafe von einem Jahr und zwei Wochen Gefängnis verurteilt, nachdem ihm ein Psychiater »intellektuelle Defekte« attestiert hatte. Der Berufungsrichter setzte diese Strafe auf sieben Monate herab – diese Zeit hatte der Angeklagte allerdings vor Prozessbeginn schon in Untersuchungshaft gesessen. Am 29. Juli 1914 war Peruggia deshalb wieder ein freier Mann. Bei der Rückkehr in seine italienische Heimat wurde er als Nationalheld gefeiert.
Eduardo de Valfierno starb 1931, ohne jemals für den von ihm in Auftrag gegebenen Diebstahl der Mona Lisa belangt worden zu sein. Der »Marqués« hatte seine Spuren geschickt verwischt, Peruggia kannte nicht einmal seinen wahren Namen. Erst nach dem Tod des Argentiniers durfte Karl Decker die Gespräche veröffentlichen, die er mit Valfierno geführt hatte.
Mit abgesägtem Gewehr ins Munch-Museum
Der Klau der Mona Lisa gilt bis heute als der Kunstdiebstahl des Jahrhunderts. Das Verbrechen, das dem kleinen Arbeiter Peruggia und seinen Komplizen in einem der größten Museen der Welt gelungen war, der kriminelle Kampf des italienischen David gegen den französischen Goliath, hat allerdings mit heutiger Kunstkriminalität nicht mehr viel gemein. Die drei Gentleman-Täter hatten vorher genau ausgekundschaftet, wo sie sich verstecken konnten, welche Wege sie nehmen mussten, um die Mona Lisa zu klauen. Sie trugen keine Waffen bei sich, und niemand wurde verletzt. Ein mit schusssicherem Doppelglas gesicherter Klimatresor schützt inzwischen das Bild, dem sich die Museumsbesucher nur bis auf einen Sicherheitsabstand nähern dürfen.
Heute sind Kunstdiebe nämlich meist professionelle Kriminelle, die brutal und rücksichtslos ihr Ziel verfolgen und damit nach Schätzungen jährlich einen weltweiten Schaden von einigen Milliarden Dollar anrichten. Die Gewalt, mit der sie dabei vorgehen, hat in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten kontinuierlich zugenommen. Als etwa 2004 eine Gruppe unbekannter Täter zwei Gemälde von Edvard Munch aus dem Munch-Museum in Oslo raubte, kam sie während der regulären Öffnungszeiten. Die maskierten Männer bedrohten die Besucher des Museums mit abgesägten Gewehren und riskierten dabei Verletzte oder sogar Tote.
Viele Täter scheitern allerdings dabei, ihre wertvolle Beute wieder loszuwerden. Durch vernetzte Polizeibehörden, vor allem aber durch elektronische Datenbanken, zu denen auch Auktionshäuser, Kunsthändler und Museen Zugang haben, ist heutzutage jeder Kunstkäufer innerhalb kürzester Zeit in der Lage festzustellen, ob das ihm angebotene Werk sauber ist oder ob es sich um heiße Ware handelt, die er selbst nie wieder loswerden würde.
Der Diebstahl aus Museen dient deshalb heute kaum noch dem Zweck, sich der Kunst ihrer selbst wegen zu bemächtigen. Die geraubten und gestohlenen Werke dienen vielmehr als Objekte der Erpressung von Versicherungen und Sammlungen. Andere Diebe wiederum sind nur noch an dem reinen Material der Objekte interessiert, an der Bronze von Skulpturen oder dem Gold von Münzen und Kunstwerken, die sich leicht einschmelzen und weiterverkaufen lassen. Denn nicht nur die Preise der Kunst sind in den vergangenen Jahren rapide gestiegen, sondern auch die von seltenen Metallen.
Artnapping – Erpressung mit Kunst
Der brutale Überfall auf das inzwischen geschlossene Privatmuseum der Stiftung Sammlung Bührle in Zürich, bei dem im Februar 2008 während der Öffnungszeiten wertvolle Hauptwerke von Cézanne, van Gogh, Monet und Degas im Schätzwert von 180 Millionen gestohlen wurden, gilt als bis dahin größter Kunstraub Europas. Vier Jahre später wurde Cézannes Knabe mit der roten Weste in Belgrad sichergestellt. Kurz darauf gab die Staatsanwaltschaft Zürich bekannt, dass ein weiteres Gemälde, Degas’ Darstellung des Comte Lepic mit seinen beiden Töchtern, schon einige Monate vorher ins Museum zurückgekehrt sei. Ob dafür ein Finderlohn oder Lösegeld gezahlt wurde, ist nicht bekannt.
Brutalisierung: Mit gezogenen Waffen stürmten Unbekannte 2008 das Privatmuseum der Stiftung Sammlung Bührle in Zürich. Die Bilder tauchten später in Serbien wieder auf. © Marko Djurica/picture alliance/REUTERS
Auch die Spur der sieben Gemälde von Freud, Gauguin, Mejer de Haan, Matisse, Monet und Picasso aus dem Besitz der niederländischen Unternehmerfamilie Cordia, die im Oktober 2012 nachts aus der Kunsthal Rotterdam gestohlen wurden, führte auf den Balkan. Der Fall endete allerdings nicht so glimpflich: Die Mutter des Hauptverdächtigen, Radu D., verbrannte angeblich alle Werke aus Angst, ihr Sohn könne überführt werden. Bis auf einige Aschereste in einem Ofen gibt es dafür allerdings keine Beweise. Angeblich soll es auch hier Versuche gegeben haben, die Beute an die Eigentümer zurückzuverkaufen. Im Februar war es dann allerdings ein Versicherungskonsortium, das für den Verlust 18,1 Millionen Euro auszuzahlen hatte.
Das Geschäft mit dem Artnapping ist lukrativ. Der geheimnisvolle unbekannte Millionär, der Kunstdiebstähle in Auftrag gibt, um die Werke im geheimen Keller anzuschauen, existiert nach Meinung der meisten Kunstfahnder nicht. Jedenfalls wurde seit Jahrzehnten weltweit kein Einziger dingfest gemacht. Nicht nach den beiden Überfällen, bei denen in den letzten Stunden des Jahres 2009 in Südfrankreich gleich 30 wertvolle Kunstwerke von Degas, Picasso, Rousseau und anderen Klassikern der Moderne gestohlen und nie wieder gesehen wurden. Nicht nach dem Diebstahl von zwei Picasso-Gemälden aus dem Besitz des Sprengel-Museums in Hannover, die 2008 aus einer Ausstellung in Pfäffikon verschwanden. Nicht, nachdem Vjeran T. 2010 Werke von Picasso, Braque und Matisse aus dem Museum für Moderne Kunst in Paris stahl. Und nicht nach dem Verschwinden des Degas-Pastells, das Unbekannte trotz Alarmsicherung am Silvestertag 2009 aus dem Musée Cantini im Zentrum von Marseille von der Wand schrauben konnten. Die französische Polizei ging auch hier von einem sogenannten »Inside-Job« aus, bei dem Museumsmitarbeiter beteiligt gewesen sein sollen. Auch von den auf über hundert Millionen Dollar geschätzten Gemälden von Rembrandt, Vermeer, Degas und Manet, die falsche Polizisten schon im März 1990 aus dem Isabella Stewart Gardner Museum in Boston geraubt haben, fehlt bis heute jede Spur – obwohl für Hinweise auf den Verbleib inzwischen fünf Millionen Dollar ausgesetzt sind und die Tat längst verjährt ist. Am offiziellen Kunstmarkt lassen sich solche weltberühmten Werke nicht verkaufen. Und im digitalen Zeitalter werden Fahndungsbehörden, Flughäfen, Zollstationen und auch der Kunsthandel über Datenbanken in Sekundenschnelle über »heiße Ware« informiert.
Ein Goya fürs Fernsehen
Einer der frühesten bekannten Fälle von Artnapping sorgte für so viel Aufsehen, dass er sogar Eingang in den ersten James-Bond-Film fand. Der ehemalige Lastwagenfahrer Kempton Bunton aus Newcastle-upon-Tyne hatte das Porträt, das der spanische Maler Francisco de Goya im Sommer 1812 vom Duke of Wellington, dem späteren Napoleon-Bezwinger bei Waterloo, gemalt hatte, am 21. August 1961 aus der National Gallery in London gestohlen. Der damals 57-Jährige war mit einer Leiter über das offen stehende Fenster einer Herrentoilette ins Museum eingestiegen. Er wollte mit seiner Beute allerdings kein Geld erpressen, sondern eine politische Entscheidung: Er habe das Kunstwerk gestohlen, erklärte Bunton, nachdem er sich gestellt hatte, um einen Fonds gründen zu können, aus dem die Fernsehgebühren für bedürftige Menschen bezahlt werden sollten: »Ich hatte niemals vor, irgendetwas für mich selbst zu behalten. Mein einziges Ziel war, dass armen und alten Menschen, die in unserer Überflussgesellschaft vernachlässigt zu werden scheinen, die Fernsehlizenzen bezahlt werden.« Er selbst sah nach eigenen Angaben immer nur die damals in Großbritannien existierenden privaten Programme, sollte aber trotzdem auch für die öffentlich-rechtliche BBC bezahlen.
Zunächst einmal blieb das Goya-Gemälde aber fast vier Jahre lang verschwunden. In dieser Zeit kam der erste James-Bond-Film Dr. No in die Kinos. Seine Autorinnen und Autoren erklärten den spektakulären Diebstahl damit, dass der Filmbösewicht das Gemälde habe stehlen lassen: Millionen Kinobesucher sahen das Bild, nach dem Scotland Yard seit Monaten intensiv fahndete, auf der Leinwand. Das Gemälde, 64 mal 52 Zentimeter groß, steht auf einer Staffelei am Treppenaufgang in der unterirdischen Kommandozentrale des Schurken Dr. No.
Aufgeklärt wurde der Fall erst Jahre später. Am 5. Mai 1965 brachte ein großer schlanker Mann mit blondem gewelltem Haar ein sorgfältig geschnürtes Paket mit der Aufschrift »Glass. Handle with care« zur Gepäckaufbewahrung im Bahnhof New Street in Birmingham. Er stellte sich als Mr. Bloxham vor, bezahlte beim diensthabenden Beamten, Ronald Lawson, sieben Shilling Gebühr und erhielt dafür, nachdem er das Paket mit den Worten »Seien Sie sehr vorsichtig damit« übergeben hatte, den Gepäckschein Nummer F 24458. Sechzehn Tage lang blieb das mit Pappe und Holzwolle geschützte Paket neben Koffern und anderen Gepäckstücken in einem Regal liegen. Am 21. Mai erhielt dann die Redaktion der Tageszeitung Daily Mirror einen Brief, der unter anderem einen Gepäckschein mit der Nummer F 24458 des Bahnhofs von Birmingham enthielt. Detective Inspector John Morrisson und Detective Sergeant Jack Ion machten sich mit einem Streifenwagen sofort auf den Weg dorthin. Sie klingelten den Bahnhofsvorsteher aus dem Bett und hielten am Morgen des 22. Mai um zwei Uhr nachts Goyas rahmenloses Porträt des Herzogs von Wellington wohlbehalten in den Händen. Nach ausführlichen Untersuchungen hing es fünf Tage später wieder bei den anderen Gemälden spanischer Künstler in Raum XVIII der National Gallery am Trafalgar Square.
Kempton Bunton stellte sich der Polizei und wurde zu milden drei Monaten Haft verurteilt – wegen des Diebstahls des zerstörten Bilderrahmens. Dass er das Gemälde jemals hätte behalten wollen, konnte ihm nicht nachgewiesen werden.
Heute werden die Kunstwerke von gut organisierten Banden gestohlen, die häufig aus gut ausgebildeten, aber schlecht bezahlten ehemaligen Soldaten aus dem ehemaligen Ostblock oder vom Balkan stammen. »Seit sie am Geschäft beteiligt sind«, sagt Charles Hill, der ehemalige Leiter der Kunstabteilung bei Scotland Yard, »ist es auch zunehmend brutaler geworden. Dass Museen heute während der Öffnungszeiten überfallen, dass die Besucher mit Schusswaffen bedroht oder den Aufsehern ein Messer an den Hals gehalten wird, hat es früher nicht gegeben.« Die Täter bleiben aber – mag der Diebstahl selbst wegen schlechter Sicherheitsvorkehrungen auch noch so einfach gewesen sein – häufig auf den Werken sitzen.
Zwar gibt es seit vielen Jahren, vor allem seit der Öffnung des »eisernen Vorhangs«, einen grauen Markt für teure bunte Bilder. Nicht über seriöse Galerien oder Auktionshäuser wird mit ihnen gehandelt, sondern in Hinterzimmern, unter der Ladentheke und über das Internet. Mit gestohlenen Kunstwerken wurde in Luxemburg bereits Geld gewaschen, versuchten Kriminelle in der Türkei Heroin zu bezahlen, wurden teure Immobilien finanziert. Selbst über Kleinanzeigen auf den Kunstmarktseiten seriöser Blätter wie der Süddeutschen Zeitung, der FAZ, der Welt oder des Handelsblatts wurden schon Werke zweifelhafter Herkunft angeboten, die sich im legalen Kunsthandel nicht absetzen lassen. In der Regel ist dieser Vertriebsweg für jene, die aus den gestohlenen Bildern Geld machen, aber viel zu öffentlich. Deshalb wechselt die wertvolle Beute nicht selten mehrfach den Besitzer, dient als Zahlungsmittel bei illegalen Geschäften – oder sie wird irgendwann wieder den ursprünglichen Besitzern angeboten, gegen Lösegeld oder einfach nur gegen die Zusicherung von Straffreiheit. »Das ist nicht die Regel«, bestätigt eine leitende Mitarbeiterin eines großen Versicherungskonzerns im Rheinland gegen Zusicherung von Vertraulichkeit. »Aber Sie würden sich trotzdem wundern, wie oft solche Deals vorkommen. Wir zahlen doch lieber einen kleinen Prozentsatz als Finderlohn als den vollen Marktwert, zu dem ein Kunstwerk bei uns versichert wurde.«
Schatten und Dunkelheit im Rotlichtviertel
»Wir standen bei Scotland Yard natürlich sehr unter Druck«, erinnert sich der damalige Polizeioffizier Charles Hill. Aus der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt hatten unbekannte Täter am Abend des 28. Juli 1994 zwei wertvolle Gemälde von William Turner und eines von Caspar David Friedrich aus der Ausstellung Goethe und die Kunst gestohlen. Offiziell führte die Frankfurter Polizei die Ermittlungen in einem der spektakulärsten deutschen Kunstraubfälle, aber Hills Londoner Kunstdezernat war, weil die Turner-Bilder der Londoner Tate Gallery gehörten, unmittelbar nach dem Raub ebenfalls aktiv geworden: »Ich habe den Chief Superintendent der Polizeistation Belgravia gebeten, uns Jurek Rokoszynski auszuleihen«, erinnerte sich Hill zehn Jahre später. »Er sprach Deutsch, und die Tate Gallery lag im Bezirk Belgravia. Der Chief Superintendent stimmte zu, meine Chefs bei Scotland Yard auch. Also übernahm Rocky den Job und blieb auch dabei, als er und Micky Lawrence die Polizei verließen und sich selbstständig machten.«
Der Kunstraub mitten in der Frankfurter Innenstadt, zwischen Römer und Dom, machte weltweit Schlagzeilen. Der letzte Wächter hatte in der Schirn an dem lauen Sommerabend im Juli 1994 das Licht ausmachen sollen. Nachdem um 22 Uhr alle Besucher die Ausstellungssäle verlassen hatten, waren auch die vierzehn Aufseher und das Kassenpersonal nach Hause gegangen. Nur ein 28-jähriger Wachmann drehte noch seine letzte Runde. Als er die Räume verschließen und die Alarmanlage aktivieren wollte, überwältigten ihn zwei maskierte Männer, die sich irgendwo in der Ausstellungshalle versteckt gehalten hatten. Sie zogen ihm eine blickdichte Stoffhaube über den Kopf und fixierten sie mit Klebeband. Dann legten sie dem Mann Handschellen an, nahmen ihm seine Schlüssel ab und sperrten ihn in eine Abstellkammer.
Sekunden später schraubten sie drei Gemälde von der Wand, die im Obergeschoss in der Ausstellung hingen. Mit den Bildern, die zusammen für rund 62 Millionen D-Mark versichert waren, stiegen sie in den Lastenaufzug, um die Kunsthalle durch einen Hinterausgang an der Domseite zu verlassen. Dort wartete ein Fahrer. Ein Ehepaar sah noch, wie die Bilder in einen Kleinlaster verladen wurden. Als sie aber, weil ihnen die Angelegenheit seltsam vorkam, die Polizei verständigen wollten, blockierten Dutzende wütende Autofahrer die einzige Telefonzelle in der Nähe: Rund um Schirn-Kunsthalle und Römer waren an diesem Abend besonders viele Falschparker abgeschleppt worden.
Die drei Einbrecher wurden schnell geschnappt. Sie hatten am Tatort an einer Tür Fingerabdrücke hinterlassen, die die Polizei ins Rotlichtviertel hinter dem Frankfurter Bahnhof führten. Die Bilder aber blieben lange verschwunden: zwei 78 mal 78 Zentimeter große Ölgemälde des britischen Malers Joseph Mallord William Turner: Schatten und Dunkelheit – Der Abend der Sintflut und Licht und Farbe – Der Morgen nach der Sintflut. In furiosem Farbwirbel markieren die beiden Bilder, die zu den letzten vollendeten Werken Turners zählen, den Übergang von der gegenständlichen zur ungegenständlichen Malerei und zur Wiedergabe des reinen Lichtes. Ebenso spurlos verschwunden blieb das Gemälde Nebelschwaden von Caspar David Friedrich, das die Hamburger Kunsthalle für die Frankfurter Ausstellung ausgeliehen hatte.
Ein Polaroid für eine Million Pfund
Nach dem Raub meldeten sich immer wieder angebliche Mittelsmänner und behaupteten, sie hätten Zugang zu den Bildern – ein »Mr. Rothstein« zum Beispiel, der sich als Betrüger aus Nigeria entpuppte. Oder zwei Männer aus Essen, die dem im Januar 2001 in Antwerpen als Strohmann fungierenden niederländischen Privatdetektiv Ben Zuidema zwei plumpe Fälschungen verkaufen wollten. Immer wieder hofften die beiden geschädigten Museen, ihre Schätze zurückzubekommen. Und immer wieder wurde ihre Hoffnung enttäuscht.
Die Sensation kam erst Jahre später: Im Dezember 2002, acht Jahre nach dem Raub, gab die Tate bekannt, dass sie ihre beiden Turners zurückerhalten hatte – das eine Bild nur Tage zuvor, das andere schon im Juli 2000. Sandy Nairne, damals Programmdirektor der Tate, erinnerte sich später in einem Buch zum Fall[3] an ergebnislose Ermittlungen unmittelbar nach der Tat, ans Warten in Hotellobbys in Bad Homburg bei Frankfurt und in Restaurants in Rüdesheim am Rhein. Und an jenen 22. Juli 1999, an dem es zum ersten Mal so schien, als könnte es doch noch gelingen, Kontakt zu jenen Männern zu bekommen, in deren Besitz sich die Bilder auch Jahre nach der eigentlichen Tat noch befanden.
Die ehemaligen Polizisten Rokoszynski und Lawrence erfuhren von einem Häftling, der bis heute nur »D« genannt wird, dass der Frankfurter Rechtsanwalt und Notar Edgar Liebrucks einen solchen Kontakt möglicherweise herstellen konnte. »Einem Informanten von uns war es gelungen«, so Lawrence, »Zugang zu der Bande zu bekommen, die die Bilder ursprünglich gestohlen hatte. Dabei wurde, als es um die Rückgabe der Bilder ging, ständig der Name Liebrucks genannt, weil er einen der Täter in der Vergangenheit vertreten hatte. Der Informant hat dann ein Treffen zwischen Liebrucks und Jurek Rokoszynski vermittelt. Ein Ergebnis dieses Treffens war, dass er mit uns zusammenarbeiten wollte.« Abgesichert durch entsprechende Zusagen des höchsten britischen Gerichtshofs, verschiedener Behörden und der Frankfurter Staatsanwaltschaft legte die Tate ein Sonderkonto bei der Deutschen Bank in Frankfurt an. Darauf wurden zehn Millionen Pfund aus jenem Betrag von 24 Millionen Pfund geparkt, den die Versicherung der Schirn nach London an die Tate hatte überweisen müssen.
Einen Vertrauensvorschuss im Gegenwert von einer Million Pfund kostete es angeblich allein, von den Hintermännern des Kunstraubs ein Polaroid zu bekommen, das deren tatsächlichen Zugang zu einem der Turner-Gemälde belegte. Vier weitere Millionen flossen, als nach zahlreichen frustrierenden Absagen, Terminverschiebungen und immer wieder neuen Bedingungen das Schatten und Dunkelheit-Bild am 19. Juli 2000 in Frankfurt übergeben wurde. Nicht als Lösegeld wollen alle Beteiligten und auch Sandy Nairne bis heute diese Summe verstanden wissen, sondern als »Belohnung für Hinweise zur Wiederauffindung der wertvollen Bilder«. Dass »Artnapping« – der Diebstahl von Kunstwerken zur Erpressung der Eigentümer – ein äußerst lukratives und erfolgreiches Geschäft ist, ist in einschlägigen Kreisen allerdings seit Langem kein Geheimnis mehr.
Um die Verhandlungen über den zweiten Turner nicht zu gefährden, vereinbarten alle Beteiligten Stillschweigen über die erste Rückgabe. Von den zwölf Mitgliedern des Museumsvorstandes waren nur zwei informiert worden. Ob die Täter von 1994 dieselben Personen waren, die die Rückgabe der Gemälde abwickelten, wollte Edgar Liebrucks nicht kommentieren: »Dazu sage ich gar nichts.« Es dauerte noch einmal fast zweieinhalb Jahre, bis im Frankfurter Büro des Juristen auch Licht und Farbe an Sandy Nairne und seinen Kollegen Roy Perry übergeben wurde. Mehrere frühere Übergabetermine seien zunächst geplatzt, erinnert sich Nairne an den erneuten Nervenkrieg.
Edgar Liebrucks berichtete einmal an anderer Stelle, er sei im Herbst 2002 in seiner Kanzlei abgeholt und zu einer Hütte im Wald gefahren worden: »Dort wurden mir der zweite Turner und der Caspar David Friedrich gezeigt.« Nach ausführlicher Prüfung wurde das Bild dann am 14. Dezember 2002 ebenfalls in Frankfurt an die Vertreter der Tate Gallery übergeben. Und wieder flossen dafür fünf Millionen Pfund in bar. »Das Geld«, erzählte Liebrucks vor einigen Jahren, »habe ich dann in einer Plastiktüte über die Frankfurter Zeil zu denen gebracht, von denen das Gemälde kam.«
Den Schirn-Raub beschreibt Sandy Nairne in seinem Buch über den Fall als Geschichte aus den Abgründen der Museumswelt. Darf man, um wertvolle Kulturgüter zu retten, mit Kriminellen zusammenarbeiten, die wahrscheinlich aus der serbischen Mafia kommen und möglicherweise Morde auf dem Gewissen haben? Heiligt in diesem Fall der Zweck die Mittel? Diese Frage, lautet Nairnes Fazit, könne immer nur für den konkreten Einzelfall beantwortet werden. Er sei froh gewesen, dass die höchsten Instanzen seines Landes den Weg, den er gegangen sei, ausdrücklich genehmigt hatten.
Dass die gesamte Aktion für die Tate sogar mit einem Plus enden würde, ahnte Nairne damals nicht. Ein Jahr nach dem Diebstahl hatte der betroffene Versicherungskonzern Hiscox im April 1995 die Versicherungssumme in Höhe von 24 Millionen Pfund überwiesen. Drei Jahre später erwarb die Tate Gallery dann aber mit Zustimmung des Finanz- und des Kulturministeriums für nur acht Millionen Pfund das Besitzrecht an den beiden Gemälden wieder zurück – für den Fall, dass sie jemals wieder auftauchen sollten. Das Geschäft war riskant, weil zu jenem Zeitpunkt niemand mehr ernsthaft mit einer Rückgabe rechnen konnte. Als sie schließlich doch erfolgte, konnte sich das Museum nicht nur über seine wertvollen Gemälde freuen. Es war zusätzlich auch um 16 Millionen Pfund reicher.
Nebelschwaden in Hamburg
Bei der Rückführung der Hamburger Nebelschwaden unterscheiden sich die Darstellungen. Im Januar 2003 meldete sich Liebrucks nach Angaben des Museums bei der Hamburger Kunsthalle, um die Rückführung der Nebelschwaden von Caspar David Friedrich vorzubereiten. Polaroidfotos, auf denen das Gemälde zusammen mit aktuellen Tageszeitungen zu sehen war, belegten auch diesmal die Ernsthaftigkeit des Angebotes. Als Lösegeld forderten die Besitzer 1,5 Millionen Euro, so