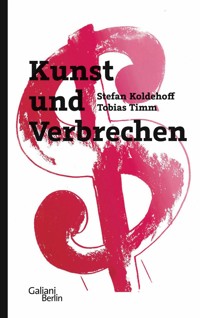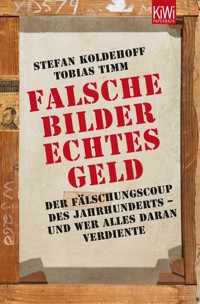9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Vincent van Gogh (1853–1890) ist im öffentlichen Bewusstsein vor allem als unverstandener Einzelgänger mit tragischem Ende gegenwärtig. Dabei hat die kunsthistorische Forschung diese und viele andere romantische Legenden in den vergangenen Jahren zweifelsfrei widerlegt. Van Gogh kämpfte erfolgreich um seine künstlerischen Fähigkeiten, suchte intensiv den Austausch mit der Avantgarde seiner Zeit und genoss das Ansehen seiner Malerfreunde. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Stefan Koldehoff
Vincent van Gogh
Über dieses Buch
Vincent van Gogh (1853–1890) ist im öffentlichen Bewusstsein vor allem als unverstandener Einzelgänger mit tragischem Ende gegenwärtig. Dabei hat die kunsthistorische Forschung diese und viele andere romantische Legenden in den vergangenen Jahren zweifelsfrei widerlegt. Van Gogh kämpfte erfolgreich um seine künstlerischen Fähigkeiten, suchte intensiv den Austausch mit der Avantgarde seiner Zeit und genoss das Ansehen seiner Malerfreunde.
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Vita
Stefan Koldehoff, geboren 1967 in Wuppertal, absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zum Verlagskaufmann. Nach dem Studium der Kunstgeschichte, Germanistik und Politikwissenschaft freiberuflicher Journalist, Autor und Moderator unter anderem für «die tageszeitung» (taz) in Berlin, die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) und den Westdeutschen Rundfunk (WDR) in Köln. 1998 bis 2001 Redakteur des Kunstmagazins «art» in Hamburg, zuletzt stellvertretender Chefredakteur. Seit 2001 Kulturredakteur beim Deutschlandfunk in Köln. Stefan Koldehoff, der als Autor auch für die «Süddeutsche Zeitung» schreibt, lebt mit Frau und zwei Kindern in Köln.
Impressum
rowohlts monographien
begründet von Kurt Kusenberg
herausgegeben von Uwe Naumann
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2022
Copyright © 2003 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Für das E-Book wurde die Bibliographie aktualisiert, Stand: Juli 2022
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten
Redaktionsassistenz Katrin Finkemeier
Covergestaltung any.way, Hamburg
Coverabbildung akg-images (Vincent van Gogh. Selbstbildnis, 1887. Amsterdam, Van Gogh Museum)
ISBN 978-3-644-01483-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Wahrheit und Dichtung
Wann genau die Legende die historische Wirklichkeit überholt hatte, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Wer dafür verantwortlich ist, dass jene öffentliche Figur Vincent van Gogh entstand, die mit dem realen Menschen kaum noch etwas zu tun hat, kann nur vermutet werden: Seine Schwägerin Johanna van Gogh legte den Grundstein, als sie 1913 den Briefwechsel zwischen Vincent van Gogh und seinem Bruder Theo veröffentlichte – und dabei der Familie unangenehme Passagen dezent ausließ. Der Kunsthistoriker Julius Meier-Graefe griff diese Vorlage dankbar auf und verbreitete in seinen Büchern, die in hohen Auflagen gedruckt wurden, nach dem Schrecken des Ersten Weltkriegs das rührende Klischee vom unverstandenen Genie: Van Gogh habe nie Interesse am Erfolg gehabt, zu Lebzeiten angeblich nur ein einziges Bild verkauft und sei schließlich unter der Sonne des französischen Südens wahnsinnig geworden, bis er sich schließlich im Alter von nur 37 Jahren erschoss. Elias Canetti wird sich später in seinen Memoiren aus den Jahren 1921 bis 1924 erinnern, dass «nach dem Erscheinen des ‹Vincent› von Meier-Graefe van Gogh zum vornehmsten Gesprächsstoff der Pensionstafel wurde. […] Damals war es, daß die Religion um van Gogh begann, und Fräulein Kündig sagte einmal, jetzt erst, seit sie sein Leben kenne, sei ihr aufgegangen, was es mit Christus auf sich habe.» Die mythische Reduktion der komplexen Persönlichkeit Vincent van Goghs auf den plakativen Gegensatz zwischen Genie und Wahnsinn verfehlte ihre Wirkung auch auf Canettis Mutter nicht, von der der Autor zuvor selbst schrieb: «Malerei hatte ihr nie viel bedeutet.» Als er sie nun, nach dem Erscheinen von Meier-Graefes Roman, über van Gogh befragt, hört der noch nicht Zwanzigjährige, was dem damals allgemein verbreiteten Van-Gogh-Bild entsprechen dürfte: «Ein Verrückter, der Strohsessel und Sonnenblumen gemalt hat, immer alles gelb, der mochte keine anderen Farben, bis er einen Sonnenstich bekam und sich eine Kugel in den Kopf schoß.»
Der letzte romantische Künstlermythos der Moderne war geboren – und fand durch die cineastische Verklärung im Oscar-gekrönten Spielfilm «Lust for Life» – mit Kirk Douglas als van Gogh und Anthony Quinn als Gauguin – seine geniale Fortschreibung in der Nachkriegszeit. Spätestens seitdem glaubt jeder, über Vincent van Gogh alles zu wissen. Dass längst die meisten Legenden durch historische Tatsachen widerlegt sind, interessiert dabei nach wie vor bestenfalls am Rande. Vincent van Gogh war kein unverstandenes Genie: Er rang um seine Kunst, bemühte sich zeit seines künstlerischen Schaffens um Anerkennung und erhielt sie auch von angesehenen Kritikern seiner Zeit wie Albert Aurier und Künstlerkollegen wie Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Signac oder Claude Monet. Auch die Legende, van Gogh habe zu Lebzeiten nur ein einziges Werk verkaufen können, ist längst widerlegt. Und die Beziehung zwischen Vincent und Theo van Gogh verlief durchaus nicht so ausschließlich harmonisch, wie lange angenommen werden musste. Im Gegenteil, das Verhältnis der beiden Brüder war geprägt durch häufige Auseinandersetzungen über finanzielle oder künstlerische Probleme.
Die Literatur über van Goghs kurzes Leben und das immerhin rund 2100 Werke umfassende Œuvre füllt einige Regalmeter. Es gibt eigene wissenschaftliche Untersuchungen über die Romane, die er las, über die Blumen, die er malte, und über die Handschrift, in der er seine Briefe verfasste. Wenig verlässlich sind die bislang existierenden Werkverzeichnisse. Sie enthalten bis heute falsche Zuschreibungen und Fälschungen – und regelmäßig fügen mehr oder minder kompetente Experten angeblich neu entdeckte Werke hinzu oder schreiben andere als Fälschungen ab. Den seriösen Versuch, sowohl im Hinblick auf das Werk als auch auf das Leben die Spreu vom Weizen zu trennen, unternimmt seit seiner Gründung 1973 das Van Gogh Museum in Amsterdam. Hier lagert als Besitz der von den Erben eingesetzten Van-Gogh-Stiftung der Nachlass von Vincent und Theo van Gogh, darunter Hunderte von Zeichnungen, Graphiken, Gemälden und Briefen. Im Museum angesiedelt ist außerdem das «Van Gogh Research Project», das – unberührt von materiellen Interessen – inzwischen auch an einem neuen Werkkatalog arbeitet. Der offene Zugang zu diesen Beständen macht es heute möglich, durch das sorgfältige Studium eines großen Teiles der originalen Quellen den Legenden und Mutmaßungen um Vincent van Gogh Fakten entgegenzusetzen.
Diese Monographie versucht, aus dem Mythos Vincent wieder den Menschen van Gogh werden zu lassen. Sachlich und nur behutsam kommentiert, beschreibt sie nichts als sein Leben.
Kindheit und Jugend (1853–69)
Vincent Willem van Gogh wird am 30. März 1853 in Zundert, einem Dorf in der südniederländischen Provinz Brabant, geboren. Sein Vater, der Theologe Theodorus van Gogh (1822–85), war dort vier Jahre zuvor, am 11. Januar 1849, zum reformierten Prediger berufen und am 1. April des Jahres in sein Amt eingeführt worden. 1851 heiratet er die zweieinhalb Jahre ältere Anna Cornelia Carbentus (1819–1907), die Tochter eines Buchbinders aus Den Haag. Ihre jüngere Schwester Cornelia hatte bereits ein Jahr zuvor Theodorus’ älterem Bruder Vincent («Onkel Cent»; 1820–88) das Jawort gegeben. Ein Jahr nach der Hochzeit bringt Anna van Gogh ein Kind zur Welt, das, tot geboren, auf den Namen Vincent Willem getauft und auf dem Friedhof von Zundert begraben wird. Die Kindersterblichkeitsrate in der agrarisch geprägten Region Brabant beträgt damals noch knapp zehn Prozent. Von den 106 Kindern, die 1852 in Zundert zur Welt kamen, wurden neun tot geboren.
Auf den Tag genau ein Jahr später werden Theodorus und Anna van Gogh dann zum ersten Mal wirklich Eltern. Auf den Sohn, der ebenfalls den Namen Vincent Willem erhält, folgen in den nächsten Jahren fünf weitere Geschwister: Anna Cornelia (1855–1930), Theodorus («Theo»; 1857–91), Elisabeth Huberta («Lies»; 1859–1936), Willemina Jacoba («Wil»; 1862–1941) und Cornelis Vincent (1867–1900). Bei der Geburt dieses letzten ihrer Kinder ist Anna Cornelia van Gogh bereits 47 Jahre alt.
Über die Kindheit Vincent van Goghs ist wenig bekannt. Als der Maler kurz nach seinem Tod durch die intensiven Anstrengungen seiner Schwägerin Johanna van Gogh-Bonger berühmt wurde, bemühten sich zwar verschiedene Kunsthistoriker und Heimatforscher, die damals noch lebenden Zeitzeugen zu befragen; ein Vergleich ihrer Zeugnisse ergibt aber, dass viele Erinnerungen tatsächlich gar nicht realen Erlebnissen entsprechen können, dass sich Zeit und Ortsangaben gegenseitig widersprechen – mit einigen Ausnahmen allerdings. Übereinstimmend berichten mehrere Altersgefährten des jungen Vincent van Gogh, dass dessen Vater seinen Kindern untersagte, mit Gleichaltrigen auf der Straße zu spielen. Stattdessen ging der Pastor jeden Tag um ein Uhr mit seiner Frau, seinen Kindern und dem Dienstmädchen spazieren. Einige Zeitzeugen, die sich in den zwanziger Jahren noch an Vincent van Gogh erinnern konnten, charakterisieren den rothaarigen Jungen sehr unterschiedlich. Während ihn die einen als stilles und wohlerzogenes Kind beschreiben, das viel gelesen habe, erinnert sich die Dienstmagd der Familie, Jacomina Honcoop, an «schlechte Manieren, für die er von seinen Eltern viel Strafe erhielt»[1]. Der Sohn des Zimmermanns Franken sah dagegen: «Vincent kam oft in die Werkstatt, um zu basteln. Er machte so hübsche Dinge, dass der Zimmermann voll des Lobes über diese Leistung sprach.»[2]
Im Garten hinter dem Haus hielt Theodorus van Gogh für seine Kinder drei Ziegen und einen schwarzen Hund, der auf den Namen Fédor hörte. An jene Zeit denkt Vincent später häufig zurück. Mehr als zwanzig Jahre später schreibt er im April 1876 als Hilfslehrer in England an Theo: Wir gehen oft an den Strand, heute vormittag habe ich den Jungen geholfen, eine Burg aus Sand zu bauen, wie wir das in Zundert oft im Garten getan haben.[3] Als ihn siebzehn Monate vor seinem Tod in Südfrankreich ein Krankheitsanfall ereilt, erinnert er sich erneut: Während meiner Krankheit habe ich jedes Zimmer im Haus in Zundert vor mir gesehen, jeden Weg, jede Pflanze im Garten, die Umgebung, die Felder, die Nachbarn, den Friedhof, die Kirche, unseren Gemüsegarten dahinter – bis auf das Elsternnest in der hohen Akazie auf dem Friedhof.[4] Der prägenden Bedeutung, die diese frühen Natureindrücke in der Brabanter Heidelandschaft für ihn hatten, war sich van Gogh dabei durchaus bewusst. Du wirst sagen: Aber jeder hat doch von klein auf Landschaften und Figuren gesehen. Frage: Ist auch jeder als Kind nachdenklich gewesen?, fragt er den Bruder in einem anderen Brief, Hat auch jeder, der sie gesehen hat, Heide, Felder, Äcker, Wald geliebt, und den Schnee und den Regen und den Sturm? Das hat nicht jeder so wie Du und ich, es ist eine besondere Art von Umständen, die dazu mitwirken müssen, es ist auch eine besondere Art von Temperament und Charakter, die dazu kommen muß, damit es Wurzel faßt.[5]
Im April 1861 taucht der Name Vincent van Gogh zum ersten Mal auf der Schulgeldliste der Dorfschule von Zundert auf. Wahrscheinlich, bislang aber nicht belegt, ist allerdings, dass er schon seit 1860 den Unterricht besucht. «Seine Eltern fanden aber, daß ihn der Verkehr mit den Bauernjungen zu roh werden ließ», begründet Theos Witwe Johanna van Gogh-Bonger im Vorwort zur Erstausgabe der Briefe Vincent van Goghs den Umstand, dass Theodorus van Gogh bereits im November 1861 beschließt, seinen Sohn Vincent und dessen Schwester Anna wieder von der Schule herunterzunehmen. Dass der alkoholabhängige Lehrer Jan Nicolaas Dirks die Schule nicht mit der nötigen Sorgfalt leitete, mag dabei ebenfalls eine Rolle spielen.
Vincent und seine Geschwister werden in der folgenden Zeit nacheinander von drei Gouvernanten, Anna Phillipina Birnie, Anke Maria Schull und Jeanette Jacqueline Kuyper betreut. Am 1. Oktober 1864 verlässt Vincent zum ersten Mal das Elternhaus, um in den folgenden zwei Jahren die protestantische Internatsschule von Jan Provily im etwa 30 Kilometer entfernten Zevenbergen zu besuchen. An den Abschied erinnert er sich zwölfeinhalb Jahre später in einem Brief an die Eltern: Gerade kamen wir an Zevenbergen vorbei, und ich dachte an den Tag, als Ihr mich dahin brachtet und ich auf dem Gehweg bei Herrn Provily stand und Eurem Wagen auf der nassen Straße nachsah. Und dann der Abend, als mein Vater mich zum ersten Mal besuchen kam. Und das erste Nachhausekommen zu Weihnachten![6] Am 31. August 1866 wechselt der Dreizehnjährige ins 50 Kilometer von Zundert entfernte Tilburg, wo am 3. September an der «Rijks Hoogere Burgerschool Wilhelm II.» der Mittelschulunterricht beginnt. Die Schulleitung stuft ihn als «hinreichend gebildet ein, um dem Unterricht beizuwohnen». Der Stundenplan umfasst die Fächer Niederländisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Rechnen, Geschichte, Erdkunde, Geometrie, geradliniges Zeichnen, Handzeichnen, Pflanzen- und Tierkunde, Schönschreiben und Turnen. Vincents Zeichenlehrer in Tilburg ist der Kunstpädagoge und angesehene Maler Constantijn Huysmans, der sich unter anderem für die Kunsterziehung von Arbeitern eingesetzt hatte. Anders als in Zevenbergen kann Vincent diesmal nicht in der Schule selbst wohnen. Er kommt bei der Familie Hannik unter, der sein Vater dafür Kostgeld bezahlen muss. Wahrscheinlich sind es auch finanzielle Gründe, die dazu führen, dass der durchaus fleißige und intelligente Fünfzehnjährige im März 1868 mitten im Schuljahr die Schule wieder verlassen muss, um ins Elternhaus nach Zundert zurückzukehren. Der nicht eben hoch bezahlte Pastor Theodorus van Gogh hatte neben seiner Frau und den Hausangestellten inzwischen sechs Kinder zu ernähren. Nach einem fünfzehnmonatigen Aufenthalt in Zundert verlässt Vincent van Gogh im Sommer 1869 erneut das Elternhaus – diesmal in Richtung Den Haag. Er soll bei seinem Onkel Vincent zum Kunsthändler ausgebildet werden.
Erste Schritte ins Berufsleben (1869–73)
Vincent van Goghs Onkel besaß zunächst ein Geschäft für Zeichen- und Malereibedarf in der Spuistraat 55. Durch den Kontakt zu Malern der sogenannten Haager Schule wie Johannes Bosboom und Jan Weissenbruch beschloss er später, sich ganz dem Kunsthandel zuzuwenden. 1858 schließlich machte die renommierte Pariser Galerie Goupil & Cie., bei der dann Theo van Gogh arbeiten sollte, ein Übernahmeangebot. Ab 1861 firmierte die Kunsthandlung van Gogh als Haager Filiale von Goupil unter der Adresse Plaats 14 in der Stadtmitte. Van Gogh selbst hatte sich aus gesundheitlichen Gründen inzwischen aus dem Geschäft zurückgezogen und reiste jedes Jahr an die Côte d’Azur. Seine Ehe mit der Schwester von Anna Cornelia Carbentus, Cornelia, blieb kinderlos. Die Geschäfte in Den Haag führte der junge Kaufmann Hermanus Gijsbertus Tersteeg (1845–1917).
Theodorus van Gogh begleitet seinen 16 Jahre jungen Sohn nach Den Haag, wo Vincent am 30. Juli 1869 als «Büroangestellter» ins Einwohnerregister eingetragen wird. Tatsächlich entsprechen seine Aufgaben als jüngster Lehrling des Unternehmens, wie er später seiner Schwester Lies berichtet, eher denen eines Hilfsarbeiters: Einpacken, auspacken, Fotos und Radierungen mit Trennpapieren abdecken und beim Einkisten der Gemälde helfen.[7] Sein Gehalt beträgt dreißig Gulden im Monat. Schon Kost- und Logisgeld in der angesehenen Pension der Familie Roos am Lange Beestenmarkt 32 verschlingen allerdings 34 Gulden, sodass die Eltern vier Gulden monatlich zu Vincents Auskommen beisteuern müssen. Der behält selbst nichts zur freien Verfügung übrig und erinnert sich einige Jahre später an seine vier Jahre dauernde Ausbildung als an schlimme Armut und harte Arbeit[8].
Nach dem Zeichenunterricht in Tilburg kommt Vincent in Den Haag zum ersten Mal wieder mit bildender Kunst in Berührung. Goupil gilt als progressive Galerie, die neben der etablierten Salonkunst auch Werke der Pleinairmaler der sogenannten Schule von Barbizon und deren Anhänger in der ortsansässigen Haager Schule vertrat.
Theodorus van Gogh und seine Familie ziehen am 29. Januar 1871 von Zundert nach Helvoirt in der Nähe von ’s-Hertogenbosch um: Eineinhalb Jahre später besucht der inzwischen 15 Jahre alte Theo seinen Bruder Vincent in Den Haag. Beide scheinen bei diesem Besuch eine Reihe von Gemeinsamkeiten zu entdecken. Theo van Gogh erhält die Gelegenheit, sich über die Arbeit im Kunsthandel zu informieren. Als der jüngere Bruder sich wenige Monate später entschließt, ebenfalls eine Ausbildung bei Goupil zu beginnen, gratuliert ihm Vincent überschwänglich: Das war eine gute Nachricht, die ich da aus Pa’s Brief las. Von Herzen wünsche ich Dir Glück dazu. Ich zweifle nicht daran, dass Du viel Vergnügen finden wirst, es ist so ein schöner Laden. Es wird eine große Veränderung für Dich sein. Es freut mich so, dass wir nun beide im selben Fach & im selben Geschäft sind; wir müssen eifriger miteinander korrespondieren.[9]
Tatsächlich beginnt nach Theos Besuch 1872 der Briefwechsel zwischen den beiden Brüdern, der bis zu Vincents Tod andauern soll. Vor allem im Van Gogh Museum in Amsterdam, aber auch in einigen anderen privaten und öffentlichen Sammlungen, werden die mehr als 900 Briefe aufbewahrt, die allein von Vincent van Gogh erhalten sind. Sein auf diese Weise hinterlassenes schriftliches Œuvre zählt zu den umfangreichsten der modernen Kunstgeschichte.
unterstützte seinen Bruder Vincent fast zehn Jahre lang – beginnend mit dessen Entscheidung, nach Den Haag zu gehen, um Maler zu werden, bis zu Vincents Tod im Juli 1890. Dass das Verhältnis zwischen den beiden Brüdern keineswegs ausschließlich gut war, geht vor allem aus den rund 900 Briefen hervor, die beide zwischen 1871 und 1890 wechselten. Theo van Gogh überlebte seinen Bruder nicht lange. Kurz nach Vincents Tod verschlechterte sich auch seine Gesundheit rapide. Am 25. Januar 1891 starb er an Dementia paralytica, wohl als Folge einer Syphilis-Erkrankung. Beide Brüder liegen seit 1914 nebeneinander auf dem Friedhof von Auvers-sur-Oise bei Paris begraben.
Etwa um diese Zeit beginnt van Gogh auch damit, erste Zeichnungen seiner Umgebung in Den Haag anzufertigen. Zu den frühesten gesicherten Blättern zählt die auf Herbst 1872 datierte Straßenszene De Lange Vijverberg, auf dem er mit dünnen Bleistift- und Federstrichen drei Spaziergänger auf einer Seepromenade mit dem Haager Parlamentsgebäude im Hintergrund zeichnet. Der ungelenken und unproportionierten Darstellung fehlt räumliche Tiefe. Die Plastizität der abgebildeten Personen, Bäume, einer Laterne und einer Sitzbank im Vordergrund versucht van Gogh durch Schraffuren anzudeuten. Ähnliche Blätter folgen: eine weitere Kanalszene, ein Deich, ein Feldweg mit Tor. Sie dokumentieren eindrucksvoll die mühevolle Anstrengung eines nicht übermäßig talentierten Autodidakten, für den die Zeichenkunst zu diesem Zeitpunkt ein angenehmer Zeitvertreib, sicher aber noch keine Berufung ist.
Lange Zeit wurde die frühe künstlerische Entwicklung Vincent van Goghs anders beurteilt. 1955 tauchten zwölf angebliche Kinder- und Jugendzeichnungen gleichsam aus dem Nichts auf. Der niederländische Kunsthistoriker Jan G. van Gelder hatte sie in der Zeitschrift «De Tafelronde» publiziert und auch gleich eine scheinbar plausible Erklärung für die Herkunft der teilweise sogar mit «V.W. van Gogh» beschrifteten, in der Linienführung sehr sicheren Zeichnungen mitgeliefert: Drei der Blätter sollten demnach aus dem Besitz von van Goghs Tanten Antje, Doortje und Mietje stammen, die sie als Lehrerinnen zur Belohnung an fleißige Schüler verteilt hätten. Die anderen Blätter ließen sich van Gelder zufolge bis zu einer Familie Aalbersberg zurückverfolgen, deren Verwandte als Angestellte der Pastorenfamilie van Gogh gearbeitet hatten.
Vergleicht man diese angeblichen Kinderzeichnungen, die in den Jahren 1862 und 1863 entstanden sein sollen, mit den gesicherten ersten Zeichnungen aus Den Haag, so fällt auf, dass das Kind Vincent van Gogh im Alter von acht bis zehn Jahren bereits erheblich sicherer gezeichnet hätte als der junge Erwachsene mit 19 Jahren. Inzwischen gelten die sogenannten Juvenilia deshalb nicht mehr als authentische früheste Arbeiten van Goghs.[10]
Während Theo van Gogh am 1. Januar 1873 seine Ausbildung in der Brüsseler Niederlassung von Goupil beginnt, die einst ihrem Onkel Hendrik van Gogh («Onkel Hein»; 1814–77) gehört hatte, besucht Vincent im selben Monat und noch einmal im März seinen Onkel Cornelis Marinus van Gogh («Onkel Cor»; 1824–1908), der in Amsterdam eine Kunsthandlung unterhält. Bei dieser Gelegenheit besichtigt er auch das «Trippenhuis» mit seiner Sammlung alter Meister. Die folgenden Monate bringen vor allem eine Reihe von Ortswechseln. Am 17. März schreibt Vincent an Theo: Du hast sicher schon gehört, daß ich nach London gehe & das wahrscheinlich schon bald. Ich hoffe sehr, daß wir einander vorher noch sehen. […] Es wird in L. ein völlig anderes Leben für mich sein, weil ich wahrscheinlich allein auf einem Zimmer werde wohnen müssen, also auch für viele Dinge sorgen muß, mit denen ich jetzt keine Last habe. Ich wünsche mir sehr, L. zu sehen, wie Du Dir wohl denken kannst, aber trotzdem tut es mir leid, von hier weggehen zu müssen. Nun, da feststeht, daß ich weggehen muß, merke ich erst, wie sehr ich an Den Haag hänge. Aber enfin, das ist nun nicht anders & ich habe die Absicht, die Dinge nur nicht zu schwer zu nehmen. Ich finde es herrlich für mein Englisch, ich kann es wohl gut verstehen, aber Sprechen geht doch lange noch nicht so gut wie ich will.[11]
Erfahrungen als Lehrer und Kunsthändler (1873–77)
Über Brüssel, wo er sich am Bahnhof mit Theo verabredet, und Paris, wo er das Hauptgeschäft von Goupil besucht, erreicht Vincent van Gogh nach einigen Wochen London. In der Southampton Street 17 betreibt Goupil unter der Leitung von Charles Obach zwar kein eigenes Ladengeschäft; das Unternehmen unterhält dort aber ein Warenlager. Vincents Vater berichtet in einem Brief an Theo: «Wir haben einen netten Brief von Vincent. Er lebt am Stadtrand von London und fährt morgens um 8 Uhr 30 mit einem kleinen Dampfer in die Stadt, wozu er eine Stunde braucht. Er ißt in der Stadt und kommt um sieben nach Hause. Seine Unterkunft ist recht teuer, aber er weiß noch nicht, wie hoch sein Gehalt sein wird. So weit gefällt es ihm sehr gut, und Onkel Cent hat dafür gesorgt, daß er mit einigen Leuten zusammenkommt.»[12] Am 13. Juni meldet sich Vincent selbst bei Theo: Es geht mir, den Umständen entsprechend, sehr gut. Ich habe eine Pension gefunden, wo es mir vorläufig sehr gut gefällt. Es sind noch 3 Deutsche im Haus, die viel von Musik halten & selbst Klavier spielen & singen, was die Abende sehr gesellig macht. Ich bin hier nicht so beschäftigt wie in Den Haag, weil ich von morgens 9 bis abends 6 Uhr im Geschäft sein muß & samstags schon um 4 Uhr fertig bin. Ich wohne in einer der Vorstädte von London, wo es verhältnismäßig ruhig ist, es hat etwas von Tilburg oder so. […] Es ist sehr teuer, hier zu leben: In meiner Pension wohne ich für 18 Shillings pro Woche ohne die Wäsche & ich muß dann noch in der Stadt essen.[13] Das Gehalt des Angestellten beträgt, wie erneut Theodorus van Gogh in einem Brief an Theo berichtet, «90 Pfund, 1080 Gulden im Jahr, doch muß er wegen der dortigen hohen Lebenskosten sparsam sein; seine Unterkunft und sein Mittagessen kosten ihn 890 Gulden jährlich. Er ist sehr glücklich mit der Firma. Er ist noch nicht ganz an seine Arbeit gewöhnt, aber der Ton seiner Briefe zeugt von Zufriedenheit.»[14]
Van Goghs erste Adresse in London ist nicht bekannt. Sicher ist aber, dass er Ende August 1873 ein Zimmer im ruhigen Vorort Brixton, im Haus der aus Südfrankreich stammenden Beamtenwitwe Ursula Loyer (1815–95) bezieht, die dort in der Hackford Road 87 eine Bewahranstalt für kleine Kinder führt. Eine erst 1972 entdeckte Zeichnung van Goghs zeigt das Haus von der gegenüberliegenden Straßenseite aus und ist, neben einigen weiteren Blättern aus jener Zeit, Beleg dafür, dass er auch in London weiterhin zum Zeitvertreib die Gegend skizziert, in der er lebt. Einige Zeichnungen schickt er seinen Eltern.
Die Tochter seiner Vermieterin, Eugenie Loyer (1854–1911), galt lange Zeit als jene erste Frau, in die sich Vincent van Gogh unglücklich verliebte. Vor allem Andeutungen in seinen späteren Briefen galten als Beleg für die nicht erwiderte Liebe. So schreibt Vincent van Gogh am 12. November 1881 an seinen Bruder Theo: Was war das für eine Liebe, die ich in meinem 20sten Jahr hatte? Schwierig zu bestimmen, meine körperlichen Leidenschaften waren damals sehr schwach, möglicherweise durch ein paar Jahre arge Armut und harte Arbeit. Aber meine geistigen Leidenschaften waren stark, und ich meine damit, daß ich darauf aus war, ohne etwas zurück zu wollen oder Gnade annehmen zu wollen, allein geben zu wollen, doch nicht empfangen. Unsinnig, verkehrt, übertrieben, hochherzig, vermessen, denn in Sachen Liebe muß man nicht allein nehmen, sondern auch geben, und andersherum nicht allein geben, sondern auch nehmen. […] Früher habe ich einen solchen Fehler begangen. Ich habe ein Mädchen aufgegeben & sie heiratete einen anderen und ich ging weg von ihr und behielt sie doch in Gedanken. Verhängnisvoll.[15]
In ihrem Vorwort zur Erstausgabe der Briefe Vincent van Goghs bezog auch dessen Schwägerin Johanna diese Passage auf Eugenie Loyer, die sich im Februar 1874 mit Samuel Plowman verlobt hatte. Sie interpretiert, die Vornamen von Mutter und Tochter verwechselnd: «Im Juli soll er nach Holland kommen, und um diese Zeit herum scheint er Ursula von seiner Liebe gesprochen zu haben – doch nun mußte er erfahren, daß sie schon im Geheimen mit jemandem, der vor Vincent bei ihnen gewohnt hatte, verlobt war. Er bemüht sich, sie zu einer Lösung des Verlöbnisses zu bewegen, indessen, es gelingt ihm nicht, und mit diesem ersten großen Kummer kommt eine Veränderung in seinen Charakter. Als er in diesem Sommer während der Ferien nach Hause kam, war er abgemagert, still und niedergeschlagen, ein anderer Mensch; doch zeichnete er ziemlich viel.»[16]
Mit dieser, wie heute feststeht, frei erfundenen Episode, beginnt die Legende vom einsamen Künstler, der im Alter von 20 Jahren in London zum ersten Mal vom Leben enttäuscht wird und fortan freiwillig die Einsamkeit sucht.