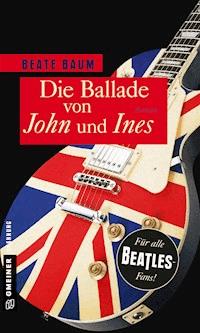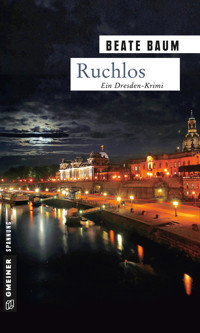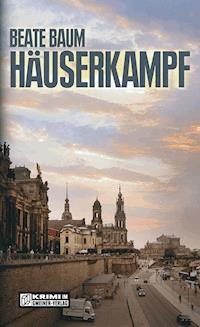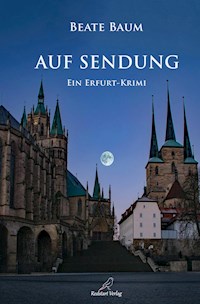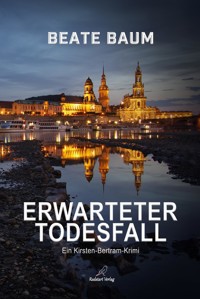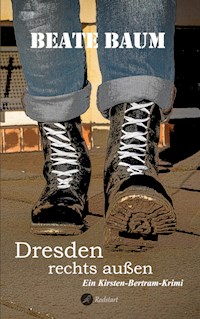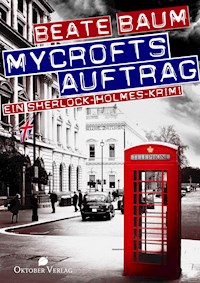6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Redstart Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Journalistin Kirsten Bertram von einem bisher unbekannten Frühwerk des Dresdner Künstlers Markus Zwönitz erfährt, ist sie Feuer und Flamme. Doch dann geschehen zwei Todesfälle im engsten Umfeld des Malers, und ein Freund von Kirsten gerät ins Visier der Polizei. Kirsten will helfen und beginnt zu recherchieren. Spielt die Künstlergruppe Abseits, die einst mit spektakulären Aktionen die DDR-Regierung herausforderte, bis heute eine Rolle? Und wie passt der Reiterhof Natur ins Bild? Dann gibt es plötzlich eine Attacke auf ihre Wohnung und Kirstens Mann gerät in Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Epilog
Nachwort und Danksagung
Impressum
1. Kapitel
»Nun verrate mir aber erst einmal, was gegen das Raskolnikoff spricht«, verlangte ich, als ich ein großes Bier bestellt hatte. »Oder gegen das draußen sitzen.« Victor hatte mich dringend treffen wollen, und obwohl ich in diesen extrem heißen Sommerwochen abends nach der Arbeit ausgelaugt und erschöpft war, hatte ich es ihm nicht abschlagen können. Nicht meinem Freund seit vielen Jahren.
Allerdings hatte er meinen Vorschlag eines Treffens im schattigen, grünen Hof hinter der Kneipe Raskolnikoff in der Dresdner Neustadt abgelehnt. Stattdessen wollte er, dass ich in seine Wohnung kam, wo es noch nicht einmal einen Balkon gab – was ich rigoros zurückgewiesen hatte. Seit Mitte Juni herrschten in der Stadt Temperaturen von weit über 30 Grad, wobei ich die ersten zwei Wochen im angenehm frischen Irland verbracht hatte. Nun aber war ich seit einem Monat wieder zurück in meinem kleinen Büro in der Redaktion der Dresdner Zeitung, wo sich das Arbeiten zunehmend unerträglich gestaltete. Da galt es, sich am Abend einen Platz zu suchen, wo man zumindest die Illusion frischer Luft verspüren konnte.
Als Kompromiss hatten wir uns auf die Planwirtschaft geeinigt; allerdings bestand Victor auf Plätze im Innern der ansonsten leeren Kneipe, obwohl wir uns in dem idyllischen Garten an einen größeren Tisch hätten dazusetzen können.
»Bist du neuerdings allergisch gegen frische Luft?« Ich lehnte mich an die Wand, um ein wenig von der Brise zu spüren, die durch das offene Fenster hereinkam. Ich musste dringend unter die Dusche. Mir den verklebten Schweiß des Tages abwaschen.
»Hier drin ist es doch kühler als draußen«, meinte Victor. »Außerdem muss ich sichergehen, dass niemand mithört.«
Nun hatte er meine Aufmerksamkeit. »Du machst es spannend.«
Er zuckte die Achseln und fragte, ob ich etwas essen wollte.
Ich seufzte. Weil er sich so geheimnisvoll gab und mir an diesem Abend einfach alles zu viel war. »Sollte ich. Tagsüber bekomme ich zurzeit kaum etwas hinunter.« Ich schlug die Speisekarte auf und warf einen Blick hinein. »Ein Salat wäre gut.«
Victor studierte das Angebot deutlich länger als ich. Offensichtlich wusste er nicht, wie er sein Anliegen vorbringen sollte.
Ich betrachtete ihn über den Tisch hinweg, sein rundliches Gesicht mit den kühn geschwungenen Augenbrauen, die dunklen Haare, die er frisch färbte, sobald sich ein grauer Ansatz zeigte, die Regenbogen-Tätowierung auf seinem linken Oberarm. Wir hatten uns auf der Party einer gemeinsamen Freundin kennengelernt und waren sofort ein Herz und eine Seele gewesen. Es war ein schreckliches Klischee, aber mit dem schwulen Raumausstatter konnte ich tatsächlich über viele Dinge reden, die ich weder bei meinem Mann ansprach noch mit Freundinnen thematisierte. Er wiederum sah in mir so etwas wie eine große Schwester und fragte mich oft um Rat. Selten machte er es allerdings so spannend wie an diesem Abend. Warum rückte er nicht damit raus, was er wollte?
»Ist was mit Franz?«, tastete ich mich vor. Bei unserem letzten Treffen hatte er mir von seinem neuen Partner erzählt, der mehr wollte, als Victor zu geben bereit war.
»Nein, nein. Nichts Privates.«
Ein Glück. Ein Gespräch über Beziehungsprobleme wäre mir an diesem Abend schwergefallen.
»Ich hoffe, du kannst mir mit deinem Insiderwissen als Kulturredakteurin weiterhelfen«, setzte er endlich an, da brachte die junge Kellnerin auch schon unsere Getränke. Wir bestellten das Essen, stießen an und tranken einen Schluck, bevor er fortfuhr. »Es geht um den Kunstbetrieb. Also um Bildende Kunst.«
Ich dachte, dass ich ebenso wie er Mineralwasser hätte bestellen sollen. Abgekämpft, wie ich war, stieg mir bereits der erste Schluck Bier zu Kopf. Mit einer fahrigen Bewegung strich ich eine Haarsträhne aus meiner verschwitzen Stirn.
»Deshalb nicht ins Raskolnikoff«, schloss ich. Die Kneipe beherbergte im ersten Stock eine Galerie und wurde häufig von Künstlern frequentiert.
Victor nickte nur. »Zwönitz«, wurde er endlich präziser.
Ich musste spontan lachen. »Den hätten wir nicht im Raskolnikoff getroffen«, war ich mir sicher. »Und hier auch nicht.« Markus Zwönitz gehörte zu den bekanntesten Malern Deutschlands; zwar lebte er zeitweise in Dresden, war jedoch ganz und gar nicht der Typ für eine alternative Neustadt-Kneipe. »Keine Ahnung, wo Leute hingehen, die meinen, dass sie zu Recht Unsummen für ihre Arbeit bekommen, und es ein Skandal ist, sie dafür Steuern zahlen zu lassen – aber weder dort- noch hierhin.«
Darum ginge es nicht, meinte Victor. Er wolle vermeiden, dass irgendjemand aus dem Kunstbetrieb unser Gespräch mitbekäme.
»Okay, dann leg los!« Trotz meines erschöpften Zustands war ich neugierig.
Die Bedienung trat aus der Küche und kam durch den leeren Kneipenraum unter dem Deckenporträt von Planübererfüllungs-Kumpel Adolf Hennecke zu unserem Tisch. Sie sah beneidenswert frisch aus. Wehmütig dachte ich, dass ich Extremtemperaturen in ihrem Alter auch besser ausgehalten hatte. Wobei sie damals deutlich seltener waren – und die arme Frau sich damit noch würde herumschlagen müssen, wenn ich längst in der kühlen Erde des Friedhofs lag.
Himmel, Kirsten, jetzt hör aber auf!, riss ich mich aus diesen morbiden Gedanken und stach die Gabel in den Salat.
»Du isst zu wenig, was?«, vermutete Victor. Er hatte seine Kartoffelsuppe vor sich stehen und hob einen vollen Löffel zum Mund.
»Vermutlich.« Mein Rockbund schlackerte. Definitiv hatte ich in den letzten Wochen abgenommen. Was ich nicht wollte, und was mir auch nicht gut stand. Aber solch eine warme Suppe hätte ich jetzt nicht heruntergebracht. »Die Hitze … Aber das ist nun wirklich nicht wichtig. Jetzt sag mir, worum es geht!«
»Also gut. Ich habe einer Nachbarin meine Hilfe versprochen und weiß nicht, wie ich das halten soll.« Er machte eine Pause, in der ich ein aufmunterndes Geräusch produzierte, fuhr dann fort: »Sie war Zwönitz’ Jugendliebe.«
»Holla!«, rutschte es mir heraus. Wie sehr ich auch unter der Hitze litt, als Journalistin sah ich natürlich eine Geschichte für die Dresdner Zeitung. Weniger über das ehemalige Liebesleben des Künstlers – ich arbeitete bei keinem Boulevard-Blatt! – aber über seine Jugend, seine Anfänge als Maler. Markus Zwönitz wohnte nicht nur in unserem beschaulichen Elbflorenz, sondern auch in Zürich und New York, bei jedem Ranking der weltbesten Künstler stand er auf einem der obersten Plätze. Und er war der Presse gegenüber extrem verschlossen. Anfragen liefen über sein Management und wurden mit wasserdichten Pressemitteilungen beantwortet. Einmal näher an diesen Weltkünstler heranzukommen, wäre reizvoll.
»Nein, auf keinen Fall darfst du darüber schreiben!«, reagierte Victor. »Marion hat sich mir anvertraut, weil sie nicht mehr weiterweiß. Das mit Zwönitz ist lange her, sie ist chronisch krank und lebt von einer kleinen Erwerbsunfähigkeitsrente.«
»Und wie sollst du ihr helfen?« Ich streifte meine Sandalen ab, um die bloßen Füße auf dem Fliesenboden der Kneipe zu kühlen.
Victor aß einen weiteren Löffel Suppe, bevor er antwortete, und ließ seinen Blick durch den nach wie vor leeren Kneipenraum wandern. »Sie ist im Besitz eines sehr frühen Gemäldes von Zwönitz und hat sich, da es ihr finanziell schlecht geht, entschlossen, es zu verkaufen.«
Ein bislang unbekanntes Jugendwerk von Markus Zwönitz! Das wäre unbedingt einen großen Artikel wert. Ich hütete mich, etwas zu sagen.
Aber natürlich registrierte Victor meine Reaktion. »Kirsten, ich meine es ernst! Falls du mir nicht helfen kannst, ist es okay, aber du darfst das nicht benutzten.«
»Großes Pfadfinderinnen-Ehrenwort«, versicherte ich.
»Ich weiß, dass du nie freiwillig durch den Matsch gerobbt bist!«
»Okay, wenn ich etwas darüber schreibe, robbe ich durch Matsch – und du bestimmst, wo.«
Nachdem er gerade noch besorgt ausgesehen hatte, verzog sich sein Gesicht zu einem breiten Lächeln. »Deal!«
Mist, dachte ich. Aber Freundschaft ging vor journalistischem Ehrgeiz.
»Eine Galerie hat Marion viel Geld für das Bild geboten«, breitete Victor die interessante Geschichte weiter aus.
Ich nahm eine weitere Gabel Salat. Die alte Weisheit, nach der der Appetit mit dem Essen kommt, stimmte für mich. »Lass mich raten: Zwönitz verweigert seine Zustimmung?«
»Genau. Ich hätte nie gedacht, dass das nötig ist. Das Bild ist signiert, und die Galerie hat sogar ein Gutachten erstellen lassen. Es gibt keine Zweifel, dass es von ihm stammt.«
Ich zuckte die Schultern. »In der Kampfklasse gelten eigene Regeln. Was für ein Bild ist es denn?«
Ein wenig betreten gestand Victor, dass er es nicht wusste. Seine Nachbarin hatte ihm das Werk nicht gezeigt.
»Aber du glaubst ihr?« Immerhin konnte es auch sein, dass die Frau sich wichtigmachen wollte.
»Natürlich!« Victor war entrüstet. »Sie will eben nur nicht darüber sprechen. Und sie hofft auch immer noch, dass sie sich im Guten mit Zwönitz einigen kann.«
»Aber was sollst du nun tun?«
»Bislang hat Zwönitz sie nur an seinen Privatsekretär verwiesen, und der scheint kein besonders umgänglicher Mensch zu sein.«
Genau, jetzt fiel es mir ein: Was ich als Zwönitz’ Management abgespeichert hatte, war ein Privatsekretär. Ich trank einen Schluck Bier. »Und was kannst du da tun?«, wiederholte ich meine Frage in abgewandelter Form.
Victor wand sich sichtlich. »Vermitteln, das war die Idee.«
»Mithilfe deiner Freundin, der Kulturredakteurin.« Es sollte neutral klingen, ich fürchtete jedoch, Victor hörte, dass ich genervt war. »Du bist zu gut für diese Welt, das habe ich dir schon oft gesagt!« Ich pikste eine Tomatenhälfte auf. »Ich habe selbst schon mal für einen Artikel versucht, an Zwönitz heranzukommen – keine Chance. Selbst meine Chefin, die viele Künstlerinnen und Künstler kennt, beißt sich da die Zähne aus. Ich vermute, es wäre das Beste, wenn deine Nachbarin einen Anwalt beauftragt.«
Nun zeigte sich auf Victors Gesicht die Entschlossenheit, über die er bei aller Menschenfreundlichkeit verfügte. »Ich will es wenigstens versuchen.«
»Aber ich kann dir nicht helfen«, machte ich noch einmal klar. »Das ist eine Liga, in der ich nicht mitspiele. Da geht es vor allem um richtig viel Geld. Solche Bilder werden als Wertanlage gekauft, mit denen wird spekuliert.«
Victor nickte. »Ich weiß. Vermutlich denkt Marion, dass ich an Zwönitz herankomme, weil ich ab und an für Kunden Bilder kaufe – aber das findet natürlich auch nicht in der Preisklasse statt. Das höchste der Gefühle ist da mal ein signierter Druck, schon die sind ja für Normalsterbliche unerschwinglich.«
Ich fand es beeindruckend, wie wenig ihm die schwüle Hitze auszumachen schien. Andreas, mein Mann, hatte am Morgen gesagt, er habe die fünfte Nacht in Folge kaum geschlafen. Und das, wo er als freier Investigativjournalist viel mehr Stress hatte als ich in der Redaktion. Ich hoffte, er war jetzt zuhause und ruhte sich aus. »Ich weiß. Ich hatte mal damit zu tun, dass ein Museum signierte Drucke nicht ausstellen konnte, weil die Versicherung zu teuer war«, erinnerte ich mich. »Ohne zu wissen, um was für ein Bild es sich handelt, vermute ich, dass es um Zwönitz’ Marktwert geht. Wenn das Werk schlecht ist, könnte sein Ansehen sinken. Oder aber«, kam mir ein anderer Gedanke, »die Summe, die deiner Klientin geboten wurde, ist für einen echten Zwönitz zu niedrig und der Verkauf würde die Kurse versauen.«
Victor schüttelte den Kopf. »Wir reden über den Preis eines Eigenheims.«
Ich nickte nur. Nach allem, was ich über die Summen auf dem Kunstmarkt wusste, schockte mich in der Hinsicht nichts mehr. Wenngleich ich nur zu gern über dieses Bild und das Angebot geschrieben hätte. »Welche Galerie ist es denn?«
»Invers«, antwortete Victor, schoss dann einen scharfen Blick aus seinen eigentlich so sanften braunen Augen ab. »Denk an den Matsch!«
Eine sehr junge Galerie, die im vergangenen Jahr mit der Ausstellung einer Graphic Novel-Künstlerin aufgetrumpft hatte. Ich fragte mich, warum Zwönitz’ Jugendliebe, die ja wie er über 70 sein würde, Invers kontaktiert hatte und nicht eines der traditionellen Häuser. Auf meine Frage hin beschwor Victors Blick mich regelrecht.
»Ich schreibe nichts, habe ich doch versprochen. Aber ein bisschen Neugierde musst du mir schon zugestehen!«
Zögerlich berichtete er, dass seine Nachbarin erst eine alteingesessene Dresdner Galerie kontaktiert hatte. »Die haben aber abgewunken und ihr Invers empfohlen.«
»Die werden gewusst haben, wieso«, mutmaßte ich. »Ich fürchte, dir wird nichts anderes übrigbleiben, als dich mit diesem Privatsekretär auseinanderzusetzen.« Es wurde Zeit, dass ich nach Hause kam. Zu Andy, unter die Dusche, ins Bett.
Victor druckste herum. Er signalisierte der Kellnerin, dass er noch ein Wasser wollte. Ich rief durch den Raum, sie sollte auch für mich eines bringen.
»Dieser Mensch hat Marion richtig bedroht«, ließ er endlich die Katze aus dem Sack.
»Wie, bedroht?« Ich stürzte einen großen Schluck des eiskalten Mineralwassers herunter, kaum dass die Kellnerin die Gläser abgestellt hatte.
Victor wartete mit der Antwort, bis sie sich wieder entfernt hatte. »Wenn es ihr gelingen sollte, das Bild ohne Zwönitz’ Einwilligung zu verkaufen, würde sie verklagt. Sie solle sich darauf einstellen, dass sie ihres Lebens nicht mehr froh würde.«
»Das ist jetzt keine so schreckliche Drohung, oder?«
»Kirsten, die Frau hat Multiple Sklerose, ist arbeitsunfähig und lebt von einer Mini-Rente. Für sie ist das eine Drohung!«
Er schaffte es, dass ich mich wie ein Monster fühlte. Ich murmelte etwas wie »Natürlich«, und fragte, was er nun tun wolle.
Er sei sich noch nicht ganz sicher, antwortete Victor. »Das Gespräch mit dem Privatsekretär bleibt mir ja, vielleicht finde ich noch einen anderen Weg.«
Natürlich kannte er durch seinen Job einige Leute im Kunstbetrieb, wenn auch nicht Künstler in Zwönitz’ Preisklasse. Eventuell konnte ihm von denen jemand weiterhelfen. Ich würde es ihm und seiner Nachbarin von Herzen gönnen. »Soll ich meine Chefin mal fragen?«, bot ich an. »Sie ist immer für eine Überraschung gut. Vielleicht fällt ihr etwas ein.«
Victor zog eine Grimasse. »Danke für das Angebot. Aber ich glaube, im Moment ist es am besten, wenn so wenig Leute wie möglich von der Geschichte wissen.«
*
Kurze Zeit später machte ich mich auch schon auf den Nachhauseweg. Für den Moment konnte ich Victor nicht weiterhelfen, und ich brauchte eine Dusche und hoffentlich ein wenig erholsamen Nachtschlaf. Wenn ich ausgeruht war, würde ich noch einmal neu nachdenken, jetzt war in meinem Kopf nur noch Watte. Verklebte, warme Watte.
In der Alaunstraße fand das pralle Leben statt. Der Platz vor dem Kulturzentrum Scheune war voller Menschen, die meisten der dort Feiernden waren vermutlich nicht in Deutschland geboren. Aus etlichen Geräten schallte Musik, orientalische Klänge mischten sich mit Gangsta Rap, der Pegel der Gespräche dazu war ebenfalls beachtlich. Zigaretten- und sonstiger Qualm waberte durch die feucht-stickige Luft, mischte sich mit dem Geruch nach Bier und Schweiß.
Normalerweise genoss ich das Großstadtgefühl in der Neustadt, aber nicht an diesem Abend. Ich beschleunigte meine Schritte, bis ich in die Böhmische Straße einbiegen konnte, wo es deutlich ruhiger war. Zum Glück lag unser Schlafzimmer nach hinten hinaus; das Fenster zum Hof konnte nachts weit offenstehen, ohne dass wir durch Lärm wachgehalten wurden.
Schleppend stieg ich die Treppen in den zweiten Stock hoch, zerrte gleich hinter der Tür die Sandalen von meinen Füßen. Ich schaute in das neben dem Eingang liegende Wohnzimmer und wunderte mich, dass mein Liebster weder dort noch auf dem Balkon war. Auf dem kleinen Tisch draußen stand eine leere Bierflasche neben einem Aschenbecher. Im Zuge einer extrem belastenden Reportage über AfD- und sonstige rechts-außen-Bürgermeister in Sachsen hatte Andreas wieder zu rauchen begonnen. Ich fand es schrecklich, hasste den Geruch ebenso wie den Geschmack beim Küssen, und akzeptierte es nur, weil er versichert hatte, nach Abgabe des Artikels sofort wieder aufzuhören.
Ich nahm die Flasche mit hinein und stellte sie in der aufgeräumten Küche auf die Arbeitsfläche, ging ins Arbeitszimmer. Viel zu oft saß Andreas bis spät am Schreibtisch. Jetzt war der Raum jedoch verwaist. War er noch einmal irgendwohin aufgebrochen? Schließlich war es gerade mal zehn Uhr. Aber sein Schlüsselbund lag auf der Kommode im Flur. Die Schlafzimmertür war geschlossen, also war er wohl früh zu Bett gegangen, was ihm bestimmt guttun würde.
Ich beschloss, mir noch die lange ersehnte Dusche zu gönnen und dann ebenfalls unter die Decke zu kriechen. Selbst für die Tagesthemen war ich zu erledigt. Ich zog mich aus, stopfte die durchgeschwitzten Sachen in den Korb mit der Schmutzwäsche und brauste mich lauwarm ab. Danach fühlte ich mich deutlich besser.
Als ich in das dunkle Schlafzimmer kam, hörte ich Andreas’ leisen Atem. Ich legte mich neben ihn und schlief sofort ein.
*
Hinter den Vorhängen war die Dämmerung zu erahnen, als ich durch ungewohnte Geräusche geweckt wurde. Mühsam kämpfte ich mich durch den Schleier des Schlafes. Andreas atmete schwer und rasselnd, dazwischen hörte ich ihn würgen. Er hatte die dünne Decke von sich gestrampelt und krümmte sich zusammen. Ruckartig richtete ich mich auf.
»Andy? Andy! Was ist los, ist dir schlecht?«
»Ja. Nein. Weiß nicht«, brachte er mühsam hervor und presste beide Hände auf die bloße, linke Brust. Ich war schlagartig wach und sprang aus dem Bett, stürzte zum Telefon im Flur und noch während ich den Notruf wählte, wieder zurück, um Andreas nicht aus den Augen zu lassen.
»Mein Mann – vielleicht das Herz – bitte –« Meine Stimme erstarb, da folgte auch schon die Frage nach unserer Adresse.
In wenigen Minuten sollte ein Rettungswagen da sein.
Ich fühlte Andys Stirn, die mit eiskaltem Schweiß bedeckt war, bemühte mich, Ruhe auszustrahlen, sagte ihm, dass Hilfe unterwegs sei, wäre beinahe in ein hysterisches Lachen ausgebrochen, als ich daran dachte, wie ungern er Ärzte aufsuchte, und was für eine Abneigung er gegen Krankenhäuser hatte.
Planlos warf ich Wäsche und Handtücher in eine Tasche. Pyjamas besaß Andreas nicht, er schlief lediglich mit Boxershorts, mitunter einem T-Shirt bekleidet. War das ein Problem? Was für eine idiotische Frage!
Andy stöhnte lauter, ich legte ihm wieder meine Hand auf die Stirn, redete sinnloses Zeug.
Als es klingelte, raste ich zum Haustüröffner und betätigte ihn, stopfte noch schnell ein Shirt in die Tasche, suchte und fand Andys Portemonnaie, in dem sich hoffentlich die Versicherungskarte befand, und sein Smartphone.
Mit einem knappen Gruß trat eine Notärztin ein, hinter ihr zwei Rettungsassistenten mit einer Trage. Sie folgten mir zum Schlafzimmer, die sehr junge Frau beugte sich über Andy, sprach ihn an und prüfte seinen Puls, öffnete ihre Einsatztasche und legte Elektroden an, mit denen, wie ich wusste, EKGs erstellt wurden. Nachdem sie die Kurven auf ihrem I-Pad betrachtet hatte, nickte sie einem der Rettungsassistenten zu, der daraufhin Andys Blutdruck maß.
»165 zu 100«, gab er das Ergebnis wieder. Viel zu hoch. Verdammt, warum war Andy nie zu einer einzigen Vorsorgeuntersuchung gegangen? Ich suchte seinen Blick, er wirkte paralysiert.
Als nächstes steckte der Mann ein Gerät auf Andreas’ rechten Zeigefinger und studierte die Zahlen, die auf dessen Display erschienen. Die schienen immerhin kein weiterer Anlass zur Sorge zu sein, denn er murmelte nur »Passt«.
Die Ärztin hatte in der Zwischenzeit den linken Arm meines Liebsten abgebunden und eine Spritze angesetzt. »Ich lege Ihnen einen Zugang für ein Schmerzmittel und einen Blutverdünner sowie ein Mittel gegen den Bluthochdruck«, erklärte sie ruhig. »Dann bringen wir Sie ins Krankenhaus.«
Wie schlecht es meinem Liebsten ging, war spätestens jetzt klar, als er ergeben die Augen schloss.
Eher Sekunden als Minuten später schickten sie sich an, die Wohnung zu verlassen.
»Wohin fahren Sie?« Meine Stimme klang heiser. »Kann ich mitkommen?«
»Nicht im Rettungswagen«, sagte die Ärztin. »Krankenhaus Friedrichstadt, Kardiologie.«
Als sie aus der Tür waren, registrierte ich, dass ich noch mein dünnes, ärmelloses Nachthemd trug. Schnell riss ich ein Leinenkleid aus dem Schrank, das ich über das Hemdchen zog und stolperte in meine Sandalen. Ich schaffte es kaum, meinen Rucksack und die Tasche mit Andys Sachen, Fahrradhelm und Schlüssel zu greifen, bevor ich aus dem Haus stürzte.
2. Kapitel
»Ihr Mann hat übermorgen Geburtstag«, bemerkte die Angestellte an der Anmeldung des Krankenhaus Friedrichstadt, nachdem sie Andreas’ Versicherungskarte eingelesen hatte.
Die in ruhigem, freundlichem Ton gemachte Aussage sorgte dafür, dass mir die Tränen in die Augen schossen. »Er wird doch erst 50!«, platzte ich heraus. »Das ist doch viel zu früh für einen Herzinfarkt!«
Niemand hatte das Wort ausgesprochen, aber das war auch nicht nötig.
»Das gibt es leider immer mal wieder«, sagte die Frau. »So viele Faktoren, die das bestimmen.«
»Er hat so lange nicht geraucht! Und wirklich dick ist er auch nicht! Ja, er macht nicht viel Sport und trinkt regelmäßig Alkohol …« Ich wurde immer leiser, spürte, dass ich mich selbst überzeugen wollte. Wie jeder aufgeklärte Mensch kannte ich die Risikofaktoren, und Andreas lebte nicht gesund.
»Es wird bestimmt alles gut«, versicherte die Angestellte, während sie ihren Blick schon der Frau hinter mir zuwandte.
Ich murmelte »Danke« und ging zu einer Bank an der Seite, setzte mich. Nachdem ich so schnell wie möglich über die Marienbrücke in den linkselbischen Stadtteil gefahren war, hatte ich mich auf dem ausgedehnten Klinikgelände zur Kardiologie durchgefragt, nur um dort zu erfahren, dass mein Mann bereits im Katheterlabor lag, wo ihm Stents gelegt wurden, und ich ihn erst sehr viel später auf der Intensivstation würde sehen können. Zunächst einmal sollte ich ihn anmelden. Froh, etwas zu tun zu haben, war ich in das Eingangsgebäude an der Friedrichstraße zurückgegangen und hatte das Formular für Andreas ausgefüllt. Dort wurde auch nach seinem Hausarzt gefragt. Voller Wut strich ich das Feld durch. Warum nur hatte ich ihn nicht mehr gedrängt, sich einen Arzt zu suchen und routinemäßige Check-Up-Untersuchungen machen zu lassen?
Längst war draußen eine strahlende Sonne aufgegangen, es würde ein weiterer glühend heißer Augusttag werden. Ob sie in diesem Katheterlabor eine Klimaanlage hatten? War Andy gerade warm oder kalt? Hatte er Schmerzen? Angst? Ich weinte. Durch den Schleier der Tränen schaute ich auf einen alten Mann, der gerade das Gebäude betrat.
Musste ich Andreas’ Familie benachrichtigen? Sein Verhältnis zu den Eltern – Hamburger Unternehmer im Ruhestand – und seinem Bruder war unterkühlt, eigentlich ein Nicht-Verhältnis. Und genau so wollte er es auch. Ich vertagte die Frage. Ich würde Andy sprechen können, sagte ich mir mit aller Entschiedenheit. Früher oder später, und dann konnte er das selbst entscheiden. Falls nicht, dann – ich verbot mir, an der Stelle weiterzudenken.
In drei Tagen hatte Andreas Abgabefrist für die große Rechts-außen-Reportage. Die Zusage der Wochenzeitung Jetzt, der bedeutendsten Zeitung Deutschlands, für den Artikel war sein größter Erfolg seit er als freier Journalist selbstständig arbeitete, und er hatte sich mit noch mehr Engagement als üblich hineingestürzt. Und war prompt ständig gestresst gewesen. Verdammt!
Acht Uhr. Zu früh, um meine Chefin anzurufen und ihr zu sagen, dass ich später oder gar nicht kommen würde. Ich bemerkte einen Getränkeautomaten an der Wand und holte mir einen Kaffee, nahm ihn mit zu der parkähnlichen Fläche zwischen den Gebäuden. Unter einem der hohen Bäume war die Temperatur angenehm, und ich trank mit kleinen Schlucken. Der Kaffee schmeckte grässlich und machte mich noch nervöser. Ich goss die Flüssigkeit aus und warf den Becher in einen Abfalleimer, ging zu dem seitlich liegenden Haus R mit der Kardiologie- und Intensivklinik. Der Informationsbereich, von dem aus ein junger Pfleger mich zur Anmeldung geschickt hatte, war frei. Hinter der Theke stand nun eine ältere Frau.
Ich räusperte mich, unsicher, ob meine Stimme mir gehorchte, fragte, ob sie wisse, wann ich zu meinem Mann könne.
»Andreas Rönn, sagen Sie?«
»Ja.«
»Der ist noch im Katheterlabor. Dann kommt er auf die Intensivstation. Aber wenn er da zwei Stunden stabil ist, kann er Besuch empfangen.«
Nein, Genaueres könne sie nicht sagen. Eigentlich logisch, dass während einer Operation keine Updates herausgegeben wurden, aber ich fühlte mich innerlich zerrissen, wollte einfach nicht akzeptieren, dass ich im Moment nur warten konnte.
»Danke«, sagte ich leise.
Ich sollte doch erst einmal nach Hause fahren, sagte sie. »Frühstücken Sie in Ruhe, dann vergeht die Zeit schneller.«
Ein guter Tipp dachte ich. Ich könnte duschen, das Nachthemd ausziehen, dass sich unter meinem Kleid in unangenehmen Falten um meinen Körper legte, in Ruhe überlegen, was Andreas noch brauchen würde, und ja, etwas essen und vielleicht einen Kräutertee trinken.
Ich blieb. Ich musste einfach in Andys Nähe sein. Allerdings ließ ich mir den Weg zu dem Warteraum an der Intensivstation zeigen. Dort war niemand außer mir, außerdem war es vergleichsweise kühl. So bequem wie möglich in einen Stuhl am gekippten Fenster ausgestreckt, kam ich ein wenig zur Ruhe.
Es war so etwas wie Liebe auf den ersten Blick gewesen, als ich Andreas kennengelernt hatte. Ihm eilte ein Ruf voraus: Chaot, Draufgänger, der für eine Story alles riskiert, auch: Trinker und starker Raucher. Im zweiten Nachwendejahr galt er in der Erfurter Redaktion des Tageskurier schon als alter Hase, ich kam direkt nach meinem Volontariat aus Dortmund. Ich war ein halbes Jahr älter, aber er hatte schon deutlich mehr erlebt. Sich mit seinen Eltern überworfen, deswegen und um dem Wehrdienst zu entgehen, nach Berlin gezogen. Er hatte in besetzten Häusern gelebt, eine preisgekrönte Reportage verfasst. Er trug Cowboystiefel.
Weinte oder lachte ich bei dieser Erinnerung? Die Stiefel waren peinlich gewesen, dachte ich nun, damals fand ich sie cool. Ebenso wie seine heruntergerockten Jeans und die knittrigen Hemden. Vor allem aber seinen Enthusiasmus, den Glauben, mit seinen Artikeln etwas verändern zu können.
Die Art, wie er mich ansah mit seinen strahlend grünen Augen. Wie er mich mitriss gleich im ersten Gespräch. Wie wir zusammen tanzten in einem der damals selbst im kleinen Erfurt aus dem Nichts entstehenden Clubs. The Rolling Stones: »It’s Only Rock’n Roll (but I like It)«
Wie wir das erste Mal zusammen im Bett landeten.
Wie wir ein Paar wurden.
Wieder weinte ich, nun komplett haltlos. Das erste Mal in meinem Leben spürte ich, was die Redewendung ›sich die Augen aus dem Kopf weinen‹ bedeutete. Ich heulte buchstäblich Rotz und Wasser, bis keine Flüssigkeit mehr kam. Danach fühlte ich mich leer, taub, todmüde. Es war mittlerweile kurz nach zehn. Ich rief Marlen an.
Meine Chefin gab sich hörbar Mühe, ihren Schreck zu verbergen, als ich ihr berichtete, was passiert war. Sie kannte und mochte Andreas. Betont forsch sagte sie, es würde bestimmt alles gut. »Komm bloß nicht auf die Idee, du müsstest heute noch in die Redaktion! Du hast mehr als genug Überstunden«, schärfte sie mir ein und hängte sanft an: »Gib Bescheid, wenn es was Neues gibt. Und du kannst mich auch so jederzeit anrufen, das weißt du, oder?«
Ich wusste – oder ahnte – es. Als richtig befreundet hätte ich uns nicht bezeichnet, es tat gut, die Versicherung zu hören.
Ob Andreas bei der Jetzt auf einen ähnlich einfühlsamen Auftraggeber hoffen konnte, was die Abgabe der Reportage anging? Eigentlich sollte sich eine Fristverlängerung bei solch einem gravierenden Krankheitsfall von selbst verstehen, andererseits gab es für Freiberufler nie irgendwelche Garantien. Stets hing alles am guten Willen einzelner Redakteure.
Nachdem ich nun mein Handy in der Hand hatte, ging ich ins Internet, suchte nach Herzinfarkt. Las, wie wichtig der Faktor Zeit war, fragte mich, wie lange Andy sich schon im Bett gewunden hatte, bis ich wach geworden war. Las auch, dass die Todesrate noch immer hoch war. Klickte die Seite zu und steckte das Telefon tief in meinen Rucksack.
Hätte es etwas geändert, wenn ich am Abend zuhause gewesen wäre? Vielleicht hatte es Warnzeichen gegeben, immerhin war er so ungewohnt früh ins Bett gegangen. Ich hätte ihn gleich ins Krankenhaus befördern können.
Hör auf, befahl ich mir selbst. Andy hätte niemals eingewilligt, solange es ihm nicht richtig schlecht ging, und außerdem war es bestimmt früh genug gewesen. Niemand hatte etwas anderes in Betracht gezogen. Alles wurde wieder gut!
Mein Gedankenkarussell hörte nicht auf, sich zu drehen. Ich holte mein Handy wieder hervor, ignorierte die vor wenigen Minuten aufgerufene Internetseite, die nun wieder erschien, und tippte Markus Zwönitz in die Suchzeile, überflog die Ergebnisse.
Das meiste war mir bekannt: Im Ranking der größten Künstler – der Begriff bezog sich ausschließlich auf die Höhe der erzielten Verkaufspreise – lag Zwönitz weltweit auf Platz sechs. Den Künstlernamen hatte er nach seinem Geburtsort gewählt. Im Vorjahr war eine aufsehenerregende Retrospektive in Paris Anlass für viele lobende Artikel gewesen. Noch in diesem Monat sollte eine Ausstellung mit neuen Werken in Berlin eröffnet werden, auf die die Kunstwelt gespannt wartete. Markus Zwönitz befand sich auf dem Zenit seiner Karriere. Ich nahm mir seinen Werdegang vor:
… international bekannt wurde Markus Zwönitz, nachdem sein Zyklus »Aufbegehren« Mitte der 90er Jahre in New York Furore gemacht hatte, las ich in einem Internet-Lexikon. Die sieben Bilder beschäftigen sich mit dem offiziellen Kunstverständnis der DDR, wo Zwönitz zwar zum Kunststudium zugelassen worden war, nach Unterzeichnung der Biermann-Petition jedoch der Hochschule verwiesen –
»Frau Rönn? Sie können jetzt zu Ihrem Mann.«
Ich nahm mir nicht die Zeit, darauf hinzuweisen, dass ich einen anderen Nachnamen trug, sondern stürzte auf den Pfleger zu, Handy in der einen, meinen Rucksack und die Tasche mit Andys Sachen in der anderen Hand.
»Hier herein.« Er deutete auf die offenstehende Tür einer Umkleidekabine. »Ziehen Sie die OP-Mütze über Ihre Haare, legen Sie den Kittel und den Mund-Nasen-Schutz an. Wenn Sie sich die Hände desinfiziert haben, kommen Sie durch die hintere Tür direkt auf die Station.« Er klang müde.
Ich wollte ihm für seinen Einsatz danken, bis ich den Mund aufbekam, war er aber schon verschwunden. Mit steifen Bewegungen legte ich meine Habseligkeiten ab, streifte Mütze, Kittel und Maske über und hielt die Hände unter den Desinfektionsspender, klinkte die Tür mit dem Ellenbogen auf und stand gleich darauf in einem riesigen Raum, in dem ein antiseptischer Geruch hing, ein Grundton aus piepsenden Geräten herrschte und hartes Neonlicht jeden Winkel ausleuchtete. Wo mein Liebster im ersten der insgesamt fünf Betten lag und seine Lippen zu einem angedeuteten, schiefen Grinsen verzog, sobald er mich sah.
»Andy!« Unsicher, voller Angst, eines der vielen Kabel abzureißen, die scheinbar überall kreuz und quer hingen und sämtlich zum Bett meines Liebsten führten, legte ich die drei Schritte zu ihm zurück. Er war blass, sämtliches Blut schien aus seinem Gesicht gewichen zu sein, das eingefallen wirkte. Die Augen schauten mich jedoch klar und ungetrübt an. Musste er nicht noch benebelt von der Narkose sein? »Andy, verdammt noch mal –« Ich wusste nicht weiter. Durfte ich ihn berühren? Wozu hatte ich meine Hände desinfiziert? Vorsichtig strich ich ihm über den Unterarm, beugte mich dann sogar vor und legte meine Wange an seine. Roch trotz des Desinfektionsmittels in seinen Haaren den Rauch vom Vortag und hätte ihn gleichzeitig küssen und ohrfeigen können.
»Hi«, hörte ich seine Stimme an meinem Ohr. Er klang heiser. »Jetzt bin ich offiziell ein alter Mann.«
Ich spürte ein Lachen in meiner Kehle und richtete mich auf. »Idiot!« Er sah tatsächlich um Jahre gealtert aus. Das war mir allerdings so egal wie nur irgendetwas. »Du könntest ein toter Mann sein.«
»Quatsch. So schnell wirst du mich nicht los.«
»Wie lange –« begann ich, als eine Frau in grünem OP-Kittel erschien.
»Guten Tag, ich bin Dr. Kroschke«, stellte sie sich vor. Sie sprach mit osteuropäischem Akzent. »Wie fühlen Sie sich?« Das ging an Andreas.
»Wenn ich jetzt ›gut‹ sage, darf ich dann nach Hause?«
Die Ärztin begann herzhaft zu lachen. »Ganz bestimmt nicht.« Sie studierte den Monitor neben dem Bett. »Die gute Nachricht ist: Sie waren schnell genug hier.«
Ich hörte mein eigenes, erleichtertes Stöhnen überlaut.
»Wir haben Ihnen drei Stents gelegt und der Eingriff ist komplikationslos verlaufen.«
Diese Frau Doktor Kroschke erschien mir wie eine gute Fee. Auch sie sah müde aus, wirkte jedoch voll konzentriert.
»Ich hab’s mitbekommen«, sagte Andreas.
»Um das geschwächte Herz zu schonen, werden die Stents ohne Narkose eingelegt, lediglich die Einstichstelle an der Arterie wird betäubt«, lieferte die Ärztin eine knappe Erklärung.
Ich stellte es mir extrem gruselig vor, solch eine Operation bei vollem Bewusstsein zu erleben. Hilflos strich ich Andy wieder über den Arm.
»Aber Ihre Koronararterien waren in sehr schlechtem Zustand – auf gut deutsch: verkalkt. Was bedeutet, dass es auch jetzt noch Probleme geben kann. Die nächsten 24 Stunden sind entscheidend, deshalb werden wir sie mindestens so lange auf der Intensivstation unter Beobachtung behalten.«
Andy schluckte. Ich fragte mich, ob er wirklich gedacht hatte, er könnte schon bald wieder nach Hause.
»Dann verlegen wir Sie auf die Innere und danach sollten Sie sofort in die Reha«, fuhr die Ärztin fort.
Ihre Sätze führten bei meinem Mann dazu, dass er noch bleicher zu werden schien. »Aber ich muss arbeiten. Ich habe eine Abgabefrist für einen wichtigen Artikel.«
»Wann?«
»In drei Tagen«, sprang ich ein, und wandte mich an Andreas mit dem Angebot, die Redaktion anzurufen und um eine Verlängerung der Frist zu bitten.
»Tun Sie das«, lautete der Rat der Medizinerin. »Nehmen Sie den Stress raus, das ist ganz wichtig.«
»Nein, bitte, Kirsten …« Andys Augen flehten mich an, ich wusste aber nicht, worum er bat. Natürlich war dieser Artikel extrem wichtig für ihn, aber er musste doch einsehen, dass er jetzt nicht arbeiten konnte!
Doktor Kroschke wirkte ungeduldig. »Aus medizinischer Sicht gibt es da nichts zu diskutieren. Sie bekommen von uns jedes Attest, das sie benötigen.«
Andy ignorierte sie. »Die Reportage muss wie geplant nächste Woche erscheinen. Sonst hätten sie gewonnen.«
Ich wandte meinen Blick der Ärztin zu. Sie verstand und verabschiedete sich mit: »Fünf Minuten, dann gern morgen wieder.«
»Ich weiß, dass die Geschichte wichtig für dich ist«, begann ich, als Andreas mir auch schon ins Wort fiel:
»Sie haben mich bedroht. Extrem bedroht. E-Mails, einmal sogar ein Brief an unsere Adresse.«
»Das rechte Pack?«, fragte ich, ärgerte mich sofort, dass ich Zeit verschwendete. Natürlich sprach er über diejenigen, deren Treiben er aktuell recherchiert hatte, und die uns beide bereits im vergangenen Jahr bedrängt und körperlich angegriffen hatten. »Warum hast du nichts davon gesagt?«
»Der Text ist fast fertig«, sagte Andy, anstatt meine Frage zu beantworten. Seine Stimme klang immer leiser und schwächer. Er musste aufhören zu reden, er musste sich ausruhen! »Nur noch ein Passus über den parteilosen Bürgermeister einer Kleinstadt im Erzgebirge, der sich von den Freien Sachsen instrumentalisieren lässt. Da habe ich gestern erst Hintergrundinfos gekriegt.«
»Aber das reicht doch nächste Woche!«
Die Kopfbewegung sollte wohl »Nein« bedeuten. »Ich habe schon zwei Verlängerungen bekommen. Einmal um zwei Wochen und noch mal von Donnerstag auf Montag. Noch einmal machen die nicht mit. Und dann war alles umsonst.« Erschöpft schloss er die Augen.
Plötzlich wusste ich, worum er mich die ganze Zeit bat. »Ja, ich mach es«, versicherte ich ihm. »Ich schreib den letzten Teil und schick den Text in deinem Namen weg.«
*
Dieser Idiot! Wieso hatte er mir die Drohungen verschwiegen und sich allein dem Stress ausgesetzt? Rauchen anstatt zu reden? Und jetzt lag er mit einem Herzinfarkt auf der Intensivstation und die Ärztin meinte, es könnte noch Probleme geben …
Während ich dem Ausgang des Klinikgebäudes zustrebte, rief ich Marlen an und berichtete, wie es um Andreas stand.
»Ihr wart rechtzeitig da«, lautete ihre Reaktion weniger auf das, was ich gesagt, als auf das, was sie aus meinem Tonfall herausgehört hatte. »Und du weißt doch: Unkraut vergeht nicht.«
Ich lachte. »So was Ähnliches sagt er selbst auch.«
»Also mach dir nicht zu viele Sorgen. Er wird gut versorgt, ernährt sich zwangsweise gesund, und in der Reha muss er auch Sport machen.«
Mein Lachen klang schrill. »Und danach werde ich dafür sorgen!« Ich stand wieder in dem kleinen Park. Die Mittagssonne gleißte, ich lehnte mich an einen Baum. »Da ist noch was«, begann ich, und erzählte von der Reportage. Was sie für Andreas bedeutete, musste ich nicht betonen, dazu kannte sie ihren ehemaligen Kollegen gut genug.
»Typisch Mann, dass er das allein durchstehen wollte«, kommentierte sie. »Gut, wenn du ihm jetzt hilfst, es zum Abschluss zu bringen.«
Eine alte Frau mühte sich, einen sehr viel jüngeren Mann im Rollstuhl auf die vertrocknete Wiese zu schieben.
»Ja, denke ich auch«, sagte ich.
»Soll ich doch den Sonntagsdienst übernehmen?«
Diese Frau war einfach großartig! Vor Wochen hatte sie mich gebeten, zu tauschen, weil sie auf eine Party in Berlin eingeladen war. Andreas wollte an seinem Geburtstag ohnehin nichts Großes machen, also hatte ich zugestimmt – und würde auch jetzt nicht davon abrücken. »Nein, nein, ich denke, an Andys Geschichte ist nicht mehr viel zu machen, und die Arbeit wird mir guttun. Aber Danke für das Angebot.«
»Kein Problem. Dann sehen wir uns am Montag.«
Ich trat auf das ungleiche Paar zu und bot meine Hilfe an. Seufzend willigte die Frau ein und überließ mir die Griffe des Rollstuhls. Ich bugsierte ihn unter den Baum, an dem ich gestanden hatte. Auf den wenigen Metern zu meinem Fahrrad nahm die Hitze mir schier die Luft und ich spürte, dass mein Kreislauf kurz davor war, zu kollabieren. Einen Moment lang suchte ich im Schatten des Torhauses Halt an der Mauer, fuhr dann ganz langsam nach Hause.
*
Was sollte das heißen? Natürlich hatte ich meine liebe Not, Andreas’ handschriftliche Notizen zu entziffern. Zwar hatten wir in der Vergangenheit so manches Mal zusammengearbeitet und seine Schrift war mir vertraut, aber jeder Journalist entwickelte im Laufe der Jahre so etwas wie eine eigene Kurzschrift, um im Recherchegespräch die wichtigsten Fakten festzuhalten. Andy hatte die Interviews auch aufgezeichnet, weil es gerade bei solch einer brisanten Story rechtlich relevant sein konnte, dass ein Zitat nicht nur stimmte, sondern man es auch belegen konnte – nach Möglichkeit wollte ich mir die Aufnahmen aber erst zum Schluss zur Kontrolle anhören. Einzelne Passagen zum Schreiben herauszusuchen, war eine unendlich mühsame Angelegenheit.
Ich hatte geduscht, etwas gegessen, und saß nun in Unterwäsche an Andys Rechner. Er hatte mir gesagt, wo ich die Dateien und eben jenes Notizbuch fand, mit dem ich mich nun herumschlug, bevor er erschöpft aber halbwegs beruhigt eingeschlafen war.
Ich verstand immer besser, warum es ihm so wichtig war, dass die Reportage erschien. Zum Glück war der Text bis auf den letzten Teil komplett fertig, geschliffen druckreif formuliert, sodass für mich nur noch jener nach außen parteilose Bürgermeister übrigblieb, über den mein Liebster erst am Vortag weitere Informationen erhalten hatte.
Ein ums andere Mal hatte es mich während des Lesens geschüttelt. Ich war sicher, dass auf die Aussagen, die Andreas gesammelt hatte – sowohl von den Bürgermeistern als auch von deren Wählern – häufig der Tatbestand der Volksverhetzung zutraf. Dass sehr oft etwas wie »das können Sie ruhig schreiben!« dazu geäußert wurde, machte es noch ungeheuerlicher. Es gab auch Gegenstimmen – in jedem Ort hatte Andreas Menschen aufgetrieben, die versuchten, eine andere Form der Politik voranzutreiben. Sie berichteten von Hassbotschaften und Drohungen, durchstochenen Reifen und eingeworfenen Fensterscheiben. Das war die Gegenwart in Sachsen. Quasi nebenher hatte Andy aufgezeigt, wie dilettantisch die Rechten sich in der Realpolitik anstellten, dass sie nichts vorzuzeigen hatten, auch wenn sie teilweise schon seit Monaten im Amt waren.
Ich massierte mir die Schläfen, stand auf und schloss das Fenster, schaltete den Ventilator ein. Unser Urlaub im frisch-kühlen Irland zu Beginn des Sommers schien Lichtjahre her zu sein. Da war es Andy so gut gegangen! Aber auch dort hatte er zu viel getrunken. Wenn ich im Pub ein kleines Pint Bier nahm, war es bei ihm ein großes, und es blieb nie bei einem. Dazu Fleisch, Pommes und andere frittierte Lebensmittel. Aber wenigstens keine Zigaretten und kein Stress. Und wir waren gewandert.
Jetzt mach dich nicht verrückt, befahl ich mir selbst. Es war gutgegangen. Sollte es tatsächlich noch Probleme geben, war er in guten Händen. Und das Ganze würde ihm eine Warnung sein, in Zukunft besser auf sich zu achten.
Nein, so einfach war das nicht. Nicht bei Andreas Rönn. Aber ich würde ihn dazu bringen.
3. Kapitel
Wieder erwachte ich mit der einsetzenden Morgendämmerung, dieses Mal irritiert von der Stille im Schlafzimmer. Meine Hand fuhr zur linken Bettseite, und ich realisierte, dass Andy nicht da war, nicht da sein konnte, weil er im Krankenhaus Friedrichstadt auf der Intensivstation lag. Angeschlossen an all diese Geräte, inmitten von Rauschen und Piepen. Ich hoffte so sehr, dass er weder Schmerzen noch Angst hatte, dass er schlafen konnte, sich erholen. Obwohl ich nicht gläubig war, schickte ich eine Art Gebet an das Universum.
Am Vortag hatte ich bis weit in den Nachmittag hinein an Andreas’ Text gearbeitet. Schon unter normalen Bedingungen war es schwierig, im Stil eines anderen zu schreiben, und mein Liebster war nicht umsonst Investigativjournalist, während ich im Kulturbereich arbeitete. Er formulierte stets direkter, pointierter, frecher als ich. Ich hatte versucht, meine Sätze entsprechend anzugleichen, mich unter den gegebenen Umständen aber erst recht ungeheuer schwergetan.
Was hatte ich dann gemacht? Es fiel mir schwer, mich die wenigen Stunden zurückzuerinnern. Vermutlich, weil ich die Zeit in einem Zustand zwischen Wachen und Schlafen verbracht hatte. Da war eine spartanische Mahlzeit gewesen – das Vorhaben, Lebensmittel einzukaufen, hatte ich auf den heutigen Tag verschoben, eine weitere Dusche, Fernsehen und sehr früh dann mein Bett.
Nun war ich hellwach, ohne zu wissen, was ich um kurz nach vier tun sollte. Eine Zeitlang drehte ich mich von einer Seite auf die andere, genoss die angenehm kühle Luft, die durch die weit geöffneten Fenster hereinströmte, fiel noch einmal in einen leichten Schlaf, in dem mich wirre Träume von Operationen am offenen Herzen quälten. Der Arzt sah aus wie Markus Zwönitz und hatte eine Zigarette im Mund. Schweißgebadet schreckte ich hoch, als die Asche herabfiel.
Um fünf Uhr stand ich auf. Ging in die Küche und beschickte die Kaffeemaschine, inspizierte ein weiteres Mal die wenigen Vorräte und machte eine Einkaufsliste.
Ich brauchte ein neues Geburtstagsgeschenk für Andreas. Die vorgesehene Flasche Single Malt samt Gutschein für eine große Whiskey-Verkostung war wohl auf absehbare Zeit nicht das Richtige. Ohnehin müsste ich in die Altstadt fahren, um ein paar Pyjamas für ihn zu kaufen. Auf der Intensivstation würde er weiterhin einen der hinten offenen OP-Kittel tragen, hatte man mir am Vortag erklärt, danach bräuchte er aber eigene Wäsche.
Wann konnte ich wieder zu ihm?
Während ich ein paar Löffel Müsli aß, rief ich mit meinem Handy die Internetseite des Krankenhauses auf. Der Auftritt war entsetzlich unübersichtlich. Es dauerte ewig, bis ich die Information fand, die tägliche Besuchszeit liege zumeist zwischen 15:00 und 20 Uhr. So lange konnte ich auf keinen Fall warten! Ich würde später auf der Station anrufen.
Nach dem Frühstück nahm ich mir den Text noch einmal vor, feilte hier und da an einem Ausdruck, erklärte ihn dann für fertig. Ich würde ihn ausdrucken und Andreas mitnehmen; es würde ihn weniger stressen, wenn er sich solch einen wichtigen Artikel noch einmal anschaute, als wenn er nicht wüsste, was ich in seinem Namen eingereicht hatte.
Endlich konnte ich mich auf den Weg machen, um Lebensmittel einzukaufen. Es war ein besonderes Erlebnis, so früh im Ausgehviertel Neustadt unterwegs zu sein. Auf den Bürgersteigen und an den Straßenrändern lagen die Überreste einer Freitagnacht, die viele im Freien gefeiert hatten; vereinzelt waren schon die guten Geister der Stadtreinigung unterwegs, um die Spuren zu beseitigen. Bei den anderen Menschen, denen ich begegnete, fragte ich mich, ob sie vom Vorabend übrig waren oder sich auf ihrem Arbeitsweg befanden. In dem Supermarkt, wo ich zügig meinen Wagen belud, war ich so lange die einzige Kundin, bis ein Besoffener hereingetorkelt kam und lautstark nach Zigaretten fragte.
Als ich in der Böhmischen Straße die Zeitung aus dem Briefkasten holte, fiel mein Blick auf eine Anzeige für ein Beth-Hart-Konzert in Leipzig. Andy hörte die amerikanische Bluessängerin sehr gern – da hatte ich doch eine Geschenkidee! In der Wohnung war es kühler als draußen, also schloss ich sämtliche Fenster und zog auch gleich im Wohnzimmer, das nachmittags in der prallen Sonne lag, die Jalousien herunter. Halb neun. Ich suchte die Telefonnummer der 2. Medizinischen Klinik des Krankenhauses Friedrichstadt heraus und wurde von der Information aus sehr schnell und bereitwillig verbunden. Auf der Intensivstation klingelte es so lange, dass ich schon wieder auflegen wollte, als sich eine müde Frauenstimme meldete.
Meinem Mann ginge es soweit gut, teilte sie mir mit, allerdings werde er »wohl noch bis morgen« auf der Station bleiben.
Natürlich sorgte die Aussage dafür, dass bei mir die Alarmglocken schrillten.
»Hat sich sein Zustand verschlechtert?«
Der Blutdruck sei am Morgen wieder auf 165 zu 85 gewesen. »Da müssen die Ärzte eine medikamentöse Neueinstellung vornehmen und er muss beobachtet werden.«
»Ja, natürlich«, sagte ich und fragte, ob ich ihn sehen könnte.
»Nu, kein Problem. Gerade beginnt die große Visite, aber wenn Sie so um 12 kommen, passt das.«
*
Ich hatte keine Ahnung, welche Größe Andreas brauchte. Natürlich war ich nicht auf die Idee gekommen, in einen seiner Hemdkragen zu schauen; die Ziffern, die ich auf den Schlafanzugpackungen las, schienen mir denjenigen für Oberhemden zu entsprechen. Ratlos hielt ich Ausschau nach einer Verkäuferin. Ich befand mich in dem einen Kaufhaus, das es in Dresden noch gab, allerdings auch mit reduziertem Personalschlüssel.
»Nein, das sind die normalen Konfektionsgrößen«, wurde ich schließlich belehrt. Das half mir nicht weiter. Ihrem Blick nach fragte die Frau in meinem Alter sich, wie ich ohne solches Wissen bislang durchs Leben gekommen war. »50 / 52 entspricht in etwa M, 52 / 54 L«, lieferte sie mir eine Information, mit der ich etwas anfangen konnte.
Ich bedankte mich und erstand drei Pyjamas in 52 / 54, schöne, altmodisch gestreifte Modelle in Baumwolle, außerdem einen Bademantel. Eigentlich war es viel zu heiß dafür, aber spätestens in der Reha würde Andy ihn brauchen.
Wie gut es uns beiden ergangen war bislang, ohne ernsthafte Krankheiten! Gleich darauf dachte ich jedoch wieder wütend, dass Andreas vermutlich schon länger gesundheitliche Probleme hatte. Die nicht zum Infarkt hätten führen müssen, wenn er rechtzeitig zum Arzt gegangen wäre. Erst, als ich an der Kasse meine Kreditkarte aus dem Rucksack holen wollte, spürte ich, dass ich die freie Hand zur Faust geballt hatte.
Noch immer hatte ich über eine Stunde herumzubringen, bevor ich mich auf den Weg zum Krankenhaus machen konnte. Ich ging in die große Buchhandlung schräg gegenüber. Es würde Andreas bald besser gehen, einen anderen Gedanken wollte ich überhaupt nicht zulassen, und dann würde er sich über etwas zu lesen freuen.
Ich durchstreifte die Belletristik- und die Krimiabteilung, landete schließlich bei der regionalen Literatur. Ein Dresden-Krimi, der zurückführte in die Anfänge der Chipindustrie, das könnte etwas sein. Immerhin war Andy in jenen Jahren hergekommen. Anschließend kaufte ich in einem Supermarkt Weintrauben. Die würde er doch essen dürfen, es konnte nichts gegen Obst sprechen, oder? Ich war an dem Punkt angelangt, wo ich mich selbst dafür verfluchte, keine Ahnung von Medizin zu haben. Warum hatte ich Anglistik und Germanistik studiert? Was nutzte mir all mein Wissen über Kunst und Kultur?
Schließlich beschloss ich, meinen Weg in die Friedrichstadt auf eine größere Fahrradrunde durch den Großen Garten auszudehnen. Bewegung war für mich das beste Mittel gegen fruchtlose Grübeleien. Zwar ließ die Hitze es nicht zu, sich richtig auszupowern, aber ich genoss das Dahingleiten auf den Wegen der Parkanlage und erreichte etwas ausgeglichener das Eingangsportal des Klinikgeländes.
*
»Keine Panik«, lautete Andreas’ Reaktion auf meine besorgte Nachfrage, wie es ihm ginge. »War bloß ein bisschen hoher Blutdruck.«
»Vielleicht können Sie Ihrem Mann klarmachen, dass das keine Kleinigkeit ist«, sagte Dr. Kroschke, die neben dem Bett auf der Intensivstation erschien. »Sie sind dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen und sollten das ernst nehmen!«, verlangte sie von Andreas. »Ein anhaltend zu hoher Blutdruck ist ein Risikofaktor für einen weiteren Infarkt, und ob es dann so glimpflich ausgeht, steht in den Sternen.«
Ich war froh, dass die Frau Tacheles sprach. Vermutlich hatte sie damit eher Einfluss auf Andy als ich.
»Ich denke, dagegen kriege ich die Pillen«, hielt er dagegen. Es musste ihm schon deutlich besser gehen als am Vortag, wenn er sein übliches Selbstbewusstsein zeigte. Auch sein Gesicht wies wieder ein wenig Farbe auf. Nach wie vor war er an etliche Überwachungsmonitore angeschlossen, schaffte es aber, den Eindruck zu erwecken, er würde gleich aufstehen und herausspazieren. Was er vermutlich sehr gern tun würde.
»Dagegen gibt es auch Ernährungsumstellung, sofortigen Rauchstopp, weniger Stress und Sportaufbau«, machte die Ärztin ihm klar.
Andy verzog das Gesicht.
Ich hätte ihn am liebsten geohrfeigt. »Ja«, sagte ich. »Auf jeden Fall.« Ich fragte Dr. Kroschke, wie es nun weiterginge.
Sie richtete die Antwort an Andreas: »Sie bleiben mindestens bis morgen Früh, vielleicht auch bis Montag auf der Intensiv, den Blutdruck behalten wir ganz besonders im Auge. Dann geht es auf die Normalstation.« Sie machte eine Pause, studierte einen Kurvenausschlag auf einem Monitor genauer. »Erst da wird mit der Mobilisierung begonnen.«
»Aber ich muss –«, begann Andy.
»Du musst gar nichts!«, fiel ich ihm ins Wort. »Du wirst so lange aus dem Rennen genommen, wie es sein muss.«
Die Ärztin nickte. Auf der normalen Station würde mein Liebster ein bis zwei Wochen bleiben, je nach gesundheitlicher Entwicklung. »Und abhängig davon, wann ein Platz in der Reha für Sie frei ist. Die sollte sich sofort anschließen.«
»Ich muss zwischendurch auch mal arbeiten!«, beharrte Andy. Er sprach, als habe er die Zähne zusammengepresst.
»Nein«, lautete Dr. Kroschke schlichte Antwort. »Und regen Sie sich nicht auf, der Blutdruck geht schon wieder hoch.« Mit einem knappen Gruß ging sie weiter zu einem anderen Patienten.
Mit ihrem Weggang verlor Andreas etwas von seiner Sicherheit. »Kirsten, du weißt, dass ich nicht so lange nichts machen kann. Dann bin ich weg vom Fenster!«
Ich versuchte, die verstörende Umgebung mit all ihren Geräten auszublenden und mich ganz auf ihn zu konzentrieren. »Ich hab deinen Artikel fertig. Ich bring ihn dir morgen mit, dann kannst du ihn durchsehen. Aber du musst jetzt vernünftig sein!« Immerhin war die Station klimatisiert. Was mir am Vortag nicht aufgefallen war, registrierte ich jetzt dankbar.
»Das bin ich doch. Ich wollte doch sowieso wieder mit dem Rauchen aufhören, gesunde Ernährung ist okay, auch Sport, meinetwegen. Aber ich muss arbeiten!«
Das Schlimme war: Ich wusste, dass er recht hatte. Als freier Autor war er gezwungen, stets neue Artikel anzubieten und pünktlich zu liefern, sonst würde man ihn schnell von der Liste potenzieller Mitarbeiter streichen. Aber jetzt ging es nun mal nicht anders.
»Pass auf«, begann ich. »Du machst alles mit, ohne einen Aufstand zu veranstalten, und vielleicht kannst du ja in der Reha ein neues Thema in Angriff nehmen.«
Ich sah ihm an, dass er weiter argumentieren wollte.
»Wenn du nicht zustimmst, bringe ich dir den Artikel morgen nicht vorbei«, machte ich ihm klar.
Er gab sich Mühe, einen gleichgültigen Gesichtsausdruck zu zeigen und produzierte ein Achselzucken.
»Ich kann auch in der Jetzt-Redaktion anrufen und sagen, dass du den Artikel leider nicht liefern kannst.« Besorgt schielte ich auf die Monitore. Der Blutdruck musste jetzt eigentlich in horrende Höhen schießen. Tatsächlich schlug eine Kurve aus.
»Das wagst du nicht!«
»Lass es nicht drauf ankommen!«
Wütend starrte er mir in die Augen. Ich fragte mich, ob automatisch ein Alarm ausgelöst wurde, wenn der Blutdruck zu hoch war. Immerhin befanden wir uns auf einer Intensivstation. Nachdem wir diesen Kampf nun einmal ausfechten mussten, war hier der beste Ort dafür.
Endlich seufzte Andreas resigniert auf. »Das nennt man Machtmissbrauch, das ist dir klar, oder?«
»Ja«, sagte ich.
Von hinten näherte sich ein Pfleger mit einem Tablett, das er auf dem Nachttisch absetzte. »Ihr Mittagessen. Lassen Sie es sich schmecken!«
Auf einem Teller befand sich ein Stück gedünsteter Fisch, Kartoffelbrei und bis zur Unkenntlichkeit verkochtes Gemüse. Daneben stand ein Glas Wasser. Andy beäugte die Mahlzeit, nahm zögerlich eine Gabel und verzog angeekelt das Gesicht. Obwohl ich mir gut vorstellen konnte, wie fade es schmecken musste, drängte ich ihn, zu essen. »Dann kriegst du auch die hier.« Ich hielt die Weintrauben hoch.
»Hast du noch mehr erzieherische Maßnahmen auf Lager?«, murrte er.
»Ich lass mir was einfallen.«
*
Ich sollte auch etwas essen, machte ich mir klar, als ich das Gebäude verließ. Es schien wichtig, dass ich fit und gesund blieb. Am Vortag hatte ich in der Nähe des historischen Neptunbrunnens ein Café gesehen. Vielleicht gab es dort einen Salat oder eine Suppe.
Tatsächlich sah das Angebot recht vielversprechend aus, und ich bestellte eine Gemüsesuppe, setzte mich nach draußen in den Schatten. Vermutlich wurde die Ernährungsumstellung, von der die Ärztin gesprochen hatte, das kleinste Problem. Zuhause kochten wir schon meist eher gesund. Blieben die Snacks zwischendurch und allzu ausgiebige Mahlzeiten, wenn wir essen gingen, auch die gelegentliche Tiefkühlpizza in der heimischen Küche. Vor allem aber der regelmäßige Alkohol und zu viel Kaffee. Und immer wieder: der Stress.
Ich hatte die Suppe aufgegessen und überlegte, was ich mit diesem Samstagnachmittag anstellen konnte. In unsere Wohnung zog mich wenig, der Balkon lag nun in der prallen Sonne, in den Räumen wurde es schnell stickig. Langsam schlenderte ich zu meinem Fahrrad und schloss es auf, fuhr los, die Friedrichstraße entlang.
Bis ich den Bahnhof Mitte erreicht hatte, wusste ich, wohin ich wollte: zurück in die Altstadt, in die Bibliothek. In den Räumlichkeiten im Kulturpalast war es angenehm temperiert, und ich würde fundierte Informationen zum Thema Herzinfarkt finden – ohne die Bücher gleich kaufen zu müssen. Für den heutigen Tag hatte ich genug Geld ausgegeben.
Eine Stunde später hielt ich einen Stapel Ratgeber im Arm. Das Ernährungs-Programm für gesunde Gefäße, Ratgeber Herzinfarkt, Mediterrane Ernährung sowie Essen gegen Herzinfarkt. Außerdem Neustart – ein Herzinfarkt kann das Ende sein oder ein Anfang. Die Beschreibung dieses Buches klang ein wenig esoterisch, aber es war ein Text, der Mut machen wollte, und das konnte ich gebrauchen. Herzinfarkt – ein Medizinskandal ließ ich im Regal stehen. Nachdem die viel gescholtene Schulmedizin meinem Mann wahrscheinlich das Leben gerettet hatte, brauchte ich momentan keine alternativmedizinischen Tipps.
Auf dem Weg zu den Ausleihterminals passierte ich in der Fachbuchabteilung die Regale mit den K-Notationen, den Büchern über Bildende Künstler. Ein prachtvoll aufgemachter Band über Markus Zwönitz war prominent in der Mitte eines Bords aufgestellt. Es würde mir guttun, mich nicht ausschließlich mit Andreas’ Gesundheitszustand zu beschäftigen, dachte ich. Vielleicht kam ich auf eine Idee, wie Victor vorgehen konnte. Ich legte das voluminöse Werk zu den anderen Büchern, lieh alle aus und radelte langsam nach Hause.
*
Im Endeffekt konnte ich mit den Ratgebern zum Thema Herzinfarkt herzlich wenig anfangen. Die Tipps kamen mir allesamt banal und selbstverständlich vor. Wie schlecht viel rotes Fleisch war und wie gut Gemüse, wusste doch heutzutage wirklich jeder, dachte ich genervt. Und dass eine grundlegende Veränderung der Lebensumstände eine positive Angelegenheit sein konnte – geschenkt.
Säße Andreas mit mir auf dem Balkon, würde er darauf hinweisen, dass eine Kneipen-Tour mit ein paar Gläsern zu viel durchaus zur Lebensqualität beitragen konnte. Und er hätte nicht unrecht damit, auch wenn diese Exzesse für mich weitgehend passé waren. Meist ging ich eher früh mit einem Buch ins Bett. Andy dagegen zog nach wie vor gern mit Freunden oder auch allein um die Häuser. War gezogen, korrigierte ich mich. Auch damit musste nun Schluss sein. Ich hoffte, er würde es einsehen.
Es war früh am Abend und noch immer an die 30 Grad heiß. Obwohl wir viele Pflanzen auf dem Balkon hatten, darunter Efeu, das die Hauswand überzog, strahlte das Mauerwerk hinter mir zusätzliche Hitze ab. Nur gelegentlich sorgte ein leichter Windhauch für die Illusion von Abkühlung. Vielleicht war es im Innern der Wohnung kühler, nachdem den ganzen Tag niemand dort gewesen war.
Ich ging in die Küche, wo es ganz erträglich schien, und bereitete mir ein kleines Abendessen: Salat mit Schafskäse, Brot und Käse. Dazu Mineralwasser. Kurz liebäugelte ich mit dem Weißwein, der im Kühlschrank stand, wusste aber, dass mich nach den vergangenen Tagen schon ein kleines Glas aus der Bahn werfen würde. Während der Mahlzeit nahm ich mir das Buch über Zwönitz vor. Und war schnell fasziniert.
Natürlich kannte ich seine expressiven Bilder und hatte mich schon so manches Mal gefragt, wie der Maler es schaffte, seine Figuren, abstrahiert, wie sie angelegt waren, so ausdrucksstark wirken zu lassen. Die Äußerungen jedoch, die ich bislang von Markus Bürger, wie Zwönitz eigentlich hieß, vernommen hatte, machten ihn zu einem absolut unsympathischen Menschen. Soweit ich mich erinnerte, hatte er nichts ausgelassen: Frauen konnten seiner Meinung nach grundsätzlich schlechter malen als Männer, seine ehemaligen Weggefährten aus dem Osten waren Duckmäuser, seine Werke wurden zu Recht zu astronomisch hohen Summen gehandelt, er sah es aber nicht ein, Steuern zu zahlen. Alles lief hinaus auf: Jeder ist seines Glückes Schmied und die Verlierer sollten sehen, wo sie blieben.
Nun erfuhr ich etwas über seine Herkunft: das Aufwachsen in der Enge der Kleinstadt, ein gewalttätiger Vater, eine psychisch labile Mutter. Flucht in die Kunst, obwohl niemand in seinem Umkreis dafür Verständnis hatte. Zu malen galt als unmännlich, als brotlos ohnehin; der Jugendliche wurde von Familie und Lehrern gleichermaßen genötigt, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Lediglich seine Jugendfreundin Marion Schneider hielt zu ihm.
Das musste Victors Nachbarin sein, die ein frühes Werk von ihrem damaligen Freund verkaufen wollte, um ihre karge Rente aufzubessern. In Zwönitz’ Denken zählte sie wohl zu den Verlierern.
Marion Schneider malte selbst, laut Autorin des Buches gar nicht schlecht, und das Paar verbrachte endlose Stunden mit Diskussionen über Kunst, Schwärmereien von den großen Museen der Welt, von deren Besuch sie nur träumen konnten.
Jetzt hingen Zwönitz’ Werke in diesen Häusern, während Schneider noch immer Probleme haben dürfte, nach Paris oder Madrid zu kommen. Ob sie überhaupt mit ihrer Kunst weitergemacht hatte?
Ich überlegte, ob ich Victor anrufen sollte, beschloss aber, zunächst weiterzulesen.
Die junge Frau saß Zwönitz Modell und sorgte sogar für eine erste kleine Ausstellung in den Räumen der Bank, in der sie eine Ausbildung begonnen hatte, während Zwönitz auf die Erweiterte Oberschule ging.
Noch etwas hatten die beiden jungen Leute gemein: Zunehmend misstrauten sie dem SED-Regime, rieben sich an der Kulturpolitik nach dem 11. Plenum des ZK 1965, gestalteten sogar Flugblätter, die verlangten, die Kunst müsse frei sein.
Trotz aller Widerstände ließ Zwönitz nicht von der Kunst und schaffte trotzdem sein Abitur. Und bekam einen der begehrten Studienplätze in Dresden. Dort musste er sich allerdings mit genau der Kulturpolitik arrangieren, die er verabscheute. Was er eine Zeitlang versuchte, jedoch nicht schaffte. Erträglich wurde ihm das Studium nur durch Gleichgesinnte, mit denen er sich regelmäßig traf und über Kunst und Politik diskutierte. Sie nannten sich Abseits, organisierten gemeinsam Ausstellungen, ohne sich um die Regularien dafür zu scheren, träumten von einer Revolution der Maler und knüpften Kontakte in den Westen.
Draußen dämmerte es, ich stand von meinem Abendbrottisch auf und schaltete die Deckenbeleuchtung ein, räumte die Lebensmittel in den Kühlschrank. Vermutlich waren diese »Gleichgesinnten« aus den frühen 70er Jahren diejenigen, die Zwönitz später verächtlich gemacht hatte. Was war mit dem Mann passiert, nachdem er in den Westen ausgewiesen worden war?
Ich prüfte die Außentemperatur und riss sämtliche Fenster in der Wohnung auf. Mittlerweile war ich so müde, dass ich sofort hätte einschlafen können, aber dann wäre ich am morgigen Sonntag wieder extrem früh wach geworden. Außerdem wollte ich gern noch mehr über Zwönitz erfahren. Ich goss mir noch ein großes Glas Mineralwasser ein und begann von Neuem zu lesen.
In jener Zeit nahm der Maler auch sein heute weltweit bekanntes Pseudonym an. Es wurde darüber gerätselt, ob der Grund war, dass die Künstlergruppe Abseits in Dresden einige Bedeutung erlangt hatte. Die Orte der illegalen oder halblegalen Ausstellungen sprachen sich blitzschnell herum, Vernissagen wurden zu großen Happenings. Anscheinend ließ man die Freunde erst einmal gewähren. Mit Zwönitz’ Unterzeichnung der Biermann-Petition war jedoch eine Grenze erreicht. Er wurde ausgewiesen und musste im Westen, wo ihn zu dem Zeitpunkt noch niemand kannte, neu anfangen.
Mir fielen die Augen zu und ich gab auf, ging ins Bett.
4. Kapitel
»Herzlichen Glückwunsch!« Ich beugte mich vor und gab Andreas einen Kuss, überreichte ihm den Krimi, den ich liebevoll mit bunten Bändern umwickelt hatte. Darin lag ein Gutschein für die Konzertkarten.
Er sah deutlich besser aus, das Gesicht wies wieder Farbe auf, die grünen Augen vermittelten seine Ungeduld. Am Telefon hatte ich erfahren, dass sein Blutdruck stabil geblieben war, man ihn jedoch wegen der knappen Besetzung auf der Inneren noch bis Montagmorgen auf der Intensivstation behalten würde.
»Danke.« Er entfernte die Bänder und studierte den Klappentext. »Hört sich gut an.«
»Schau mal rein!«
»Wow! Beth Hart. Klasse! Aber wird das nicht zu aufregend für mich?« Die Frage war ironisch betont, aber tatsächlich hatte ich mich gefragt, ob er in sechs Wochen in der Lage sein würde, nach Leipzig zu fahren und dort zwei Stunden oder länger zu stehen.
»Ich hab die Tickets noch nicht gekauft«, sagte ich betont cool. »Wir können also erst einmal sehen.«
»Wie es dem Invaliden geht.«
»Genau.« Ich wich nicht von meinem flapsigen Tonfall ab. »Hier ist der Artikel. Vielleicht kannst du ihn jetzt direkt durchgehen? Ich hab ja Dienst.«
»Du hast ein Leben.«
Was sollte ich darauf entgegnen? »Also, ich hätte nichts gegen einen freien Tag einzuwenden.«
Von hinten näherte sich eine ältere Krankenschwester, sie schob einen Wagen mit Verbandsmaterial. »Ich würde mir einmal Ihre Einstichstelle ansehen«, sagte sie.