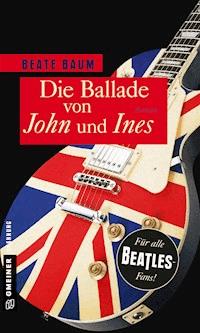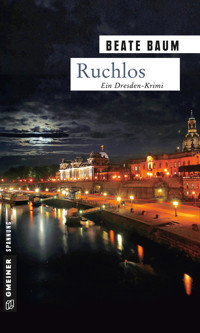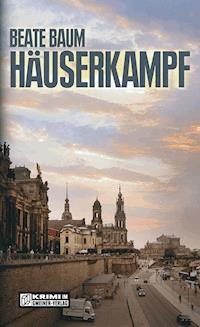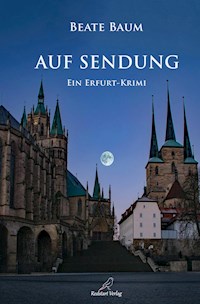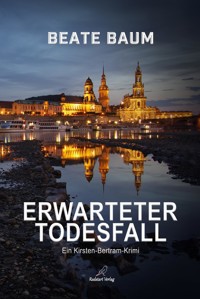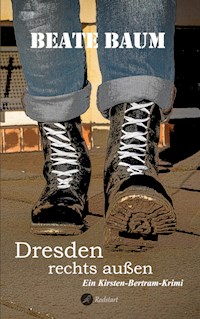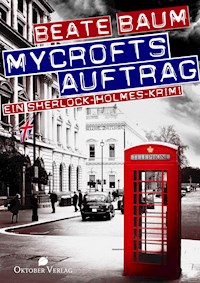4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Redstart Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als plötzlich Andreas wieder im Leben der Redakteurin Kirsten Bertram auftaucht, wird es kompliziert. Nicht nur, weil sie sich lange nicht zwischen ihm und ihrem aktuellen Freund entscheiden konnte und sich wieder zu ihm hingezogen fühlt. Andreas will auch einen Mord beobachtet haben. Überzeugt davon ist Kirsten nicht, dennoch hilft sie ihm bei seinen Recherchen. Anfang des Jahrtausends erschien der vorliegende Krimi unter dem Titel Dresdner Silberlinge in der legendären DIE-Reihe. »Beate Baum kann die Atmosphäre der Stadt gut vermitteln, auch manches Spießige, das sich gern zeitgeistig gibt«, meinte damals die Sächsische Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Epilog
Impressum
Vorwort
20 Jahre ist es nun her, dass ich das Manuskript »Dresdner Silberlinge« abgeschlossen hatte und damit zum Copyshop ging, es zigfach vervielfältigte und an alle möglichen Verlagshäuser im Land verschickte. Darunter auch an den Verlag Das Neue Berlin. Dort konnte ich die Cheflektorin direkt ansprechen, denn sie hatte die Ablehnung eines früheren Manuskripts von mir mit der Frage nach anderen Texten verbunden. Mein Anschreiben, dessen Word-Doc ich noch hier habe, begann mit: »Sehr geehrte Frau Oehme, Sie werden sich schwerlich noch an mich erinnern.«
Bereits wenige Tage später, es war ein Freitagnachmittag, erhielt ich einen Anruf. Dorothea Oehme wollte die »Dresdner Silberlinge« in der Traditionsreihe DIE – Delikte-Indizien-Ermittlungen herausbringen – und zwar schon im kommenden Frühjahr. Ein Grund zum Feiern, unbedingt: Kurz nach dem Telefonat kam mein Mann nach Hause und wir zogen los in die Neustadt, um das erste von vielen, vielen Malen anzustoßen auf meinen ersten Verlagsvertrag, meine erste Buchveröffentlichung.
Danach ging alles ganz schnell: Vertragsunterzeichnung, Lektorat – ganz altmodisch wurden noch mit mit Bleistiftanmerkungen versehene Ausdrucke hin- und hergeschickt, eine Premierenlesung organisieren. Und versuchen, mich nicht mehr wie eine Hochstaplerin zu fühlen, wenn ich mich als Autorin bezeichnete.
Im Februar 2001 erblickte »Dresdner Silberlinge« das Licht der Welt, es war der zweite Krimi, der in der sächsischen Landeshauptstadt spielte. Davor gab es einen, dessen Autor als Tatort die Frauenkirche gewählt hatte – marketingtechnisch natürlich deutlich geschickter, nichtsdestotrotz kann man das Buch heute in den Tiefen des Internets nicht mehr aufspüren. »Dresdner Silberlinge« – dass der Titel ungeschickt gewählt war, schwante mir bei der ersten Nachfrage, ob es sich um einen historischen Krimi handelt –, erlebte hingegen 2009 eine Neuauflage unter dem sehr viel passenderen Titel »Tod in Silicon Saxony« bei dem kleinen Leipziger fhl Verlag (sowie 2015 die Aufnahme ins Gmeiner Ebook-Programm). Und natürlich war es der Auftakt für meine Kirsten Bertram-Reihe.
Heute ist der Krimi natürlich auch ein Zeitdokument meines damaligen Schreibens – und so habe ich der Versuchung widerstanden, den Text zu bearbeiten, wenngleich es mich so manches Mal in den Fingern juckte, denn die eigenen Ansprüche sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten doch gewachsen.
Ein aus heutiger Sicht schier unglaublicher Rückblick auf die technische Entwicklung in der Halbleiterindustrie ist es ohnehin. Schließlich geht es um einen sensationellen Chip, auf dem man eine ganze CD abspeichern kann …
Abgesehen davon ging es natürlich von Anfang an um die Dreiecksbeziehung von Kirsten Bertram, Andreas Rönn und Dale Ingram. Uwe Schimunek schrieb in seinem Nachwort zu der Neuauflage des Buches im fhl Verlag: »Denn mal von den Verbrechen und dem coolen Dresdner Neustadt-Flair abgesehen – selbstverständlich reden wir hier über einem spannenden Dresden-Krimi, schließlich ist die Erstausgabe in der legendären DIE-Reihe erschienen – abgesehen vom Handwerk also, lebt das Buch von den großen Gefühlen, die auf Jahrtausende einfach pfeifen: Liebe, Eifersucht, Enttäuschung, Glück ...«
1. Kapitel
»Da sitzt Frau Bertram – Kirsten, Besuch für dich«, flötete meine Kollegin Frauke vom Türrahmen aus, strahlte den Besuch noch einmal an und verschwand aus dem kleinen Büro.
»Hallo«, sagte Andy. Er hatte sich kaum verändert. Ein wenig fülliger, das blonde Haar etwas dünner und sehr kurz geschnitten, ein paar Fältchen mehr um die strahlend grünen Augen … Mein Gott, wie lange war das jetzt her?
»Gut siehst du aus.« Er hatte seine kleine Reisetasche abgestellt und war seitlich um meinen Schreibtisch herumgegangen.
»Du aber auch.« Endlich stand ich auf, und wir umarmten uns lange. Dann drehte ich mich zu Ines um, mit der ich den Raum teilte, und übernahm die Vorstellung: »Ines Frey, seit ewigen Zeiten bei unserer edlen Zeitung hier – Andreas Rönn, ein ehemaliger Kollege und Freund. Heute Redaktionsleiter beim Tageskurier in Gera«, konnte ich mir nicht verkneifen anzuhängen.
Andy machte jedoch meinen Versuch aufzuschneiden gleich zunichte: »Nicht mehr. Seit zwei Monaten bin ich mein eigener Herr.«
»Du hast es tatsächlich getan!« Tausendmal hatten wir in Erfurt davon geträumt, frei zu arbeiten, wollten gemeinsam ein Büro aufmachen, uns nur noch mit den Themen beschäftigen, die uns interessierten. Dann – es war nun tatsächlich schon fast vier Jahre her – war Andreas auf die Leiterstelle weggelobt worden, ich hatte weiter in Erfurt beim Tageskurier geschuftet, bis ich vor einem halben Jahr die Mutterschaftsvertretung hier übernommen hatte.
»Ja, und es geht mir gut damit. Ich bin auch beruflich in Dresden. Ich schreibe über den Boom der Mikroelektronik im Osten.«
Warum war ich jetzt enttäuscht? Schließlich hatten wir schon ewig nichts mehr voneinander gehört, meine Entscheidung war damals nach vielem Hin und Her für Dale ausgefallen, und Andreas hatte mir schon vor zwei Jahren, als wir noch häufiger telefonierten, gesagt, dass er in Gera mit einer Frau zusammenlebte.
»Bist du gerade erst angekommen?«, fragte ich.
Er nickte: »12:52 Uhr am Bahnhof Neustadt. Und da eure Redaktion quasi auf dem Weg zu meiner Pension liegt, wollte ich dich persönlich fragen, ob du heute Abend schon etwas vorhast.«
Ich schüttelte den Kopf, ärgerlich und erfreut zugleich: »Mittlerweile gibt es auch hier Telefon. Du hättest ruhig mal vorher anrufen können. Aber gut: Treffen wir uns um sieben in der Planwirtschaft in der Louisenstraße, dann zeig ich dir die Neustadt. Solch ein Kneipenviertel gibt’s sonst höchstens noch in deiner alten Heimat.«
*
»Warum hast du dich nicht vorher gemeldet?«, fragte ich, als wir in der fast leeren Kneipe an einem der stilisierten Werktische saßen. Planübererfüllungs-Kumpel Adolf Hennecke blickte stoisch aus dem riesigen Deckengemälde auf uns herab, während Andy herumdruckste und sein Bierglas hin und her drehte.
»In solchen Momenten fehlt mir immer noch die Zigarette.«
»Stimmt. Ist mir doch gleich heute Mittag aufgefallen, dass irgendwas anders ist.«
»Und allein der Bauchansatz war’s nicht. Aber der stammt daher. Ja, vor drei Monaten habe ich die letzte geraucht.«
»Bei mir sind es ja jetzt schon fast zwei Jahre. Da verliert sich der Jieper so langsam. Aber in Stresssituationen juckt es immer noch.«
»Schöne Aussichten.« Er trank einen Schluck Bier. »Na ja, auf jeden Fall war ich einfach höllisch unsicher, wie es ist, wenn wir uns wiedersehen. Und deshalb hab ich den Anruf immer von einem auf den anderen Tag verschoben. Bis mir dann gestern klar wurde, dass ich nun genauso gut gleich bei dir vorbeigehen kann.«
Ich konnte ein Lachen nicht unterdrücken. Das war so typisch Andy. Eine Gruppe Jugendlicher stieg die Stufen in den Kneipenraum hoch und belegte lautstark einen Ecktisch. Ich schlug vor, zum Spanier in der Alaunstraße zu gehen.
*
Es war ungemütlich kalt, als wir gegen halb elf nach Unmengen von Tapas und Bier das Restaurant verließen. Dennoch beschlossen wir, noch einen kleinen Spaziergang zu machen. Schließlich wollte ich Andreas noch etwas von dem bunten Viertel mit den unzähligen Kneipen, Bars und Restaurants zeigen. Ich führte ihn durch den Hinterhof, der die Alaunstraße mit der Görlitzer Straße verbindet, an einigen halb verfallenen Häusern vorbei zurück auf die Louise. So langsam erwachte das Leben: Überall kamen uns junge Menschen entgegen, Punker mit ihren Hunden, langhaarige Typen, aber auch einige gestylte Schönheiten. Vor einem Kebab-Imbiss standen trotz der Kälte drei Männer essend auf dem Bürgersteig, vom gegenüberliegenden Blue Note drang ein kraftvoller Boogie-Woogie herüber.
»Du hast recht. Das Viertel kann locker mit Berlin mithalten«, staunte Andy. »Ich glaube, du hast es ganz gut getroffen. Du kannst dir wohl noch vorstellen, wie es an solch einem Mittwochabend in Erfurt aussieht.«
Während des Essens hatte er erzählt, dass er zurück in die Thüringer Landeshauptstadt gezogen war, nachdem er den Job beim Tageskurier geschmissen hatte. Seine Beziehung war schon Monate zuvor beendet gewesen. Er wirkte heimatlos. Fast schämte ich mich für mein Wohlgefühl in Dresden, mit Dale.
Am Jazz-Café bogen wir zum Martin Luther-Platz ein. Andy bewunderte die herrliche Gründerzeit-Bebauung und die imposante Kirche, ich spürte jedoch, dass er nicht bei der Sache war. Als ich vorschlug, noch einen Absacker zu nehmen, stimmte er sofort zu.
Der Barraum des Raskolnikoff war so voll, dass wir nur mit Mühe einen winzigen freien Tisch mit zwei kunstvollen, aber grässlich unbequemen Stühlen fanden. Nachdem wir bestellt hatten, rückte Andy auf dem Sandboden nahe an mich heran, um Frank Zappa und die Stimmengeräusche zu übertönen.
»Da ist noch etwas«, begann er. »Ich habe mich zwar bei dir nicht angemeldet, dafür aber bei dem großen SAI-Chipwerk angekündigt, dass ich die Geschichte gemeinsam mit einer Kollegin von der Sächsischen Rundschau mache, also – mit dir.«
»Du hast was?!« Das war nun allerdings auch wieder typisch Andy: andere ohne zu fragen einzuspannen und dann zu glauben, dass man seinem jungenhaften Grinsen alles verzieh. »Selbst wenn ich Zeit hätte, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben hier von Anfang an jeden Furz über das Werk berichtet. Ich denke, wenn ein Leser heute SAI liest, bekommt er einen Gähnkrampf!«
»Also, Zeit hast du doch wohl genug, nach allem, was du mir heute erzählt hast.« Er ignorierte mein wütendes Atemholen – tatsächlich hatte ich ihm berichtet, wie angenehm und zugleich langweilig der »Dienst nach Vorschrift« war, den ich auf meiner Vertretungsstelle schob. »Und es gibt was Neues, das ihr garantiert noch nicht hattet: SAI Dresden ist das einzige Werk weltweit, das demnächst einen Chip produzieren wird, auf dem ganze CDs abgespeichert werden können. Das wird den Musikmarkt revolutionieren.«
Bob Dylan löste mit einer ruhigen, altersweisen Version von »The Times they are a-changin’« Zappa ab, die Kellnerin brachte unser Bier. Ich trank einen großen Schluck.
»Ah ja. Und woher weißt du das?«
»Eine alte Bekannte aus Berlin arbeitet hier in der Technischen Entwicklung. Neulich haben wir nach Ewigkeiten mal wieder telefoniert, da hat sie mir das erzählt. Bei der Presseabteilung musste ich zwar reichlich Überzeugungsarbeit leisten, weil sie das eigentlich erst in einer Woche öffentlich machen wollen, aber schließlich habe ich es geschafft. Und weil ich dachte, du würdest vielleicht gern mal wieder mit mir zusammenarbeiten, habe ich dich eben mit angekündigt.« Da war es, das Grinsen.
»Und wie üblich hast du es nicht für nötig gehalten, mich vorher zu fragen. Nein, danke, kein Interesse.« Ich winkte der Bedienung, um zu zahlen.
»Hey, komm, Kirsten, sei nicht sauer. Lass uns noch ein Bier trinken, ja? Nur noch eins.«
»Trinken tust du noch genauso viel wie früher. Im Gegensatz zu dir muss ich morgen früh arbeiten.« Dennoch nickte ich schließlich, als die junge Kellnerin an unseren Tisch kam, und Andy orderte zwei weitere Pils.
»Wenn du willst, kann ich dich ja morgen ganz einfach entschuldigen. Aber es wäre doch auch für dich mal wieder was anderes, als über Verkehrsumleitungen oder das Baby des Monats zu schreiben.«
Unwillkürlich nickte ich. In den letzten Monaten hatte mein Job tatsächlich wenig Aufregendes geboten. Andreas wusste, dass es mir Spaß machte, mich in neue Themen einzuarbeiten, sie für die Leser aufzubereiten. Ich schaute ihn an, wie er eine Zigarettenschachtel auf dem Tisch neben uns fixierte, und musste lächeln. Ja, doch, und ich würde tatsächlich nach so langer Zeit gern einmal wieder mit diesem Chaoten zusammenarbeiten.
*
Dale kam erst nach Hause, als ich am nächsten Morgen in der Küche beim Frühstück saß. Er sah fürchterlich übernächtigt aus. Ich hatte den riesigen DDR-Heizkörper voll aufgedreht, um die Novemberkälte zu vertreiben, die über Nacht das ganze Haus ausgekühlt hatte, und mich in meinem alten Morgenmantel auf das Küchensofa gekuschelt.
»Schön warm hier.« Er wickelte sich aus einem beigefarbenen Wollschal, öffnete seine Lederjacke und gab mir einen Begrüßungskuss. »Das ist wirklich kein Wetter mehr für nächtliche Observationen.«
»Hast du denn wenigstens was mitbekommen?«
»Natürlich nicht.« Er schüttelte den Kopf, als ich ihm die Kaffeekanne hinhielt, strich sich mit einer müden Bewegung das schwarze Haar aus der Stirn. »Nein, ich habe heute Nacht schon viel zu viel gehabt. Ich glaube, ich gehe gleich ins Bett. Heute Nachmittag muss ich der Firmenleitung Bericht erstatten, und wenn ich Pech habe, wollen Sie, dass ich mich noch eine Nacht auf die Lauer lege. Manchmal hasse ich diesen Job wirklich.«
Jacke und Schal in der Hand verließ er die Küche. Ich konnte ihm gerade noch ein »Schlaf gut« hinterherrufen. Mein Schlaf war nicht gut gewesen. Das Wiedersehen mit Andreas hatte mich ziemlich aufgewühlt.
*
»Und? Gab es Probleme?« fragte Andy, als wir uns um halb drei am Albertplatz trafen, und ergänzte, als ich ihn fragend ansah: »In der Redaktion.«
»Ach so, nein. Ich habe in der Konferenz angekündigt, dass ich an einem neuen SAI-Chip dran bin und den ganzen Nachmittag unterwegs sein werde. So viele brandaktuelle Geschichten habe ich ja nun tatsächlich nicht auf dem Tisch.« Ich trat von einem Fuß auf den anderen und bohrte die Hände noch tiefer in die Taschen meines Trenchcoats. »Du hast dir wirklich die falsche Zeit für deinen Besuch ausgesucht. Diese Brunnen hier« – ich wies mit dem Kinn auf die beiden großen, runden Bauwerke rechts und links der Straßenbahnhaltestelle – »sehen im Sommer wunderschön aus, wenn das Wasser vor den Figuren aufsteigt. Jetzt ist alles so tot.«
Endlich hielt die Linie Sieben, die uns die Königsbrücker Straße hoch nach Klotzsche zu dem größten Mikrochip-Werk Deutschlands bringen sollte.
»Also, ich finde, die Stadt sieht auch jetzt klasse aus«, sagte Andreas, als wir uns gesetzt hatten. »Ich bin heute Vormittag ein bisschen herumgelaufen und hab mich gefragt, warum ich nicht viel früher mal hergekommen bin.«
Er öffnete seine gefütterte Cordjacke, und ich erkannte darunter das blau-grau gestreifte Hemd, das er vor etlichen Jahren in einer ganz besonderen Nacht getragen hatte. Mittlerweile waren die Farben ziemlich verwaschen, es stand ihm immer noch sehr gut. Ich selbst trug unter dem Mantel einen schmal geschnittenen Blazer, dessen bronzener Farbton gut zu meinen Haaren passte. Als ich ihn anzog, hatte ich mir eingeredet, ihn für den Termin auszuwählen.
Wir passierten das Geburtshaus Erich Kästners, die ehema lige Sowjetkaserne, in der heute der hiesige Rundfunk residierte, das größtenteils brachliegende alte Industriegebiet und erreichten schließlich den Hightechstandort. Andy pfiff leise durch die Zähne, als wir die Auffahrt hinaufgingen, und holte seine Kamera aus der Tasche.
»Nicht schlecht.« Er ging in die Knie, um den Stahl-Glas-Palast in voller Pracht aufnehmen zu können.
»Gehört dir genauso wie mir und allen Sozialhilfeempfängern, denen das Kleidergeld gekürzt wurde«, entgegnete ich. »Über 100 Millionen öffentliche Mittel. Das ist schon eine ganz ordentliche Grundlage für solch einen Bau.«
Der Pförtner begrüßte uns in breitestem Sächsisch und rief Frau Meißner, die Pressesprecherin, an, die uns kurz darauf abholte und in ihr Büro im ersten Stock führte. Die Fensterfront bot einen überwältigenden Ausblick auf Dresden, das sehr schmal aussah, wie es da hinter dem herbstbunten Wald lag, geteilt durch die glitzernde Elbe.
»Solch einen Arbeitsplatz möchte ich auch haben«, sagte ich spontan.
Die attraktive junge Frau lächelte: »Ja, das sagt jeder, der hierhin kommt. Ich kann mich selbst nicht sattsehen. Nehmen Sie doch Platz. Kaffee, Tee?« Sie wies auf die Thermoskannen auf dem runden Tisch. »Ihr Name ist Bertram?« wandte sie sich an mich, als wir uns gesetzt hatten. »Sie haben noch nicht für die Rundschau über uns berichtet, oder?«
»Nein, das macht sonst die Kollegin Pistorek. Aber ich hoffe, Sie nehmen auch mit mir vorlieb.«
»Selbstverständlich. Ich denke, Ihr Kollege hat Ihnen gesagt, dass wir den Bericht über den neuen HT-Chip mit einer Sperrfrist bis zum nächsten Donnerstag belegen müssen? Der Hintergrund wird Sie ohnehin weniger interessieren, da wir ja mit der Rundschau in ständigem Kontakt stehen.«
»Nein, davon hat Herr Rönn mir leider nichts gesagt«, antwortete ich mit einem giftigen Seitenblick zu Andy, der gleich ansetzte, das habe er auch nicht so verstanden.
»Aber Herr – Herr Rönn«, mit einer etwas ungeduldigen Bewegung strich Frau Meißner sich durch das halblange, seidige blonde Haar. »Sie werden wohl verstehen, dass wir in solchen Fällen niemanden bevorzugen können. Davon war auch nie die Rede. Sie haben mir am Telefon gesagt, Sie möchten eine ausführliche Hintergrundgeschichte recherchieren und deshalb lieber vor der allgemeinen Pressekonferenz kommen. Ich habe nun volle zwei Stunden Zeit für Sie, danach treffen Sie noch Mitarbeiter der Technischen Entwicklung, sodass Sie hinreichend Material für Ihren Artikel haben müssten. Die Sperrfrist für Berichte über den HT müssen Sie einhalten, ansonsten werden wir Sie ebenso mit einer Konventionalstrafe belegen wie jeden anderen.« Mit einem verärgerten Zug um den Mund stand sie auf und ging zu ihrem Schreibtisch.
»Besten Dank«, zischte ich Andy zu.
Als Frau Meißner mit zwei Hochglanzmappen an unseren Tisch zurückkam, hatte sie bereits wieder ein verbindliches Lächeln aufgesetzt. Auf dem ersten Blatt der Materialsammlung prangte der Stempelaufdruck »Sperrfrist: 18. November, 15 Uhr«. Frauke Pistorek zu erklären, dass ich in ihrem Gebiet gewildert hatte, ohne etwas Außergewöhnliches anbieten zu können, würde noch ein ganz besonderes Vergnügen werden.
Andreas holte, als ob nichts gewesen wäre, Block und Kugelschreiber aus seiner Kameratasche und bat die Pressespre cherin, bevor wir über den neuen Chip redeten, kurz die Geschichte des Werks zu referieren.
»Gern.« Frau Meißner nickte und sprach einige Minuten über den Aufschwung der Hightechindustrie, die speziellen Vorzüge des Standorts Dresden – niedrigere Gehälter als in Bayern, dachte ich und war mir trotz meines Ärgers bewusst, dass Andy das gleiche durch den Kopf ging – sowie die extremen Schwierigkeiten, die mit solch einer Fertigung verbunden seien.
»Sehen Sie, wir sprechen von Hunderttausenden von hochkomplizierten elektronischen Verbindungen auf einer Fläche, die kleiner ist als der Nagel meines kleines Fingers.« Sie hielt uns einen sorgfältig manikürten Fingernagel hin.
»Wissen Sie, wie so ein Chip aufgebaut ist?« Auf unser Kopfschütteln zog sie eine schematische Zeichnung aus einer der Pressemappen. »Sehen Sie, dies ist ein Transistor, eine Art Schalter, der entscheidet, ob Strom fließt oder nicht. Und das ist die Information, mit der ein Chip arbeitet. Hunderttausende von Transistoren schalten Strom an und aus. So signalisieren sie Eins oder Null.«
»Ah ja«, sagte ich nur. Wäre ich zu solchen gedanklichen Turnübungen in der Lage gewesen, hätte ich gleich etwas Gescheites lernen können.
»Und damit diese ganzen Verbindungen, die Sie hier sehen«, Frau Meißner wies noch einmal auf die Zeichnung, »funktionieren, muss jeder Chip rund 200 Fertigungsschritte durchlaufen – manche sogar bis zu 400 – und jeder einzelne ist Präzisionsarbeit.« Nach einer kurzen Atempause fuhr sie fort: »Und damit kommen wir zu unserem brandneuen Produkt, dem sogenannten HT-Chip. Das Besondere daran ist, dass wir die Speicherkapazität enorm steigern.« Sie blickte von mir zu Andreas. »Das heisst, dass größere und kompliziertere Programme abgespeichert werden können – so wird der HT in Zukunft auch für EC-Karten eingesetzt, um einen aufwendigeren Sicherheitscode verwenden zu können – oder eben für Musik, die ja enorm viel Speicherplatz braucht.«
Ich trank einen Schluck Kaffee und dachte nostalgisch an meine Schallplattensammlung.
»Sie kennen sicherlich die bunten Plastechips für Einkaufswagen«, fuhr die Pressesprecherin fort. »Ähnlich sieht der HT aus. Darauf kann dann eine komplette CD abgespeichert werden. Der Player dafür hat die Größe einer halben Zigarettenschachtel. Wir sind überzeugt, dass das der Walkman der Zukunft sein wird und dass SAI weltweit die Nummer Eins mit diesem Produkt ist.« Sie schaute auf ihre Armbanduhr, die ein winziges Gesteinsstück der Frauenkirche zierte. »Ich denke, ich führe Sie jetzt einmal durch die Halle. Sie haben noch ausführliches Material in der Mappe und werden ja außerdem noch mit der HT-Projektgruppe sprechen.«
Durch eine Schleuse, die die Pressesprecherin mit einer Karte öffnete, erreichten wir Umkleideräume. Frau Meißner gab uns riesige weiße Anzüge, Kopfmasken, Hand- und Überschuhe. »Die gesamte Produktion findet unter Reinraumkonditionen statt. Das sind quasi klinische Bedingungen. Deshalb dürfen Sie auch nichts von draußen mitnehmen. Falls Sie sich etwas notieren wollen, kann ich Ihnen gleich einen Reinraumblock und -stift geben.«
»Ist ja spacig«, murmelte ich. Als wir uns wenige Minuten später vor dem Eingang zur Halle wiedertrafen, musste ich lachen. Das Outfit ließ mich an Weltraumflüge und Schwerelosigkeit denken. Auch die Pressesprecherin hatte sich von der elegant gekleideten Frau in ein unförmiges weißes Wesen mit Namenszug auf dem Rücken verwandelt. Bei uns stand an dieser Stelle »Besucher«. Frau Meißner reichte uns je einen DIN A5-Block, der wie abwaschbar aussah, und einen Stift, ging dann voran in die große Halle.
Lauter Fliwatüts, dachte ich, als ich die unzähligen chromglänzenden großen Maschinen sah. Überall standen Menschen herum, beugten sich über Anlagen, sprachen miteinander, trugen große Boxen durch die Gegend, blickten konzentriert auf Monitore und Digitalanzeigen. Ich konnte mir nicht vor stellen, wie man sie – abgesehen von den Namen auf den Rücken – unterscheiden sollte. Die Luft war sehr trocken, dabei zog es ein wenig.
Frau Meißner führte uns zu einer relativ kleinen Maschine. »Hier wird jeweils der erste Produktionsschritt gemacht.« Ihre Stimme klang undeutlich durch den Mundschutz. »Sehen Sie dort die silbernen Scheiben?« Sie wies auf ein Metallregal, ähnlich denen in Kantinen, die das schmutzige Geschirr auf nehmen. Hier lag in jedem Fach eine durchsichtige Plastikbox mit etwa 25 glänzenden runden Scheiben. Gerade wurde der unterste der Silberlinge in die Maschine eingeführt.
»Die Scheiben nennt man Wafer. Auf jedem dieser Wafer entstehen 200 bis 2.000 Chips, je nach Größe. Hier wird das Silizium dafür mit den ersten Lackschichten überzogen.«
Nach einer Viertelstunde war ich froh, als wir die seltsame »reine« Atmosphäre verließen und uns kurz darauf wieder in Straßenkleidung gegenübersaßen. Frau Meißner wies auf die Wand hinter uns: »Sehen Sie dort – die Uhr – das ist ein komplett bearbeiteter Wafer, der gegen Ende der Produktion verworfen wurde. Holen Sie sie ruhig mal herunter.«
Ich stand auf und nahm die Uhr von der Wand. Sie war etwa so groß wie eine Langspielplatte, so blank, dass man sich in ihr spiegeln konnte, aber in Hunderte von kleinen Quadraten unterteilt. Ich fuhr mit dem Finger darüber. Abgesehen von den Linien war das Material absolut glatt.
»Sie haben über den HT immer in der Zukunftsform gesprochen«, fragte ich nach. »Er ist also noch nicht fertig?«
»Wir gehen davon aus, dass wir am kommenden Mittwoch einen Prototyp präsentieren können. Aber über den aktuellen Stand können Sie am besten die Kollegen von der TE informieren.«
*
Sechs Männer und zwei Frauen saßen um den hellgrauen, ovalen Tisch in einem Konferenzraum neben dem Büro der Pressesprecherin, die sich bereits mit einer Entschuldigung verabschiedet hatte. Auf dem Tisch stand neben den obligatorischen Thermoskannen mit Tee und Kaffee und dem Rondell mit Kaltgetränken ein Teller mit belegten Brötchen sowie einer mit Plunderteilchen. Einer der Männer hatte ein kleines Gerät vor sich liegen, bei dem es sich um einen »Player« für den neuen Chip handeln musste. Sieben Augenpaare sahen uns fragend entgegen, eins amüsiert. Susanne Böttger, Andys Bekannte, war Anfang 30, trug einen blonden Kurzhaarschnitt und war ein bisschen stämmig, sah dabei jedoch durchtrainiert aus. Neben ihr saß die andere Frau. Sie wirkte sehr lebhaft, jetzt lachte sie und fragte Susanne halblaut etwas, die daraufhin zu dem Mann ihr gegenüber blickte, den Kopf zur Seite legte und ihn anlächelte.
Andreas räusperte sich: »Also, bevor die Vorstellung hier sozusagen im Flüsterton weitergegeben wird: Ich bin Andreas Rönn, freier Journalist und ein alter Bekannter von Susanne Böttger«, er blickte zu ihr, »und das ist meine Kollegin Kirsten Bertram von der Sächsischen Rundschau. Wir berichten über den neuen HT-Chip und wollen gern die Menschen kennenlernen, die dieses technische Wunderwerk möglich machen.«
»Noch ist es nicht möglich«, schaltete sich ein hagerer Mann Mitte 40 ein, dessen seltsam großer Kopf durch den weit zurückgewichenen Haaransatz noch betont wurde. Er wirkte verärgert. »Mein Name ist Joachim Schwarze, ich bin der Projektleiter. Wir arbeiten zurzeit daran, den Speicherplatz zu erweitern. Bezogen auf die Möglichkeit, Musik zu speichern, heißt das: keine ganze CD, sondern nur zwei Lieder. Davon können Sie sich auch gern einen eigenen Eindruck verschaffen.« Er reichte das Gerät hinüber, und per Kopfhörer hörte ich eine rauschfreie Wiedergabe eines Techno-Songs. Die Mini-Anlage konnte ich fast mit meiner Hand umschließen, die Bedienungselemente waren so klein, dass jemand mit dickeren Fingern wahrscheinlich Probleme bekam.
»Aber in einer Woche soll es so weit sein?«, fragte ich noch einmal nach.
»Wir tun, was wir können, wir sind kurz vorm Ziel«, war die einzige Antwort, die ich von Herrn Schwarze bekam.
»In einer Woche wird es zu schaffen sein«, sagte die Frau neben Susanne Böttger. »Und ein technisches Wunderwerk, wie Sie es genannt haben, ist es jetzt schon. In dem Gerät steckt keinerlei Mechanik. Da kann nichts rappeln. Sie können es einstecken haben, wenn Sie einen Handstand machen.«
Davon hatte ich schon immer geträumt! Aber natürlich gehörte ich mit meinen 35 Jahren auch nicht zu der Haupt-Zielgruppe für solch einen Musik-Chip. Was mich jedoch wie jeden anderen betreffen würde, war die Möglichkeit, Geldkarten besser zu sichern, über die wir jetzt noch sprachen. Ich begann zu verstehen, wie groß der Schritt für die Mikro-Elektronik war.
Eine knappe Stunde lang unterhielten wir uns mit den Entwicklern über das Potenzial des neuen Wunderchips und die Schwierigkeiten bei der Produktion, ließen uns auch etwas über ihre Lebensläufe erzählen, um den ganzen technischen Daten gewissermaßen ein menschliches Gesicht zu geben. Im Vergleich zu den bunten Lebensläufen der meisten Journalisten glichen sich die Biografien ziemlich. Fast alle waren zwischen Mitte 30 und 40, West und Ost waren etwa 50/50 vertreten, ebenso Physiker und Elektrotechniker, Diplom-Ingenieure und Promovierte. Fünf der acht hatten eine Zeit lang im Ausland studiert, promoviert oder gearbeitet.
Als wir unsere Blöcke zuklappten, kam Susanne Böttger zu Andreas: »Bleibt es bei heute Abend? Du kommst zu uns? Das ist übrigens mein Freund«, sie wies auf den jungen Mann, der ihr gegenüber gesessen hatte, »Markus Fischer.«
Die beiden nickten sich zu, dann sagte Andreas: »Ja, natürlich, wenn die Einladung noch steht.«
»Klar. Ich mache jetzt Feierabend. Ich würde dich ja gleich mitnehmen, aber ich bin mit dem Fahrrad da. Wenn du mir aber einen kleinen Vorsprung lässt, erwarte ich dich bei uns.«
*
Am nächsten Morgen holte mich der Radiowecker mit den Lokalnachrichten aus dem Tiefschlaf. Dale drehte sich noch einmal grummelnd um, als die Ansagerstimme verkündete:
»… gab es gestern Abend einen Verkehrsunfall mit Todesfolge auf der Tannenstraße. Eine junge SAI-Mitarbeiterin war gegen 18:30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Heimweg in Richtung Neustadt, als ein PKW sie erfasste. Nach Aussage eines Zeugen soll es sich um einen dunkelroten Mittelklassewagen wahrscheinlich japanischer Bauart gehandelt haben. Die junge Frau wurde gegen einen Baum am Straßenrand geschleudert und erlag wenig später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Fahrer des Wagens ist flüchtig. Die Dresdner Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.«
2. Kapitel
»Ich möchte gern eine größere Geschichte über die tote Radfahrerin auf der Tannenstraße machen«, sagte ich in der zehn-Uhr-Konferenz.
So schrecklich ich die Nachricht fand, schien es mir doch eine gute Gelegenheit, den autofixierten Dresdnern die Folgen ihres Denkens zu präsentieren. Renate Markward, die Lokalchefin, sah von dem Stoß Papier vor sich auf. Sie war knapp 50, immer extrem korrekt gekleidet und eigentlich – davon war ich nach einem halben Jahr überzeugt – zutiefst unsicher. Das versuchte sie durch einen ausgeprägt autoritären Führungsstil zu kompensieren. Jetzt fragte sie nach dem SAI-Artikel.
»Ja, das ist dumm gelaufen. Ich habe da wohl etwas falsch verstanden«, druckste ich herum, gab mir dann einen Ruck: »Sperrfrist. Nächsten Donnerstag können wir ihn bringen.«
»Gut«, sagte die Markward mit einem Blick, der genau das Gegenteil signalisierte.
»Das heißt aber, dass ich heute genug Zeit habe, um etwas über die Fahrradfahrerin zu machen. Das ist doch ein menschliches Schicksal, das die Leser interessiert«, machte ich noch einen Vorstoß.
Die Chefin hatte ihren Blick schon wieder den Blättern vor sich zugewandt, sie nickte nur und sagte: »Meinetwegen.«
*
Die Polizeipressesprecherin war an solch einem Morgen natürlich gefragt. Etliche Male hörte ich nur das Besetztzeichen, dann endlich war Veronica Marten für mich da:
»Nu, Frau Bertram, viel haben wir noch nicht. Die Tote hieß Susanne Böttger …« Mir rutschte ein lautes »Was?« heraus, und Frau Marten, die dachte, ich hätte den Namen nicht richtig verstanden, wiederholte: »Susanne Böttger, mit O-Umlaut. Sie war 32 Jahre alt und gebürtige Berlinerin. Wie ihr Lebensgefährte sagte, ist sie fast immer mit dem Rad zur Arbeit gefahren – aus Fitnessgründen«, fügte sie hinzu.
Ein Passant hätte gesehen, wie ein dunkelroter Wagen – weder das genaue Fabrikat noch das Kennzeichen hatte er nennen können – mit überhöhter Geschwindigkeit die Radfahrerin erfasste. Als der Zeuge die junge Frau erreichte, war sie bereits ohnmächtig. »Sie hatte eine Gehirnerschütterung und starke innere Verletzungen. Obwohl sofort ein Krankenwagen geholt wurde, ist sie bereits kurz nach der Aufnahme im Neustädter Krankenhaus verstorben, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.«
Ich bedankte mich bei der Beamtin und legte auf. Gerade, als ich Andys Handynummer eingetippt hatte, kam er zur Tür herein, kreidebleich, mit dunklen Schatten unter den Augen. Er zog die Schultern nach vorn, als wolle er weniger Angriffsfläche bieten. Ich ging auf ihn zu und nahm ihn in den Arm.
»Komm, setz dich. Ich hab’s gerade erfahren. Willst du einen Kaffee?«
Als ich mit zwei Tassen vom Sekretariat zurückkam, hatte er eine Schachtel Zigaretten in der Hand. »Darf ich hier …?« Ich nickte, blickte kurz entschuldigend zu Ines hinüber, die mir signalisierte, dass es in Ordnung sei.
»Das war Mord, Kirsten.« Mit zitternden Händen steckte er eine Zigarette in Brand.
Ich starrte ihn an und schüttelte den Kopf: »Was? Wieso?«
»Sie wurde umgebracht. Der hat voll auf sie draufgehalten. Ich schwör’s dir, Kirsten. Das war kein Unfall. Das war wie eine Hinrichtung.« Er schluchzte.
Ich ging vor seinem Stuhl in die Hocke, legte die Hände auf seine Knie und blickte ihm in die Augen. »Nun mal langsam. Erzähl.«
Er inhalierte einmal tief und berichtete dann, dass er Susanne gefunden hatte. Wir waren am gestrigen Nachmittag gemeinsam mit der Straßenbahn bis zum Goethe-Institut gefahren. Ich hatte ihm gesagt, dass er dort aussteigen und von hinten in die Neustadt hineinlaufen könne, dann hätte Susanne bestimmt ihre Wohnung in der Kamenzer Straße erreicht, bis er käme.
»Da an der Haltestelle hab ich sie noch gesehen«, sagte er und strich die Asche auf der Untertasse ab. Mit der anderen Hand hielt er die Kaffeetasse so fest umklammert, dass die Knöchel weiß hervortraten. »Sie kam die Hauptstraße herunter und bog in die Tannenstraße ein.«
Direkt danach sah er einen Wagen, der zwischen zwei Bäumen am Anfang der relativ ruhigen Straße stand, starten und losfahren.
»Da hat jemand auf sie gewartet und dann Vollgas gegeben und mit aller Kraft auf sie draufgehalten.« Er schluckte. »Glaub mir, das war geplanter Mord.«
Ich schüttelte den Kopf: »Andy! Wir waren lange unterwegs, du warst k. o., es war dunkel – und die Dresdner fahren manchmal wie die Berserker.«
Andreas verschluckte sich an dem Rauch, als er mit den Tränen kämpfte: »Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Das war kein Unfall!« Er starrte mich an, als wollte er mich beschwören, ihm zu glauben. »Als sie da lag – sie hatte Licht am Fahrrad und einen grellorangenen Anorak an – ich bin zu ihr gerannt, aber sie war schon ohnmächtig.« Nun begann er, richtig zu weinen. Ich nahm die heruntergebrannte Zigarette aus seiner Hand, drückte sie aus, gab ihm ein Papiertaschentuch.
Wie er weiter hervorwürgte, hatte er sofort einen Krankenwagen gerufen und Susanne bis auf die Notaufnahme begleitet. Danach machte er seine Aussage bei der Polizei.
»Aber die haben mir nicht geglaubt. Immer wieder haben sie etwas von ›überhöhter Geschwindigkeit‹ und ›Fahrerflucht‹ wiederholt, bis ich darauf bestanden habe, dass die Kripo meine Aussage aufnimmt. Das ist dann auch passiert, aber …«, er zuckte die Schultern, fingerte eine neue Zigarette aus der Packung. »Hast du schon bei der Polizei angerufen?«
Für ihn schien klar zu sein, dass ich mich mit der Geschichte beschäftigte. Ich nickte und wiederholte, was die Sprecherin gesagt hatte.
»Aber es kann ja auch taktische Gründe haben, dass sie für die Öffentlichkeit nichts von Mord erwähnen.« Zum Beispiel deine Sicherheit, fiel mir spontan ein – falls nicht die Fantasie mit ihm durchgegangen war, wovon ich noch nicht überzeugt war. Laut fragte ich: »Was hast du dann gemacht gestern Abend?«
»Nachdem alles vorbei war, habe ich bei dir angerufen, aber es war niemand zu Hause.«
»Ja, wir waren im Kino«, schob ich ein.
»Dann bin ich in eine Kneipe an der Louisenstraße, hab mich ans Fenster gesetzt, wo ich die Straße im Blick hatte, und mich betrunken. Die erste Schachtel Zigaretten«, mit einem kaum wahrnehmbaren Lächeln sah er von seinen Händen, die er die ganze Zeit betrachtet hatte, auf, »hatte ich mir schon im Krankenhaus gezogen. Etwas zum Festhalten.«
»Schon klar. Aber wenn du jetzt noch ein bisschen hier bleibst, dann qualm uns bitte nicht pausenlos zu.« Ich hatte einen Entschluss gefasst. »Ich mach den Artikel eben fertig und dann gehen wir zusammen zur Kripo. Vielleicht haben die ja was Neues. Einverstanden?«
Andy nickte. Hilflos strich ich ihm noch einmal leicht über den Arm, ging dann zu meinem Schreibtisch und rief den ADFC an, ließ mir sagen, was ich ohnehin wusste: Dass für Fahrradfahrer die Tannenstraße mit ihrem schmalen Bürgersteig und fehlendem Radweg einer der vielen kritischen Bereiche in der Dresdner Innenstadt war und dass dringend stärker auf die Bedürfnisse und die Sicherheit der nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer geachtet werden müsste. »Die Autofahrer brettern da doch alle mit 70, 80 runter – da musste ja mal was passieren.«
Aus dem Rathaus gab es ebenfalls das zu Erwartende. Alle bedauerten den »tragischen Unglücksfall« – so oder ähnlich, PDS und Bündnis 90 / Die Grünen wiesen darauf hin, dass sie seit Langem ein besseres Geh- und Radwegenetz forderten, von der SPD sollte erst am Abend eine öffentliche Stellungnahme kommen, die CDU – in der Regierungsverantwortung – wollte sich auf keine konkreten Maßnahmen festlegen lassen, und der FDP-Sprecher regte an, über ein Fahrradfahrverbot im innerstädtischen Bereich nachzudenken.
In Rekordgeschwindigkeit schrieb ich den Text, sagte Ines, falls jemand frage, sei ich nur eben etwas essen, und zog Andy aus der Redaktion.
*
Sogar an solch einem kalten, verregneten Novembertag flanierten die Touristen über den Schlossplatz und am Fürstenzug entlang. So schnell wie möglich schoben wir uns durch sie hindurch, entschuldigten uns immer wieder bei den Hobby-Fotografen und Videofilmern, denen wir ins Visier liefen, bis wir hinter der Frauenkirchen-Baustelle die Polizeidirektion erreichten. Der historische Kern Dresdens erinnerte mich immer an ein Freilufttheater. So schön ich es auch fand: Im Allgemeinen reichte mir der weltberühmte Canaletto-Blick auf die Gebäude – von der Neustädter Elbseite aus.
Wir gingen an der Längsseite des riesigen Gebäudes – ebenfalls Teil der historischen Kulisse – entlang, bis wir den Haupteingang erreichten. Als wir den Vorraum betraten, ertönte über einen in die Decke eingelassenen Lautsprecher die Frage, was wir wollten.
»Wir möchten gern Hauptkommissar Hantzsche sprechen«, antwortete Andreas in Richtung der Tonquelle. Daraufhin wurde ein Summer betätigt und die Verbindungstür ließ sich öffnen. Wir standen in einem kleinen Warteraum, der mit zwei Tischen, vier Stühlen, einem Ständer mit Informationsmaterial und einer Kiste Kinderspielzeug so vollgestellt war, dass man sich kaum bewegen konnte. An den Wänden hingen diverse Fahndungsaufrufe, Sicherheitshinweise sowie ein großes Plakat mit einer durchgestrichenen Zigarette. Andy, der seine Schachtel schon aus der Jackentasche gezogen hatte, brummte etwas und steckte sie wieder ein. Ich schaute mir die Broschüren an.
Nach etwa fünf Minuten kam ein kleiner, untersetzter Mann Mitte 50 mit wachen, schmalen Augen. Seine Haare waren voll und noch fast schwarz, die Bewegungen langsam und überlegt. Nacheinander streckte er uns die Hand zur Begrüßung hin.
»Ihr Kollege Herr Schreiber hat mir gestern Abend gesagt, dass Sie den Fall wohl übernehmen würden«, fügte Andy an, nachdem er kurz zusammengefasst hatte, worum es ging.
Hantzsche nickte. »Freut mich, dass Sie von sich aus kommen. Ich hätte Sie sonst heute noch aufgesucht.« Ein waschechter Sachse; ich verstand ihn nur mit Müh und Not, Andy schien es genauso zu gehen. »Kommen Sie in mein Büro, bitte.«
Mit einem Schlüssel öffnete er die Verbindungstür und ging uns voran zwei Stockwerke hoch, einen langen Flur entlang in ein kleines Büro hinein. Er setzte sich hinter den penibel aufgeräumten Schreibtisch, wies mit der Hand auf die Stühle davor: »Nehmen Sie Platz. Wie geht es Ihnen?«
Die Frage war an Andreas gerichtet, der mit seinen geröteten, umrandeten Augen noch immer sehr bleich und erledigt aussah. Er machte jedoch nur eine ungeduldige Handbewegung.
Indem Hantzsche die Mappe, die vor ihm lag, aufschlug, sagte er: »Sie haben zu Protokoll gegeben, der Fahrer eines roten Mittelklassewagens habe Ihre Bekannte mit Absicht überfahren.« Sein Blick war skeptisch.
»Ja! Er stand am Straßenrand, und als Susanne an ihm vorbeigefahren war, ist er gestartet, hat so schnell wie möglich beschleunigt und auf sie draufgehalten.«
»Herr Rönn, Sie leben in Erfurt. Das ist im Vergleich zu Dresden eine Kleinstadt. Wir haben hier mit sehr schwierigen Verkehrsbedingungen zu kämpfen. Unfälle mit Todesfolge passieren – leider.«
Andy umklammerte die Lehnen seines Stuhls und wiederholte, was er mir gesagt hatte: »Ich weiß, was ich gesehen habe. Das war Mord. Ist denn eine Obduktion gemacht worden?«
Der Kommissar betrachtete ihn aufmerksam, nickte dann: »Nu. Die Ergebnisse habe ich gerade hereinbekommen. Nun ist es tatsächlich so, dass der Aufprall des Fahrzeugs außergewöhnlich stark war – das kann auf Absicht schließen lassen, muss aber nicht.« Er blickte auf, als keiner von uns etwas sagte, fuhr er fort: »Wenn man von einem geplanten Mord ausgeht, dann stellt sich die Frage des Motivs. Sie haben gestern Abend zu Protokoll gegeben, dass Sie dazu nichts sagen können, Herr Rönn.« Während des Sprechens blätterte er in der Mappe, suchte sich offensichtlich erst die Informationen zusammen. »Ist Ihnen vielleicht in der Zwischenzeit eine Idee gekommen?«
Andy schüttelte heftig den Kopf. »Mein Gott, nein. Ich hatte ja auch nur ganz sporadischen Kontakt zu Susanne. Wir haben etwa ein- bis zweimal im Jahr miteinander telefoniert. Und von Problemen hat sie bei unserem letzten Gespräch nichts gesagt. Im Gegenteil«, seine Stimme klang gepresst, »es schien ihr richtig gut zu gehen.« Er zog seine Zigaretten aus der Tasche und hielt sie unschlüssig in der Hand.
»Verstehe.« Der Kommissar drehte sich auf seinem Stuhl um und holte einen Aschenbecher aus dem Schrank hinter ihm, schob ihn über den Tisch. »Sie sind Journalist. Könnte es viel leicht sein, dass Susanne Böttger Ihnen eine, sagen wir mal, heiße Geschichte erzählen wollte?«
»Ich glaube nicht. Zumindest hat sie nichts angedeutet. Sie hatte mir den Tipp mit dem neuen SAI-Super-Chip gegeben, aber gleich gesagt, dass ich mich an die Pressestelle wenden müsste, wenn ich etwas darüber schreiben wollte.«
»Was für ein Super-Chip?«, fragte Hantzsche nach und wir erklärten es ihm. Er machte sich einige Notizen, blickte uns dann abwartend an.
»Was ist denn mit dem Auto?« fragte ich. »Wird danach gefahndet?«
Hantzsche zuckte die Schultern. »Nu, selbstverständlich. Aber ohne Kennzeichen oder wenigstens genauen Wagentyp …«
»Verdammt, es war so eine Familienschleuder – ich denke, ein Japaner. Ich kenne mich da nicht so aus. Haben Sie nicht ein Fotoalbum, das ich mir anschauen könnte? Dann würde ich den Wagen bestimmt wiedererkennen.«
Der Kommissar schüttelte den Kopf. »Vielleicht sehen sie das Modell auf den Straßen und geben uns denn Bescheid.« Er klappte die Mappe zu. Offensichtlich war für ihn das Gespräch beendet. »Guddi. Ansonsten werden wir uns bei Ihnen melden, Herr Rönn, wenn wir weitere Informationen brauchen.« Er machte eine kurze Pause. »Ich denke, es versteht sich von selbst, dass von einem eventuellen Mordverdacht die Öffentlichkeit nichts erfahren sollte. Frau Böttgers Tod war ein tragischer Unfall – mehr möchte ich auf keinen Fall irgendwo lesen.«
»Aber Sie ermitteln jetzt wegen Mordes?«, hakte Andreas noch einmal nach. »Es war Mord. Ich täusche mich nicht, glauben Sie mir.«
»Wir werden allen Spuren nachgehen, da können Sie ganz unbesorgt sein.« Das war das definitive Abschiedswort.
*
»Wow, das ist ja eine echte Villa«, staunte Andy, kaum, dass ich ihm die Jacke abgenommen hatte. Nachdem er nachmittags etwas geschlafen hatte, sah er nicht mehr ganz so mitgenommen aus. Wir standen in der quadratischen Eingangs halle des alten Wohnhauses, das Dale vor knapp zwei Jahren geerbt hatte. Von hier gingen Küche, Wohnzimmer, Bad sowie ein geräumiges Büro, in dem Dale momentan noch arbeitete, ab. Überall war noch einiges zu machen, aber das 100 Jahre alte Mauerwerk war stabil und trocken, das Dach dicht und der große verwilderte Garten ein Paradies. Ich führte Andreas zunächst die Treppe hoch in den ersten Stock, zeigte ihm unser Schlafzimmer, das zweite Bad mit der alten, riesigen Badewanne, die aufzufüllen fast eine halbe Stunde dauerte, und öffnete schließlich die Tür zu meinem Zimmer.
»Hier ist mein Reich.« Ich liebte diesen Raum mit dem altersdunklen Parkettfußboden und dem Erker, in den ich einen Lehnsessel aus den 20er-Jahren gestellt hatte. Eine Wand wurde von Bücherregalen ausgefüllt, in einer Ecke stand ein kleines Ausziehsofa und mitten im Zimmer mein Schreibtisch.
»Hier schläfst du heute Nacht.« Bevor wir uns vor dem Polizeipräsidium getrennt hatten, hatte ich ihn eingeladen, den Abend und die Nacht bei uns zu verbringen.
Andy war zum Fenster gegangen und versuchte, die Dunkelheit mit seinen Blicken zu durchdringen: »Das ist ja Wahnsinn, solch ein Grundstück mitten in der Stadt.« Er wandte sich um, und wir gingen die alte, weiß gestrichene Holztreppe wieder nach unten. »Es sind ja keine fünf Minuten zu Fuß vom Albertplatz. Und das alles hat Dale geerbt?«
»Ja«, antwortete der selbst.
Er war gerade aus seinem Büro gekommen, mit ihm eine Wolke abgestandenen Qualms. Wir hatten zwar gemeinsam mit dem Rauchen aufgehört, Dale war jedoch ein halbes Jahr später bei einem besonders kniffligen Fall wieder schwach geworden. Mir erging es nun wie allen ehemaligen Rauchern: Der Geruch, der sich überall festsetzte, und der Geschmack beim Küssen störten mich ungemein.
»Hallo, Andreas.« Die beiden Männer gaben sich die Hand. »Es tut mir leid, was mit deiner Bekannten passiert ist.«
Gemeinsam gingen wir in die Küche. Dale bot Andy ein Bier an, erklärte dann: »Ich hatte dem Vorbesitzer dieses Hauses geholfen, Eigentumsansprüche eines damals in Erfurt lebenden Wessis als Betrugsversuch aufzudecken. Danach war er so dankbar, dass er meinte, nicht seine entfernten Verwandten, sondern ich sollte das Haus bekommen.«
»Nicht schlecht. Das Glück muss man erst mal haben.« Die beiden prosteten sich zu, ich beschäftigte mich mit der Spaghetti-Sauce. Es war seltsam, wieder in dieser Konstellation zusammen zu sein. Wir hatten damals, als ich aus dem Ruhrgebiet nach Erfurt gekommen war, einiges gemeinsam erlebt, aber meine Unfähigkeit, mich klar für einen der beiden Männer zu entscheiden, hatte uns alle drei auch häufig bis an den Rand des Nervenzusammenbruchs geführt. Heute Abend hatten sich die beiden offenbar vorgenommen, sehr höflich miteinander umzugehen, wie ich aus dem Small Talk heraushörte. Ich hielt mich zunächst ganz zurück. Nach einigen Minuten nahm Andreas dann aber unser Gespräch wieder da auf, wo wir es mittags abgebrochen hatten:
»Ich glaube nicht, dass dieser Kommissar viel macht. Für den bin ich doch nur ein Spinner, der sich was zusammenfantasiert.«
»Du musst zugeben, dass es sich wirklich ziemlich verrückt anhört – dass jemand am frühen Abend gezielt und geplant überfahren wird«, entgegnete ich. »Und dann hast du noch nicht einmal den Wagentyp erkannt.«
»Mensch, Kirsten, ich hab seit Jahren verdammt wenig mit Autos am Hut. In Erfurt steht immer noch mein alter Golf, aber die Autos heute sehen doch alle gleich aus.«
Ich stellte Nudeln und Sauce auf den schweren Holztisch, Dale goss Rotwein ein. Die beiden hatten das bequeme Küchensofa vermieden und sich an die Schmalseiten des Tisches gesetzt; auch ich zog einen Stuhl vor.
»Also, ich weiß nicht«, beharrte ich. »Das wäre doch viel zu riskant. Ein anderer Zeuge hätte das Kennzeichen bemerken können.«
Andy trank den letzten Schluck Bier. »Ich war gestern der einzige Fußgänger dort. Die Ecke ist, abgesehen vom Autoverkehr, ziemlich tot um die Zeit. Und die Autofahrer kommen so schnell die Hauptstraße runter, die gucken nicht zur Seite. Wenn ich nicht dort gewesen wäre, hätte es gar keinen Zeugen gegeben.«
Ich nickte nachdenklich. Das hörte sich logisch an. Ich schaute zu Dale hinüber, der unser Gespräch bislang schweigend verfolgt hatte. Es war ihm nicht anzusehen, ob er Andreas’ Geschichte glaubte oder nicht. Wahrscheinlich war das die Erfahrung aus unzähligen Befragungen als Polizist und Privatdetektiv.
»Okay, gehen wir mal davon aus, dass du recht hast«, überlegte ich laut. »Dann fällt mir spontan ein, dass die bei SAI ganz schön in Terminschwierigkeiten sind. Vielleicht hat das etwas mit Susannes Tod zu tun.«
»Du meinst, dass sie die Produktion verzögert hat – aus Sicherheitsgründen, oder so?« fragte Andy nach.
Ich zuckte die Schultern. »Ja, so was in der Art.«
Jetzt schaltete Dale sich doch ein: »Interessanter ist zunächst das persönliche Umfeld. In neun von zehn Fällen liegt das Motiv für einen Mord in der Familie. Kanntest du ihren Freund auch, Andreas?«
Andy verneinte und erzählte, was er wusste: Dass Susanne nach dem Studium – sie war Physikerin gewesen – zunächst an einer Uni in Frankreich gearbeitet und dann vor etwa einem Jahr die Stelle hier in Dresden bekommen hatte.
»Und kurz danach muss sie auch mit ihrem Freund zusammengekommen sein. Als wir Anfang des Jahres telefonierten, hat sie ihn auf jeden Fall schon erwähnt. Er ist Ossi, kommt aus einem kleinen Ort oben an der Küste – das ist aber auch schon alles, was ich weiß. Ach ja, er hat auch mal in Erfurt gelebt.«
»Also, ich denke«, sagte Dale, »dass der Kommissar da beginnen wird.«
»Wenn der überhaupt was unternimmt.« Andy trank einen Schluck Wein, sah mich eindringlich an. »Ich werde auf jeden Fall selbst ein bisschen herumschnüffeln.« Ich drückte mich vor der Antwort auf seine unausgesprochene Frage – oder Bitte, ob ich ihm dabei helfen würde, krempelte die Ärmel meiner Bluse hoch und griff ebenfalls nach dem Weinglas. Andreas’ Blick zeigte an, dass er sich in die Geschichte verbeißen würde. Und ich war mir nicht sicher, ob ich daran teilhaben wollte.
Dale stand auf, um Kaffee zu kochen. Ich räumte die Teller ab, holte Kaffeetassen aus dem alten Büfett, das vom Vorbesitzer stammte, stellte für die Männer einen Aschenbecher dazu.
»Jetzt werde ich auch noch von zwei Seiten zugequalmt.«
»Ich hör auf jeden Fall wieder auf«, sagte Andy. »Ich finde es selbst grässlich, wie schnell man wieder meint, nicht ohne die Dinger leben zu können.« Er schaute auf die große Bahnhofsuhr über der Küchentür: »Es ist noch nicht einmal acht Uhr. Noch nicht zu spät für einen Kondolenzbesuch bei Susannes Freund.«
*
Durch die Sprechanlage neben der Eingangstür des aufwendig sanierten Gründerzeithauses in der Kamenzer Straße ertönte eine weibliche Stimme. Zögernd nannte Andreas seinen Namen. Es dauerte einen kurzen Moment, bis der Öffner betätigt wurde.
Im zweiten Stock standen wir Susannes Kollegin, Elke Bärmann, gegenüber. Andy entschuldigte sich für den späten Besuch und sagte, wir wollten Markus Fischer unser Beileid aussprechen. Ohne ein Wort zu sagen, wies die junge Frau mit ausgestrecktem linken Arm in das Zimmer am Ende des Flurs, ging uns dann voran.
Markus Fischer saß mit starrem Gesichtsausdruck auf einem blauen Designersofa. In seinem schwarzen Cordhemd und dunkelgrauer Wollhose wirkte er sehr elegant, die grau durchzogenen blonden Haare boten einen reizvollen Kontrast zu den blauen Augen. Vor ihm auf dem kleinen Glastisch standen eine dreiviertelleere Flasche irischer Whiskey und zwei Gläser. Er schien uns erst zu bemerken, als wir direkt vor ihm standen.Andy beugte sich vor:
»Markus, Herr Fischer, Susannes Tod tut mir so leid. Erinnern Sie sich an mich?«
»Natürlich.« Seine Stimme klang erstaunlich klar. »Wir können uns ruhig duzen. Wenn du gestern Abend hier gewesen wärst, hätten wir es ja auch getan.«
»Setzt euch doch.« Elke Bärmann wies auf das Sofa und einen kleinen Sessel, der in der Ecke stand, bot dann Getränke an. Wir wählten Bier, und unter dem Vorwand, ihr helfen zu wollen, folgte ich der jungen Frau in die Küche.
»Er soll jetzt nicht allein sein«, sagte sie ungefragt. Ihre Stimme hörte sich schleppender an als die des Mannes; die Bewegung, mit der sie das brünette Haar zurückstrich, war etwas unkoordiniert. Durch ihre ausgeprägte Gestik wirkte sie jünger als sie war, auf eine unscharfe Weise attraktiv. Erst bei näherem Hinsehen entdeckte man die zahlreichen Falten um die Augen, die grauen Haare, die vor allem die Ponysträhnen durchzogen. »Susanne war – ich war mit beiden befreundet, und nachdem die Polizei gestern bei Markus war, ist er zu mir gekommen.«
Sie gab mir zwei Pils- und zwei Wassergläser, nahm Bier und Mineralwasser aus dem Kühlschrank, und wir gingen ins Wohnzimmer zurück. Andy hatte den Sessel herangezogen und saß Markus gegenüber. Ich nahm neben ihm auf dem Sofa Platz, rückte ein wenig zur Seite, um Elke zwischen uns zu lassen, nachdem sie allen eingeschenkt hatte.
»Trink ein wenig Wasser zwischendurch, Markus.« Sie schob ihm das Glas zu.Er verzog das Gesicht:
»Ich werde sowieso nicht betrunken. Ich trinke seit Stunden und nichts passiert.« Er schüttete das Wasser hinunter, griff dann wieder nach dem Whiskey-Glas. »Es nützt alles nichts. Nichts nützt etwas. Ich hab ihr so oft gesagt, sie soll hier nicht Rad fahren, aber sie hat nur gemeint, die Dresdner müssten sich mal daran gewöhnen, dass die Straße nicht nur den Autofahrern gehört.« Er machte eine Pause, seine Augen füllten sich mit Tränen. »Mein Gott, wenn ich den erwische!« Die Drohung stieß er fast tonlos hervor, sein Blick war immer noch auf unergründliche Weiten gerichtet.
»Du bist nie mit dem Rad gefahren?«, fragte Andreas.
»Nein.« Er schluckte. »Mir war es immer zu gefährlich hier in der Stadt. Am Wochenende sind wir manchmal zusammen rausgefahren, zum Vergnügen, aber zu SAI habe ich immer das Auto genommen.« Er stellte das Whiskey-Glas hin, stand auf und begann, im Zimmer auf und ab zu gehen.
Erst jetzt fiel mir auf, wie groß er war. Er musste Susanne um gut einen Kopf überragt haben.
»Hatte Susanne denn auch noch ein eigenes Auto?«, fragte Andreas.
»Nein.« Markus hielt seinen Oberkörper mit den Armen umfasst.
Es war Andy am Gesicht abzulesen, dass er überlegte, wie er unauffällig die Frage nach dem Wagen der beiden stellen konnte.
»Seit wann wart ihr zusammen?«, schob ich ein, das »du« einfach übernehmend.
Markus schien mich nicht gehört zu haben, aber bevor ich die Frage wiederholen konnte, antwortete Elke:
»Am kommenden Sonnabend hätten sie ihren ersten Jahrestag gehabt.« Als sie meinen irritierten Blick bemerkte, erklärte sie, dass sie die beiden damals quasi zusammengebracht habe. »Ich kenne Markus schon seit fast zehn Jahren.« Sie räusperte sich. »Und Susanne sagte mir gleich bei unserem ersten Treffen, dass sie ihn interessant fände.«
Ganz leise hörte man von draußen die Stimmen von Leuten, die sich zu ihrem Freitagabend in der Neustadt aufmachten; ich betrachtete Markus, über den Elke sprach, als wäre er nicht im Raum. Er hatte sich wieder hingesetzt, trank einen Schluck Whiskey, blickte weiter ins Leere.