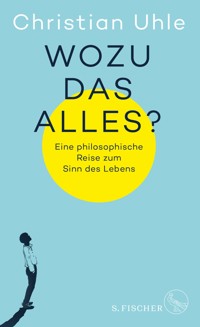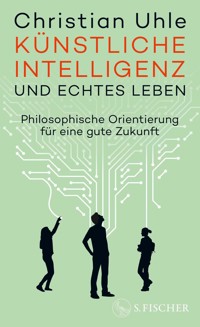
18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kann KI uns helfen, ein sinnerfülltes Leben zu führen? Schon in naher Zukunft werden wir von einer persönlichen KI durch unseren Alltag begleitet. Auch virtuelle Partner und die Vernetzung unserer Umwelten im Internet der Dinge sind nicht länger Nischenphänomene. Der Philosoph Christian Uhle bietet uns eine Orientierungshilfe durch diese Neuerungen. Denn die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz faszinieren mit großer Strahlkraft und entwickeln sich rasend schnell. Mit Sicherheit werden sie die Gesellschaft und die Welt, in der wir leben, nachhaltig verändern. Aber in welche Richtung? Meist sind neue Technologien mit den glitzernden Versprechen einer besseren Zukunft verbunden: Mehr Zeit für das Wesentliche dank smarter Apps! Mehr Verbindung zu deinen Mitmenschen durch Online Dating! Entlastung und Begleitung durch KI - rund um die Uhr! Christian Uhle schaut, wo sich tatsächlich Potentiale für ein erfüllteres Leben, eine gute Zukunft eröffnen – und wo wir in die Irre geleitet werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Christian Uhle
Künstliche Intelligenz und echtes Leben
Philosophische Orientierung für eine gute Zukunft
Über dieses Buch
Schon in naher Zukunft werden wir von einer persönlichen KI durch unseren Alltag begleitet. Auch virtuelle Partner und die Vernetzung unserer Umwelten im Internet der Dinge sind nicht länger Nischenphänomene. Die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz faszinieren mit großer Strahlkraft und entwickeln sich rasend schnell. Mit Sicherheit werden sie die Gesellschaft und die Welt, in der wir leben, nachhaltig verändern. Aber in welche Richtung? Meist sind neue Technologien mit den glitzernden Versprechen einer besseren Zukunft verbunden: Mehr Zeit für das Wesentliche dank smarter Apps! Mehr Verbindung zu deinen Mitmenschen durch Online Dating! Entlastung und Begleitung durch KI – rund um die Uhr!
Der Philosoph Christian Uhle schaut, wo sich tatsächlich Potenziale für ein erfüllteres Leben, eine gute Zukunft eröffnen – und wo wir in die Irre geleitet werden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Christian Uhle, geboren 1988, ist Philosoph und lebt in Berlin. Als Wissenschaftler hat er zu gesellschaftlichen und technologischen Transformationen geforscht und seine Perspektiven in zahlreichen Vorträgen und Gastbeiträgen öffentlich gemacht. Er war philosophischer Berater der Arte-Serie »Streetphilosophy«, ist Host mehrerer Veranstaltungsreihen und Speaker zu Themen wie Sinn im Leben und am Arbeitsplatz, New Work, digitaler Wandel und Künstliche Intelligenz. Zuletzt ist von ihm »Wozu das alles? Eine philosophische Reise zum Sinn des Lebens« bei S. FISCHER erschienen.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2024 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Hissmann, Heilmann, Hamburg
Coverabbildung: iStock Images
ISBN 978-3-10-491979-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Aufbruch in eine neue Welt
Das Netz, in dem wir stehen
Wozu dieses Buch?
Technologie als Versprechen
1 Endlich mehr Zeit für dich!
Was ist Technik? – Eine philosophische Perspektive
Technik als Weltbeziehung
Technik als innere Einstellung
Durch welchen Wald gehst du?
Sprung in die Freiheit?
Ein Versprechen mit Haken
Rebounds – Wenn der Schuss nach hinten losgeht
Im Rausch der Geschwindigkeit
Auf der Überholspur
Von Puzzlesteinen zum ganzen Bild
Mut zur Gestaltung
Wenn gewonnene Zeit zum echten Gewinn wird
2 Du bist nicht allein!
Kommunikation und Sozialität im Umbruch
Eine neue Rolle von Technik
Social Media
Wir sind ein Körper
Das Ende des Alleinseins
Ein neuer Blick auf die Welt
Vernetzt und doch allein?
Übersetzungstools
Turmbauer 2.0
Online-Dating
Zwischen Liebesglück und Verzweiflung
Szenario I: Netz der Verbundenheit
Szenario II: Labyrinth der Einsamkeit
Forschungsstand
Gesamtbild
Künstliche Intelligenz und echte Liebe?
Das große Verkupplungsprojekt
Das Ende analoger Romantik?
3 Ein neuer Freund und Helfer!
Was ist neu an KI?
Was kann KI?
Welche Auswirkungen hat KI?
Ein süßes Versprechen
Eine allzu menschliche Vermenschlichung
Künstliche Freundschaft
Kopien, besser als das Original
Wie funktioniert KI?
Wenn Mensch und Maschine durcheinandergeraten
Neue Formen von Beziehungen
Szenario I: Die entfremdetste Generation aller Zeiten
Szenario II: Die beziehungsfähigste Generation aller Zeiten
Der Teufel steckt im Detail
Welche KI führt uns zum Abgrund?
Kaffeeklatsch mit Taylor Swift
Welche KI führt uns in eine gute Zukunft?
Wenn mehrere Zukünfte eintreffen
Künstliche Helfer – echte Hilfe?
Welche Fähigkeiten zählen?
Mit cleveren KIs zu mehr Mündigkeit
Eine Frage des Geschäftsmodells
Das Alignment-Problem
Der Sapiens bekommt Gesellschaft
Die Neuankömmlinge sind da
Eine neue Gesellschaftsordnung
Wie gestalten wir die neuen Beziehungen?
4 Die Welt ist dir zu Diensten!
Ein neues Internet
Weisers Visionen
Wer bedient wen?
Von Kraft zu Kommunikation
Verlebendigung als Verzauberung
Kampf gegen die Gleichgültigkeit
Naturverhältnisse im Wandel
Eine neue Art, durch das Leben zu gehen
Auf dem Weg zur Weltseele
Mit IoT die Wunden der Moderne heilen?
5 Sinn statt Hamsterrad!
Out of Office
Werden wir alle arbeitslos?
Welche Fähigkeiten sind noch etwas wert?
Welche Abläufe sind automatisierbar?
Eine Welt voller Führungskräfte
Mit New Work zu mehr Sinn?
Ein Wandel mit Schattenseiten
Ein Fächer voller Möglichkeiten
Szenario I: Die große Sinnexplosion
Szenario II: Die große Langeweile
Zwei Verteilungsfragen
Szenario III: Der große Burnout
Was Keynes nicht ahnte
Mit neuen Denkweisen in eine neue Arbeitswelt
Es muss nicht alles besonders sein
Kein Ende in Sicht
Von Algorithmen und Weizenkörnern
Zweifelhafte Versprechen
Wie integrieren wir KI?
Vor der Welle
Dank
Aufbruch in eine neue Welt
Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als der Papst starb. Es war das Jahr 2005 und ich mitten in der aufregenden Blüte der Jugend irgendwo zwischen Colorado und Las Vegas. Über meine Schule hatte ich mit fünfzehn anderen Schülerinnen und Schülern an einem Austausch teilgenommen; es war die mit Abstand weiteste Reise, die ich bis dahin unternommen hatte. Unsere Tage platzten vor Eindrücken geradezu aus allen Nähten: das hautnahe Erleben einer Kultur, die wir bis dahin nur aus dem Fernsehen kannten, die beeindruckende Natur und natürlich der geballte Klatsch und Tratsch von mehr als einem Dutzend Jugendlicher weit weg von zu Hause …
Mitten in dieser Zeit hätte die Nachricht des Todes von Papst Johannes Paul II. kaum eine Chance gehabt, einen Platz in meiner Erinnerung einzunehmen. Doch ein Mitschüler war zutiefst mitgenommen von dem Verlust und brach den Austausch kurzerhand ab, um für die Beerdigung nach Rom zu fliegen und dort seine Familie zu treffen. Für mich damals wie heute unvorstellbar.
Wir haben nie darüber gesprochen, wie es dort war, auf dem Petersplatz, die Andacht, die Stimmung unter den Gläubigen, die geteilte Emotionalität. Aber ich habe ein Foto gesehen von der versammelten Menge, die gemeinsam den Blick nach vorne richtet, auf diesem riesigen und geschichtsträchtigen Platz. Es gibt kein aktives Miteinander, jeder blickt für sich nach vorne. Und doch spüre ich auf diesem Foto ein Verschmelzen der einzelnen Menschen zu einem gemeinsamen Organismus, verbunden durch Trauer und Gebet.
Dieses Foto ist für mich zu einem Symbol der Digitalisierung geworden – oder besser gesagt: der Zeit davor. Es steht sinnbildlich für all die geteilten Erfahrungen und Erinnerungen, für all die Konzerte und Sonnenuntergänge, bevor wir ein Smartphone in der Hand hielten. 2005 war die Andacht. Seitdem hat sich viel verändert.
Vergleicht man diese Situation mit der Wahl von Papst Franziskus im Jahr 2013, sieht man Fotos des gleichen Platzes und einer ähnlichen Menschenmenge. Nur ein Detail ist anders – und dadurch so viel. Fast alle halten ein kleines Gerät hoch, halten den historischen Moment fest, an dem sie gerade teilhaben. Auf dem Foto ist ein ganzer Ozean von Bildschirmen zu sehen. Schauen die Gläubigen eigentlich nach vorne? Oder erleben sie das Ereignis gerade auf ihrem Handydisplay?
Acht Jahre liegen zwischen den Fotos, das ist nicht viel, das ist noch nicht einmal eine Generation. Gleicher Ort, gleiche Religion, eine andere Gesellschaft. Was hat sich verändert in diesen Jahren? Was ist passiert?
Auf jeden Fall sind einige Unternehmen sehr reich geworden. 2007 brachte Apple mit dem iPhone das erste Smartphone auf den Markt. Bis Ende 2023 wurden insgesamt mehr als 17 Milliarden Geräte verkauft – mehr als doppelt so viele, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt.[1] Der Gesamtumsatz der Verkäufe wird auf über 400 Milliarden Dollar jährlich geschätzt.[2] Diese beeindruckenden Dimensionen haben große Auswirkungen auf uns alle. Denn die Digitalisierung prägt unser Leben nicht nur in den Momenten, in denen wir ein Smartphone in der Hand halten. Unsere gesellschaftlichen Grundstrukturen werden zunehmend dadurch geprägt. Wir erleben nichts Geringeres als eine neue Ära unserer Ökonomien: Der industriell geprägte Kapitalismus mit den Schlüsselindustrien rund um Öl, Kohle, Stahl, Maschinen, Automobile wird zunehmend abgelöst durch einen digital geprägten Kapitalismus, in dessen Zentrum Prozessoren, Software, Apps, Plattformen, Algorithmen und digitale Dienstleistungen stehen. Auf diese Weise entstehen neue wirtschaftliche und gesellschaftliche Machtverhältnisse, neue Jobs, neue Gewinner und Verlierer. Der inhaltliche Fokuswechsel des Kapitalismus und damit auch unserer Vorstellungen davon, was Innovation und Fortschritt eigentlich bedeuten, verändert außerdem den Zeitgeist unserer Arbeitswelten. Werte wie Selbstbestimmung und Flexibilität sind populärer geworden, sie bekommen nun Platz, der früher in den engen Taktungen und rigiden Strukturen von Fabriken und deren Verwaltungen nicht bestand. Das beeinflusst uns alle – direkt oder indirekt. Denn wir führen unser Leben nicht im luftleeren Raum, sondern innerhalb dieser Gesellschaft. Hier knüpfen wir Beziehungen, hier arbeiten wir, hier suchen wir nach Sinn und Glück. Wenn sich der Kontext ändert, dann macht das etwas mit uns.
Das Netz, in dem wir stehen
Wenn ich mir Fotos anschaue vom Petersplatz und die wogende Menge aufblitzender Displays sehe, dann frage ich mich, wie die Digitalisierung unser Erleben von besonderen Momenten verändert hat. Diese Situation ist nur ein Beispiel von unzähligen Ereignissen, bei denen Menschen in Massen ihre Geräte hochreißen und kaum noch durch die eigenen Augen blicken.
Wie ändert sich unsere Wahrnehmung eines Ereignisses, wenn wir nicht nur durch unsere eigenen Augen schauen, sondern gleichzeitig eine zweite Perspektive einnehmen durch Linsen, Filter und Bildschirme? Was macht es mit uns, wenn wir in einem spektakulären Sonnenuntergang gedanklich bereits einen Post sehen, bewertet mit Likes? Wenn wir auf einem Konzert nicht nur Musik hören und tanzen, sondern parallel die ersten Kommentare auf unsere Storys lesen?
Wenn dies unsere Beziehung zu Ereignissen verändert, dann ändert sich in Teilen auch unsere Art, durchs Leben zu gehen – unser »In-der-Welt-Sein«, wie es in der phänomenologischen Philosophie ausgedrückt wird. Unsere Perspektive ändert sich, wir achten auf andere Details, nähern uns der Situation etwas anders. Solche Veränderungen verlaufen interessanterweise gleichzeitig schnell, tiefgreifend und trotzdem subtil. Denn gerade weil sie unsere grundsätzlichen Verwurzelungen in der Welt neu ausrichten, sind sie schwer zu fassen. »Wir können das Netz, in dem wir stehen, nicht zuziehen«, schrieb Walter Benjamin in einem berühmten Aufsatz[3] und meinte damit genau das: Wenn Strukturen besonders prägend und elementar sind für unser In-der-Welt-Sein, dann sind diese Strukturen besonders schwierig zu erkennen. Sie sind keine Gegenstände, die wir vor uns sehen, sondern die Brille, durch die wir auf die Welt blicken.
Die Digitalisierung ist eine Transformation dieser Tiefenstruktur. Außergewöhnlich an dieser Umwälzung ist die Kombination aus Breite, Tiefe und Geschwindigkeit. In der Breite sind sämtliche Lebensbereiche betroffen – und dies häufig tiefgreifend. Außerdem vollzieht sich die Veränderung in besonders hohem Tempo: Während einige Institutionen ihre Formulare gerade erst digitalisieren und Unternehmen über Home-Office-Regelungen diskutieren, werden bereits Quantencomputer und vollautonome Drohnen entwickelt.
Bei all dieser Dynamik haben wir vermutlich noch gar nicht verstanden, was das Smartphone mit uns und unserer Gesellschaft gemacht hat. Dank Navigationsapps bewegen wir uns anders durch die Umgebung, fahren durch Straßen, die wir sonst nie gesehen hätten und nehmen Städte anders war. Wir gehen auf Veranstaltungen, von denen wir ohne Social Media und digitale Werbung nie erfahren hätten. Wir hören Musik, die unsere Stimmung beeinflusst und auf die wir ohne Algorithmen nie gekommen wären. Wir halten einen Kontakt zu Menschen, der früher unmöglich gewesen wäre, gehen dadurch Freundschaften ein, die sonst nicht entstanden wären. Durch Online-Dating lieben sich Menschen, die sich sonst nie begegnet wären, bekommen manchmal sogar Kinder miteinander, so dass neues Leben und ein veränderter Genpool entstehen. Da verändert sich Gesellschaft in ihren basalen biologischen Grundfesten.
All das haben wir kaum begriffen, und doch stehen bereits die nächsten Entwicklungen vor der Tür und lassen kaum Gelegenheit, das bisher Geschehene erstmal in Ruhe zu verarbeiten. In der absehbaren Zukunft werden viele Menschen einen eigenen digitalen Assistenten nutzen, der sie vom Moment des Aufstehens bis zum Schlafengehen durch den Tag begleitet, der immer für sie da ist, der alles weiß und der ihnen das Gefühl gibt, verstanden zu werden und niemals mehr allein zu sein. Was gestern wie Science-Fiction klang, ist durch die Veröffentlichung von ChatGPT geradezu über Nacht zu einer fast greifbaren Möglichkeit geworden. Und ist beim Lesen dieses Buches vielleicht schon Realität.
Das Smartphone und ChatGPT sind besonders eindrückliche und vieldiskutierte Fälle, doch sie sind nur die Spitze des Eisbergs der digitalen Transformation. Zum Beispiel entwickelt sich der 3D-Druck sprunghaft weiter und verändert Fertigungen und Wertschöpfungsketten: Ersatzteile, komplizierte Formen, lebensrettende medizinische Implantate können prinzipiell überall in kürzester Zeit gedruckt werden. Sogar der Wohnungsbau ist davon betroffen, indem Drucker komplette Häuser in Rekordzeit und zu einem Bruchteil der üblichen Kosten errichten. Während hier die physische Sphäre transformiert wird, ermöglichen digitale Brillen das Eintauchen in virtuelle und erweiterte Realitäten: 2023 hat Apple eine eigene Brille vorgestellt, durch die Nutzende eine Mischung aus echter Umgebung und virtuellen Elementen sehen können. Die ganze Welt verwandelt sich so in einen digitalen Raum und bisherige Modelle wie die Microsoft HoloLens bekommen eine mächtige Konkurrenz. Auch in der Medizin ist vieles in Bewegung, KI ermöglicht die Diagnose von Krankheiten, noch bevor Symptome auftreten. Und in der Landwirtschaft überwachen Drohnen die Felder und liefern Daten in Echtzeit, während autonom gesteuerte Traktoren die Saat ausliefern. Die Art und Weise, wie wir Nahrung produzieren und verteilen, wird neu definiert.
Diese Liste ließe sich seitenlang fortsetzen, man denke an autonome Waffensysteme, Kryptowährungen, NFTs in der Kunstwelt, KI-generierte Musikstücke, selbstfahrende Autos, adaptive Verkehrssteuerungen, das Internet der Dinge, smarte Straßenlaternen, intelligente Stromnetze, Gesichtserkennung, maßgeschneiderte Werbung im Einzelhandel, datenbasierte Analysen im Leistungssport, digital überwachte Ökosysteme, realistische Deepfake-Videos und so weiter.
All das ist bereits Realität oder könnte es demnächst sein. Manches klingt eindeutig wünschenswert, etwa bessere Diagnosen von Krankheiten. Anderes klingt möglicherweise dystopisch, zum Beispiel eine Gesichtserkennung in Echtzeit, die in der EU nur in Ausnahmefällen erlaubt ist.[4]
Es ist faszinierend und beängstigend zugleich, wie viel bereits passiert ist und wie viel noch auf uns zukommt in den nächsten Jahren. In der Gesamtschau wird deutlich: Die Transformation steht erst ganz am Anfang. Wir können uns zwar kaum noch eine Welt vorstellen ohne Computer, Internet und Smartphones – aber das sind nur die ersten Kapitel dieses Zeitalters. Die Geschichte geht weiter, und es sieht so aus, als würden wir derzeit an der Schwelle zu einem neuen Kapitel stehen.
Für sehr lange Zeit waren die Schlüsselbegriffe, an die man als Erstes dachte, wenn es um Digitalisierung ging: Computer, Programme, Internet. Diese Aufzählung ist nicht zufällig, sie folgt einer Logik. Der Computer war die zentrale Hardware der ersten Welle, die darauf laufenden Programme waren die Software und das Internet der Modus der Vernetzung. Bis heute existiert all das natürlich immer noch. Aber wenn man Menschen nach ihren ersten Assoziationen zu »Digitalisierung« fragt, hört man tendenziell eher Begriffe wie Smartphone, Apps, Social Media. Auch hier haben wir ein Triplett aus der prägenden Hardware der letzten fünfzehn Jahre, der Art von Software sowie einem bestimmten Modus des Vernetztseins. Natürlich lösen sich diese Stufen nicht ab, sondern bauen aufeinander auf und bilden verschiedene Schwerpunkte, die gemeinsam eine eigene Phase der Digitalisierung prägen. Wenn wir uns aktuelle Entwicklungen anschauen, drängt sich der Verdacht auf, dass die kommenden Jahre von einem neuen Triplett bestimmt sein werden – dass wir also in eine neue Phase eintreten. Nicht das Smartphone ist der zentrale Wachstumstreiber, sondern Künstliche Intelligenz. Sie kann sowohl in bestehende Anwendungen integriert werden, kann als neue Gesprächspartnerin zur Verfügung stehen und auch eine neue Generation von Robotern ermöglichen. Diese müssen nicht so menschenähnlich aussehen wie in Filmen, sondern sind häufig mit Sensoren ausgestattete kleine Geräte, die teils unsichtbar in die Umgebung integriert werden. Zusätzlich zum allgemeinen Internet auf dem PC und zur Dauerkommunikation mit dem Smartphone breitet sich nun ein weiterer Modus der Vernetzung aus: Das Internet der Dinge beschreibt die Vernetzung nicht nur von Menschen mit Menschen, sondern auch von Dingen mit Dingen, etwa im Smart Home, wo zum Beispiel Fenster mit Thermostaten kommunizieren können.
Im Verlauf dieser drei Stufen sind digitale Technologien stetig enger an uns herangerückt – und prägen unser Leben immer umfassender. Während ein PC noch einen festen Platz zu Hause oder im Büro hat, wird das Smartphone zum ständigen Begleiter. Doch so allgegenwärtig es auch ist: Wir müssen es aus unserer Tasche holen und aktiv bedienen. In der nun bevorstehenden Phase wird das seltener nötig. Denn mit KIs können wir nebenher sprechen, können diese Software also mit freien Händen nutzen. Zusätzlich kommunizieren im Hintergrund Autos mit Ampeln und unsere Kleidung mit der Waschmaschine. Kurz gesagt: Das Internet ist nicht mehr in unserer Hand, sondern überall um uns herum. Wie auch bei den vorherigen Stufen hat dies weitreichende kulturelle, soziale und wirtschaftliche Veränderungen zur Folge.
Stufe: die Computer-Ära
Hardware: Personal Computer
Meilenstein: Apple I (1976) und IBM PC (1981)
Software: Programme
Meilenstein: Windows 3.0 (1990)
Vernetzung: Internet
Meilenstein: World Wide Web (1991)
»Wo« ist die Digitalisierung?
Auf dem Schreibtisch (stationär)
Stufe: die Smartphone-Ära
Hardware: Smartphone
eilenstein: iPhone 1 (2007)
Software: Apps
Meilenstein: Apple App Store (2008)
Vernetzung: Mobiles Internet und Social Media
Meilenstein: Facebook (2004)
»Wo« ist die Digitalisierung?
In meiner Hand immer dabei (mobil)
Stufe: die KI-Ära
Hardware:KI-gestützte Robotik (umfasst Smarte Produkte)
Software: Künstliche Intelligenz
Meilenstein: ChatGPT (2022)
Vernetzung: Internet der Dinge
»Wo« ist die Digitalisierung?
Überall um mich herum (ubiquitär)
Wozu dieses Buch?
Längst wird deutlich: Digitalisierung ist kein Thema allein für Computerfreaks, sondern betrifft uns alle – ob wir wollen oder nicht. Es ist eine Entwicklung, die unser aller Zukunft prägen wird. Ein so weitreichender Prozess sollte wohlüberlegt, gemeinsam und demokratisch gestaltet werden. Dieses Buch möchte Anregungen geben, wie über Digitalisierung und Künstliche Intelligenz nachgedacht werden kann. Daraus folgt nicht unmittelbar, was genau zu tun ist – das muss jede und jeder von uns selbst entscheiden. Aber wenn wir das eigene Leben in der Welt, unsere Rolle darin und die Entwicklungen in der Gesellschaft besser verstehen, kann dies auch bei der Orientierung im Alltag helfen.
Auf diesem Weg begegnen wir zahlreichen Grundsatzfragen, die somit immer auch philosophische Fragen sind. Deshalb werden wir an vielen Stellen einen Blick in die Philosophie werfen. Gerade in Zeiten sehr schneller und tiefgreifender Transformationen lohnt es sich innezuhalten und zu philosophieren.
Die Frage ist drängend: Wie verändert Künstliche Intelligenz unser Leben und unsere Gesellschaften? Allerdings ist diese Frage auch tückisch. Denn sie klingt, als wäre KI etwas, das außerhalb unserer Gesellschaft steht und wie eine übergeordnete Macht auf uns einwirkt. Das stimmt nicht. Künstliche Intelligenz verändert nicht als äußere aktive Kraft unsere Gesellschaft, sondern sie ist selbst ein Produkt unserer Gesellschaft. Das mag wie ein Detail klingen, ermöglicht aber einen präziseren Blick und bildet daher einen Ausgangspunkt für das gesamte Buch: Technologie fällt nicht vom Himmel, und sie ist niemals neutral. Technologie wird von Menschen gemacht. Daraus ergeben sich zentrale Fragen: Welche gesellschaftlichen Werte und Vorstellungen kommen in den KI-Anwendungen zum Ausdruck? Welche Menschenbilder, welche Ansichten über das Leben, welche Wünsche und Sehnsüchte leiten die digitalen Technologien und ihren Einsatz? Welche sozialen Machtverhältnisse spiegeln sich in der Gestaltung und den Visionen neuer Technologien wider?
Zwischen Gesellschaft und Künstlicher Intelligenz besteht ein Wirkungszusammenhang, der in beide Richtungen geht. Beides prägt sich wechselseitig oder sogar noch tiefgreifender: Beides bedingt einander. Was Digitalisierung und KI ausmacht, lässt sich nicht unabhängig von gesellschaftlichen Werten, Annahmen und Narrativen bestimmen. Und umgekehrt: Was unser Menschsein und unser Leben ausmacht, lässt sich nicht länger unabhängig von digitalen Technologien bestimmen.
Technologie als Versprechen
Jede Technik ist durchtränkt von Wertevorstellungen und Hoffnungen. Manchmal lösen sie eine regelrechte Begeisterung aus. Aber woher stammt diese Faszination? Warum assoziieren wir »Fortschritt« so sehr mit technologischen Entwicklungen? Warum denken viele Menschen zuerst an die technischen Möglichkeiten, wenn sie sich überlegen, wie die Welt in dreißig Jahren aussieht?
Technologie hat einen Nimbus, einen Zauber, sie verschiebt die Grenzen des Möglichen. Eben noch musste man wochenlang auf einen Brief aus Amerika warten, heute ist die E-Mail in Sekundenschnelle verschickt. Und eine Minute später ist das Staunen bereits verschwunden und wir halten all das für völlig normal. Dann brauchen wir fliegende Autos oder täuschend echte virtuelle Realitäten, um noch beeindruckt zu sein. ChatGPT markiert einen Meilenstein in der Menschheitsgeschichte und doch habe ich viele Personen um mich herum erlebt, die schon wenige Wochen nach der Einführung so selbstverständlich damit umgingen wie mit einem Regenschirm.
Aber es ist nicht nur das. Neue Technologien erzeugen nicht nur eine kurze, vergängliche Euphorie, weil sie den Horizont des Bekannten übersteigen. Sie sind auch mit ausgesprochenen oder unausgesprochenen Versprechen eines besseren Lebens verbunden. Innovationen glänzen verheißungsvoll, sie sind wie Vorboten einer goldenen Zukunft. In Werbespots oder Zukunftsvisionen werden diese Versprechen unmittelbar sichtbar. An anderen Stellen schwingen sie unausgesprochen mit und bilden die unbewusste, narrative Tiefenstruktur des sogenannten Fortschritts.[5]
Wir können die Entwicklung besser verstehen und bewusster gestalten, wenn wir diesen Treibstoff unter die Lupe nehmen: Welche Hoffnungen und Versprechen werden uns da gemacht – ausgesprochen oder versteckt? Mit welchen Bedürfnissen und Sehnsüchten spielen sie? Und werden diese Versprechen eingelöst oder drohen sie möglicherweise sogar nach hinten loszugehen?
In diesem Buch möchte ich fünf solcher Technologieversprechen – und insbesondere solchen eines sinnerfüllten Lebens – nachgehen, sie explizit machen, versuchen einzuordnen und überlegen, ob sie realistisch sind und wir tatsächlich auf eine bessere Zukunft hinsteuern oder ob es leere, trügerische Versprechen sind, die uns an der Nase herumführen.
Insofern ist der Anspruch dieses Buches weder, eine kohärente Theorie unserer von KI geprägten Gesellschaft zu entwickeln, noch vollständig alle Facetten des Themas KI zu beleuchten. Vielmehr geht es darum, den Blick auf eine Reihe ausgewählter Aspekte zu richten, die mir häufig zu kurz zu kommen scheinen: Werden Künstliche Intelligenzen und digitale Services dazu führen, dass mehr Menschen ihr Leben als sinnvoll erfahren? Wie können wir die Entwicklung diesbezüglich in eine positive Richtung lenken?
Diesen Fragen werden wir uns annehmen, indem wir einer Reihe konkreter Sinnversprechen nachgehen:
Endlich mehr Zeit für dich! – Im ersten Kapitel gehen wir einem Versprechen auf den Grund, das mit vielen Technologien verbunden ist: mehr Freiräume für das, was wirklich wichtig ist. Geht die Rechnung auf, oder werden wir durch die vielen Innovationen nur noch gestresster?
Du bist nicht allein! – Insbesondere Social Media, aber auch Übersetzungstechnologien und KI-basiertes Online-Dating versprechen, Menschen miteinander zu verbinden. Welche Formen von Sinn und Verbundenheit entstehen hier wirklich?
Ein neuer Freund und Helfer! – Im dritten Kapitel tauchen wir tiefer ein in die neuen Entwicklungen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz. Wie verändern sich soziale Strukturen und unser Sinnempfinden, wenn wir nicht nur mit Menschen, sondern zunehmend auch mit KIs sprechen?
Die Welt ist dir zu Diensten! – Das Internet der Dinge ist die Vision einer Welt, in der alle Gegenstände miteinander vernetzt sind. Hier zeichnet sich eine grundsätzlich neue Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt ab – wird sie eine sinnhafte Einbettung fördern oder zu noch mehr Entfremdung führen?
Sinn statt Hamsterrad! – Arbeitswelten werden immer stärker durch digitale Technologien strukturiert. Künstliche Intelligenz beschleunigt den Wandel hin zu New Work. Aber werden wir am Ende wirklich mehr Sinn im Job erfahren? Oder erzeugt diese Entwicklung vor allem mehr Verliererinnen und Verlierer?
Als philosophische Gedankenreise ist dieses Buch eine Einladung zum Hinterfragen und Mitdenken. Ein solcher Prozess kann gerade bei einem so dynamischen Gegenstand wie der KI-Transformation nie abgeschlossen sein. Aber das macht das Leben ja so spannend, es gibt immer wieder Neues zu entdecken.
1Endlich mehr Zeit für dich!
»Warum bist du hier?«, sprach er sie an, zugewandt und mit offenem Blick.
Die salzige Meeresluft spielte sanft mit ihren kurzen Haaren, eine Welle brach an den Felsen und in ihr nachdenkliches Schweigen hinein. Nackt saßen sie dort, die warme Sonne glitzerte auf ihrer nassen Haut. Keiner der beiden jungen Menschen beachtete die Homaten, die regungslos hinter ihnen standen.
»Ich heiße Mi«, antwortete sie und sah ihn lange an.
Vielleicht spürten sie bereits in diesem Augenblick, dass dies der Anfang einer innigen Beziehung werden sollte. Die Luft lag voller Möglichkeiten. Ihr ganzes Leben hatten sie noch vor sich an diesem 21. Mai 2500 – ein langes, gesundes, unbeschwertes Leben in einer Welt, in der niemand arbeiten musste, in der für alles gesorgt war und es an nichts mangelte.
Was für eine phantastische Vorstellung.
Mit dieser Szene beginnt der einzigartige Roman von Ludwig Dexheimer: Das Automatenzeitalter. Vor fast hundert Jahren verfasste er seine Utopie einer besseren, friedvollen und hochtechnisierten Zukunft.[6]
Was tun Menschen in einer Welt ohne jegliche Verpflichtungen und Sorgen? Worüber sprechen sie? In der Vorstellung des Autors laden sie ihre Freunde zum Dinner ein, diskutieren stundenlang über Kunst und Wissenschaft und unternehmen Reisen. Das junge Paar Mi und Lu fügt sich nahtlos in diesen Zeitgeist ein. Fast jede Woche fliegen sie in ihren ultraschnellen Luftyachten an ferne Orte, besuchen kurz Indien und sind zum Abendessen zurück in ihren Villen in Europa. Dort ist der Haushalt immer schon erledigt, denn jeder Quadratzentimeter ihrer Häuser ist vollgestopft mit Technik, jeder menschliche Handgriff wurde ersetzt. Selbst allerkleinste Aufgaben werden ihnen abgenommen. Nach dem Duschen genügt ein einziger Befehl und schon werden die Bewohnerinnen und Bewohner von mechanischen Armen angekleidet.
Wer kann derart luxuriös leben? Sind Mi und Lu zwei verwöhnte Rich Kids des 26. Jahrhunderts, die sich auf Kosten der hungernden Massen vergnügen? In dem Roman von Ludwig Dexheimer wäre das undenkbar. Jeder Mensch unter dem Himmel bekommt eine identisch große Villa, eine Luftyacht und drei Homaten. Alles Weitere steht zur freien Verfügung: Das feinste Essen, Kleidung und selbst Aufenthalte in Luxushotels können von jeder Person zu jeder Zeit bestellt werden. Geld wurde komplett abgeschafft.
Es ist erstaunlich, wie egalitär, liberal, pazifistisch und radikal diese Zukunftsvision ist, die der deutsche Chemiker 1930 veröffentlichte. Entgegen dem faschistischen Zeitgeist wollte er eine Welt ohne Nationen entwerfen, ohne Hass und ohne Geschlechterrollen.[7] Ungewöhnlich ist auch, dass er diese Welt nicht als unerreichbare Utopie ansah, sondern als völlig realistische und ernstgemeinte Zukunftsprognose. Dexheimer war ein unerschütterlicher Optimist und glaubte fest daran, dass sich die Menschheit zum Besseren entwickelt. Für ihn war klar, dass es irgendwann keinen Hunger und keine Ungerechtigkeit mehr gibt, keine Wut, keine Gewalt, keinen Egoismus und keine Verzweiflung. Dieser positive Blick auf die Zukunft speiste sich aus einer zentralen Quelle der Hoffnung: dem technischen Fortschritt.
Vor allem die vollständige Automatisierung von Produktion, Logistik, Reinigung und vielen weiteren Bereichen ermöglicht den Romanfiguren ein komfortables, sorgenfreies Leben. Niemand muss mehr arbeiten – alle unangenehmen Aufgaben sind maschinisiert oder werden von Homaten übernommen: von Robotern mit einer Künstlichen Intelligenz. Sie halten den Menschen im Alltag den Rücken frei: »Was wären wir ohne die Technik? Sklaven und Handlanger! Sie erst hat es uns ermöglicht, dass wir uns ausschließlich höheren, geistigen Tätigkeiten widmen können«, schwärmt ein Freund von Mi und Lu. Deshalb haben die Menschen im Automatenzeitalter viel Zeit. Ihre Woche wirkt wie eine nie endende Aneinanderreihung von Sonntagen.[8]
In dieser Geschichte kommen zentrale Versprechen von Technologie zum Ausdruck: Unser Leben soll besser werden. Und »besser« heißt hier vor allem komfortabler und bequemer. Lästige Aufgaben werden vereinfacht, beschleunigt oder sogar ganz ersetzt. Dadurch wachsen die Freiräume für sinnvolle Tätigkeiten. Im Automatenzeitalter wird diese Logik ins Extrem gezogen und besonders greifbar.
Springen wir zurück in unsere Gegenwart, dann können wir überall ähnliche Botschaften entdecken: weniger benötigte Zeit für das, was man tun muss, mehr freie Zeit für das, was man tun will.
So wirbt Waze, ein Konkurrent von Google Maps, explizit damit, durch die Nutzung der App wertvolle Zeit zu sparen.[9] Und es stimmt ja, wenn wir dank Navigation die kürzeste Route nehmen und Staus vermeiden, sind das bare Minuten, die wir früher ankommen. Auch vernetzte Systeme werden mit ähnlichen Narrativen verknüpft, so schwärmt das Branchenmagazin Control: »Zeit ist die wertvollste Ressource unseres Lebens und als Sterbliche können wir sie niemals zurückerlangen. Es ist selten, dass wir eine Gelegenheit bekommen, auf einen Schlag große Mengen an Zeit zu sparen. Genau darum geht es jedoch bei der Automatisierung.«[10] Und Samsung bewirbt ein Smartphone damit, dass es uns hilft, »das meiste aus jeder Minute herauszuholen, im Büro wie auch außerhalb davon«.[11]
Digitale Innovationen werden also häufig mit dem Versprechen verkauft, uns zu entlasten und mehr Zeit zu schenken für das, was wirklich zählt. Dank Mähroboter muss der Rasen nicht mehr mit eigenem Körpereinsatz auf die Wunschlänge gebracht werden – wir können uns währenddessen zurücklehnen, einkaufen oder ein Buch lesen.[12] Viele andere Innovationen schlagen in eine ähnliche Kerbe: Kontaktdaten werden im Hintergrund automatisch synchronisiert und müssen nicht mehr händisch übertragen werden. Das neue Paar Schuhe ist dank Online-Shopping nur ein paar Klicks entfernt und von der Couch aus bestellbar. Virtuelle Besprechungen machen viele Dienstreisen überflüssig und wenn doch Reisen notwendig sind, können Hotels und Bahnfahrten von unterwegs gebucht werden. Auch Überweisungen werden per App abgewickelt – das langwierige Ausfüllen von Formularen entfällt. Sogar der Gang zur Ärztin entfällt teilweise dank Telemedizin: »Tschüss Wartezimmer. Hallo Online-Arzt«, wirbt eine große Plattform.[13] Und nun werden immer bessere Assistenzen angeboten, die auf Künstlicher Intelligenz basieren und uns bei privaten oder beruflichen Aufgaben unterstützen können. Vielleicht bringen uns in nicht allzu ferner Zukunft sogar selbstfahrende Autos ans Ziel – dann würde viel Lebenszeit plötzlich verfügbar, in der wir bisher ein Lenkrad in der Hand halten mussten. Überall locken Entlastung, Vereinfachung, Komfort und Zeitersparnis. Eine verheißungsvolle Aussicht.
Ich genieße die ruhige Stunde vor dem Arbeitstag. Diese Zeit gehört mir allein. Die anderen sind schon aus dem Haus und in meinem ganz eigenen Rhythmus trinke ich meinen schwarzen Kaffee, lasse mir einige Nachrichten vorlesen und schaue zwischendurch einfach aus dem Fenster. Es fühlt sich gut an, dem sanften Wiegen der Blätter zuzusehen, während im Hintergrund alles erledigt wird und meine hundert Mails durch eine KI beantwortet werden. Plötzlich klingelt es an der Tür.
»Was ist das?«, frage ich mehr zu mir selbst.
»Ein Geschenk für Birgit. Ihr seid heute Abend auf ihrem Geburtstag eingeladen«, antwortet die sanfte Stimme meiner Künstlichen Assistenz. Sehr gut! Daran hatte ich gar nicht gedacht.
Die Hoffnung, durch neue Technologien mehr Komfort, Bequemlichkeit und Freizeit zu gewinnen, ist nicht erst durch die Digitalisierung in die Welt gekommen. Im Gegenteil, seit jeher sind die meisten Technologien mit dieser Hoffnung verbunden: Egal ob Auto, Gasheizung oder Pürierstab – immer geht es darum, effizienter, bequemer und schneller zum Ziel zu kommen. Allein durch die Waschmaschine sparen wir irrsinnig viel Zeit und Aufwand. Während bei einem Haushalt von vier Personen wöchentlich circa 5 Stunden für die Handwäsche benötigt werden, sind es mit einer Waschmaschine nur eine Stunde. Damit werden etwa 220 Stunden im Jahr gespart.[14] Hinzu kommen all die weiteren Haushaltsgeräte. So wirbt Bosch für einen Geschirrspüler: »Warum Zeit damit verschwenden, das Geschirr zu waschen, wenn Bosch Geschirrspüler ohne Aufwand für perfekte Sauberkeit sorgt, so dass du mehr Zeit mit deiner Familie verbringen kannst.«[15]
Wenn wir über Digitalisierung und Künstliche Intelligenz nachdenken, dann ist es hilfreich, sich diese grundlegenden Eigenschaften von Technik bewusst zu machen. Was ist Technik überhaupt? Und warum entwickeln wir sie?
Der spanische Philosoph José Ortega y Gasset stellte die Versprechen von Einfachheit und Zeitersparnis in den Mittelpunkt seiner Definition: »Technik ist die Anstrengung, uns Anstrengung zu ersparen.«[16]
So gesehen stoßen die utopistischen Darstellungen aus dem Automatenzeitalter direkt ins Herz der gesellschaftlichen Technisierung. Die mit digitalen Innovationen verknüpften Botschaften eines angenehmeren Lebens sind kein kleiner Nebenaspekt, sondern hängen unmittelbar damit zusammen, was Technik im Kern ausmacht.[17] Daher werden wir unsere philosophischen Überlegungen mit diesem zentralen Aspekt beginnen.
Was ist Technik? – Eine philosophische Perspektive
Ein Leben ohne große Anstrengungen klingt erstmal verlockend, aber warum eigentlich? Steht dahinter der plumpe Wunsch nach Bequemlichkeit? Ist die Geschichte der Technik mit anderen Worten eine Geschichte der Faulheit? Besteht deshalb so viel Aufregung um Künstliche Intelligenz – weil wir Couch-Potatos sind und darin insgeheim unsere Erlösung sehen?
Wenn man sich den ein oder anderen Werbespot anschaut, in dem sich Menschen dank digitaler Services lässig zurücklehnen, sieht es fast so aus. Aber es ist hilfreich, aktuelle Innovationen in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Seit der Homo sapiens auf dieser Erde ist, benutzt er Werkzeuge und entwickelt Techniken, um seine Ziele effektiver zu erreichen. Lange bevor es Computer und bequeme Sofas gab, erleichterte es ein spitzer Stein, einen Knochen aufzubrechen, um an das nährstoffreiche Mark zu gelangen. Ohne technische Hilfsmittel ist dies unmöglich oder zumindest sehr anstrengend. Sich das Leben an dieser Stelle einfacher zu machen, ist weder Faulheit noch Luxussucht, sondern eine Frage des nackten Überlebens. Die »Anstrengung, dem Menschen Anstrengung zu ersparen« bedeutet also nicht unbedingt verwöhnte Bequemlichkeit. Der grundsätzliche Ansatz, die Welt um sich herum durch Technik unter Kontrolle zu bekommen, ist für ein zerbrechliches Lebewesen wie den Homo sapiens geradezu notwendig.
Trotzdem bleibt die Frage, was Technik mit uns macht – und ob es unbegrenzt wünschenswert ist, sich Anstrengung zu ersparen. Gehört es nicht auch zu einem sinnerfüllten Leben, manche Dinge selbst zu tun? Spüren wir in kleinen Anstrengungen nicht auch unsere eigene Lebendigkeit? Auf gesellschaftlicher Ebene wirft all das ebenfalls zahlreiche Fragen auf: Welche Strukturen kommen in den Versprechen eines einfacheren Lebens zum Ausdruck? Wie prägt das wiederum die Menschen? Und wird unser Leben durch den technischen Fortschritt tatsächlich komfortabler? Auf den nächsten Seiten werden wir einen Blick in die Technikphilosophie werfen, um einige Puzzleteile zu sammeln, was Technik ausmacht und wie sie auf uns wirkt.
Die Theorie von Leszek Kołakowski bietet hierfür einen guten Ausgangspunkt. Der polnische Philosoph sieht die menschliche Existenz mit zwei elementaren Herausforderungen verbunden: praktisch mit der Welt umzugehen und sich emotional in ihr geborgen zu fühlen. Das ist eine ebenso simple wie hilfreiche Analyse. Denn der Mensch ist in eine Welt geworfen, die kaum berechenbar erscheint. Sie ist voller Hürden, Gefahren und Unwägbarkeiten. Denken wir zum Beispiel an Gewitter: grelle Blitze, ohrenbetäubende Donner, peitschender Regen – unsere Vorfahren hat das vermutlich in helle Aufregung versetzt. Sie sahen sich einerseits vor der Aufgabe, mit diesen Naturgewalten in irgendeiner Form praktisch umzugehen und Handlungsstrategien zu entwickeln – zum Beispiel in einer Höhle Unterschlupf zu suchen oder ein schützendes Dach zu bauen. Gleichzeitig waren diese plötzlichen Ereignisse emotional beunruhigend und bedrohten das Gefühl, in der Welt zu Hause zu sein. Um dieses Gefühl wiederherzustellen, erzählten Menschen Geschichten, in welchen die heftigen Gewitter erklärt wurden. So begannen sie, ihren Erfahrungen einen Sinn abzugewinnen und vermieden das Gefühl, in einer unverständlichen, fremden, willkürlichen Welt zu leben.
Laut Kołakowski folgt Technik der ersten dieser beiden Strategien: Durch Technik geht der Mensch praktisch mit seiner Welt um und schafft es, sie teilweise unter Kontrolle zu bekommen. Es geht also darum, die Welt um sich herum beherrschbarer zu machen und ihr weniger ausgeliefert zu sein. Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Aber kann dieser Ansatz auch zu weit getrieben werden? Und wie verändert es unser Lebensgefühl, wenn immer mehr Bereiche von einer solchen Logik der Beherrschung durchzogen werden?
Im Automatenzeitalter ist die Herrschaft des Menschen über seine Welt perfekt geworden. Dank Technik ist hier wirklich alles unter Kontrolle. Nur an einer einzigen Stelle des Romans flackert plötzlich der Anflug einer Sinnkrise auf: »Es ist eine langweilige Welt, Lu. Alles ist automatisch geworden und geht seinen gleichmäßig geregelten Gang«, meint Mi nachdenklich. »Kein Krieg, keine Revolution, keine Eifersuchts- und Liebestragödien, keine Hungersnot unterbricht das ewige Einerlei. Kein Justizmord, über den man sich entrüsten, keine Heldentat, die man bewundern könnte, weil jede Gelegenheit dazu fehlt. Ich glaube, auch wir Menschen von heute sind Automaten geworden.«
Dieser letzte Satz ist spannend und nimmt eine einflussreiche Analyse vorweg, die in dieser Klarheit erst Jahre später in der Philosophie formuliert wurde. Grundgedanke dieser Analyse ist: Wenn wir die Welt technisch betrachten, drohen auch wir selbst technischer zu werden. Der technische Blick sieht die Welt als ein systemisches Ding an, das uns zur Verfügung steht und an unsere Bedürfnisse angepasst werden kann. Wenn dieser Blick dominant wird, kann es passieren, dass wir uns selbst den Dingen annähern. Denn unser Lebensgefühl wird wesentlich dadurch geprägt, wie wir mit unserer Welt in Beziehung treten.
Technik als Weltbeziehung
Technik ist genau eine solche Art und Weise, mit der Welt in Beziehung zu treten – und das verändert nicht nur unsere Außenwelt, sondern auch uns selbst. Dieser Zusammenhang wird insbesondere in der phänomenologischen Philosophie beleuchtet.[18] Ihr Grundgedanke ist erstmal simpel, bei näherer Betrachtung aber folgenreich: Technik vermittelt zwischen Mensch und Welt – und steht insofern zwischen diesen beiden Elementen. Eine Brille zum Beispiel steht zwischen meinem Auge und der Außenwelt. Auch eine Axt wirkt als Mittel zwischen mir und dem Holz. Ein Fahrrad ist zwischen mir und der Straße, und ein Dach befindet sich zwischen mir und dem Regen. In all diesen Fällen lässt sich die Beziehung durch eine kurze Formel beschreiben:
Ich–Technik–Welt
Spannend ist nun die Frage, wie Technik unsere Weltbeziehungen verändert. Offenbar ist die Beziehung Ich–Axt–Holz eine andere als Ich–Kettensäge–Holz. Die unterschiedliche Technologie verändert meine Beziehung zum Holz, wie ich es wahrnehme und empfinde, was es mir bedeutet und wie ich mich selbst im Umgang damit erlebe. Durch die Kettensäge erscheint es mir zum Beispiel viel weicher. Und weil ich einen Baum auf diese Weise leichter fällen kann, steigt möglicherweise auch meine Selbstwirksamkeitserfahrung und es sinkt meine Demut gegenüber dem Wald.
Ich–Technik–Welt, diese drei Elemente beeinflussen sich also gegenseitig. Dieses Verhältnis geht so tief, dass in der Phänomenologie davon gesprochen wird, dass sich Ich, Technik und Welt gegenseitig hervorbringen. Vielleicht klingt das in Bezug auf die Kettensäge etwas übertrieben, aber schauen wir uns ein weiteres Beispiel an, das tiefer in den Alltag hineinreicht: Seit ich acht Jahre alt bin, beginnt jeder meiner Tage mit dem gleichen Griff zur Seite – zu meiner Brille. Innerhalb eines Augenblicks verschiebt sich mein gesamtes Sichtfeld. Wo eben noch verschwommene Farbkleckse waren, werden plötzlich Gegenstände sichtbar. Nach dem Frühstück wechsle ich dann zu Kontaktlinsen und meine Welt stellt sich endgültig scharf. Alles ganz normal, keine große Sache.
Aber eigentlich ist es eine gewaltige Sache. Dieses kleine Gestell und diese zwei Gläser ändern alles: meine Art, mich körperlich durch den Raum zu bewegen und die Welt um mich herum zu begreifen. Meine Art, andere Menschen anzuschauen, auf sie zuzugehen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Insofern auch die Art, wie andere Personen mich wiederum wahrnehmen, wie sie auf mich reagieren und welches Gefühl sie mir vermitteln. Meine ganze Welt, mein ganzes Lebensgefühl, mein ganzes Ich und meine Identität wären anders, wenn ich meinen minus sechs Dioptrien hilflos ausgeliefert wäre.
Ich–Brille–Welt, ein einziges Zwischenglied verändert meine gesamte Weltbeziehung. Jeder einzelne Tag vom Aufstehen bis zum Schlafengehen verläuft komplett anders. Insofern sind Brillen und Kontaktlinsen Technologien von schier unfassbarer Reichweite. Trotzdem denken wir selten darüber nach und finden diese Möglichkeit meist selbstverständlich. Darin eben besteht die Kraft besonders umwälzender Technologien: Sie verändern unser Leben derart grundsätzlich, dass wir sie kaum noch wahrnehmen.
So ergeht es uns mit einer ganzen Reihe konkreter Technologien – und so ergeht es uns mit der Technisierung unseres Lebens insgesamt. Unser Alltag ist zutiefst durchzogen von Werkzeugen, angefangen von Messern und Gabeln über Spülmaschinen, Schlüssel, Stifte, Computer, Fahrräder, Heizungen, Herdplatten bis hin zu Uhren, Kalendern, Schuhen, Kaffeemaschinen oder Telefonen. Gerade weil die Relation Ich–Technik–Welt so verbreitet ist, prägt sie unser Lebensgefühl auf eine Weise, die uns selten bewusst wird. Was macht Technik mit uns?
Wenn unser Blick und Zugriff auf die Welt insgesamt technischer wird, dann werden wir stärker zu einem Homo Faber: Wir analysieren und versuchen, pragmatisch und effizient zu sein; Verliebtheit ist für uns ein Hormontaumel, Luft ist eine Mischung aus Gasen, Körper sind Systeme – genauso wie Wälder. Es werden Flüsse begradigt und Autos gebaut, Inseln und Strände mit Preisschildern versehen, Skihallen in die Wüste gebaut, Tiere in Fabriken geschlachtet, Kalkulationen erstellt und Berichte geschrieben. Die ganze Welt wird als ein mechanisches System gesehen, das man nutzen und verbessern kann.
Wenn es aber das Ziel ist, das eigene Leben beherrschbar zu machen, bleibt weniger Raum, um sich innerlich berühren zu lassen. Stattdessen beginnt man selbst zu funktionieren und bewegt sich wie eine geölte Maschine durch den Tag, plant und optimiert. »Wie geht’s?« – »Gut, und selbst?« In solchen Momenten ähneln wir Sprachrobotern, die Antworten erfolgen geradezu vorprogrammiert.
Auch wenn nur wenige Personen komplett von dieser Perspektive durchdrungen sind, ist sie zumindest doch verbreitet. Denn der technische Zugriff auf die Welt ist ein zentrales Merkmal unserer industrialisierten Gesellschaften – und das macht uns selbst technischer.
Technik als innere Einstellung
Ein technisches Zeitalter ist also nicht bloß durch den äußerlich sichtbaren Umstand gekennzeichnet, dass Menschen viele technologische Gegenstände benutzen. Vielmehr prägt Technik auch die Weise, durch das Leben zu gehen und soziale Beziehungen zu gestalten. In der phänomenologischen Philosophie wurde das besonders herausgearbeitet. Hier wurde immer wieder die grundsätzliche Frage gestellt: Was ist Technik?
Technik ist nicht nur etwas, das ich sehen kann. Technik ist eine innere Einstellung, eine Grundhaltung gegenüber der eigenen Welt, die darauf abzielt, Dinge unter Kontrolle zu bringen, sie sich anzueignen und nach den eigenen Vorstellungen zu formen. Technik ist eine Grundstruktur unserer Gesellschaften.
Diese Struktur hat große Parallelen zu dem, was der Philosoph und Psychoanalytiker Erich Fromm als »das Haben« bezeichnet hat.[19] Er geht davon aus, dass wir grundsätzlich auf zwei Arten durchs Leben gehen können: Aus der Haltung des Habens heraus versuchen wir, die Welt an unsere eigenen Bedürfnisse anzupassen, sehen sie als unsere Ressource, als ein Ding, das uns zur Verfügung steht und das wir gewissermaßen besitzen können. Aus der Haltung des Seins hingegen öffnen wir uns der Welt, lassen uns berühren und auf sie ein. Wenn man zum Beispiel einen Text in der Haltung des Habens liest, geht es darum, sich Informationen anzueignen und diese anschließend zu besitzen. Liest man denselben Text in der Haltung des Seins, lässt man die Gedanken tiefer auf sich wirken, man wird automatisch langsamer lesen und geht als veränderter Mensch aus diesem Prozess.
Dieser Unterschied wird häufig auch sprachlich deutlich: Bist du ein kommunikativer Mensch oder hast du gute Kommunikationsfähigkeiten? Bist du lustig oder hast du Humor? In der Haltung des Habens wird die eigene Persönlichkeit zum »Asset«, zum Marktkapital. Sinn aber erfahren wir, wenn wir in der Haltung des Seins mit anderen in Beziehung treten und uns auf die Welt einlassen.
Und so ist dies die vielleicht größte Gefahr einer Technisierung: die Gefahr eines inneren Sinnverlusts.
Diese Gefahr besteht nicht direkt, sondern indirekt. Wir stürzen nicht in eine Sinnkrise, nur weil wir eine elektrische Zahnbürste benutzen. Der Zusammenhang ist subtiler: Wenn Technik unsere Lebensbereiche immer tiefer durchdringt, dann kann unsere eigene Perspektive technischer werden und eine Haltung des Habens gefördert werden, die zwar pragmatisch und effizient ist, aber weniger feinfühlig gegenüber den Mitmenschen und dem Zauber in dieser Welt.
Die Folge ist dann eine innere Entfremdung gegenüber der Welt, das Gespür für die eigene Eingebundenheit bekommt Risse. In gewisser Hinsicht liegt das in der Natur der Sache, denn das Verhältnis Ich–Technik–Welt ist ein distanziertes Verhältnis. Da steht etwas zwischen mir und der Welt. Da habe ich keinen direkten Kontakt, spüre nicht unmittelbar. Eine Gabel distanziert mich von dem Essen, ich taste es nicht. Ein Schuh distanziert mich von dem Boden, er fühlt sich immer gleich an. Ein Bildschirm distanziert mich von meinem Gegenüber: Anstatt direkt in sein Gesicht zu schauen, blicke ich auf Pixel, blicke auf ein Bild.