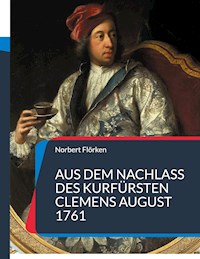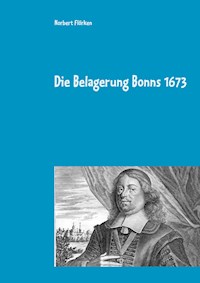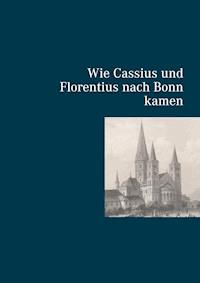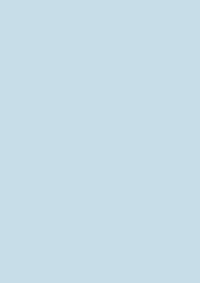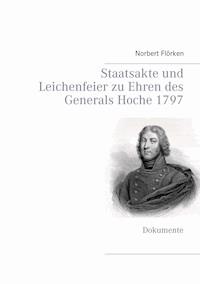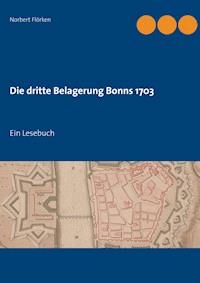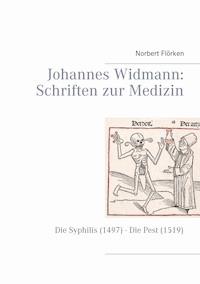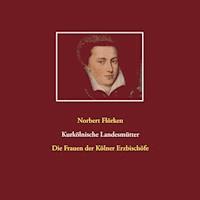
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch handelt von Personen, die es eigentlich gar nicht geben durfte: Kurköln war bis 1794 ein geistliches Territorium mit einem Erzbischof an der Spitze, und der durfte nach Kirchenrecht nicht heiraten - also gab es auch keine >First Lady<. Sollte man meinen. Aber die Wirklichkeit und das Bedürfnis nach Zweisamkeit waren mächtiger als der >Codex Iuris Canonici< , und so kommt Kurköln - wenn auch nicht auf dem Papier, so doch in der Realität - zu mehreren Landesmüttern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 60
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titelbild: Agnes Truchsessin, geb. von Mansfeld-Eisleben (Wikipedia)
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Kurkölnische „First Ladies“
NN um 1490
Antonia Wilhelmina von Arenberg (1557 - 1626)
Agnes von Mansfeld-Eisleben (1551 - 1637)
Gertrud von Plettenberg (? – 1608)
Maria Katharina Charlotte von der Marck (1648 - 1721)
Constance Desgroseilliers (ca. 1680 – ca. 1723)
Mechthild Brion (ca. 1710 - ca. 1776)
Maria Eva Sophia von Starhemberg (1722 - 1773)
Maria Caterina Isabella Barbieri (? -1817)
Antoinette de Heathcote
Anhang
Abbildungen
Bildnachweis
Digitalisate
Literaturverzeichnis
Index
Anmerkungen
Vorwort
Dieses Buch handelt von Personen, die es eigentlich gar nicht geben durfte: Kurköln war bis 1794 ein geistliches Territorium mit einem Erzbischof an der Spitze, und der durfte nach Kirchenrecht nicht heiraten – also gab es auch keine ›First Lady‹. Sollte man meinen.
Aber die Wirklichkeit und das Bedürfnis nach Zweisamkeit waren mächtiger als der ›Codex Iuris Canonici‹1, und so kommt Kurköln – wenn auch nicht auf dem Papier, so doch in der Realität – zu mehreren Landesmüttern.
Sie sollen hier vorgestellt werden mit dem wenigen, was an Informationen heute noch zu greifen ist – auch ein Beitrag zur Frauengeschichte in der frühen Neuzeit.
Abbildung 1: Louis XIV, Roi de France
Abbildung 2: Madame de Montespan
Mätressen – hier Madame de Montespan, eine Mätresse Ludwigs XIV. – waren im Zeitalter des Absolutismus durchaus erlaubte weibliche Günstlinge des Königs: seine Geliebte, seine Ratgeberin, seine Privatsekretärin, Mutter seiner natürlichen Kinder. Ihr Einfluss auf den Monarchen konnte gross sein - wie z.B. bei der Madame Pompadour – oder gering. Wie es Kindern und ihren Müttern aus dem einfachen Volke erging, die unehelich oder vorehelich geboren wurden, beschreibt Müller-Hengstenberg in seinem Aufsatz.
Einleitung
Seit nahezu 1000 Jahren sind die Priester der römisch-katholischen Kirche zu Ehelosigkeit und Enthaltsamkeit verpflichtet – und genauso lange wird dieses Gebot des Zölibats missachtet, von den einfachen Priestern bis zu den Päpsten. Dass Päpste, Bischöfe und Priester Kinder zeugten, war kein Skandal2, sondern jahrhundertelang Alltag.
Unmöglich war allerdings ein regelrechtes Eheverlöbnis, und Erzbischof Gebhard von Truchsess und seine Ehefrau Agnes haben dies am Ende des 16. Jahrhunderts schmerzlich erfahren müssen. Agnes war – im eigentlichen Sinne – die einzige ›Landesmutter‹ von Kurköln, und Antonia Wilhelmina war die Ehefrau des resignierten Kurfürsten Salentin von Isenburg; ob alle anderen hier vorgestellten Frauen in jedem Falle als ›Mätressen‹ - auch als ›Konkubinen‹ beschimpft – einzuordnen sind, kann mit letzter Sicherheit nicht bewiesen werden – zu oft wurde ein Verhältnis mit dem jeweiligen Kurfürsten auch angedichtet3. Eindeutig ist die Situation, wenn der Kurfürst Vater wurde: Ernst und Gertrud, Joseph Clemens und Constance und Clemens August und Mechthild.
Im folgenden ist normalerweise die Rede von den Kölner Kurfürsten und weniger von den Erzbischöfen, weil der Einfluss der Frauen auf die kirchlichen Aufgaben ihres ›Mannes‹ sehr gering war, auf die politischen aber manchmal umso grösser. Bild- und Textmaterial zu dem Personenkreis sind spärlich, entsprechen aber dem allgemeinen Bild der Zeit.
Bonn, den 20.09.2017
Kurkölnische „First Ladies“
NN um 1490
Über die erste „Landesmutter“ ist nichts bekannt: kein Name, kein Stand, kein Datum – nur dass sie dem Erzbischof Hermann von Hessen4 um 1490 einen Sohn geboren hat. Hermann, genannt „der Friedsame“ („pacificus“, * um 1450 † 19. Oktober1508 in Poppelsdorf) war von 1480 bis 1508 als Hermann IV. Erzbischof von Köln. Vorher war er Dechant von St. Gereon und Domherr; er wird als frommer und ernsthafter Seelsorger bezeichnet und hielt sich gerne im (Vorgänger-) Schloss Poppelsdorf auf, dort starb er auch. Sein Sohn Hermann wurde später Stiftsherr von St. Maria ad Gradus und 1503 Probt von St. Aposteln.
Abbildung 3: Hermann von Hessen, ca. 1500
siehe
1499 Koelhoff’sche Chronik
, Seite
→
.
Antonia Wilhelmina von Arenberg (1557 - 1626)
Antonia Wilhelmina von Arenberg war die Ehefrau von Salentin von Isenburg-Grenzau (1532-1610); sie wäre die erste bekannte Landesmutter von Kurköln, wenn Salentin nicht drei Monate vor der Hochzeit auf das Amt des Erzbischofs und Kurfürsten verzichtet hätte, um die 20jährige Antonia Wilhelmina zu heiraten.
Sie wurde am 1. März 1557 in Vollenhove (Overijssel, NL) geboren als Tochter von Jean de Ligne, Graf von Arenberg5, und seiner Ehefrau Margaretha von der Marck, Fürstin von Arenberg. Am 10. Dezember 1577 fand die Heirat mit Salentin in Bonn statt. Der Ehe entstammten zwei Söhne: Salentin (? – 1619) und Ernst (1584-1664).
Antonia Wilhelmina starb am 26. Februar 1626.
Abbildung 4: Salentin von Isenburg 1570
Antonia Wilhelmina
Salentin war zwar schon Erzbischof, aber noch nicht zum Priester geweiht, deswegen erreichte er problemlos die päpstliche Dispens zur Resignation und Heirat. Am 13. September 1577 eröffente Salentin den verblüfften Landständen in Brühl6, dass er das Amt des Erzbischofs niederlege, zugunsten der Familie Isenburg, die durch den Tod seines einzigen Bruders auszusterben drohte. Die Heirat fand dann drei Monate später statt.
Kalte Weltleute schüttelten den Kopf, und selbst der philosophisch-strenge August DE THOU wusste nichts zu antworten, als ihm in Baden[-Baden] sein literarischer Freund LANGUET eine schöne Dame, die ihrem Gasthofe gegenüber am Fenster stand, mit der Frage zeigte: ob er wol einer solchen Schönheit das Erzbisthum Köln vorziehe?7
siehe
1568 Die Schlacht von Heiligerlee
, Seite
→
.
Agnes von Mansfeld-Eisleben (1551 - 1637)
Agnes ist die erste und einzige kurkölnische Landesmutter im strengen Sinne, denn sie war verheiratet mit dem Kurfürsten Gebhard Truchsess-Waldburg (1547-1601)8. Für die Tochter des Grafen Johann Georg I. von Mansfeld-Eisleben war der Lebensweg als Kanonissin im protestantischen Stift Gerresheim bei Düsseldorf vorgesehen.
Abbildung 5: Gebhard von Truchsess 1582
Abbildung 6: »vermeinte Churfürstin von Cölln Agnes Mansfeld Truches«, nach 1583
»Ego Dei gratia Colonie episcopa«9
1578 besucht Agnes in Köln ihre Schwester Maria, die mit Graf Peter Ernst von Kriechingen verheiratet ist. Bei diesem Aufenthalt wird Gebhard10 auf sie aufmerksam. Die beiden Verliebten verbringen daraufhin einige Zeit miteinander. Allmählich verbreiten sich die Informationen über diese Liaison, auch weil die Kammerzofe und der Kammerdiener beim morgendlichen Dienstbeginn im Schloss Brühl ihre Herrschaften nicht in den gewohnten Betten antreffen.
Nun treten Agnes' Brüder auf den Plan: angeblich drohen im April 1582 Graf Hoyer Christoph (1554-1587) und Graf Ernst (1554-1609) gegenüber Gebhard in Köln damit, ihre Schwester zu erdolchen, um ihre Ehre zu retten. Es wäre allerdings sehr verwunderlich, wenn einer der mächtigsten Männer des Heiligen Römischen Reiches - der Erzkanzler Italiens und einer der sieben Kurfürsten - sich von zwei Rabauken aus der Provinz beeindrucken liesse.
Abbildung 7: Schloss Mansfeld, by Francke 1723 So sahe Manßfeld sonst mit Wall und Mauren aus, Der tapfern Grafen Sitz, das hochberühmte Haus, von dessen Stamm wir dieses können lesen, Daß Kayser, Könige mit ihm verwandt gewesen.
Aber Gebhard gelobt tatsächlich, seine Agnes zu ehelichen, was dann am 2. Februar 1583 in Bonn, im Haus seines Schwagers Kriechingen in der Acherstrasse, geschieht. Gefeiert wird anschliessend in der Gasthaus ›Zur Bloemen‹ am Markt.
Nach geltendem kirchlichen Recht war die Heirat ungesetzlich, als Ausweg erschien der Konfessionswechsel Gebhards zu den Protestanten. Damit verlor er aber automatisch die Würde des Erzbischofs und das Territorium Kurköln, denn nach dem ›