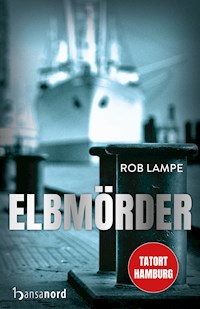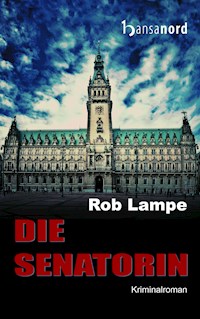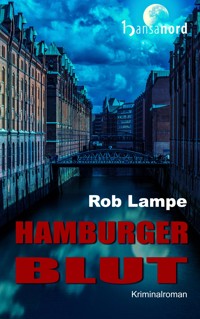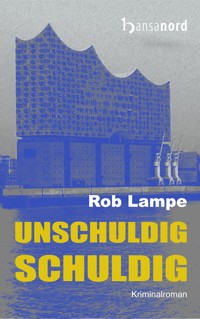14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hansanord Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Peter Döbler wuchs mit der Idee des Sozialismus und Kommunismus auf, fest eingebunden in das gesellschaftliche Gebilde der DDR, bis er erkennen musste, dass dort kein Platz für seine Vorstellung von Freiheit vorgesehen war. Er musste sich entscheiden und tat etwas, was noch niemand vor ihm gemacht hatte.
Ohne einen einzigen Schluck Trinkwasser bei sich zu haben, begab er sich im Sommer 1971 an den Kühlungsborner Strand und schwamm 45 km nach Fehmarn, vorbei an Grenzposten, Patrouillenbooten und Schießbefehl.
Es ist die längste Strecke, die jemals ein Mensch, allein und ohne Hilfsmittel, über die Ostsee geschwommen ist und gehört zu den spektakulärsten DDR-Fluchten überhaupt.
Doch was waren die Hintergründe?
Wie verliefen seine Vorbereitungen?
Welche Reaktionen der Partei gab es nach seiner Flucht?
Dieser Roman erzählt die Geschichte eines mutigen jungen Arztes, der Unvorstellbares geleistet hat, um endlich in der Freiheit seine Träume leben zu können.
Ein eindrucksvolles Stück deutsch-deutscher Zeitgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Rob Lampe
Kurs NordWest
über den Autor
Impressum
Inhalt
Vorwort
Prolog
SAL, KAPVERDISCHE INSELN – OKTOBER 1994
Acht Stunden blieben ihm noch. Dann würde sein Flieger Richtung Hamburg abheben. Acht Stunden, in denen er überlegen konnte, ob er erneut einen Neuanfang starten wollte. Der Zeitpunkt schien ideal und lange herbeigesehnt. »Mit spätestens fünfundfünfzig machst du nur noch das, was dir Spaß macht«, hatte er immer gesagt. Und nächstes Jahr, im Sommer, würde er fünfundfünfzig. Im fernen Hamburg müsste er nur noch seine Sachen zusammenpacken, sich verabschieden. Von seinen Bekannten, seinen Freunden, seiner Freundin. Sie wäre für dieses Abenteuer nicht zu begeistern gewesen, das wusste er. Das hatte er schon immer gewusst. Die Sonne brannte erbarmungslos auf den feinkörnigen hellen Sandstrand, als Peter das Inseltaxi verließ und gedankenversunken die nächste Strandbar ansteuerte. Dass er dabei rhythmisch zur Musik der Einheimischen tänzelte, bemerkte er schon gar nicht mehr. So hatte er sich an seine neue Heimat gewöhnt. Hier auf Sal tanzte jeder. Seine 262 Escudos Wechselgeld fest in der Hand, dachte er: Das genügt für acht Stunden, und freute sich auf entspannte Bierchen mit gebratenem Fisch. Die Strandbar war noch leer. Alle Tische waren frei, sodass er sich einen in der hinteren Ecke suchte. Es war der einzige, der noch im Schatten stand. Zufrieden gab Peter bei einer Inselschönheit seine Bestellung auf und genoss die Aussicht. Dann füllten sich von einer Sekunde zur anderen die Tische. Entweder musste ein Reisebus Bleichgesichter angekommen sein oder in einer benachbarten Hotelanlage war ein Sportkurs zu Ende gegangen. Er schaute sich um und aß die letzten Stücke seines Thunfischsteaks, als er am Nachbartisch deutsche Gesprächsfetzen vernahm. Den Dialekt erkannte er sofort. Zur Begrüßung erhob er sein Bierglas. Es war bereits sein zweites Glas. Die drei Urlauber, die offenbar gerade erst angereist waren, hatten den Sportkurs noch vor sich. Sie hoben ebenfalls ihre Biergläser und signalisierten mit einer Handbewegung, er möge ihnen doch Gesellschaft leisten. Er nahm sein Bier und gesellte sich zu den Deutschen. »Ich bin Peter und nein, ich mache keinen Urlaub hier«, klärte er die drei auf, die sich als Andreas, Wolfgang und Hans vorstellten. »Im Gegenteil. Ich werde in wenigen Wochen hierher auswandern. Muss nur noch zuhause alles abschließen.« Ungläubiges Schweigen auf der anderen Seite des Tisches. »Gestern Abend erst«, fuhr Peter fort, »habe ich das Angebot erhalten, auf einer Nachbarinsel eine Lodge zu übernehmen und Angeltouren für Touristen zu organisieren.« Er strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Angeln Sie?« Die drei verneinten. »Da entgeht Ihnen aber was. Ich liebe das Hochseefischen, vor allem die Marline. Die sind seit jeher meine Leidenschaft. Meine Arztpraxis in Hamburg ist bereits verkauft.« Die Touristen, die tatsächlich gerade für zwei Wochen Pauschalurlaub auf der Insel angekommen waren, hörten Peter fasziniert zu, beeindruckt vor so viel Energie und Mut. Vom Arzt zum Angler. Chapeau! Das würde ihm keiner so schnell nachmachen. »Mein Vater hat immer gesagt«, schmückte Peter weiter aus, »es komme im Leben auf drei Dinge an: Freude an der Arbeit, Kompromissbereitschaft und ausreichend Freizeit.« Die drei Urlauber stimmten ihm zu. »Ich sehne mich immer noch nach grenzenloser Freiheit. Ich kann gar nicht genug davon bekommen.« »Das kennen wir gut«, bestätigte das graumelierte Bleichgesicht, das sich als Andreas vorgestellt hatte. »Sie kommen auch aus Norddeutschland?«, fragte Peter in die Runde und trank von seinem Bier. »Ja, aus Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb können wir Ihren Wunsch nach Freiheit mehr als nachvollziehen«, warf Wolfgang, das leicht untersetzte Bleichgesicht zur Linken, dessen Mundwinkel beim Zuhören die ganze Zeit rege auf und ab zuckten, ein. »Noch vor fünf Jahren hing der Eiserne Vorhang zwischen uns und unseren Träumen. Und genau diese versuchen wir jetzt nachzuholen. Deswegen sind wir hier.« Wolfgang hob sein Bierglas. »Hätte uns jemand im Sommer neunundachtzig gesagt, dass wir fünf Jahre später auf den Kapverdischen Inseln zusammen mit einem Auswanderer ein wässriges Bier trinken würden, wir hätten ihn für verrückt erklärt. Am Balaton – klar. Aber hier?« Peter verschluckte sich und grätschte dazwischen. »Aus Rostock? Das ist verrückt! Ich komme auch daher. Bin in Rostock geboren und habe lange dort gelebt«, sagte er und wischte sich mit der Serviette den Mund ab. »Bis ich schließlich einundsiebzig die DDR verlassen habe.« »Verlassen habe?«, fragte Andreas leise, während er sich nervös rechts und links umschaute. Auch nach fünf Jahren Mauerfall sank er bei gewissen Themen abrupt seine Lautstärke und hielt nach Stasi-Spitzeln Ausschau. »Ja«, antworte Peter ebenso leise. »Wie denn?« »Geschwommen. Bin geschwommen. Von Kühlungsborn nach Fehmarn.« Nun wurde der Graumelierte ernst und nachdenklich. Mit seiner rechten Hand fasste er sich über seine runzelnde Stirn. »Einundsiebzig, sagten Sie?« »Ja, richtig. Im Juli.« »Ich glaub’s nicht«, flüsterte Andreas und schlug Wolfgang und Hans auf die Schultern. »Das ist er! Das ist der Kerl!« Wolfgang und Hans schauten einander ratlos an, als Andreas um den Tisch zu Peter ging und triumphierend sagte: »Dann müssen Sie der Arzt Peter Döbler sein!« Peter verschluckte sich erneut an seinem Bier. Nun half auch keine Serviette mehr – sein Hemd war hin. Wie ferngesteuert stand er auf und ließ sich von Andreas drücken, einmal, zweimal, während die anderen allmählich verstanden, was ihr Freund Andreas gerade angedeutet hatte. »Ja, ich bin Peter Döbler. Aber woher kennen Sie meinen Namen? Haben Sie über mich in den Zeitungen gelesen? Dachte nicht, dass die DDR das damals an die große Glocke gehängt hätte.« Andreas löste die Umarmung, ging einen Schritt zurück und musterte Peter von oben bis unten, als wolle er sich vergewissern, dass er wahrhaftig vor ihm stehe. Er schüttelte ungläubig den Kopf. »Ich bin der Mann, der an diesem Abend einundsiebzig den Befehl erhielt, Sie zu suchen«, sagte er. »Sie waren republikflüchtig. Wir suchten Sie mit einem Großaufgebot an Kampfschwimmern und Grenzbooten. Ich war der Einsatzleiter. Hätten wir Sie gefunden, wären Sie drei oder vier Jahre in den Bau gegangen.« Stille. Peter lief ein kalter Schauer über den Rücken. 6.000 Kilometer von der Heimat entfernt auf einer kleinen Insel in einer noch kleineren Strandbar im Atlantischen Ozean. Ausgerechnet hier traf er auf den Mann, den er in dieser Nacht 25 Stunden lang im Nacken gespürt, dessen Schatten ihn in Angst versetzt und selbst Jahre später noch in seinen Alpträumen verfolgt hatte. Er musste sich setzen, nachdenken und versuchen, das Gehörte zu verarbeiten, während seine Finger nervös mit der Tischkante herumspielten. Er fühlte sich in ein Vakuum hineingezogen. Alles verstummte. Doch dieser Zustand währte nicht lange, denn plötzlich suchte ihn die bohrende Frage heim, die ihn immer und immer wieder gequält hatte. In Sekundenschnelle lief die Flucht vor seinem geistigen Auge ab. Suchscheinwerfer zu Land, Suchscheinwerfer zu Wasser, Schnellboote, Schießbefehl. Peters Mund wurde trocken, kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn, sein Gesicht verhärtete sich. Er trank einen Schluck von seinem Bier. Dann beugte er sich zu Andreas über den Tisch, der sich ebenfalls wieder hingesetzt hatte, und fragte mit zittriger Stimme: »Hätten Sie auf mich geschossen?«
ERSTER TEIL
Es gibt Momente, in denen der Tod verführerischer erscheint als das Leben.
1
Noch wusste der 19-jährige Peter nicht, dass er nur zwölf Jahre später in einer der spektakulärsten DDR-Fluchten seine Heimat, sein geliebtes Rostock, würde verlassen müssen. Noch wohnte er mit seinem Bruder, seiner Mutter und Großmutter zusammen, hatte vor wenigen Wochen sein Abitur gemacht und wartete auf die Zusage fürs Studium. Doch der Reihe nach …
ROSTOCK, DDR – AUGUST 1959
Es waren bewegte Zeiten in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, die dank der geografischen Lage seit der DDR-Gründung durch die Pläne der SED eine systematische Aufwertung erfahren hatte. Die Stadt an der Unterwarnow war 1952 Bezirksstadt geworden und seitdem Straße um Straße, Block um Block gewachsen. 1960 würde der neue Überseehafen in Warnemünde seinen Betrieb aufnehmen, dann würde Rostock als Tor zur Welt gelten. Zumindest für den Außenhandel der DDR. Seeleute und Transitreisende würden zum Stadtbild gehören. Peters Familie wohnte in einer schönen Drei-Zimmer-Altbauwohnung in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Also von innen schön. Von außen war dieses Mehrfamilienhaus in der Fritz-Reuter-Straße immer noch deutlich vom Zweiten Weltkrieg gezeichnet: baufällige Balkone und Einschlaglöcher verirrter Kugeln und Granatsplitter der Alliierten. »Der Brief ist da. Lag heute im Briefkasten«, begrüßte Laura ihren Enkel Peter, als er abends nach Hause kam. »Und sag’ Christian Bescheid, dass das Abendbrot fertig ist.« Ganze zwei Monate hatte er auf die Zusage der Uni warten müssen. Eigentlich ein Selbstläufer, bei einem Abi-Schnitt von 1,6. Doch er hatte sich in den vergangenen Tagen immer wieder dabei ertappt, dass er ins Grübeln geriet. Nun hatten diese trüben Gedanken ein Ende und er war seinem Wunsch, Arzt zu werden, einen Schritt näher. »Christian«, rief Peter in Richtung seines Bruders, als er sich im Bad Hände und Gesicht wusch. Das Fußballspiel mit Gerd auf dem nahegelegenen Ackerplatz hatte seine Spuren hinterlassen - und großen Hunger. »Abendbrot ist fertig.« Etwas später kam auch er in die Küche und erblickte auf dem Küchentisch eine offene Flasche Sekt und vier Gläser. Davor der ersehnte Brief mit dem Stempel der Universität Rostock. »Na mach schon auf, Peter«, forderte seine Mutti ihren Ältesten auf. Maria, im ostpreußischen Kolberg geboren, war eine typische DDR-Frau und Mutter. Linientreu und genügsam. Sie arbeitete in einem kleinen Geschäft der staatlichen Handelsorganisation HO, das alle, naja fast alle Artikel des täglichen Bedarfs führte. Der Verdienst war spärlich, aber er reichte für die täglichen Mahlzeiten. Die Familie würde sich auch in Zukunft über Wasser halten können. Und dass sie sich gestern noch von Sabine, einer früheren Schulfreundin, eine neue Dauerwelle hatte machen lassen, war Schicksal, aber dem heutigen Anlass angemessen. Mütter spüren so was eben!, dachte sie und hoffte, dass der Sekt noch gut sei, während sie aufgeregt an ihrem Haar herumspielte. »Mach' schon auf, Peter«, wiederholte sie. Peter genoss den langersehnten Moment, setzte sich an den Küchentisch und öffnete mit seinem Buttermesser fein säuberlich den Brief. Er las. Leise. Erblasste. Legte ihn beiseite und schenkte sich etwas Sekt ein. Trank einen Schluck und nahm den Brief erneut zur Hand. Las noch einmal. Seine Miene blieb eingefroren. Die Familie wartete auf das erlösende »Jaaaa!« – doch es erklang nicht. Peter faltete das Schreiben wieder zusammen und schob es in den Umschlag zurück. »Sie haben mich abgelehnt«, fasste er ruhig zusammen, stand auf und ging ins Kinderzimmer. Dort verlor er seine Contenance. »Die Schweine haben mich abgelehnt!«, schrie er und warf die Tür ins Schloss. Maria bat Christian, ihr das Schreiben zu geben. Dann las auch sie. Leise. Erblasste ebenfalls. Doch ihr war der Appetit auf ein Glas Sekt vergangen. Sonst so um Haltung bemüht, rang sie jetzt sichtlich mit den Nerven. »Er soll sich erst mal ein Jahr in der Poliklinik bewähren und dann noch mal um einen Platz bewerben.« sprach sie leise. »Wofür denn bewähren?«, fragte Laura ratlos. »Anscheinend erfüllt er nicht alle sozialistischen Anforderungen an einen Studenten und muss sich deshalb in der täglichen Arbeit bewähren«, sagte Maria, den Tränen nahe. Dann machte der Brief die Runde. Erst Großmutter, später Christian. Doch der Inhalt blieb gleich. Maria reagierte als Erste und wollte zu Peter, ihn trösten, doch Laura hielt sie zurück. »Lass ihn. Gib ihm Zeit und Ruhe, alles zu verdauen. Das schafft Peter am besten allein.« Sie schenkte ihrer Tochter ein aufmunterndes Lächeln. »Mach uns lieber einen Tee.«
* * *
Es war noch völlig still in der Wohnung, als Peter am nächsten Morgen in die Küche schlich und zwei Scheiben Brot mit Käse herunterschlang. Er hatte nun genug Ruhe hinter und einen Plan vor sich gehabt. Peter wischte seinen Mund mit dem Handrücken sauber, griff sich die Absage, zog Schuhe und Jacke an und ging zur anderthalb Kilometer entfernten Betriebspoliklinik der Neptun-Werft. Er wollte dieses »Zwangsjahr« so schnell wie möglich beginnen – und beenden. An seinem Ziel, Medizin zu studieren, hatten die Zeilen der Uni und die schlaflose Nacht nichts geändert. Sein Weg führte ihn vorbei an der Bäckerei Droste, der Tischlerei Barkhaus, der Gaststätte »Zum Alten Krug«, dessen einarmiger Wirt Fiete als alter Nazi verschrien war, sowie an zahlreichen maroden Gebäuden und verwitterten Ruinen. Schließlich stand er vor der Neptun-Werft, einem riesigem Areal, das nicht nur die Fabrikgebäude, sondern auch soziale Einrichtungen wie ein Klubhaus mit Festsaal, eine Betriebskinderkrippe und auch die Poliklinik beherbergte. Hatte die Werft im Ersten Weltkrieg noch Schiffe für die stolze Kaiserliche Marine und im Zweiten für die Nazis gebaut, musste sie in den ersten Jahren nach dem verlorenen Krieg vor allem Reparationen wie Schiffsreparaturen und –neubauten für die Sowjets leisten. Peter griff in die Innentasche seiner Jacke und zog das Schreiben heraus. Er atmete tief durch, betrat die Poliklinik und ging auf eine junge Dame mit Mandelaugen und Hochsteckfrisur zu, die am Empfang saß. »Guten Morgen, mein Name ist Peter Döbler und ich muss mit Professor Mannstein sprechen.« »Guten Morgen, junger Mann«, antwortete die Dame. Sie schwenkte demonstrativ den Kopf zur großen Wanduhr. »Es ist gerade mal halb sechs. Die Sprechstunde unseres Direktors beginnt um acht. Sie können gerne warten. Zimmer 118.« Müde, aber zufrieden suchte Peter das Zimmer auf. Es bestand aus neun leeren Stühlen, einem Tisch mit drei ordentlich aufgereihten Exemplaren der Tageszeitung »Neues Deutschland«, Sprachrohr der SED, und stickiger Luft. Er drückte den Lichtschalter, doch nichts geschah. Er suchte nach einem zweiten. Vergebens. So setzte er sich unverrichteter Dinge auf den nächstbesten Stuhl und wartete. Wenn er gleich um acht drankäme, würde er es bis dreiviertel neun zum Zuckersäcke-Schleppen in die Marmeladenfabrik schaffen. Eigentlich hätte er um acht dort sein sollen. Aber die Poliklinik hatte heute Vorrang. Während er sich die Worte zurechtzulegen versuchte, mit denen er Professor Mannstein sein Vorhaben vortragen wollte, fielen ihm die Augen zu. Anfangs wehrte er sich dagegen, indem er laut vor sich hin sprach. »Solange ich spreche, kann ich nicht einschlafen.« Doch die Müdigkeit lastete immer gewaltiger auf ihm. Gut, fünf Minuten, dachte er und schloss die Augen. Die schlaflose Nacht forderte ihren Tribut. »Sie wollten mich sprechen?«, vernahm Peter und spürte ein kräftiges Ruckeln an seiner Schulter. »Wie spät ist es?«, krächzte er müde. »Kurz vor eins. Mir wurde gesagt, Sie wollen mich sprechen. Ich bin Professor Mannstein.« »Marmelade?!« »Nicht Marmelade. Mannstein!« »Entschuldigen Sie, Professor Mannstein.« Peter sprang auf, rieb sich die Augen und schaute auf die Armbanduhr des Direktors. Tatsächlich – es war kurz vor eins. Dann streckte er zur Begrüßung seine Hand aus. »Das weiß ich doch. Ich meinte, ich hätte schon längst in der Marmeladenfabrik sein müssen.« »Dann sollten Sie sich entscheiden, junger Mann«, sagte der Arzt und deutete mit einem Schritt zur Tür seine Ungeduld an. »Wenn Sie mitkommen wollen – ich hätte jetzt Zeit. Jetzt.« Nachdem sich Peter vorgestellt hatte, folgte er dem Direktor ins Besprechungszimmer und übergab ihm das Schreiben der Universität. »Ich möchte Medizin studieren, bin aber abgelehnt worden und soll mich nun ein Jahr in der Chirurgie bewähren. Deshalb bin ich hier.« Peter vergaß nicht, einen wichtigen Hinweis zu hinterlegen: »Und schöne Grüße von meiner Mutti, Maria Döbler, an ihre Frau. Die beiden sind ja seit Jahrzehnten eng befreundet.«
* * *
Etwa zur selben Zeit endete Marias Schicht. Und obwohl sie Fachverkäuferin für Porzellan gelernt und bis zum Krieg im Warenhaus Wertheim gearbeitet hatte, genoss sie ihre Tätigkeit als Milchverkäuferin. Denn auch hier hatte sie ständig mit Menschen zu tun. Das war ihr wichtig. Und der HO-Laden war nur 300 Meter von der Wohnung entfernt. Nicht wie früher, als sie fast 40 Minuten zum Kaufhaus benötigt hatte. Nun lief sie schnellen Schrittes von der Doberaner Straße zur Universitätsklinik im Hansaviertel. Dort lag ihr Mann Georg, Diagnose Speiseröhrenkrebs. Man konnte nicht behaupten, dass dieser Befund bei seinem jahrelangen Zigaretten- und Alkoholkonsum überraschend kam. Überraschend war nur der Zeitpunkt. Mit 51 Jahren. Seit gestern lag er in der Klinik, teilte sich mit einem Patienten namens Walther ein Zimmer und sollte morgen operiert werden. Dass Georg so zeitig einen Platz, noch dazu in einem geräumigen Zweibettzimmer, bekommen hatte, verdankte er dem operierende Arzt Dr. Biege. Beide hatten von 1943 bis 1945 Seite an Seite in Russland gekämpft und waren zusammen in Gefangenschaft geraten. Maria prüfte den Sitz ihrer Dauerwelle und öffnete die Tür zum sonnendurchfluteten Krankenzimmer. »Hallo Georg. Wie geht es dir heute?« Seitdem ihr Mann sie vor fünf Jahren wegen einer jüngeren Frau verlassen hatte, waren sie bei der Begrüßung wieder zum Vornamen übergegangen. Die jahrzehntelang gehegten und liebgewonnenen Kosenamen gab es nicht mehr. Genauso wenig wie ihre Zweisamkeit. Doch sie blieben verheiratet, was Maria hoffen ließ, dass Georg irgendwann zu ihr zurückkehren würde. Auch Georg sah einen Vorteil in dem unveränderten Status. Bedeutete er doch, dass er weniger Unterhalt für die Jungen zahlen musste. Trotz allem hatte Maria Tränen in den Augen, als sie ihren immer so starken Mann und Vater ihrer Kinder hilflos von Schläuchen und Kabeln umgeben im hellgrünen Krankenhaus-Fetzen in seinem Krankenbett liegen sah. Marias Tränen entgingen Georg nicht und er entschied sich, nichts von seiner Angst zu sagen – denn ja, er hatte Angst. Auch erzählte er ihr nichts von dem neuartigen Verfahren, das sein alter Kriegsgefährte bei ihm anwenden wollte. Er mochte gar nicht reden. So versuchte er ein schelmisches Lächeln, hoffte auf einen kurzen Besuch und antwortete: »Mir geht’s gut. Die Schwestern und Ärzte sind freundlich und versorgen mich gut. Wie geht es den Jungs?« Um Georg nicht zu beunruhigen, entschied sich Maria, Peters Uni-Absage mit keinem Wort zu erwähnen. Das konnte warten. Sie lächelte und setzte sich ans Fußende des Bettes. »Sie kommen zurecht. Es sind gute Jungs, die wir da haben, Georg.« Ihr Mann drehte den Kopf zum Fenster und schaute nachdenklich hinaus, bis sich Minuten später erneut die Zimmertür öffnete. Es war Peter. Es war nach dem Gespräch mit Mannstein nicht mehr zur Marmeladenfabrik gegangen. Stattdessen wollte er seinem Vater Glück für die Operation wünschen. Durch die gemeinsame Angelleidenschaft hatte er, im Gegensatz zu seinem jüngeren Bruder Christian, trotz Trennung immer noch ein sehr inniges Verhältnis zu ihm. »Hallo Vati.« Georg schaute Richtung Tür. »Peter! Wie war es in der Fabrik?« »Ich war nicht da, Vati. Ich habe … irgendwie … verschlafen«, antwortete Peter und hatte alle Mühe sein Lachen zu unterdrücken. Nun mischte sich seine Mutter besorgt ein. »Wieso verschlafen? Du warst doch schon um fünf aus dem Haus. Ich habe dich gehört.« »Ja, Mutti. Aber ich war nicht in der Marmeladenfabrik.« »Nicht?« »Nein, ich war bei der Neptun-Werft. Bei Professor Mannstein.« »In der Klinik?« »Ja.« Maria verstand sofort und hakte nach: »Und?« »Ich kann nächste Woche anfangen.« Fragend schaute Georg zu Maria. »Kannst du mich bitte aufklären? Ich dachte, Peter wollte Medizin studieren – und nicht gleich in der Klinik anfangen?« »Nun ja«, begann Maria und fühlte, wie eine gewisse Wärme in ihrem Gesicht aufzog. Sie ärgerte sich, dass sie das Schreiben nicht gleich erwähnt hatte. »Gestern hat Peter eine Absage der Universität bekommen und die Aufforderung, sich … sozusagen zur besseren Vorbereitung auf das Studium … nun ja … ein Jahr in der Poliklinik zu bewähren.« »Diese Schweine«, entfuhr es Georg. Nun errötete auch er und schaute reflexartig zu seinem Nachbarbett. Doch Walther hatte nichts mitbekommen und schnarchte unbekümmert weiter. »Für was solltest du dich denn bewähren müssen? Du warst immer gut in der Schule und bist für den Staat eingestellt. Warst bei den Pionieren und bei der FDJ«, flüsterte Georg und schaute Peter eindringlich an. »Ja, Vati.« Doch natürlich wusste Georg, dass er der Grund für die Absage an Peter war. Ein selbstständiger Steuerberater galt in der DDR vielen als der personifizierte Antichrist. Als Handlanger der Kapitalisten und Unrat in einer Person. Keine guten Voraussetzungen in einem Arbeiter- und Bauernstaat. Zum Studium wurden hauptsächlich Kinder von Arbeitern und Bauern oder Parteifunktionären zugelassen – Kinder von Unrat sollten diese Chance nicht bekommen. Georg schüttelte angewidert den Kopf. Jetzt sollte sich sein Sohn dem Regime gegenüber mit dem Bewährungsjahr beweisen. Beweisen, dass er neben dem Erwerb der Hochschulreife auch bereit war, eine aktive Rolle bei der Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft zu übernehmen? Georg richtete sich schwerfällig in seinem Bett auf, was in Anbetracht der ganzen Schläuche und Kabel gar nicht so einfach war und sah Peter fest in die Augen. »Ich bin sehr stolz auf dich, Peter. Stolz, dass du so schnell gehandelt und dich sofort um eine Anstellung bemüht hast«, sagte er. »Und glaub mir, diese zwölf Monate werden vorbeigehen. Die sitzt du auf einer Arschbacke ab und wirst eben ein Jahr später Arzt.« Dass ein von der Partei auferlegtes Bewährungsjahr für Kapitalistenkinder auch verlängert werden konnte, daran dachte in diesem Moment keiner im Krankenzimmer.
* * *
»Ich verstehe nicht ganz«, sagte Gerd und sein Gesichtsausruck verriet, dass er die Wahrheit sagte. »Dann hast du aber eine verdammt lange Leitung.« Gerd schaute sich die fünf gleichgroßen Gardinenringe noch einmal an, die Ingrid fein säuberlich in Sand gelegt hatte, drei als obere, zwei als untere Reihe. Ingrid musste lächeln. »Stell dir vor, die Ringe sind bunt.« »Bunt?« »Ja. Zum Beispiel blau.« »Blau?« »Oder … blau und schwarz und vielleicht noch etwas rot und gelb und grün«, versuchte sie zu helfen. Gerd und Ingrid, beide 19 Jahre alt, kannten einander seit ihrer Kindheit und hatten schon immer viel Zeit miteinander verbracht. Das änderte sich auch nicht, als sich ihre Eltern wegen unterschiedlicher politischer Auffassungen über Walter Ulbricht und Nikita Chruschtschow vor einem halben Jahr entzweiten. Für Gerds Eltern galt ein klares Weltbild. Die Sowjetunion war das Maß der Dinge und man glaubte an die Idee eines demokratischen Sozialismus. »Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen«, das Motto vertrat auch Gerds Vater. Und da ihm das nicht ausgereicht hatte, hing seit einigen Tagen ein entsprechendes Plakat in Rot mit goldener Schrift über dem Esstisch. Ingrids Vater hingegen sah das differenzierter und gönnte sich eine eigene Meinung. Ein Wort kam an jenem Abend zum anderen, aber nicht zum Ziel. Ingrids Vater versuchte noch, mit Beispielen den Bruch der langjährigen Freundschaft zu verhindern, und erzählte von manchem Unfug der SED, nämlich dass Ulbricht auf der 33. Plenarsitzung des ZK, das muss so Ende siebenundfünfzig gewesen sein, die Landwirtschaft angewiesen habe, für die Rinderhaltung der LPGs zukünftig Offenställe bauen zu lassen, sodass die Tiere praktisch im Freien lebten. Durch diese sozialistische Neuerung in der Landwirtschaft wollte die Partei offiziell eine Steigerung der Erträge und damit eine bessere Versorgung der Bevölkerung erreichen, aber auch die Baukosten für geschlossene Ställe sparen. »Was für ein Irrsinn!«, sagte Ingrids Vater. Denn es war nicht bedacht worden, dass die Idee der Offenställe aus den südlichen, warmen Regionen der Sowjetunion kam. In der DDR jedoch waren die Winter kalt. Durch die tiefen Außentemperaturen sank nicht nur die Milchproduktion, die Kälber erfroren teilweise, die Ställe ließen sich bei Frost nicht reinigen, sodass die Kühe über ihre Fladen stolperten oder auf der Gülle ausrutschten. Täglich starben Hunderte Tiere. Doch offen sagen durfte das niemand. Ausgesprochene Kritik an der Partei war gleichbedeutend mit Hetze gegen den Sozialismus und konnte im Gefängnis enden. Die Partei hatte immer Recht. Und an diesem Abend Gerds Vater. »Blau, schwarz, rot, gelb und grün«, wiederholte Gerd, der allmählich verstand. Nun sah auch er die olympischen Ringe vor seinen Füßen liegen. »Du hast es geschafft?! Bist du dabei?« »Jaaaa«, schrie Ingrid und warf die Arme in die Luft. »Was für ein Glück! Erst vor drei Wochen konnte ich direkt von der Sportschule zum Medizinstudium gehen und gestern wurde ich in den olympischen Kader der Turner berufen.« Gerd ging auf sie zu und schloss sie in die Arme. Freundschaftlich, aber doch ein paar Sekunden länger als sonst. »Mein Ziel ist jetzt natürlich die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1964 in Tokio« posaunte Ingrid raus. »Vielleicht sogar schon Bronze oder Silber nächstes Jahr in Rom.« Gerd genoss den Moment, die sonst eher introvertierte Ingrid so ausgelassen zu erleben. Auch neu, anders. Er hatte bei der Umarmung ihren Körper gespürt – und erste Schmetterlinge. »Komm, das müssen wir feiern. Lass uns zur Eisdiele fahren. Ich habe zwei Mark dabei.« »Nein, das schaff ich nicht. Muss gleich zum Training. Die Goldmedaille kommt ja nicht von allein herbeigeflogen.«Soviel zu ihrer Ausgelassenheit, dachte er betrübt und sagte: »Na gut. Dann begleite ich dich zumindest dorthin.« »Das wäre mir eine große Freude, Genosse Gerd.«
2
Eine Woche später war es so weit. Peter hatte seinen ersten Arbeitstag. Frühmorgens, wenn auch nicht so früh wie beim letzten Besuch, erschien er in der Poliklinik bei der Hochsteckfrisur mit Mandelaugen. »Guten Morgen, Herr Döbler. Professor Mannstein erwartet Sie bereits im Untersuchungszimmer. Wenn Sie mir folgen wollen, bringe ich Sie dorthin.« Peters Enttäuschung darüber, ein Jahr verloren zu haben, war mit dieser Aussage wie weggeblasen. Professor Mannstein erwartet Sie bereits im Untersuchungszimmer, das klang sehr vielversprechend für den ersten Arbeitstag und war mehr, als er erwartet hatte. Der Professor tastete gerade einen jungen Mann ab, der vielleicht 16 oder 17 Jahre alt war. »Da sind Sie ja, Döbler.« Der Professor forderte ihn mit einer Handbewegung auf, an seine Seite zu kommen. Peters Wangen glühten, er war bereit! »Der junge Mann hat eine Blinddarmentzündung«, erklärte Mannstein. »So eine Appendizitis kommt meist sehr plötzlich, trifft vor allem junge Menschen, ist sehr schmerzhaft und heilt nur selten von allein ab. Ursache sind fast immer Bakterien. Helfen Sie dem Jungen, sich wieder aufzusetzen? Wir lassen ihn sofort zur OP in die Universitätsklinik bringen.« Nach ein paar Minuten war der erste Einsatz schon wieder vorbei. Der Patient wurde mit Antibiotika, einem Eisbeutel auf dem Bauch und seinem Befund vom Krankentransport abgeholt, während der Professor Peter mit einem kurzen Kopfnicken signalisierte, dass er mitkommen solle. Peter folgte ihm ins Büro des Direktors. »Ich habe für die kommenden sechs Monate einen Plan gemacht«, begann der Professor seine Ausführungen. »Sie werden sich in erster Linie mit Verbandswechseln, Wundbehandlung und Gipsen vertraut machen. Danach setzen wir uns zusammen und planen die weiteren sechs Monate.« Peter, der sich in seinem Übermut schon als Arzt im weißen Kittel gesehen hatte, landete auf dem harten Boden der Tatsachen und nickte verständnisvoll. Natürlich musste er mit Verbandswechseln anfangen, dachte er. Aber diese Minuten im Untersuchungszimmer hatten ihm gezeigt, dass es richtig war, sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Jetzt wollte er umso mehr Medizin studieren.
Am ersten freien Wochenende fuhr Peter mit seinem Freund Gerd, der nach der 10. Klasse Feinmechaniker gelernt hatte, mit dem Zug nach Westberlin. Sie wollten in den Zoo-Palast. Besonders die Filme aus Amerika wie »Der alte Mann und das Meer« mit Spencer Tracy oder »Manche mögen’s heiß« mit der unschuldigen Marilyn Monroe hatten es Peter angetan. Spencer Tracy beflügelte seine Angelfantasie und Marilyn den Rest. Am Vormittag erreichten sie die S-Bahn-Station Friedrichstraße. Als der Zug hielt, sprangen sie aus der Bahn, rannten die Bahnhofstreppen hinunter und vorbei an Blumengeschäft, Kiosk und dem verrauchten Zigarrenladen hinaus auf die Friedrichstraße. Eine Wechselstube, wo sie ihre DDR-Mark in harte Währung eintauschen konnten, würden sie erst im Westteil Berlins finden. Zusammen hatten sie genau 15 Mark dabei und beteten für einen guten Wechselkurs.
»Lass den Kurs bitte, bitte bei eins zu vier sein«, sagte Gerd. »Dann können wir uns nach dem Kino noch eine Coke teilen.« Bald standen sie vor der Wechselstube und scannten nervös die Anzeigentafel mit dem Tages-Kursen: Dollar, Franc, Pfund, Lira, Peseten, Drachmen, DDR-Mark. Heutiger Wechselkurs von West- zu Ostmark: eins zu sechs. »Verdammt noch mal«, fluchte Gerd und biss sich auf die Unterlippe. »Die Cola können wir vergessen.« »Vielleicht auch nicht«, antwortete Peter. »Lass uns den Trick versuchen. Dann wäre sogar noch ein Stück Nusskuchen drin.« »Doch nicht diesen Uralttrick mit dem Rein- und Rausgehen?« »Genau den«, griente Peter und zeigte auf die Tafel. »Schau mal, immer noch eins zu sechs.« »Gut, in Ordnung. Aber nur, wenn du das Quatschen übernimmst.«
Der Trick bestand darin, dass sie lediglich eine Eintrittskarte für den Film kauften und, wie soeben beschlossen, Peter allein in den Kinosaal vorging. Nach einer Viertelstunde verließ er den Saal und sprach kurz mit dem Kartenabreißer, damit der sich sein Gesicht einprägen konnte. Auf der Toilette gab er Gerd seine Karte und würde dann zurückgehen. Sollte der Abreißer ihn nach seinem Ticket fragen, würde er hastig seine Taschen durchwühlen, voller Entsetzen nur noch seinen DDR-Ausweis finden und sagen: »Das muss ich im Saal verloren haben. Wenn Sie mir Ihre Taschenlampe geben, könnte ich es suchen gehen!« Spätestens jetzt würde der Abreißer ihn durchwinken. Und – Überraschung, Überraschung! – nur Minuten später würde Gerd folgen. Der Nachteil dieses Tricks war, dass einer die Kinoreklame und ein paar Minuten Film verpassen würde. Wobei für Gerd die verpasste Reklame schlimmer wog als irgendein Film. Er liebte diese 45- und 60-Sekünder. Vor allem das HB-Männchen und die Dr.-Oetker-Gigs mit den leckeren Kuchen, Puddings und schönen Frauen.
* * *
Dann der Schock. Als Peter mit der letzten Bahn kurz nach Mitternacht zu Hause ankam, saß seine Mutti mit geröteten Augen am Küchentisch. Christian neben ihr, blass wie die Wand. »Was ist denn los?«, fragte Peter. Keine Antwort. »Mutti! Was ist denn passiert?« »Vati ist heute Morgen gestorben.« Die Worte klangen ungehalten und überreizt. Peter setzte sich zu ihnen und versuchte zu verstehen. »Gestorben? Aber die Operation war doch gut verlaufen. Wir waren doch gerade noch bei ihm!«, sagte er mit zerbrechlicher Stimme. »Wieso ist er denn jetzt gestorben?« Maria hob den Kopf, griff nach Christians und Peters Händen und drückte sie fest. »Vati hat euch geliebt und war auf euch beide sehr stolz, das hat er mir immer wieder gesagt. Das dürft ihr nie vergessen.« Maria stockte. »Aber es gab Komplikationen.« »Was denn für Komplikationen?«, fragte Peter, worauf Christian versuchte, ihm zu berichten, was ihnen der Arzt detailliert erklärt hatte. Doch all das erreichte ihn nicht mehr. Christian redete, doch nichts davon drang zu Peter durch. Er sah nur noch lautlose Mund- und Handbewegungen. Peter zog langsam seine Hand aus der seiner Mutter und ging zum Küchenfenster. Er dachte an den Tag, als sein Vati ihn als Siebenjährigen das erste Mal zum Fischen mitgenommen hatte. Der Krieg lag damals gerade zwei Jahre zurück. Sie waren in aller Herrgottsfrühe auf dem klapprigen und rostigen Fahrrad seines Vaters losgefahren, vorbei an Ruinen und abgestorbenen schwarzen Bäumen, er selbst saß auf dem Gepäckträger und schlang seine kurzen Ärmchen fest um seinen Vater. Peter war an diesem Tag so unglaublich stolz gewesen, weil er etwas mit ihm unternehmen konnte, ganz allein, ohne seine Mutti oder Christian. Als sie nach einer Ewigkeit einen großen Teich bei Kessin an der Kösterbek erreichten, hatte Peter gemurmelt: »Der kleine Mann und das Meer.«
»Hallo? Peter? Hörst du mich?«, fragte Christian, doch sein Bruder war noch am Teich. In Gedanken schipperte er mit seinem Vater in dem kleinen Boot hinaus auf den See, um Hechte zu angeln. Und er erinnerte sich, wie er beim Versuch, einen Fisch herauszuziehen, ins kalte Wasser fiel, was sie seiner Mutter nie erzählt hatten. »Das sollte unter uns bleiben«, hatte Vati damals gesagt. »Sonst regt sich Mutti nur unnötig auf. Ist ja schließlich nichts passiert.« Doch da irrte sich sein Vater gewaltig. An diesem Tag entdeckte Peter seine Leidenschaft fürs Angeln und fürs Wasser. Er musste nur noch schwimmen lernen. Denn so hilflos, wie er sich in diesen Sekunden als Nichtschwimmer vorkam, wollte er sich nie wieder fühlen.
* * *
Die Beisetzung fand am Samstag darauf auf dem Westfriedhof statt. In der Kapelle stand sein Sarg aufgebahrt, genau an der Stelle wie Tante Hertha vor anderthalb Jahren. Damals war es Peters erste Beerdigung gewesen und er hatte lange überlegt, ob er überhaupt hingehen sollte. Doch im Nachhinein war er froh gewesen, dass er da war. Damals noch mit seinem Vater. Eine dicke Träne kullerte über seine Wange, als er einen weißen Strauß Rosen auf dem Sarg liegen sah. Er fragte sich in einem Anflug von Unverständnis, warum Vati nicht auch rote Rosen bekommen hatte wie Tante Hertha. Von wem diese weißen wohl waren? Von Mutti? Oder von seiner neuen Freundin? Doch die einsetzende Orgelmusik stoppte seine Überlegungen. Er strich sich die Haare aus dem Gesicht, nahm das Gesangsbuch aus der Kirchenbank und begann seine Lippen zu »Wir sind nur Gast auf Erden« zu bewegen. Nach der Andacht folgten die Trauergäste Pastor Niemann und dem Sarg zur offenen Grabstätte, etwa fünf Meter Luftlinie zu Tante Hertha. Der Pastor sprach einfühlsame Worte, während der Sarg von den vier Sargträgern hinabgelassen wurde. Er bekreuzigte sich und spendete den Anwesenden Trost, indem er ihnen still die Hand reichte. Christian und Peter legte er fest beide Hände auf die Schulter und flüsterte: »Die Besten holt sich der liebe Gott immer zuerst.« Nett gesagt, dachte Peter, aber totaler Unsinn. Der liebe Gott hätte sich besser jemanden anders geholt. Denn so gut war Vati nun auch nicht gewesen. Hätte er sonst die Mutti verlassen? Peter erschrak über seine Gedanken und fuhr sich mit der Hand über den Mund, wie um sicherzustellen, dass er nur gedacht hatte. Darf man bei einer Beerdigung solche Gedanken haben? Er versuchte an etwas weniger Kompromittierendes zu denken, bedankte sich beim Pastor für den Zuspruch und folgte mit Christian der Menge, die sich zum Leichenschmaus in die Fritz-ReuterStraße 81 aufmachte. Dazu gehörten neben den Nachbarn von direkt gegenüber und aus dem Erdgeschoss auch Sigrid mit einer Freundin und Marianne, die Frau von Professor Mannstein. Georgs Freundin hatte sich nach der Beerdigung verabschiedet, was Maria sichtlich erleichterte. So konnten sie in Ruhe im vertrauten Kreis Abschied nehmen.
Zu Hause angekommen, bemerkte Peter, dass ein Leichenschmaus auch Vorteile hatte. Man konnte zum Beispiel auf liebe Verwandte aus dem Westen treffen. »Na, Cousinchen?«, fragte Peter mit einem Glas Orangenlimonade in der Hand. »Sind wir heute zu spät aus dem Bett gekommen? Habe dich in der Kapelle nicht gesehen.« »Es tut mir wahnsinnig leid, dass wir es nicht zum Friedhof geschafft haben, Peter, aber die Straßen waren so voll. Es schien, als wollte die ganze Welt an diesem Wochenende an die Ostsee.« »Macht nichts, du hast nicht viel verpasst. Pastor Niemann hat wie vor anderthalb Jahren bei Tante Hertha zwei kurze Ansprachen gehalten und im Anschluss gesagt, dass die Besten immer zuerst geholt werden.« »Tante Hertha ist schon anderthalb Jahre tot? Mein Gott, wie die Zeit vergeht. – Das ist übrigens«, Sigrid zeigte auf ihre Begleitung, »meine Freundin Monika. Als ich ihr sagte, dass ich nach Rostock zur Beerdigung meines Onkels fahre, fragte sie mich, ob sie mitkommen könne. Ich hoffe, das ist in Ordnung?« »Aber natürlich.« Peter drehte sich zu Monika und genoss aus der Nähe. Hoch gewachsen, lange Haare, Sommersprossen, blaue Augen, Stupsnase, freche Zahnlücke und erstrebenswerte Gesichtszüge. »Hallo, ich bin Peter. Der Cousin von Sigrid.« »Ach nee«, antworte Monika keck und lachte. Sie war genau wie seine Cousine 22 Jahre alt und vor zwei Jahren wegen ihrer Schwimmleidenschaft nach Kiel gezogen. Sie liebte das Meer und wollte deshalb auch die Ostseestrände der DDR kennenlernen. »Sigrid hat mir schon viel von dir erzählt.« »Hat sie das?« Peter errötete und schaute kurz zu Sigrid. »Was denn?« »Das erzähle ich dir beim nächsten Mal.« »Morgen?« Sigrid staunte über die Forschheit ihres kleinen Cousins. Auch Peter selbst wirkte überrascht. Schließlich war er erst 19 und damit für eine 22-Jährige eher unsichtbar. »Falls ihr dann noch hier seid, meinte ich«, ergänzte er und schaute hilfesuchend zu Sigrid. »Morgen wollten wir nach Warnemünde«, antwortete Monika trocken. Pause. »Aber komm doch einfach mit«, sprang Sigrid Peter zur Seite. »Du kannst uns dort bestimmt noch die eine oder andere Ecke zeigen.«
* * *
»Döbler, mitkommen.« Kaum hatte Peter am Montag den Flur der Poliklinik betreten, traf er den Direktor. Eigentlich wollte er noch seinen Gedanken an den gestrigen Warnemündeausflug nachhängen und bei einem Kaffee das Übergabeprotokoll des Nachtdienstes lesen, doch es half nichts. Er kehrte um und folgte ihm ins Arztzimmer. »Setzen Sie sich bitte.« Mannstein zeigte auf den freien Stuhl vor seinem Schreibtisch und setzte sich in seinen Chefsessel. »Marianne, also meine Frau Marianne, hat mir von der Beisetzung Ihres Vaters erzählt.« »Ja.« »Mein Beileid.« »Vielen Dank, Herr Direktor.« »Sie wissen ja, Döbler, dass ich mit Ihrer Arbeit sehr zufrieden bin. Sie haben sich offenbar gut bei uns eingelebt. Jeder mag Sie.« »Danke. Es sind auch tolle Kollegen.« »Schön, schön.« Mannstein machte eine beschwichtigende Handbewegung. »Und deshalb würde ich nur ungern auf Sie verzichten.« Peter war sich nicht sicher, worauf der Direktor Mannstein hinauswollte. Er war doch gerade erst ein paar Wochen hier. »Aber?«, sagte er zaghaft. »Ich bemerke, dass Sie mit den Wundbehandlungen und Verbandswechsels nicht ausgelastet sind. Also vom Kopf her.« Mannstein begleitete seine Aussage durch wirbelnde Handbewegungen auf Höhe der Schläfen. »Nicht, dass Sie mich missverstehen, Ihre Arbeit ist wichtig für uns, für unsere Patienten, für unseren Staat. Ich kann mich nur des Eindrucks nicht erwehren, dass mehr in Ihnen steckt.« Peter fragte sich, was er ihm sagen wollte. Wurde er gerade entlassen? Oder mit neuen Aufgaben betraut? Sollte er nun doch an Mannsteins Seite assistieren? Peter war durcheinander. Der Tod seines Vaters, die Beerdigung, Warnemünde, Monika. »Worauf wollen Sie hinaus, Herr Direktor?« Mannstein stand auf, ging eine Runde durch sein spartanisch eingerichtetes Arbeitszimmer, blieb vorm Spiegel stehen, zog mit einem braunen Kamm sorgfältig seinen Scheitel nach und setzte sich wieder an seinen Schreibtisch. Dann mühte er sich, während Peters Blicke auf ihm ruhten, vergeblich an einem längst kalten Zigarrenstummel ab. Einmal, zweimal, dreimal. Nichts. Er legte ihn wieder zurück in den überfüllten Aschenbecher. Dann brach der Professor sein Schweigen. »Als was, hatten Sie gesagt, war Ihr Vater tätig?« »Steuerberater. Mein Vati war Steuerberater.« »Ach ja. Selbstständiger Steuerberater. Richtig?« »Richtig, Herr Direktor.« »Das ist gut!« »Gut?« »Ja. Sie sollten sich erneut bei der Universität fürs Medizinstudium bewerben. Und zwar noch dieses Semester.« »Aber mein Bewährungsjahr?«, sagte Peter. »Ich hatte mich doch schon beworben und wurde abgelehnt.« »Das ist doch Schnee von vorgestern, Döbler.« Professor Mannstein machte eine wegwischende Handbewegung. »Der springende Punkt ist doch, dass Sie jetzt, nach dem Ableben ihres Vaters, kein Kapitalistenkind mehr sind.« Peter hob die Augenbrauen und begann zu verstehen. »Marianne, also meine Frau, sagte mir, dass ihre Mutter als Verkäuferin in der HO arbeitet, richtig?« »Richtig, Herr Direktor.« »Dann sind Sie nun ein Arbeiterkind, Döbler. Dann haben Sie mit Ihren Zensuren jetzt die besten Aussichten auf ein Medizinstudium. Sie sollten es erneut versuchen. Am besten noch heute. Sie können gehen.« »Sie meinen jetzt?« »Aber unbedingt!«
* * *
Nachdem Peter am Nachmittag seine Bewerbungsunterlagen persönlich in der Uni Rostock abgegeben hatte, wollte er, mittlerweile war es dreiviertel vier, noch Gerd treffen. Im Krug? Oder beim Fußball? Das waren die denkbaren Varianten. Er fand ihn auf dem Ackerplatz, setzte sich auf eine provisorische Bank und klatschte Beifall. Als Gerd ihn sah, kam er auf ihn zugerannt. »Willste mitspielen, Peter?« »Nee. Willste ein Bier?« »Gibste einen aus?« »Sicher.« »Fiete?« »Was sonst?« Keine zehn Minuten später betraten Peter und der völlig verschwitzte Gerd den Alten Krug, eine 80 Jahre alte Kaschemme im Kellergeschoß eines trostlosen Betonbaus. Klein, dreckig, verraucht und urgemütlich. Fiete stand wie üblich hinterm Tresen und johlte: »Zwei Bier für den Nachwuchs?«