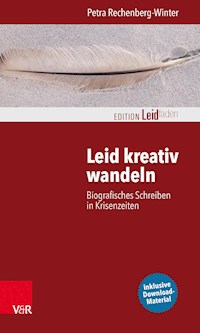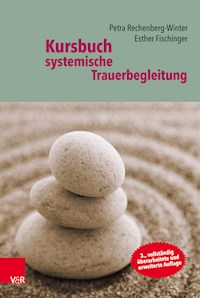
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Ob ein zur Adoption freigegebenes Kind, der Tod eines geliebten Menschen, eine Trennung oder Scheidung – wie kann man Betroffenen Kraft und Mut zu Abschied, Trauer und Neubeginn geben? In der komplett überarbeiteten dritten Auflage führen Petra Rechenberg-Winter und Esther Fischinger im ersten Teil ausgewähltes aktualisiertes Grundlagenwissen zum Verständnis von System und Trauer zusammen, um im zweiten Teil ihren Ansatz systemischer Trauerbegleitung vorzustellen. Theoretische Betrachtungen werden durch praxiserprobte methodische Zugänge ergänzt, ausgewählte Aspekte und Vorgehensweisen anhand von fiktiven Fallbeispielen illustriert. Diesen Praxisteil erweitern Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Mit ihren Kasuistiken bieten sie im dritten Teil Werkstatteinblicke, die bei aller Verschiedenheit des Settings und der Verlustsituationen der gemeinsame Nenner verbindet, trauernde Menschen in Umbruchsituationen ihres Lebens entwicklungsorientiert zu begleiten. Einen Schwerpunkt bildet die Situation trauernder Kinder. Arbeitsblätter, Handouts und Beispiele kreativer Umsetzung runden als umfangreiches Downloadmaterial den Band ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Petra Rechenberg-Winter / Esther Fischinger
Kursbuch systemische Trauerbegleitung
Mit 14 Abbildungen und einer Tabelle
Vandenhoeck & Ruprecht
Download-Material unter: http://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/kursbuch-systemische-trauerbegleitung
Code: anaqov
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2018
© 2018, 2010, 2008, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,
Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-90133-6
Keines bleibt in derselben Gestalt,
und Veränderungen liebend schafft die Natur stets neu aus anderen Formen, und in der Weite der Welt geht nichts, das glaubt mir, verloren.
Ovid, Metamorphosen
Inhalt
Vorwort zur dritten, vollständig überarbeiteten und erweiterten Auflage
1Konzeptidee Kursbuch
1.1Anliegen
1.2Systemische Einbindung
1.3Aufbau
2Einführung in systemisches Arbeiten und Trauererleben
2.1Zum Verständnis von System
2.1.1Entwicklung des systemischen Weltbilds – kurzer Überblick
2.1.2Systembetrachtung
2.1.3Systemaspekte
2.2Zum Verständnis von Trauer
2.2.1Begriffsklärung
2.2.2Trauermodelle
2.3Trauererleben
2.3.1Trauerverläufe unter erschwerten und traumatisierenden Bedingungen
2.3.2Besonderheiten traumatischer Erfahrungen in der Kindheit
2.3.3Generationenübergreifende Traumafolgen
2.3.4Exkurs in neuere Forschungsansätze
3Systemische Trauerbegleitung
3.1Zum Verständnis von systemischer Trauerbegleitung
3.1.1Trauer als (systemischer) Entwicklungsprozess
3.1.2Trauer und die Frage nach dem Sinn
3.2Trauer, Kultur, Religion und Geschlecht
3.2.1Soziokulturelle und religiöse Determinanten
3.2.2Geschlechtsspezifischer Trauerausdruck
3.3Trauerbegleitung im Lebensverlauf
3.3.1Trauer in der Kinder- und Jugendzeit: Verlust von Bindungspersonen und Bezugssystemen
3.3.2Trauer in der Kinder- und Jugendzeit: Verlust des eigenen Lebens (pädiatrische Palliativversorgung)
3.3.3Trauer in der Lebensmitte
3.3.4Trauer im Alter
3.4Begleitung von Trauersystemen
3.4.1Haltung der Begleiterinnen
3.4.2Beziehungsgestaltung
3.4.3Kommunikation
3.4.4Prozessgestaltung und Interventionen
4Zur Illustration systemischer Trauerbegleitung: Fiktives Fallbeispiel
4.1Kontaktaufnahme als systemische Intervention
4.2Erstgespräch im Einzelsetting
4.3Erste Familiensitzung – Stützende Intervention und Auftragsklärung
4.4Zweite Familiensitzung – Zusammenhalten des Systems
4.5Dritte Familiensitzung – Bilanzierung der Erfahrungen
4.6Erstes Paargespräch
4.7Zweites Paargespräch
4.8Delegation und kollegiales System
4.9Katamnestische Zwischeninformation
5Kasuistische Szenarien
5.1Einführende Gedanken: Das »Gesicht der Trauer«
5.2Begleitetes Abschiednehmen im Kontext großer Weltreligionen und östlicher Weisheitslehre
5.2.1Beispiel einer Trauerbegleitung nach der Halacha (Jüdisches Gesetz)
5.2.2Beispiel einer Trauerbegleitung aus der christlichen Kultur
5.2.3Beispiel einer Trauerbegleitung im islamischen Glaubensverständnis
5.2.4Beispiel einer Trauerbegleitung in der Begegnung mit buddhistischen Wertvorstellungen
5.3Kaleidoskop kollegialer Erfahrungen
5.3.1Trauer an biografischen Wendepunkten
5.3.2Trauer bei tabuisierten Verlusten
5.3.3Trauer um Veränderung und Verlust von Identität bei lebensverkürzender Erkrankung
5.3.4Trauer im Ringen um Normalität
5.3.5Trauer nach Unfall
5.3.6Trauer und soziale Schwierigkeiten
5.3.7Trauer bei Migration
5.3.8Trauer am Lebensende
5.3.9Trauer nach Suizid
5.3.10Trauer im System der Helfer
5.3.11Trauer und ihre frühe Symbolik in Kinderzeichnungen – Bildunterstützte Trauerwahrnehmung aus systemischer Perspektive
5.3.12Trauer und Trauma mit künstlerischen Mitteln begegnen: Flüchtlingskinder und geflüchtete Jugendliche in der Kunstwerkstatt von Refugio
5.3.13Trauerbegleitung bei Jugendlichen im (Online-) Netzwerk der Nicolaidis YoungWings Stiftung
6Selbstverständnis als Trauerbegleiter
6.1Identität
6.2Selbstreflexion
6.3Leitbilder
7Literatur
8Ausgewählte Literaturempfehlungen zu Trauer bei Kindern und Jugendlichen
9Inhaltsverzeichnis Download-Material
Vorwort zur dritten, vollständig überarbeiteten und erweiterten Auflage
In unseren Dankeszirkel schließen wir all die liebevollen privaten Begleiter ein, die uns geduldig und verlässlich Unterstützung boten über die vielen Jahre, in denen sie uns Eigenzeit für ein Herzensanliegen in Gestalt dieses stetig wachsenden und sich beständig entwickelnden Buchprojektes zur Verfügung stellten.
Ohne die Menschen, die sich uns anvertraut haben und ihre Erfahrungen in Psychotherapie und Supervision mit uns teilten, wäre dieses Buch nicht entstanden. Ihnen sind wir in einer ganz besonderen und respektvollen Dankbarkeit verbunden. Viel gelernt haben wir in der Fallarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen, deren Beiträge unser Anliegen nun in den verschiedensten Facetten reichhaltig ergänzen. So danken wir Ulrike Aldebert, Beate Augustyn, Michael Clausing, Christina Fuchs, Christiane Knoop, Thomas Malenke, Katrin Normann, Margit Papamokas, Martina Plieth, Traugott Roser, Ahmed Selim, Hafes Shalabi, Ali Shehata, Monika Weis, Friedrich Winter, Regina Wolf-Schmid, Dinah Zenker und Jörg Zerban sowie Silvia Pless und Marianne Bundrock, die mit ihren Stelen das Download-Material um eindrucksvolle Trauersymbole bereichern, ebenso Felix-Maria Kühnl, Astrid Simader und Walther Stamm für ihren Ausstellungsbericht.
Als wir uns fast in all unseren vielfältigen Überlegungen, Vorstellungen und Ansprüchen verlaufen hätten, hatten wir in Michael Clausing einen freundschaftlichen, kompetenten Wegbegleiter, dem wir dafür herzlich danken.
Sandra Englisch war in sorgsamem, anregendem und darüber hinaus gut gelauntem redaktionellem Einsatz für das Manuskript tätig. Die erweiterte dritte Auflage wurde von Johanna Mohrmann trotz der Herausforderung unterschiedlicher Dateiformate und anwachsender Volumina professionell betreut.
Und da Zirkelbewegungen keinen Anfang haben, steht unser Gruß an Günter Presting auch nicht an letzter Stelle. Seinem Vertrauen in unsere Ideen und seinem wertschätzenden Zuspruch sind wir außerordentlich dankbar.
1Konzeptidee Kursbuch
1.1Anliegen
Obwohl nach wie vor ein eher ungeliebtes Kapitel menschlichen Seins, boomt es auf dem Büchermarkt zum Thema Trauer. Die Medien greifen zunehmend die Palette menschlicher Verlusterfahrungen in Dokumentationen und Filmen auf und entsprechende Veranstaltungen sind in der Regel gut besucht. Es scheint, als hole sich die Gesellschaft einen zu lange ausgegrenzten Erfahrungsbereich in ihren Lebensraum zurück. Aufregung und Aufbruchsstimmung sind spürbar und erzeugen eine ganz eigene Dynamik – aus einem Tabu entwickelt sich mancherorts ein Faszinosum mit euphorischen Idealisierungen und Ästhetisierung menschlichen Leidens. Während sich die einen darüber freuen, dass endlich Bewegung in das Schattendasein eines existentiellen menschlichen Themas kommt, sorgen sich andere bereits wegen inflationärer, kommerzialisierter Angebote und voyeuristischem Aktionismus um Nachhaltigkeit und Qualität.
Besonders all die Fachbereiche, in denen Menschen mit Menschen arbeiten, wenden sich vermehrt und differenziert menschlichen Verlusterfahrungen zu. Dass sich Pädagogik, Psychologie, Philosophie und Theologie, Palliative Care und Hospizarbeit mit den Phänomenen von Abschied, Trauer und Neubeginn auseinandersetzen, ist nicht verwunderlich, werden doch gerade diese Berufe schwerpunktmäßig mit vielfältigen Veränderungsprozessen und schicksalhaften Brüchen im Lebenslauf ihres Klientels konfrontiert. Vermehrt werden professionelle Dialoge über die Trauer gefördert, Trauerprozesse untersucht und wirksame Unterstützungsmöglichkeiten entwickelt. Trauerbegleitung ist ins Feld interdisziplinärer Bemühungen gerückt. Bundesweit gibt es inzwischen kompetente Qualifizierungsangebote für Begleitende, die sich Qualitätsstandards verpflichten (www.bv-trauerbegleitung.de).
In Deutschland tun wir uns mit diesen Entwicklungen aufgrund der historischen Brüche besonders schwer. Mitte des 20. Jahrhunderts richtete man sich nach den gesamtgesellschaftlichen Traumen beider Weltkriege auf eine effektive Überlebensstrategie aus. Es entwickelte sich in Folge von bis dahin unvorstellbaren kollektiven Leiderfahrungsdimensionen, die mit tiefen Scham- und Schuldgefühlen einhergingen (Marks, 2007), ein gesteigertes Bedürfnis nach Sicherheit und Bestandswahrung. Das gerettete Leben sollte ein Leben für immer sein. (Technischer) Fortschritt und (wirtschaftliches) Wachstum waren unhinterfragte Axiome. Die Hoffnung auf ein Nie-Wieder und begeisterte Reaktionen auf das Ende des Kalten Krieges bildeten das psychische Bollwerk gegen die Erkenntnis unserer dauerhaften existentiellen Bedrohtheit. Inzwischen manifestieren sich jedoch in der aktuellen Weltpolitik Störungsfelder unserer Selbst- und Fremdidealisierungsleistungen. Wir erleben eine Rückkehr der Schrecken, die in den wechselseitigen Zuschreibungen von Aggression dazu beitragen, neue Unrechtshierarchien zu etablieren.
1.2Systemische Einbindung
Das Grundlagenwissen über die Langzeitwirkung unverarbeiteter Traumata und die heilkräftige Fähigkeit zu trauern (Mitscherlich u. Mitscherlich, 2007) wird heute ergänzt von der Einsicht in zirkuläre Prozesse, in denen trauernde Menschen, ihre Bezugspersonen und auch involvierte Helfersysteme gleichermaßen ihre einander bedingende Funktion erfüllen.
Konzepte der Individualisierung haben uns ein hohes Gut freiheitlich verantworteter Lebensführung und die postmoderne Ausgestaltung persönlicher Spielräume beschert. Doch letztendlich scheiterte der Versuch, existentielle Bedürfnisse mit einer verführerischen Bandbreite an Konsumangeboten zu sättigen. Ein Alltag, der kaum Räume für spirituelle Reflexion bereitstellt, sondern virtuelle Bühnen anbietet, auf denen Lebenserfahrungen im doppelten Wortsinn austauschbar sind, verstärkt die Verunsicherung im Umgang mit irreversiblen Verlusten. Beschleunigte Abfolgen von Wunsch und Erfüllung als Grundlage von Glücksempfindung einerseits (Schopenhauer) und das Einfrieren in Idealzuständen von Alterslosigkeit, immerwährender Gesundheit und Schönheit andererseits sind Versuche, die immer wieder aus dem Un- und Vorbewussten aufdämmernde, erschütternde Ahnung von Endzeitlichkeit zu kontrollieren. Um Transzendierung bemühen wir uns nicht länger im Übergang vom Diesseits ins Jenseits, sondern durch ein infinitives Gegenwartserleben.
Das »Unbehagen in der [an einer] Kultur« (Freud, 1930/2004), die eine dem Leben immanente Verlaufsgestalt ausblendet, führte in den letzten Jahren zu einer verstärkten Suche nach alternativem Verständnis von Vergänglichkeit und verantwortungsvollen Verhaltensoptionen. »Damit ist aber auch der Versuch einer irrationalen Todesvermeidung um jeden Preis aufgegeben. Der Mensch besinnt sich auf seine Endlichkeit, nicht um diese tatenlos und gleichgültig zu akzeptieren, sondern um aus solcher Erkenntnis Motivation für sein Leben zu schöpfen« (Condrau, 1991, S. 10).
Einen weiteren notwendigen Paradigmenwechsel signalisiert die Infragestellung des Ich-Ideals auch bei den Helfersystemen. Menschen, die sich in Extremsituationen befinden, gewähren uns Betreuenden existentielle Einblicke in Lebenserfahrungen, in die wir selbst noch gar nicht hineingewachsen sind, und erweitern damit unseren Horizont. Daneben muten sie uns aber auch (Selbst-)Erfahrungen zu, die wir mitunter nur schwer ertragen können. Rebellion und aufsässiges Verhalten, Enttäuschungen, (irrationale) Ängste und verzweifelte Untröstlichkeit, Gefühle voller Wucht und Intensität können bei uns Abwehrreaktionen, Kränkungsempfindungen, Insuffizienzgefühle und Sorge um das eigene Standing auslösen. Sich der eigenen Ambivalenz und vielschichtigen Motivationen bewusst zu sein, ist unverzichtbare Voraussetzung für prozessorientierte Trauerbegleitung. In diesem Spannungsfeld sind wir Professionelle in unserem scheinbar unantastbaren Rollenverständnis zu besonderer Selbstwachsamkeit aufgefordert.
1.3Aufbau
Was kann nun ein Buch zum Thema begleiteter Trauer aus systemischer Perspektive beitragen? Was unterscheidet es von den zahlreichen anderen Veröffentlichungen, die sich ebenfalls um Informationsgewinn für eine wachsende Lesergemeinde bemühen?
Aus Sicht des Einen ergänzen wir die Perspektive des Anderen (Stierlin, 1976). Den einen, systemischen Blick, vertreten von Petra Rechenberg-Winter, vertieft Esther Fischinger mit ihrem kinder- und jugendlichenpsychotherapeutischen Erfahrungshintergrund. Gemeinsam nutzen wir mit Freude unsere fachlichen wie persönlichen Ressourcen, um das Modell der systemischen Trauerbegleitung praxisrelevant zu erarbeiten.
So führen wir im ersten Teil ausgewähltes Grundlagenwissen zum Verständnis von System und Trauer zusammen (Kapitel 2), um im zweiten Teil unseren Ansatz systemischer Trauerbegleitung vorzustellen (Kapitel 3). Theoretische Betrachtungen ergänzen wir mit praxiserprobten methodischen Zugängen und illustrieren ausgewählte Aspekte und Vorgehensweisen anhand eines fiktiven Fallbeispiels (Kapitel 4). Diesen Praxisteil erweitern Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Mit ihren Kasuistiken bieten sie in Kapitel 5 Werkstatteinblicke, die bei aller Verschiedenheit des Settings und der Verlustsituationen der gemeinsame Nenner verbindet, trauernde Menschen in Umbruchsituationen ihres Lebens entwicklungsorientiert zu begleiten. Um das Selbstverständnis als Trauerbegleiter geht es in Kapitel 6.
Einen Schwerpunkt bildet – aufgrund seiner besonderen Bedeutung und der Relevanz von Systemreflexion bei diesem Thema – die Situation trauernder und sterbender Kinder.
Das Format eines Kursbuches haben wir gewählt, um Wissen möglichst praxisnah zu vermitteln. Im Viererschritt von Selbstreflexion – Theorie – Methodik – Praxistransfer bieten wir systemische Zugänge mit wechselnden Blickwinkeln (Willke, 2004). Dabei orientieren wir uns am Modell des »experimental learning« (Kolb, 1984), das individuelles Reflektieren von aktiv Erprobtem mit theoretischem Sachwissen verwebt, um die persönliche Entwicklung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Haltungen möglichst effektiv zu unterstützen (siehe Handout – H Erfahrungslernen und handlungsorientiertes Lernen).
Zur leichteren Orientierung fassen wir an dieser Stelle das wiederkehrende methodische »Instrumentarium« zusammen:
–Impulse (als solche gekennzeichnet) werden Sie in einen neuen Abschnitt einführen und als Impulsgeber innerhalb einer Lerneinheit zu eigenen Selbstreflexionen und weiterführenden Fragen anregen.
–In einem Online-Anhang finden sich Arbeitsblätter (AB) mit Interventionen der systemischen Trauerbegleitung. Sie beschreiben die einzelnen Methoden und bieten gleichzeitig die Möglichkeit, sich an den Inhalten selbstständig zu erproben. Diese Interventionen sind keine (vor)schnellen Rezepte, um gefragt oder ungefragt eine belastende Situation für die Betroffenen zu beenden, diese zu schützen oder gar stellvertretend für sie Verantwortung zu übernehmen. Vielmehr handelt es sich um Interventionen in ihrer ursprünglichen Form als »dazwischen treten, vermitteln, einem Prozess beitreten«. Begleitend, anregend und wertschätzend wollen sie »beisteuern« statt »steuern«.
–Handouts (H) im Online-Anhang fassen Wesentliches der Lerninhalte zusammen oder ergänzen im Detail.
–Zur Reflexion des persönlichen Lernens und Begleitens bieten wir ein Modell zur systemischen Auswertung (AB Auswertung von Impulsen, Übungen, Methoden) und ein Schema zur Fallpräsentation (H Prozessablauf und -reflexion) an.
Wir haben uns entschieden, in unserer Schreibweise gendergerecht weibliche und männliche Wortendungen – ohne geschlechtsspezifische Zugehörigkeiten andeuten zu wollen – abwechselnd zu gebrauchen.
Mit dem Kursbuch richten wir uns an Fachkräfte und Interessierte, die sich ergänzend zu ihrer Berufsausbildung in Trauerbegleitung qualifizieren möchten und dabei Lust verspüren, Wissen im Kontext persönlicher Fragestellungen und professioneller Identität zu reflektieren und neugierig andersartige Betrachtungszugänge zu erforschen.
Dieses Buch verstehen wir als einen Zwischenstopp in unserem eigenen lebendigen, systemischen Lernprozess. Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung und außerordentlich interessiert an Rückmeldungen, Anregungen und Ergänzungen unserer Leserinnen. Bitte fühlen Sie sich dazu herzlich eingeladen.
2Einführung in systemisches Arbeiten und Trauererleben
2.1Zum Verständnis von System
2.1.1Entwicklung des systemischen Weltbilds – ein kurzer Überblick
Wir Menschen sind Engel mit nur einem Flügel.
Um fliegen zu können, müssen wir uns umarmen.
(Luciano de Crescenzo)
Der Begriff System bedeutet im Griechischen Zusammenstellen, Verbinden einzelner Teile zu einem Gebilde, dessen wesentliche Elemente aufeinander bezogen sind. In ihrem wechselseitigen Zusammenspiel bilden sie ein einzigartiges Ganzes, das aufgabenbezogen, sinngebunden oder zweckorientiert als Einheit mehr darstellt als die Summe seiner Teile.
Dieses phänomenologische Konzept wurde Anfang des 20. Jahrhunderts aufgegriffen und weiterentwickelt. Als die mechanischen Erklärungsmodelle der Physik und Biologie nicht mehr ausreichten, um komplexe Ordnungs- beziehungsweise Unordnungszustände und Systemveränderungen zu erklären, führten naturwissenschaftliche, philosophische, erkenntnistheoretische, ökonomische, künstlerische und politische Betrachtungen zu einem Paradigmenwechsel. An Stelle der logischmathematischen Theorie einer allgemein gültigen Wirklichkeit trat die Erkenntnis, dass es endgültiges Wissen gar nicht geben kann. Vielmehr ist das, was jeweils als Wirklichkeit anerkannt ist, eine von ihren Betrachtern aktiv erzeugte Konstruktion. Bei dieser handelt es sich lediglich um den Versuch, ausgewählte Aspekte einer in ihrer Komplexität nicht zu erfassenden Wirklichkeit verstehbar darzustellen. Folglich wurden Theorien generell als Systemaktivitäten menschlicher Gesellschaften erkannt, als relative Überzeugungen, die auf eine bestimmte Bezugsgröße ausgerichtet sind (Relativismus). Sie bieten lediglich ein reduziertes Bild von der betrachteten Welt. Folglich können sie immer nur von vorläufiger Gültigkeit sein, bis neuere Erkenntnisse sie revidieren.
1928 formuliert Ludwig von Bertalanffy (Biologe und Philosoph, 1901–1972) seine »Allgemeine Systemtheorie«. Allgemein ist hier nicht mit allgemeingültig gleichzusetzen. Denn wenn unabhängige, objektive und feststehende Erkenntnisse unmöglich sind, dann trifft dies ebenso auf eine systemische Universaltheorie zu. Konsequenterweise gelten Systemtheorien immer nur innerhalb ihres Bezugsrahmens und heben je nach Systemansatz unterschiedliche Elemente hervor.
Einige ihrer Vertreter seien an dieser Stelle kurz aufgeführt: Humberto Romesín Maturana, Francisco J. Varela und Frederic Vester gehen vom biologischen Systemverständnis aus. Anhand lebender Zellen beschreiben sie deren Abgrenzung (mittels einer Zellmembran) und die operativ-autonome Selbstproduktion ihrer Bestandteile (z. B. Zellkern). Eine Zelle verwirklicht sich als materielle Einheit, indem sie als Regelwerk chemischer Reaktionen jene Teile und Prozesse erzeugt, die sich selbst erzeugen. Für dieses Phänomen der Selbstherstellung führen Maturana und Varela den Begriff Autopoiese (griechisch: Selbstmachen) ein. Das Prinzip der Selbstorganisation lebender Systeme, sprich der Fähigkeit eines Systems, sich mittels Rückkoppelung innerhalb gewisser Grenzen selbst in einem stabilen Zustand zu erhalten, bezeichneten sie als Homöostase (griechisch: Gleichstand) beziehungsweise Homöodynamik.
Aus sozialwissenschaftlichem Blick formuliert Niklas Luhmann die Konzeption sozialer Systeme, in der er Gesellschaft ansieht als ein System aller Kommunikationen, denen er die beiden Systeme Leben (Gesamtheit aller biologischen Prozesse) und Bewusstsein (Gesamtheit der intrapsychischen kognitiven Vorgänge) gegenüberstellt. Da diese drei Systeme in sich geschlossen und füreinander Umwelt sind, kommt der Kommunikation dieser Systeme untereinander die zentrale Bedeutung zu. Inwieweit sie sich untereinander verständigen können, hängt davon ab, wie anschlussfähig die Informationen, sogenannte Codierungen, für das jeweilige System sind und welche Aspekte der Kommunikation in die Bewusstseinsprozesse der Beteiligten aufgenommen werden.
Aus der Kybernetik vertreten Heinz von Foerster und Ernst von Glasersfeld den Aspekt der reflexiven Selbstreferenz. Indem sich Systeme ausschließlich auf sich selbst beziehen, gewährleisten sie ihre Autonomie gegenüber ihrer Umwelt, von der sie sich zur Sicherung ihrer eigenen Identität abgrenzen. Im Kontakt miteinander befinden sich beobachtende und beobachtete Systeme in einer permanenten gegenseitigen Kontextsteuerung. Dieses Schleifenkonzept griffen Max Wertheimer in der Gestaltpsychologie und Jean Piaget in der Lernpsychologie auf, ebenso der Erkenntnistheoretiker Gregory Bateson und Paul Watzlawick bei seinen Kommunikationsaxiomen.
In den 1950er Jahren begann in größerem Umfang die Entwicklung systemischer Konzepte und Interventionen in der Psychotherapie, bei der nicht mehr der einzelne Patient im Mittelpunkt psychotherapeutischer Bemühungen steht, sondern dessen Bezugssystem. Wer Schwierigkeiten zeigt und Probleme äußert, wird jetzt nicht mehr als behandlungsbedürftige Person definiert, sondern als ein Symptomträger angesehen, der es auf sich nimmt, Störungen seines Familiensystems darzustellen. Damit gilt er als derjenige, der einen Veränderungsbedarf öffentlich anzeigt und auf diese Weise die Mitglieder seines Systems herausfordert, sich anders als bisher zu verhalten, sprich Einstellungen und Verhalten zu verändern. So ist er es auch, der so für das gesamte System Entwicklungschancen eröffnet. Für das Beratungsverständnis bedeutet dies, dass Beraterin und Klienten miteinander vorzugsweise die zwischenmenschlichen Kommunikationsmuster betrachten und deren Wirkung auf die Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Familienmitglieder ermitteln. Mit Hilfe entsprechender Interventionen lädt die Beraterin das System ein, rigide Schleifen (Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin u. Prata, 2003) eingefahrener Problemmuster aufzuweichen und entwicklungsförderliche Handlungsoptionen für alle Beteiligten zu eröffnen.
Die frühen Ansätze systemischen Arbeitens entstammten unterschiedlichen Konzepten. Die psychoanalytisch orientierte Familientherapie übertrug Konfliktkonzepte der Psychoanalyse auf die Dynamik der Familienmitglieder. Besonders bekannt sind hier das Kollusionskonzept von Jürg Willi, das von Ivan Boszormenyi- Nagy als Metapher eingeführte Kontobuch generationenübergreifender Schuldverschreibungen und die dynamische Familientherapie nach Helm Stierlin, die die wechselseitige Individuation der Familienmitglieder in den Fokus stellt.
Die erfahrungsorientierten Ansätze stellten die Beziehungen der Familienmitglieder untereinander dar. Peggy Papp entwickelte dazu das psychodramatische Element der Familienskulptur, Virginia Satir betonte den Selbstwert und innere Freiheit als zentrale Faktoren für Wachstum und Beziehungsgestaltung (H Die fünf Freiheiten). Ihre vier Kommunikationsformen (1979) verbinden personenorientierte Aspekte mit interaktionellem Geschehen.
Auf Salvador Minuchin gehen die Ansätze zurück, die sich auf strukturelle Kriterien funktionierender Familien konzentrieren und hier besonders die Grenzen innerhalb des Systems nach außen oder Rollen und Funktionen der einzelnen Mitglieder bearbeiten.
Familie als kommunikatives System betont besonders die strategische Familientherapie der 1980er Jahre, die das Spiel eines Systems erfasst, dessen Regeln belastende Symptome aufrechterhält. Mit Hilfe entsprechender Aufgaben, die die Therapeutin den Systemmitgliedern als eine Art Hausaufgabe vorschlägt, sollen der Familie neue Erfahrungsräume als Möglichkeiten zur Veränderung eröffnen. Besonders ist in diesem Zusammenhang Mara Selvini Palazzoli zu nennen. Der Schwerpunkt therapeutischer Betrachtung lag zu dieser Zeit auf dem interaktionellen Geschehen eines Systems, die Symptome einzelner Familienmitglieder fanden dagegen nur geringe Beachtung.
Die Erweiterungen dieser genannten Konzepte berücksichtigt heute besonders die Kybernetik 2. Ordnung, die Therapeuten in die Geschichten, Sinndeutungen und Verhaltensweisen ihres Klientels eingebunden sieht. An Stelle distanzierter Interventionen führen nun alle Anwesenden eine Art Konversation, bei der die therapeutische Aufgabe schwerpunktmäßig darin liegt, einen Prozess der Veränderung zu eröffnen, bei dem einengende Geschichten zugunsten neuer Perspektiven, Ideen und Handlungsmuster zurücktreten. Steve de Shazer betont in seiner lösungsorientierten Kurzzeittherapie vorhandene Ressourcen eines Systems, ebenso Tom Anderson, der beim »reflecting team« (H Reflecting Team) mittels wertschätzender Konnotationen die Entwicklung konstruktiver Lösungsentwürfe unterstützt.
Narrative Ansätze, wie beispielsweise der von Eugene K. Epstein, verstehen den Dialog zwischen Therapeutin und Klienten als einen gemeinsamen Erzählvorgang. Im Miteinander schaffen beide Seiten zu den bisherigen nun solche alternative Geschichten, die den Handlungsspielraum des Klienten erweitern und zu wirksamen Problemlösungen beitragen.
Auch wenn Menschen fortlaufend interaktionell eingebunden sind, so erleben sie sich selbst doch als Zentrum ihres Lebens. Dieser Aspekt findet wieder zunehmend mehr Beachtung im zyklischen Entwicklungsprozess systemischer Schulen. Hier sei die personenzentrierte Systemtheorie genannt. Sie betrachtet die Lebenswelt der einzelnen Systemmitglieder in ihrem gegenseitigen Wechselspiel und die sich daraus ergebenden Musterbildungen von Wahrnehmungen, Erlebensprozessen, Handlungen und Sinnstrukturen.
Inzwischen haben sich diese Betrachtungen von den Familien auf andere Systeme wie Gruppen, Institutionen und Gesellschaften erweitert, und systemische Modelle haben dank Peter M. Senge und Chris Argyris (Senge, 2006; Argyris, 1996) längst auch in der Organisations- und Managementtheorie Einzug gehalten. Auch in der Supervision sind sie inzwischen fester Bestandteil (Rappe-Giesecke, 2003; Ebbecke-Nohlen, 2015).
2.1.2Systembetrachtung
Als Mittelpunkt diverser Umlaufbahnen unseres privaten Planetensystems sehen wir uns eingebunden in unser individuelles Beziehungssystem. Doch was genau ist unter einem System zu verstehen?
Impuls: System und Netzwerk
Wäre es nicht wunderbar, die eigene Welt noch einmal mit den Augen und der Entdeckerfreude eines Kindergartenkindes betrachten zu können?
Das Bewusstsein, dass alles möglich ist (magisches Denken), die Lust am schöpferischen Gestalten und die Empfindung, selbst der »Nabel der Welt« zu sein, lässt Kinder in diesem Alter sich als Mittelpunkt eines Sonnensystems erleben.
Übernehmen Sie diese kraftvolle Haltung für einen Augenblick, erlauben Sie sich eine 10-Minuten-Pause und organisieren Sie sich Stifte und Papier (da Sie viel Raum benötigen, empfiehlt sich mindestens Größe A2 – übliche Zeichenblockgröße).
Nun beginnen Sie mit Ihrer Person und malen Sie eine gelbsaftige energiesprühende Sonne in die Mitte des Blattes, darum herum elliptische Bahnen für die sie umkreisenden Planeten.
In die der Sonne am nächsten liegende Umlaufbahn zeichnen Sie die Menschen, die Ihnen spontan als sehr wichtig gegenwärtig sind (wahrscheinlich sind einige Menschen momentan für Sie besonders bedeutungsvoll). In die zweite und dritte Umlaufbahn zeichnen Sie entsprechend die Menschen, mit denen Sie vielleicht auch den Alltag teilen, aber die nicht die gleiche überragende Bedeutung für Sie haben wie die Personen, die Sie in den innersten Kreis aufgenommen haben. Weitere Bahnen werden so lange entworfen, wie es notwendig ist, um alle diejenigen aufzunehmen, die Sie als zugehörig empfinden. Auch wichtige Tiere sind erlaubt! Manchmal entsteht der Wunsch, verstorbene Angehörige und Freunde zu positionieren, und mitunter tauchen Erinnerungen an Menschen auf, mit denen Sie länger keinen Kontakt hatten, die Ihrem Gefühl nach aber auch mit eingetragen werden sollten – entsprechen Sie Ihrem Bedürfnis und kennzeichnen Sie diese »Planeten« mit einem kleinen symbolischen Hinweis (Tipp: Lassen Sie sich auch für Veränderungen Zeit!).
Wenn Ihr Werk vollendet ist, betrachten Sie es in Ruhe.
Fragen:
–Wie ist es Ihnen ergangen mit dieser Aufgabe?
–Welche Zuordnungen fielen Ihnen leicht beziehungsweise schwer?
–Wie viele und welche speziell für Sie wichtigen Menschen bilden Ihr »Netzwerk«?
–Von wem wünschen Sie mehr Nähe? Von wem weniger?
–Sind räumliche Entfernung und empfundene Distanz im »Maßstab« übersetzbar?
–Spüren Sie bei dieser Betrachtung Veränderungsimpulse?
–Angenommen, Sie würden diesen nachgehen, was würde das für Sie bedeuten?
–Wer in Ihrer Umgebung würde Sie darin unterstützen?
–Von wem erwarten Sie Ablehnung? Wie könnten Sie sich darauf vorbereiten?
Ergänzung »Partnerübung«
Lassen Sie Ihre Eltern/Ihren Freund/Ihre Ehepartnerin/eine Kollegin Ihres Vertrauens etc. ebenfalls ein »Sonnensystem« für Sie erstellen und vergleichen Sie die (übereinstimmende oder abweichende) Sicht der Dinge.
Systembegriff: Bereits bei der Begriffsbestimmung von System beginnt es systemisch zu werden, denn viele Wissenschaftsgebiete erklären ihre verschiedensten Phänomene physikalischer, biologischer, ökologischer, politischer oder sozialer Natur mit diesem Ansatz. Gegenseitig beeinflussen sie sich in ihrem Bemühen, komplexe Organisationsprozesse und Entwicklungen zu beschreiben. Dabei gehen sie, wie bereits beschrieben, von der Grundannahme aus, dass alles Betrachtete sich ausschließlich aus einer persönlichen Perspektive der Beobachtenden darstellt und Erkenntnisse immer in wechselseitigem Einwirken von Vorwissen, Kontext und Erwartungen entstehen.
So können wir immer nur die Welt erklären in Abhängigkeit unserer Verortung in derselben, denn als Betrachtende sind wir bereits ein Teil dessen, was wir so gern objektiv beschreiben würden und doch nie können. Leider? Das mag Wahrheitssuchende enttäuschen, doch enttarnen die Vertreter des konstruktivistischen Denkmodells jeden Allgemeingültigkeitsanspruch als Hybris und bringen uns entspannt in die Position, das Leben als eine Vielfalt möglicher Wirklichkeiten zu betrachten.
Wahrheit ist also immer mein persönliches Verständnis dessen, was ich im Austausch mit meiner Umgebung aktuell für wahr nehme, für wahr halte und mit dem ich mich von meinen Mitmenschen weniger oder mehr unterscheide. Es ist meine Interpretation beobachteter Phänomene (AB Wahrnehmungszirkel).
So definiert jede Fachdisziplin »System« entsprechend ihres kontextuellen Selbstverständnisses und abhängig von ihren jeweiligen Wissensgrundsätzen, Frage- und Aufgabenstellungen. An dieser Stelle sei unser Verständnis dargestellt.
In die systemische Begriffsbestimmung dieses Buches fließen unser Fachwissen, vielfältigste persönliche Erfahrungen sowie berufliche Einblicke ein. Besonders berücksichtigen wir Beobachtungen, die wir den von uns begleiteten trauernden Menschen verdanken.
So verstehen wir unter System ein biopsychosoziales Netzwerk miteinander verbundener Menschen, die wechselseitig aufeinander bezogen leben. Ständig beeinflussen sie sich gegenseitig in ihren Einstellungen, Haltungen und Handlungen. In diesem lebendigen Miteinander bilden sie ein einzigartiges Gesamtes. Analog einem Mobile reagieren alle Elemente fein im Windspiel ihrer Umwelt. Im jeweils eigenen Rhythmus verhalten sie sich gemäß ihrer Regeln und entsprechend ihrer aktuellen Belastbarkeit. Sie nutzen ihre spezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten, um für ihren Lebenszusammenhang angemessen pragmatisch die Herausforderungen ihres Alltags zu beantworten und ihre Existenz zu sichern.
Dynamisch besitzen sie die permanente Tendenz zur zielorientierten Entwicklung. Beständig wählen sie aus einer Reihe von möglichen Lösungen die für sie bedeutsam und wirkungsvoll erscheinenden. Systeme sind nichts Statisches, sondern sie geschehen! In unendlich komplexen Rückkoppelungsschleifen sind sie auf ihre ureigene Weise bemüht, ihr Gleichgewicht entweder zu halten oder in Zeiten tiefer Erschütterung sobald als möglich wieder herzustellen. Im Bemühen um Effektivität nach innen wie nach außen investieren die Systemmitglieder mitunter ungeheure Energien, verwickelte Mobilefäden zu entwirren, Verstrickungen zu lösen, Kontakte in Balance zu bringen und Bündnisse zu sichern. Verhaltensweisen, die Außenstehenden mitunter bizarr erscheinen, ergeben für das betrachtete System vor dem Hintergrund seiner ureigenen Geschichte einen tiefen Sinn und sollten von den Betrachtenden erst einmal als bestmögliche Anpassungsleistung dieses Systems an eine außerordentliche Situation gewürdigt werden (H Systemkompetenz).
Hier erfordert Begleitung, immer wieder respektvoll nachzufragen, was das Erlebte für die einzelnen Mitglieder des Systems bedeutet. Was heißt es für jede und jeden individuell, in der aktuellen Situation zu bestehen? An welchen Erfahrungen leiden sie? Was stärkt? Was gibt ihnen Kraft und welche Hoffnungen begleiten sie? Wie wirken sich diese unterschiedlichen persönlichen Erfahrungen auf das System aus? Was erscheint für wen förderlich? Was wird von wem als hinderlich erlebt?
In Zeiten existentieller Veränderungen, wie sie Trauersituationen darstellen, erfolgt eine massive Irritation des bisher austarierten Gleichgewichts im Beziehungsgefüge. Das gesamte Leben aller Systemmitglieder wendet sich. Im wechselseitigen Zusammenspiel sind alle herausgefordert, sowohl individuell wie auch gemeinsam, den Verlust als eine neue Realität in ihrem Leben zu begreifen. Das ist schmerzhaft, und die damit verbundenen Empfindungen wollen in ihrer persönlichen Bedeutungsgebung gewürdigt werden. Erfahrungen sowie unterschiedlichste Erinnerungen gilt es wahrzunehmen und sie auf allen Ebenen des Menschseins auszuhalten. Um sich allmählich in eine grundlegend veränderte Lebenssituation hineinzufinden, ist es für alle eine Aufgabe, sich fürs Weiterleben zu entscheiden. Was im äußeren Miteinander nicht mehr lebbar ist, gilt es einem komplexen Verwandlungsprozess zuzuführen. Dem schmerzhaft Vermissten in persönlicher Verbundenheit eine sichere seelische Repräsentanz, einen angemessenen inneren Platz zu geben, erfordert viel Entwicklungszeit. Verständlicherweise dauert es meist entschieden länger als ein traditionelles Trauerjahr, bis es dem System möglich ist, eine neue Homöostase auszubalancieren (Rechenberg-Winter, 2017).
Diese Ausgleichsanstrengungen ähneln Pendelbewegungen, denn ein Trauerprozess verläuft wie alle Entwicklungen niemals linear. Als zyklischer Wachstumsprozess ist sein Verlauf bei den Einzelnen ebenso wenig vorhersehbar wie im Gesamtverbund. Vorerst ist offen, welche komplexen Veränderungen daraus resultieren. Mit welchen Entwicklungssprüngen der Verlust beantwortet werden kann oder ob der Verlust langfristig zu einem Systemzusammenbruch führt, hängt nicht zuletzt davon ab, welche sinnstiftende Erklärungen als tragend erlebt und welche Selbstheilungskräfte aktualisiert werden können. Im Wechselspiel zwischen Chaos und Struktur ist das System beständig bemüht, manchmal bewusst erfahrbar, aber ebenso oft unbemerkt, erlebte Widersprüche pendelnd auszugleichen und sich erneut stabil zu organisieren.
Beziehung und Kontext: Keiner lebt für sich allein! Als Beziehungswesen leben Menschen auf Menschen bezogen, selbst die konsequentesten Einzelgänger reagieren auf ihre Umgebung und diese auch auf sie.
Menschen leben eingebunden in diverse Systeme wie Familie, Nachbarschaft, Arbeitsumfeld, politische Partei oder Gemeinde. Entsprechend der jeweiligen Rollen und Funktionen, die sie dort innehaben, nehmen sie ihre Mitmenschen wie sich selbst unterschiedlich wahr. In ihren Begegnungen kommunizieren sie offen und verdeckt, tauschen Erfahrungen und Sichtweisen aus und sind sich gegenseitig Spiegel. Permanent orientieren sie sich an ihren Beziehungssystemen, reflektieren deren Zusammenhalt und setzten sich mit ihren persönlichen Verpflichtungen auseinander. So beeinflussen sich nicht nur die Mitglieder eines Systems gegenseitig. Einzelne Systeme wirken gleichermaßen im größeren Zusammenhang aufeinander und sind ihrerseits wiederum in geografische, kulturelle, politische und biografische Kontexte eingebunden (von Schlippe u. Schweitzer, 2016).
Systeme 1. und 2. Ordnung: Neben dieser persönlichen Zuordnung zu Bezugssystemen unterscheiden wir in der systemischen Begleitung Systeme nach ihrer Zusammensetzung und den Funktionen ihrer Mitglieder. Unter Systemen 1. Ordnung verstehen wir die unmittelbaren Bezugssysteme, in die ein Mensch eingebunden ist, während in Systemen 2. Ordnung, wie zum Beispiel in der Beratungssituation, ein bis dahin Außenstehender hinzutritt. Es ist für alle Beteiligten klar, dass er nicht Mitglied dieses Systems 1. Ordnung werden wird. Doch ist er auch kein unbeteiligter Beobachter, denn er beeinflusst bereits mit seiner Anwesenheit das System 1. Ordnung. Bespricht nun dieser Berater Aspekte seiner Begleitarbeit mit seiner Supervisorin, bilden beide thematisch ein System 3. Ordnung. Es versteht sich von selbst, dass alle drei Systemebenen wechselseitig aufeinander einwirken.
Ein Beispiel mag dieses komplexe Zusammenspiel verdeutlichen: Menschen wirken wechselseitig aufeinander, orientieren sich also an ihrer Umgebung, verhalten sich gemäß ihres sozialen Kontextes, beantworten sensibel die von ihnen wahrgenommene Realität und fordern damit gleichzeitig ihre Umgebung heraus. In diesem Interaktionszirkel ist jede Interpunktion von Ereignisfolgen willkürlich (H Kommunikationsaxiome); die Frage »Wer hat angefangen?« lässt sich nie beantworten. Ist Anna mit ihrem Weinen schuld, dass Frank sich zurückzieht, oder weint Anna, weil Frank sich verweigert? Anders betrachtet, das heißt nicht aus der Opferperspektive, könnten wir fragen, zieht Frank sich zurück, damit Anna weint, weint Anna, damit sich Frank verweigert? Fragen nach der Verursachung sind wenig ergiebig und führen regelmäßig aufs Glatteis. Niemand ist schuld, beide sind an einem Zirkel beteiligt und tragen entsprechend Verantwortung für ihr Verhalten. Frank zieht sich zurück, obwohl Anna weint und Anna weint trotz Franks Verhalten.
Möchten Anna und Frank sich nun mit einem Berater besprechen und nehmen Kontakt mit Max auf, dann erweitern sie ihr Beziehungssystem (1. Ordnung) im Moment der Kontaktaufnahme. Ein Dritter kommt ins Spiel und Anna wie Frank werden sich in Gegenwart von Berater Max, im sogenannten System 2. Ordnung, (ein wenig) anders erleben und verhalten. Max kann sich jetzt folglich nur ein Bild vom Zusammenspiel beider machen, das sich ihm in seiner Anwesenheit bietet. In seiner Rolle beeinflusst er die Beziehungsdynamik des Paares, allein seine Präsenz ist eine Intervention. Er wird sich berichten lassen, wie Anna und Frank ihr Zusammenleben außerhalb dieses Kontextes erleben, welche Entwicklungswünsche sie aneinander haben. Anna wird in diesem Dreierkontakt neue Erfahrungen sammeln, Frank wird sich und Anna auf eine andere Art erleben, Max gewinnt neue Einblicke. Damit haben die drei im System 2. Ordnung ein Lernfeld eröffnet, dass es ihnen ermöglicht, ihre Betrachtungsweisen, Interpretationen und Verhaltensoptionen zu erweitern und in ihr System 1. Ordnung zu übersetzen (H System 1., 2. und 3. Ordnung).
Systemische Trauerbegleitung im System 2. Ordnung verlangt, dass die Reaktionen im System 1. Ordnung auf die Begleitarbeit immer wieder aufmerksam miteinander beobachtet werden. Im Metadialog werden sie mit den Ratsuchenden besprochen und die so gewonnenen Einsichten in den weiteren Begleitprozess einbezogen. Gleichermaßen verlangt der systemische Blick aufs Beratungsgeschehen, dass sich die beratende Person über alle Stationen der Begleitung hinweg mit der eigenen Einwirkung auf das von ihr unterstützte System beschäftigt. Es liegt in der Verantwortung der Beraterin, inwieweit sie ihre Reflexionen dem ratsuchenden System mitteilt oder mit welchen weiteren Interventionen sie sich fürs System nutzbringend einsetzt. Es versteht sich von selbst, dass dem Beratungsprozess eine wertschätzende Haltung den verschiedenen Systemleistungen gegenüber entgegengebracht wird. Darüber hinaus ist die Bereitschaft zu paritätischer Begegnung conditio sine qua non.
Impuls: Netzwerkkarte
Erstellen Sie eine grafische Darstellung Ihres aktuellen persönlichen oder beruflichen Kontextes. Es handelt sich dabei um eine Momentaufnahme, denn zu einem anderen Zeitpunkt würde Ihre Netzwerkkarte ein wenig anders aussehen.
Zeichnen Sie sich in die Mitte und davon ausgehend mit Pfeilen Ihre sozialen Kontakte, Hilfssysteme und Unterstützungspersonen. Charakterisieren Sie nun die einzelnen Beziehungen je nach der persönlichen Bedeutung, die Sie im jetzigen Moment für Sie besitzen – beispielsweise als dicke, gestrichelte, unterbrochene Linien, kurze oder längere Pfeile oder mit Symbolen versehen, je nach erlebter Qualität.
Fragen:
–Wenn Sie die fertige Netzwerkkarte betrachten: Was empfinden Sie, nehmen Sie Impulse wahr und wenn ja, welche?
–Was denken Sie: Wie würden die von Ihnen ausgewählten Netzwerkpartner, Freunde, Kollegen, Kolleginnen, Unterstützer, Unterstützerinnen die dargestellten Beziehungen zeichnen? Würden diese Menschen beziehungsweise Systeme Sie als Netzwerkpartner wählen?
Netzwerke: Als Beziehungswesen sind wir Menschen auf soziale Einbindungen angewiesen, die in den einzeln Segmenten unserer Netzwerkkarte entsprechend ihrer Beziehungsqualität höchst unterschiedlich erlebt werden. Der Begriff »Network« stammt aus den USA Mitte der 1970er Jahre. Ähnlich der deutschen Gemeinwesenarbeit handelt es sich dabei um eine soziale Arbeitsform. Die Networker verstehen sich nicht als diejenigen, die an der Lösung arbeiten, denn darin sehen sie die originäre Aufgabe des Netzwerkes. Sie steuern lediglich einen Lösungsprozess, in dem sie gewichten, moderieren und darauf achten, dass die Netzwerkmitglieder sich nicht überfordern, sondern kleine, machbare Veränderungsziele anstreben.
Bis heute ist der Netzwerkbegriff zentrales Element in der systemischen Arbeit. Dabei umfasst ein Netzwerk sämtliche Bezugssysteme, in denen ein Mensch lebt. Seine Familie, Freundschaften, Verbände, in denen er sich ehrenamtlich engagiert, und die Nachbarschaft zählen dazu, seine Vorgesetzten, Kolleginnen ebenso wie Mitanbieter und Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt – kurz: Er und all die Personen, die ihn herausfordern, unterstützen, enttäuschen und lieben, werden in ihrer Verbundenheit betrachtet.
Funktionale, erfolgreiche und tragfähige Netzwerke benötigen unterschiedliche Menschen, die sich nicht nur in ihrem Alter, Geschlecht und ihren Ressourcen unterscheiden, sondern sich auch so weit als möglich ergänzen und eine große Bandbreite unterschiedlicher Verhaltensweisen erlauben.
Da systemisch ausgerichtete Begleitung das Beziehungsgeschehen in den Mittelpunkt stellt, interessiert sich die Begleiterin von Anfang an für die emotionalen und sozialen Vernetzungen der einzelnen Systemmitglieder. Das soziale Netz lässt sich anhand der VIP-Karte (H Netzwerkkarte) miteinander besprechen: »Bei welchen Menschen können Sie sich Unterstützung, Zuspruch, Anregungen, Trost holen?«
Nachdem in die persönliche Netzwerkkarte aktuell bedeutsame Menschen in der jeweilig angemessenen Nähe beziehungsweise Distanz zum Mittelpunkt eingezeichnet oder mittels stellvertretender Figuren aufgestellt sind, kann folgende Besprechung stattfinden:
–Welche Beziehungen erleben Sie aktuell besonders unterstützend?
–Auf welche Art und Weise?
–In welchen Situationen nehmen Sie dies mehr, in welchen weniger wahr?
–Wie viel Kontakt wird Ihnen vom wem in Ihrer aktuellen Lebenssituation zugestanden?
–Wie ausbalanciert im Hinblick auf Geben und Nehmen erleben Sie die einzelnen Beziehungen?
–Welche Beziehungen haben sich in früheren Krisen bewährt? Trifft diese Qualität auch gegenwärtig zu?
–Wie viel Zeit und Energie benötigen Sie, um die Ihnen wichtigen Menschen anzusprechen?
–Ist dieses aktuelle Netzwerk für Sie auseichend?
–Sollten einzelne Beziehungen verstärkt und/oder neue aufgebaut werden?
–Von wem sollten Sie sich gegenwärtig fern halten?
–Wer und was könnte Sie dabei unterstützen?
Gemeinsam mit den Ratsuchenden erforscht sie die persönlichen Bedeutungen relevanter Beziehungen für die aktuelle Lebenssituation und bespricht mögliche Veränderungswünsche. Welche sozialen Ressourcen werden hilfreich erlebt? Wo finden unterstützende Begegnungen statt? Was sollte beibehalten und was verändert werden?
Uns begegnen in der Praxis gelegentlich trauernde Familien, die diese unterschiedlichen Reaktionsweisen ihrer einzelnen Mitglieder konflikthaft erleben. »Durch mich fließen die Tränen der ganzen Familie«, klagt da die Mutter ihren Partner an, der »so gar keine Gefühle zeigen kann«. Beide Eltern wiederum können nicht verstehen, dass ihr Sohn »die Nächte in der Disco durchtanzt«.
Unverständnis, Enttäuschung und Zorn, die dem Verlust gelten, sind plötzlich aufeinander gerichtet, Streit tritt wie von selbst auf, kaum, dass sie sich begegnen. Wenn es ihnen jetzt möglich ist, über ihr unterschiedliches Erleben zu sprechen, und ihre persönlichen Empfindungen auszutauschen, dann erleben sie oftmals ihre unterschiedlichen Verhaltensweisen nicht mehr als gegeneinander gerichtet, sondern als sinnvoll für sich selbst und beitragend zum Erhalt ihrer Familie. Im Nachvollziehen und Würdigen erfahren sie sich als zwar belastete, aber auch belastbare Crew, die gemeinsam in stürmischer See unterwegs ist und in der jeder das ihm zur Zeit Mögliche tut, um den Kurs ins Ungewisse zu halten/auszuhalten. Schon das Benennen, immerhin bis hierher gekommen zu sein, bis zu diesem Augenblick überlebt zu haben und Zwischenstation (in einem Hafen) machen zu können, stellt Energien für künftige Herausforderungen bereit.
2.1.3Systemaspekte
Der folgende Impuls verdeutlicht: Auf die Blickrichtung meiner Betrachtung kommt es an, was ich sehe. Damit treffen wir auf eine der zentralen Grundannahmen systemischen Verständnisses, den Konstruktivismus.
Impuls: Circle in the Air (Booth, aus Kriz, 2000, S. 211 f.)
Um die Annahme zu illustrieren, dass jede Realitätssicht abhängig vom jeweiligen Blickwinkel ist, und damit prinzipiell legitim, sei folgendes Experiment empfohlen:
–Strecken Sie einen Arm senkrecht nach oben.
–Mit ausgestrecktem Zeigefinger schreiben sie nun im Uhrzeigersinn einen großen Kreis in die Luft und wiederholen diese Runde mehrmals.
–Senken Sie nun langsam den Arm, ohne die kreisende Bewegung zu unterbrechen, den Zeigefinger halten Sie dabei weiterhin nach oben.
–Wenn Sie Ihre Kreisbildung nun von oben betrachten, werden Sie entdecken, dass Ihr Zeigefinger sich gegen den Uhrzeiger dreht.
Fazit: Derselbe Vorgang wird je nach Perspektive unterschiedlich, ja bisweilen auch gegensätzlich, erlebt und interpretiert!
Konstruktivismus: Der Konstruktivismus versteht Wirklichkeit als ein persönliches Gebilde, als eine Konstruktion, die in der kaleidoskopartigen Betrachtung des einzelnen Menschen entsteht. Statt der Kategorien richtiger und falscher Wahrnehmung gilt jede Realitätssicht als ernstzunehmend, da sie Aspekte aus einem persönlichen Blickwinkel benennt: »Du hast recht aus deiner Sicht, ich hab’ recht aus meiner!« (AB Mentale Modelle).
Die objektive Wahrheit, so es sie geben sollte, wäre viel zu umfassend, als dass sie von uns Menschen in ihrer Komplexität erfasst werden könnte. Bestenfalls gelingt uns ein ausschnittartiges Bild, und auch dies ist nicht dauerhaft gültig, sondern nur vorübergehende Erklärung. Neuere, ergänzende Erkenntnisse können es jederzeit erforderlich machen, diese Sichtweise schon bald wieder zu revidieren. »Die fraglos angenommene Voraussetzung der Berechenbarkeit alles Wirklichen wird [ …] mit allem Nachdruck in Frage gestellt und als vorwissenschaftlicher, wissenschaftlich nicht beweisbarer Glaubenssatz entlarvt« (Condrau, 1991, S. 43).
Damit treffen wir bei jeder Realitätssicht auf eine individuelle, kontextabhängige Wahrnehmung. »Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind«, heißt es im Talmud. Auch der Konstruktivismus selbst ist eine solche Wirklichkeitskonstruktion und ein Versuch, Komplexität, analog einer Landkarte, auf eine verstehbare Formel zu reduzieren.
Menschen strukturieren ihre Lebenswelt, erstellen und korrigieren ihre innere Landkarte, passen diese beständig ihren individuellen Erfahrungen an. Aktiv gestalten sie ihre eigene Orientierung. Durch die Brille dieser persönlichen Kartografie betrachten sie ihre Umwelt, interpretieren das Verhalten ihrer Mitmenschen und filtern entsprechend aus all den vielen Eindrücken heraus, was mit ihren mitgebrachten Erwartungen und Befürchtungen übereinstimmt. »Immer passiert mir das!«, sagen sie dann und bringen auf den Punkt, was unter dem Begriff der selbsterfüllenden Prophezeiungen bekannt ist. Indem ich etwas erwarte, begünstige ich damit, dass es eintritt. Nicht das Ereignis als solches bestimmt, welche Bedeutung es für mich erhält, sondern ich selbst setze den Rahmen, innerhalb dessen ich Ereignisse wahrnehme, interpretiere und entsprechend meiner individuellen Logik handele. »Eine aus einer selbsterfüllenden Prophezeiung resultierende Handlung […] schafft erst die Voraussetzung für das Eintreten des erwarteten Ereignisses und erzeugt in diesem Sinne recht eigentlich eine Wirklichkeit, die es ohne sie nicht gegeben hätte« (Watzlawik, 1984, S. 92).
Meine Vorannahmen, Vorurteile sind das Ergebnis meiner bisherigen Lebenserfahrungen und wie ich sie bewerte. In sie fließt die Realitätssicht meiner Familie, meiner Umgebung und meiner Kultur ein. Sie haben es mir bisher ermöglicht, dass ich mich in der Welt gut zurechtfinde. Das macht sie einerseits zu wertvollen Orientierungshilfen, gleichzeitig begrenzen sie meine Betrachtungsmöglichkeiten, Ideen und Impulse.
Will ich mehr lernen, dann bin ich auf die Auseinandersetzung mit anderen Menschen angewiesen. Verstehen und Bedeutungsgebung vollziehen sich immer in der Interaktion handelnder Menschen, die als autopoietische, also sich selbst organisierende Bewusstseinssysteme (Maturana) jeweils individuell unterschiedlich ihre Erkenntnisse in ihrer inneren Landkarte verzeichnen. Übereinstimmung entsteht, wenn eine Erkenntnis als passend, gangbar oder brauchbar eingeschätzt wird (Viabilität).
Für die Begleitung trauernder Menschen bedeutet dieses konstruktivistische Verständnis, dass es nie um richtig und wahr gehen kann, einzig um Möglichkeiten. Bedeutsam ist für den Einzelnen der Rahmen, in dem er seine Geschichte erzählt, und die persönlichen wie sozialen Konsequenzen, die sich für ihn daraus ergeben.
Zeigt er Widerstand, also ein Verhalten, das einzig den Erwartungen der Begleiterin widerspricht, ist dies sein interaktiver Spielzug, mit dem er auf die Unterschiedlichkeit der Bewertungen hinweist. Wer verfügt nun über die Definitionsmacht, Verhalten (einseitig) zu etikettieren?
Erfolgreiche Zusammenarbeit, also eine strukturelle Koppelung, entsteht immer dann, wenn es gelingt, einen wechselseitigen Bezug betroffener Bewusstseins- und Verhaltenssysteme herzustellen. Dann verstärkt sich die Orientierung der Anwesenden aufeinander, Wahrnehmungspräferenzen können ausgetauscht und sequentiell verknüpft werden. Es entstehen abgestimmte Räume parallelen Denkens und Verhaltens. In ihnen ist es möglich, bisherige Sichtweisen, Werthaltungen und Kommunikationsmuster in Frage zu stellen, zu dekonstruieren, und gemäß hinzugewonnener Erkenntnisse zu erweitern, zu rekonstruieren.
Konstruktionen verändern sich während der Auseinandersetzung mit dem reflektierten Gegenstand. Helfendes Tun ist ein Interaktionsprozess zwischen gleichberechtigten und gleichwürdigen Wirklichkeitskonstruktionen aller Beteiligten, ein wechselseitiger Prozess der Kundigkeit (Hargens, 2004, S. 147 ff.) (AB Wahrnehmungszirkel). Möglichkeiten werden konstruiert, statt Wirklichkeitsvorstellungen festzuschreiben! Interventionen der Begleiter sind dabei Einladungen an die Begleiteten, ihr Realitätsverständnis vor ihrem persönlichen Hintergrund und entsprechend der Grundlage ihrer Kulturmuster (Mythen, Rituale, alltägliche Gewohnheiten) zu überprüfen und im Rahmen ihrer aktuellen Möglichkeiten eventuell eigenverantwortlich zu verändern. In diesem Prozess sammelt der Begleiter seinerseits wertvolle Erfahrung für sich selbst und seine Konstruktionen. Auf diese Weise eröffnet Begleitung ein dynamisches Entwicklungsfeld gegenseitigen Voneinander-Lernens und Miteinander-Wachsens.
Zirkularität: Zu einer der großen Herausforderungen systemischen Denkens zählte der Abschied vom linearen Denken, nach dem auf den Auslöser A Reaktion B erfolgt und ein bestimmter Input zum vorhersehbaren Ergebnis führt. Doch menschliche Begegnungen sind nichtlineare dynamische Systemprozesse. Es lässt sich nicht voraussehen, welche kognitiven und emotionalen Erfahrungen eine Begebenheit für die einzelnen Beteiligten auslösen. Auch für Menschen, die in engem Kontakt stehen, ist jedes Mal ein erstes, weil neues Mal.
Die Rückkopplungsschleifen unserer Handlungen sind nicht prognostizierbar, ihre Einordnung in die jeweils individuellen Wert- und Sinnerfahrungen findet immer nur in dieser aktuellen Situation statt. Somit ist die Gegenwart einmalig und voll neuer Möglichkeiten für unerwartete Wendungen. Ins Bild des Mobiles übersetzt: Ein Systemteil bewegt sich und keines der anderen bleibt davon unberührt. Zu jeder Zeit sind diese zirkulären Prozesse wirksam, im ständigen Reagieren wirken alle Teile aufeinander ein. Dieser Prozess wird so lange fortgeführt, bis das Mobile eine stabile, wiederum nur vorübergehende (Ruhe-)Position für das Gesamte austariert hat.
Systemische Trauerbegleitung thematisiert diese individuellen Bedeutungszusammenhänge und sozialen Realitätskonstruktionen. Dabei helfen zirkuläre Fragen, die dynamischen Systemprozesse zu verstehen: »Wie, denken Sie, erlebt Ihre Frau diese Situation? Was könnte Ihre Tochter dazu meinen? Und was, denken Sie, denkt Ihr Sohn darüber, wie ich Ihnen als Familie helfen könnte?« Ungewöhnliche Fragen, die zu ungewöhnlichen Gedanken über individuell unterschiedliches Erleben und deren Wechselwirkungen im Beziehungsgeschehen einladen. Sie erforschen parallel die Entwicklungsprozesse in den Systemen 1. und 2. Ordnung und beobachten sie in ihrer gegenseitigen Beeinflussung (H Zirkuläres Fragen).
Autoorganisation und Steuerung: Systeme leben in ständigem Bestreben, ihr Gleichgewicht, das heißt die Homöostase ihres Denkens, Wahrnehmens und Handelns, so weit als möglich aufrechtzuerhalten und in einer lebensfähigen Balance zu bleiben. Sie organisieren dieses Zusammenleben mittels Regeln; selbst eine Vereinbarung, fortan ohne Regeln zu leben, wäre eine Regel. Analog zu Watzlawicks Kommunikationsregel (H Kommunikationsaxiome), nicht nicht kommunizieren zu können, kann man nicht nicht regeln.
Diese Regeln lassen sich unterscheiden in unverrückbare, an denen keinesfalls gezweifelt werden darf, da sie als existentiell grundlegend angesehen werden, und in offene, über die kommuniziert werden kann. Letztere sind allen im System bekannt, dürfen angesprochen werden, gelten als verhandel- und veränderbar. Virginia Satir sieht in diesen Erwartungsregeln psychische Überlebensregeln, an denen sich die Einzelnen ausrichten, um geschätzt, geliebt und fürs System bedeutsam zu sein.
Auf diese Weise steuert jedes System sich selbst im Kontext seiner Umgebung. Das Mobile schwingt im Windzug und versucht auf seine ihm ureigene Art, die Balance zu bewahren. Manche Spielregeln stimmen mit dem Mainstream überein, andere sind kulturell und gesellschaftlich abweichend und original auf spezifische Bedürfnisse abgestimmt. Zwischen Tradition und Neuerung findet ein beständiger Pendelprozess statt. Auf jede Veränderung reagieren Systeme in zwei gegenläufige Richtungen, das heißt Entwicklung als auch Bewahrung, und geben damit das ihnen mögliche Anpassungstempo vor (AB Bewahrer und Visionäre). So geht Wachstum immer mit bewahrenden, konservativen Kräften Hand in Hand.
Steuerungen von außen, wie beispielsweise Interventionen im Begleitkontext, sind als solche nicht möglich. Nach der radikalen Theorie der Autopoiese (Schiepek, 1999, S. 124) trifft jedes von außen kommende Umweltereignis auf die aktuelle Struktur eines Menschen und auf dessen intrapsychische Dynamiken. Und dort entscheidet es sich, ob und in welcher Weise diese Einflussnahme weiter wirkt und zu welchen strukturellen Veränderungen sie beiträgt. Alle Interventionen und Angebote führen durchs Nadelöhr des Sich-Einlassens (»self-relatedness«) der angesprochenen Menschen.
Systemische Trauerbegleitung hat sich dem Rhythmus der Autoorganisation eines begleiteten Systems anzupassen. Grundsätzlich erhebt sich die Frage, ob und wie viel Steuerung von außen möglich ist. Wir schlagen in diesem Zusammenhang den bescheideneren Begriff der Prozessarbeit anstelle von Prozesssteuerung vor und berücksichtigen damit, dass psychisch allenfalls eine punktuelle Steuerung möglich ist und Zielsetzungen von außen psychisch wenig Veränderungseinfluss auf das System nehmen können. Konstruktive, entwicklungsförderliche Begleitung findet im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten eines Systems statt und denkt die physische, psychische, soziale und spirituelle Autoorganisation mit. Mittels hilfreicher Interventionen kann sie Aspekte der Systemsteuerung von außen anstoßen, doch bleibt dieser Einfluss begrenzt und störanfällig. Mit den Klientinnen wird sie auf die Steuerungsbedingungen achten, die wahrgenommenen Erwartungen, Realitätsinterpretationen, Umgebungsbedingungen besprechen und das Systemerleben in Richtung Erweiterung bearbeiten.
Eine Grundregel systemischen Arbeitens lautet: Die Verantwortung für die Systemsteuerung liegt beim System, das eigenverantwortlich entscheidet, welche Erfahrungen es wie in ihren Alltag umsetzt. Die Prozesssteuerung der Begleitung dagegen ist Aufgabe des Begleitenden (AB (Selbst-)Steuerung).
Die Wahrheit des Denkens besteht darin, einen Gedanken nach seiner ganzen Tiefe, Höhe und Breite durchzuführen und vor keiner Konsequenz zurückzuscheuen. Die Wahrheit des Tuns ist anders. Sie besteht darin, die schmale Stelle der Möglichkeiten zu suchen und die eigenen Kraft in das rechte Maß zu bescheiden, wissend, dass der vollzogene Ansatz durch die innere Logik des Lebens selber weitergeführt wird.(Romano Guardini)
Rollen und Funktionen: Jedes Teil eines Systems, Netzwerks oder Mobiles, um im Bild zu bleiben, hat seinen speziellen Platz zugewiesen bekommen und übernommen. Das geht mitunter blitzschnell. Wer in einer Ehe zum ersten Mal die gemeinsame Steuererklärung bearbeitet hat, behält diesen Job oft lebenslang. Da ist er für die Geburtstagsgrüße zuständig und sie für die Fütterung des Goldfisches. Abgesprochen oder unbemerkt zugeteilt?
Menschen bekleiden in ihren diversen Bezugssystemen Rollen, über die sie sich identifizieren und in denen sie von ihrer Umgebung wahrgenommen werden. Die Rolle des Freundes, Ingenieurs und Partners wird im Lauf des gemeinsamen Lebens ergänzt mit der des Vaters, des Elternbeiratsvorsitzenden, des Onkels. Verliert er seinen Arbeitsplatz, erwartet ihn die Rolle des Arbeitssuchenden, später findet er sich vielleicht als Patient liegend im Krankenhaus wieder oder als Rentner in einer bisher unbekannten Lebenssituation. Alle seine Rollen sind mit bestimmten Funktionen verknüpft, mit Erwartungen, die er an sich stellt, die seine Mitmenschen von ihm fordern oder von denen er meint, dass seine Umgebung sie an ihn stellt. Bleiben wir doch noch ein wenig bei diesen Überlegungen und fragen uns, was diese Rollenentwicklung für seine Partnerin bedeuten könnte. Wie wirkt es sich möglicherweise auf ihr Selbstverständnis aus, plötzlich nicht mehr die Frau eines beruflich erfolgreichen und engagierten Mannes zu sein, sondern eines arbeitslosen? Welche Rollen und Funktionen kämen nun auf sie zu? Und welche Veränderungen sind für die Kinder denkbar? Welche Konsequenzen sind für das Familiensystem vorstellbar?
Biografische Wendepunkte stellen Rollen und Funktionen in Frage. Sie fordern Einzelne wie das Gesamtsystem dazu heraus, die Plätze im System der neuen Situation entsprechend anzupassen, Rollen neu zu klären und die damit verbundenen Funktionen neu zu bestimmen. Trauerbegleitung wird an diesen biografischen Wendepunkten angefragt, dann, wenn es bei den Ratsuchenden um Umverteilung und Hineinwachsen in veränderte, noch unklare Rollen geht. »Was kommt da auf mich zu?«, ist eine der Fragen, die die Menschen beschäftigt, und »Wie bin ich dem gewachsen?«
Systemisch vorzugehen bedeutet in diesem Zusammenhang, die veränderten Erfahrungen zu fokussieren. Was bedeutet die Neuverteilung ihrer Rollen und Funktionen für die Einzelnen und was außerfamiliär? Wie wirken sie sich in den anderen Bezugssystemen aus? Welche Entwicklungsaufgaben erkennen die einzelnen Systemmitglieder für sich (AB Rolle und Funktion)?
Nähe und Distanz: Systeme regeln bei ihrer Rollenverteilung sehr differenziert, wie viel Nähe unter den einzelnen Mitgliedern als angemessen gilt und wer zu wem wie viel Distanz zu halten hat. Generationengrenzen werden gezogen und Untergruppen mit mehr Nähe, wie beispielsweise Kindergruppe und Elternsubsystem, bilden sich heraus. Räume zur Verselbstständigung und Eigenentwicklung werden ebenso abgesteckt wie Zeiten unverzichtbarer Gemeinsamkeit. Systemische Arbeit fragt danach, wie ein System Nähe und Distanz regelt, wie viel Spielräume für die Einzelnen bestehen und inwieweit sie den unterschiedlichen Bedürfnislagen der Einzelnen entsprechen.
Auch zu ihrer äußeren Umgebung regeln Systeme Nähe und Distanz. Sogenannte geschlossene Systeme wählen mehr Abgrenzung zu ihrer Umgebung, leben nach festen Regeln und sind stärker auf sich bezogen als halboffene. Diese verfügen über durchlässigere Grenzen und nehmen mehr Anteil an der sie umgebenden Welt. Offene Systeme zeichnen sich durch große Kontaktfreudigkeit bei geringem inneren Reglement aus (H Systemtypen).
Nach innen wie nach außen ist jedes System(mitglied) bemüht, zwischen Kontakt und Abstand, zwischen Verbundenheit und Rückzug seine Autonomiebedürfnisse einerseits mit dem Beziehungswunsch andererseits in Einklang zu bringen. Für den Einzelnen bedeutet dieses Ausloten von Nähe und Distanz eine ständige Leistung als Individuum, das gleichzeitig Eigenwesen ist und als Beziehungswesen, als »zoon politicon«, angewiesen ist auf die Gemeinschaft und von Natur aus danach strebt (Aristoteles).
2.2Zum Verständnis von Trauer
2.2.1Begriffsklärung
Impuls: Trauer ist …
Bitte vervollständigen Sie spontan folgenden Satz mit einem Begriff oder einer bildhaften Umschreibung: Trauer ist für mich wie …
Alles klar, was unter Trauer zu verstehen ist? In unseren Fortbildungen erhalten wir auf diese Frage meist so viele Antworten wie Menschen, die sich an diesem Impuls beteiligen.
Sigmund Freud (1916/1917, S. 197) charakterisierte Trauer als »Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückte Abstraktion wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal usw.« In der angloamerikanischen Literatur begegnen wir differenzierten Begriffen, die nicht synonym zu verwenden sind: »Bereavement« bezeichnet die Situation eines Todes- oder Trauerfalls, »grief« bezieht sich auf dessen individuelles Erleben eines Menschen und auf seine Befindlichkeiten, während »mourning« den sichtbaren Ausdruck des Trauerverhaltens im sozialen Kontext bezeichnet. Analog verwenden einige deutschsprachige Autorinnen Kummerim Sinne von »grief« für die innerpsychischen, körperlichen, sozialen und verhaltensmäßigen Reaktionen auf alle Arten von Verlust, während sie unter Trauer (»mourning«) die bewussten wie unbewussten Prozesse und Handlungsverläufe verstehen. Trauer umfasst somit mehr als die überwiegend passiven Reaktionen des Kummers, indem sie die Bewegung hin zu Neuorientierung der Beziehungen zum Verlorenen, zu sich selbst und der Umwelt einschließt (Rando, 2003).
2.2.2Trauermodelle
Impuls: Fluss des Lebens
Angenommen, ich würde mir mein Leben wie einen großen weiten Fluss vorstellen, der von der Quelle bis zur Mündung durch unterschiedlichste Regionen fließt. Unwegsames Gelände und felsige Engpässe, Stromschnellen und weite Landschaften könnte er durchziehen. Und immer wieder würden Klippen das Wasser zum Strudeln bringen; vielleicht stauen Menschen ihn auf, um sein Weiterfließen zu steuern? Wasserfälle könnten ihn erwarten.
Wie sähe mein Lebensfluss aus?
–Welche Jahreszeiten, Wetterlagen hätte er in welchen Gegenden durchströmt?
–