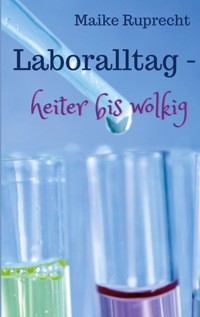
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ein Laborwecker empfängt Signale einer fremden Galaxie, Tomatenpflanzen greifen an, Praktikanten und Türen verschwinden, Osterhasen stehen unter der Notdusche. Wer unter dem Laboralltag einer technischen Assistentin nur nüchterne Arbeit erwartet, kennt Maike Ruprecht noch nicht. In ihrem Universitäts-Umfeld gibt es jede Menge heitere Begebenheiten, die ihre Arbeitszeit alles andere als langweilig werden lassen. Diese heiteren Kolumnen erschienen seit 2012 unter dem Titel "Erlebnisse einer anderen TA" zunächst in der Online-Präsenz des Laborjournals, später auch in der Printversion. Lassen Sie sich überraschen - und keine Angst vor den Enten!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Pflanzliches
Technisches
Kulinarisches
Zwischenmenschliches
Telefonisches
Wissenschaftliches
Tierisches
Werdegang und Wirrnisse
Vorwort
Alles begann in Berlin. Hier kam ich zur Welt, verbrachte meine Schulzeit, machte mein Abitur und wusste anschließend zweierlei:
Ich mag Naturwissenschaften, und ich mag nicht studieren. Also entschied ich mich für eine Ausbildung zur „Technischen Assistentin für chemische und biologische Laboratorien“. Nach zwei Jahren Ausbildung in Organischer Chemie, Biologie, Physikalischer Chemie, Fachrechnen und Biochemie wurden wir in die Welt hinaus entlassen. Etwa die Hälfte meiner Ausbildungsklasse nutzte ihre Ausbildung als Basis für ein naturwissenschaftliches Studium, die anderen, so auch ich, sah sich auf dem Arbeitsmarkt um. Da in Berlin zu diesem Zeitpunkt nur berufserfahrene TAs unter 35 gesucht wurden, fand ich meine erste Arbeitsstelle in Bayern an der TU-München. Oder vielmehr in einer ihrer Zweigstellen in dem hübschen Ort Freising, gelegen ca. 50km nördlich von München.
Die Stelle war auf ein Jahr befristet danach fand ich Anstellung an der LMU-München. Ulkigerweise nicht bei dem Professor, der die Stelle ausgeschrieben hatte, sondern bei dem jungen Postdoc, der bei meinem Bewerbungsgespräch neben ihm gesessen hatte.
Dr. Enrico Schleiff erwies sich als ein feiner Kerl, der mich von Anfang an mit mannigfaltigen Aufgaben betraute. Seine Rede: „Eine TA macht die Experimente, für die der Postdoc keine Zeit mehr hat“
So kam es, und da unser Methodenspektrum sehr breitgefächert war, arbeitete ich fortan mit verschiedenen Forschungsorganismen wie Erbse (Pisum sativum), Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana), Bierhefe (Saccharomyces cerevisiae) und Cyanobakterien. Erst später erkannte ich im Gespräch mit anderen TAs, dass es keineswegs in allen Laboren so abwechslungsreich zugeht.
Wie funktioniert nun so ein Labor für Grundlagenforschung an einer Universität? Vielleicht beginne ich mit einem Einblick ins Hierarchiegefüge:
An der Spitze der Arbeitsgruppe steht ein Professor. Er bereitet Vorlesungen vor, beantragt Fördergelder, fungiert als Ansprechpartner für die Mitglieder seiner Arbeitsgruppe, nimmt Prüfungen ab, schreibt Veröffentlichungen und leistet Gremienarbeit.
Nach dem Professor kommen die Postdocs. Diese haben ihren Doktorgrad bereits erlangt und bekleiden in der Arbeitsgruppe etwa die Funktion eines Vorarbeiters. Sie betreuen die Doktoranden, Master und Bachelor, fungieren als Ansprechpartner, koordinieren Praktika, halten Vorlesungen, schreiben Veröffentlichungen und beantragen Forschungsgelder für ihre Arbeitsgruppe, um z.B. einen Doktoranden oder TA finanzieren zu können. Und dann gibt es noch die technischen Assistenten. Wir sind das Schmieröl im Laborgetriebe. Uns obliegen unter anderem Dinge wie Organisation und Verwaltung. Wir koordinieren die Bestände an Chemikalien und Verbrauchsmaterial und verwalten alle möglichen Listen.
Darüber hinaus sind wir die große Konstante in einem Arbeitsumfeld mit intensivem Personalwechsel. Wir bewahren das Wissen über frühere Abläufe, Arbeitsvorgänge und Protokolle, betreuen jegliche Arten von Zellkulturen und machen Experimente, zu denen der Professor keine Zeit mehr hat. Manche von uns bilden wiederum ihrerseits TA aus. Es soll auch Labore geben, in denen die TAs nichts anderes tun als Puffer ansetzen und abwaschen, aber über derlei Monotonie im Arbeitsalltag will ich lieber nicht nachdenken.
2007 erhielt mein Chef seinen Ruf an die Goethe Universität Frankfurt und köderte mich mit einem Angebot, das ich nicht ablehnen konnte: Eine unbefristete Stelle. So zogen wir mitsamt unserem Equipment von der Isar an den Main.
In Frankfurt besuchte ich schließlich an der Volkshochschule meinen ersten Schreibkurs und als meine Schreibkursteilnehmerin Christine einmal eine selbstverfasste Bürokolumne vorlas, dachte ich: Sowas könnte ich doch auch mal schreiben.
Und an dieser Stelle setzt meine Halbzeitkolumne an:
Wie alles begann
Hätte ich in meinem zweiten Ausbildungsjahr zur TA eine eins in Biochemie und organischer Chemie gehabt, hätte es in den letzten sechs Jahren hier wohl keinen Text von mir zu lesen gegeben. Es sei denn, das Schicksal hätte mich auf Umwegen zum Schreiben von Laborkolumnen geführt.
Ein Quäntchen Verdienst gebührt vielleicht auch der Komplexität der damals im Unterricht abgehandelten biochemischen und organischen Reaktionen wie Gringnard und Cannizzaro, die ich damals beim besten Willen nicht begriff. Mein Gehirn weigerte sich schlichtweg, das korrekte Umklappen irgendwelcher Einfach, Doppel- und Dreifachbindungen zwischen verschiedenen Molekülen zu erfassen. Klappte einfach nicht. Womit ich nicht allein war. Meine Klassenkameradin Rita tat sich ebenfalls schwer.
Bianca und Susanne versuchten mehrmals es uns beiden zu erklären, erkannten jedoch bald, dass es mit einer Viertelstunde Erklärzeit hier nicht getan war. Hier mussten andere Kaliber aufgefahren werden und so gründeten wir unser „Lernquartett“. Als solches fuhren wir für ein verlängertes Pfingstwochenende zum biochemischen Intensivtraining an die Müritz. Sozusagen ein biochemisches Bootcamp. „Dort machen wir vormittags Unterricht und nachmittags unternehmen wir was“, verkündete Bianca, die aufgrund ihrer guten Noten zur Hauptlehrerin auserkoren worden war.
Was soll ich sagen? Es funktionierte!
Ich werde nie vergessen, was unsere Lehrerin in Organischer- und Biochemie neben die gute Note in meiner Examensarbeit schrieb: „Geht doch !“
Dass die Komplexität der von ihnen entdeckten Reaktionen ca. 100 Jahre später einen Lernurlaub an der Müritz nach sich ziehen würde, haben die Chemiker Gringnard und Cannizzaro damals bestimmt auch nicht erwartet.
Da wir vier es neben der ganzen Lernerei auch sehr lustig miteinander gehabt haben, beschlossen wir, uns fortan jährlich an Pfingsten zu treffen. Was mit gelegentlichen Babypausen zu meiner großen Freude bis heute funktioniert.
Und während ich die ganzen Gleichungen und Formelumstellungsregeln längst wieder vergessen habe- nicht hauen Bianca!- hält das durch den Lernurlaub geschmiedete Band zwischen uns Vieren bis heute. Obwohl wir uns in alle Himmelsrichtungen Deutschlands verstreut haben, kommen wir jährlich für ein paar Tage zusammen.
Am Pfingstsonntag 2012 saßen wir daher gemütlich in einem Eiscafé in Friedrichroda beisammen und tauschten Lagerfeuergeschichten aus. Was die Kollegen so treiben, wie lange wir auf Bestellungen warten müssen, wie die Vertreter so sind. TA-Klatsch eben. Dabei kam es zu folgendem Dialog:
Bianca: „Tolle Geschichten. Die müsste man mal aufschreiben.“
Ich: „Was guckst du mich so an?“
Bianca: „Na, wer von uns macht denn gerade einen Schreibkurs?“
Was leider nicht von der Hand zu weisen war. Ich hatte tatsächlich bereits ganze vier 90-minütige Termine meines VHS-Kurses für kreatives Schreiben besucht. In 360 Minuten vom Schreibkursteilnehmer zur Chronistin. So schnell kann´s gehen. Andererseits soll aufschreiben ja hilfreich beim Verarbeiten von Erlebnissen sein. Also setzte ich mich nach der nächsten Arbeitskrise zuhause an meinen Schreibtisch und fing einfach an. Mal sehen, was so dabei herauskommt.
Was soll ich sagen? Auch das funktionierte! Die Geschichte über eine problembeladene Erbsensaatgutanlieferung floss flüssig aufs Papier. Das Ergebnis mailte ich meinen drei TA-Freundinnen, bei denen die Geschichte ebenfalls große Heiterkeit auslöste. Da packte mich der Ehrgeiz. Vielleicht begeistert meine Geschichte auch eine größere Leserschaft? Auf einen eigenen Blog hatte ich keine Lust, also mailte ich meinen Text kurzerhand an die Laborjournal-Redaktion, und meine Kühnheit wurde belohnt. Am nächsten Tag schon fand ich in meinem E-Mailpostfach eine Antwortmail vor. Vom Chefredakteur persönlich.
„Nehmen wir, wie oft können Sie liefern?“
Schluck! Damit hatte ich nicht gerechnet. Die wollten nicht nur meinen einen Text veröffentlichen, die wollten mehr. Kriege ich das hin?
Ich kriegte und kriege es immer noch hin. Dies ist immerhin schon die 50. Kolumne, die das tägliche Geschehen in unserem Labor thematisiert, und wenn hier aktuell mal nichts los ist, krame ich alte Erlebnisse aus meiner Erinnerung hervor. Schließlich soll man ja auch seine Vergangenheit aufarbeiten.
An dieser Stelle vielen Dank an meine drei Damen vom Lernquartett, an die Laborjournal-Redaktion, an meine Leser und auch an meine Kollegen. Jemand muss all die inspirierenden Dinge ja erst einmal mit mir erleben, bevor ich sie aufschreiben kann.
Mal sehen für wie viele zukünftige Kolumnen Gegenwart und Vergangenheit noch reichen.
Ich bin gespannt.
Also schickte ich die nächsten acht Jahre in regelmäßigen Abständen der Redaktion meine Texte, die, da in der Printausgabe derzeit noch eine andere TA publizierte, unter dem Titel „Erlebnisse einer (anderen) TA“ zunächst online in den Editorials veröffentlicht wurden. 2020 folgte dann das nächste Level: Die Printausgabe von Laborjournal.
Mit dem hundertsten Text möchte ich nun meine Kolumne beenden, um mich neuen Projekten zu widmen. Und da mir der Gedanke gefiel, meine Zeit als Kolumnistin mit einem Buch abzuschließen, so wie man beim Verlassen einer Wohnung die Tür hinter sich zumacht, habe ich meine Texte zu einem Buch zusammengestellt. Da es sowohl in meinem Freundeskreis als auch in meiner Familie etliche Nichtbiowissenschaftler gibt, habe ich die Fachbegriffe erläutert.
Ich hoffe, es hat Ihnen ebenso viel Spaß gemacht, meine Kolumne zu lesen, wie mir sie für Sie zu schreiben.
Pflanzliches
Versuchspflanzen sollten platzsparend und kostengünstig zu kultivieren sein und einen kurzen Generationszyklus haben (also eine möglichst kurze Zeitspanne von der Keimung bis zur Samenreife). Wenn ihr genetischer Code bereits bekannt ist, erleichtert das vieles.
In unserem Labor arbeiten wir hauptsächlich mit den Klassikern Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana), Tomaten (Solanum lycopersicum) und Erbse (Pisum sativum).
A.thaliana z.B. steht auf der Hitliste der beliebtesten Versuchspflanzen weltweit ganz weit oben, hat es doch mit acht Wochen einen extrem kurzen Lebenszyklus, braucht wenig Platz und Wasser und seine Samen lassen sich leicht ernten und aufbewahren.
Bei unserer Forschung geht es kurz gefasst darum, verschiedene Gene in den Pflanzen zu unterbrechen, also auszuschalten, und zu testen, ob und wie diese Pflanzen anschließend mit erhöhten Temperaturen, erhöhter Lichteinstrahlung oder höherem Salzgehalt im Boden zurechtkommen. Überleben die Pflanzen ohne das betreffende Gen und wenn ja, wie machen sie das? Übernimmt ein Nachbargen den Job und wieviel stärker muss dieses dann arbeiten?
Die innere Mitte
Als ich mich entschloss, TA zu werden, wusste ich noch nicht, wie unglaublich nervenaufreibend dieser Beruf manchmal sein würde. Sicher, ich rechnete mit missglückten Experimenten, anstrengenden Praktikanten und Kollegen, aber sonst stellte ich mir alles recht entspannt vor. Womit ich nicht rechnete, waren die Bestellungen.
Ich erwartete, ein paar Telefonate zu führen oder, wie in der heutigen Zeit üblicher, Onlinebestellungen zu tätigen. Was war schon weiter dabei?
Naja, ich war jung und unerfahren.
Die folgenden Berufsjahre sollten mich eines Besseren belehren.
Die eindrucksvollste Demonstration für die Komplexität mancher Bestellungen lieferte mir die Anlieferung des Saatguts für unsere Erbsenanzucht.
Die Bestellung verlief erfreulich einfach. Ich schickte eine kurze E-Mail mit unseren Adressdaten sowie der benötigten Saatgutmenge an die Firma, worauf eine nette Bestätigung vom Chef persönlich folgte, dann wartete ich.
Eine Woche später, Freitag 13:30 Uhr, ich freue mich schon auf meinen Feierabend und das kommende Wochenende, läutet das Telefon.
Eine mir unbekannte Stimme nuschelt was von Erbsen, Lieferung und wohin denn? Nachdem ich all das in meinem Kopf entwirrt habe, verweise ich auf den Zusatz in der Adresse, der eigentlich alles erklärt und noch die meisten Lieferanten ans Ziel gelotst hat.
Der Mann legt auf.
30 Minuten später, Telefon, Spediteur: „Der Fahrer ist jetzt da!“
Ich sehe mich im Labor um: Kein Fahrer und erst recht keine 300 kg Erbsen.
„Wo denn?“, erkundige ich mich.
„Das weiß der Fahrer nicht so genau, irgendwo auf dem Campus Riedberg jedenfalls!“
Mir fällt ein Mantra ein, das ich vor 15 Jahren bei meinem ersten und einzigen Kurs für autogenes Training gelernt habe: Wir finden unsere innere Mitte.
Ich atme tief durch.
„Was sehen Sie denn in Ihrer Nähe, beschreiben Sie doch mal.“
Vielleicht lässt sich so sein Standort ermitteln.
„Moment!“
„Hallo?“ Aufgelegt!
Diesmal dauert es kaum 25 Minuten.
„Der Fahrer sagt, er steht direkt vor einer Baustelle“, präsentiert mir der Spediteur stolz seine neueste Erkenntnis. Aha!
Da der Campus Riedberg, ebenso wie das gesamte Stadtviertel dieses Namens gerade erst im Entstehen begriffen ist, ist alles im Umkreis von 1km Baustelle. Warum habe ich bloß nicht mit dem autogenen Training weitergemacht? Ich atme tief durch. Wir finden unsere innere Mitte.
„Geben Sie mir doch die Telefonnummer Ihres Fahrers, dann kann er mir das vielleicht genauer beschreiben“, schlage ich vor.
„Nee, geht nicht, der spricht kein Deutsch!“
„Ich kann Englisch“, wende ich ein.
„Nee, auch nicht!“
„Französisch?“
In dieser Sprache bewegen sich meine Kenntnisse zwar auf Schulniveau, aber ich bin verzweifelt, will in mein Wochenende und für ein bisschen à gauche und à droite wird es schon reichen.
„Nee, nee!“
Das erklärt immerhin, warum der gute Mann nicht einfach selbst nach dem richtigen Gebäude fragen kann. Wir finden unsere innere Mitte. Ich begrabe meine Wasich-Schönes-mache-wenn-ich-Freitag-früher-gehen-darf-Pläne und rufe ein paar Kollegen in den umliegenden Gebäuden an, ob sie einen Lastwagen sehen, ohne Erfolg. Langsam bleibt mir nur der Trost, dass Erbsensaatgut wenigstens keine empfindliche Ware ist und weder gekühlt noch mit Trockeneis versorgt werden muss.
Also kann die Spedition zur Not am Montag einen neuen Versuch starten, vielleicht sogar mit einem wenigstens Französisch sprechenden Fahrer.
Die Rettung kommt von unverhoffter Seite.
„Da steht ein LKW vor unserer Einfahrt. Könnten das die Erbsen sein?“, fragt mich unser Gärtner am Telefon, als die Leitung einmal kurz nicht durch den Spediteur blockiert ist. Tatsächlich hat der Fahrer mit seinem LKW fast zwei Stunden unmittelbar vor dem Gewächshaus gestanden, wohin er die Erbsen liefern sollte, ohne einmal sein Führerhaus zu verlassen.
Solche Geschichten passieren glücklicherweise nicht ständig, aber doch mit unerschütterlicher Regelmäßigkeit. Vielleicht spendiert mir mein Professor ja mal einen Auffrischungskurs in autogenem Training?
Shakespeare meets tomato
Ab und an seine Komfortzone zu verlassen, soll der Lebenserfahrung sehr zuträglich sein.
Dachte ich jedenfalls, als ein Kollege mich bat, für ihn Chloroplasten aus Tomatenpflanzen zu isolieren. Er war die Woche auswärts zugange, da die Pflanzen jedoch keinen anderen Termin mehr frei hatten, klopfte er bei mir an.
‚Das hast du aber noch nie gemacht‘, piepste eine zweifelnde Stimme in meinem Hinterkopf. Es könnte die meines limbischen Systems sein, dessen Aufgabe unter anderem darin besteht, mich vor potentiellen Gefahren zu warnen.
„Klar, mach ich gern“, antwortete ich, mein limbisches System ignorierend. Ein paar Tomatenchloroplasten isolieren, wird schon nicht so gefährlich sein.
Ist ja auch mal was Neues. Bislang habe ich Chloroplasten nur aus Erbse und Ackerschmalwand isoliert. Beides eine recht entspannte Angelegenheit. Warum sollten Tomatenpflanzen anders sein?
Beschwingt wanderte ich am Stichtag mit Transportkiste und Schere ausgerüstet ins Gewächshaus.
Ein Wald erwartete mich. Hinter der gläsernen Wand standen auf dem Anzuchttisch an die 50 über einen Meter große Tomatenpflanzen. Während ich noch ungläubig auf das grüne Gestrüpp starrte, kam unser Gärtner vorbei.
„Es kann passieren, dass die Pflanzen sich ineinander verhaken und es zu einer Kettenreaktion kommt, sobald du einen Topf bewegst. Schubs sie dann einfach wieder zurück in die Senkrechte“, klärte er mich im Vorbeigehen auf, winkte kurz mit seiner Bewässerungsbrause und eilte davon.
Nicht mehr ganz so beschwingt öffnete ich die Schiebetür zu unserem Tomatenabteil.
Erbsenpflanzen wachsen bei uns maximal acht Tage lang, ehe sie verarbeitet werden. In diesem Alter ist jede von ihnen ein zartes, maximal 10cm hohes Pflänzchen, das keine nennenswerte Gegenwehr leistet.
Dieser Tomatenwald dagegen wucherte seit knapp zwei Monaten vor sich hin und blickte unheilverkündend von der Höhe seines Tisches auf mich herab.
Mein limbisches System meldet sich wieder zu Wort:
„Lass uns abhauen! Ein „wandernder Wald“ brachte schon Macbeth in Shakespeares gleichnamiger Tragödie nichts Gutes‘. Ich wusste gar nicht, dass mein limbisches System so gebildet ist.
Ein wenig eingeschüchtert rückte ich dem imposanten Grünzeug zu Leibe und stellte fest: Wenn man zu seinen Versuchspflanzen aufsehen muss, fühlt man sich irgendwie nicht wie der große Forscher, der man versucht zu sein. Drei Pflanzen später erfüllte sich die unheilvolle Prophezeiung unseres Gärtners. Zwecks besserem Zugriff wollte ich die dritte Pflanze von ihren Genossen separieren, da geriet der halbe Wald ins Wanken und warf sich auf mich.
‚Siehst du, hab ich ja gleich gewusst‘, triumphierte mein limbisches System.
Ich schubste die Töpfe zurück in die Senkrechte und schnippelte tapfer weiter, bis der halbe Wald gerodet war. Bereits nach der ersten Pflanze hätte ich jedes Königreich für ein Buschmesser gegeben. Die Tomaten erwiesen sich als Gewächs von immenser Renitenz.
Noch im Mixer widerstanden sie meinen zunächst behutsamen Homogenisierungsversuchen. Es brauchte zwei Ansätze und dreimal so viel Pufferlösung, bis ich begriff, dass ich mit meiner Erbsenpflanzenverarbeitungserfahrung hier nicht weiterkam, und doppelt so lange, bis endlich die gewünschte rahmspinatartige Konsistenz erreicht war. Ab da erwies sich die weitere Verarbeitung der Tomaten als recht unproblematisch.
Trotz aller Dramatik habe ich mich wohl gut geschlagen, denn eine Woche später fragte der Kollege, ob ich in den kommenden Tagen nicht auch noch die restlichen Pflanzen verarbeiten könnte?
Was verlangt er da von mir?
Es ist immer noch derselbe Wald, dieselben Pflanzen, deren Freunde ich gemeuchelt habe. Meine sinistren Absichten sind in ihrem kollektiven Gedächtnis eingebrannt. Sie werden sich auf mich werfen, kaum dass ich das Gewächshaus betrete. Andererseits, soll es nicht der Lebenserfahrung sehr zuträglich sein, wenn man sich seinen Ängsten stellt?
„Klar, mach ich gern!“
Hier wird nicht gekniffen. Ich habe einen Plan.
Ich werde mir ein Buschmesser besorgen, die dreifache
Menge Puffer ansetzen und dann…
‚Auf ins nächste Gefecht‘, jubelt die Stimme in meinem Hinterkopf. Mein limbisches System und Shakespeares König Heinrich V müssen natürlich das letzte Wort haben.
Sesam, öffne dich!
Frühe Vögel fangen Würmer.
Diese Weisheit ist weit verbreitet und hinreichend bekannt. Warum macht man es den Vögeln dann so schwer?
Ich persönlich zähle mich zu den Lerchen, da ich morgens und am Vormittag am konzentriertesten arbeiten kann. Daher war ich nicht weiter erbost, als mir neulich beschieden wurde, die erste meiner vier Pflanzenchargen am nächsten Tag schon um 7:00 Uhr aufzuarbeiten und zwar BEVOR das Licht in der Anzuchtkammer eingeschaltet wird und in ihren Stoffwechsel eingreift. Da mir die Problematik, vor 8:00 Uhr zum Gewächshaus vorzudringen nur allzu bekannt war, bereitete ich meine Mission sorgfältig vor. Aus dem Postdoc-Büro organisierte ich mir einen Bund mit allen erforderlichen Schlüsseln, die mir sämtliche Türen auf dem Weg in die heiligen Hallen öffnen sollten.
7:00 Uhr
Frohen Mutes passiere ich ungehindert in friedlicher Morgendämmerung die Flure, entriegle die Tür zum Gewächshaus und stecke den letzten Schlüssel in die Tür zur Anzuchtkammer.
Er lässt sich nicht drehen! Ungläubig versuche ich es erneut, rüttle, nichts.
Ich probiere es mit meinem eigenen Schlüssel für unsere Laborräume. Der Gedanke, dass unsere Anzuchtkammer mit unserem Schlüssel zu öffnen ist, erscheint mir durchaus plausibel. Dem Konstrukteur des universitären Schließsystems offenbar weniger, der Schlüssel passt nicht mal ins Schloss. Was nun? Die Gärtner sind noch nicht da. Den Schlüssel aus ihrem Büro holen? Meine Schlüssel passen auch nicht in die verschlossene Bürotür.
Ich versuche es mit einem inbrünstigen „Sesam, öffne dich!“, aber die Tür bleibt geschlossen. Hat sie etwa Tausendundeine Nacht nicht gelesen?
7:05 Uhr
Noch nicht ernstlich beunruhigt suche ich jemanden vom Reinigungspersonal, berufsbedingt ebenfalls Lerchentypen, um nach einem Generalschlüssel zu fragen. Leider hat keiner der drei, die ich treffe, einen für meine Problemtür. Zurück ins Gewächshaus, niemand da, Tür verschlossen.
7:10 Uhr
Im Postdoc-Büro gibt es sicher einen Schlüssel für die Anzuchtkammer. Also zurück zum Labor, um unseren Raumpfleger zu bitten, mich dort hinein zu lassen. Der gute Mann ist allerdings verschwunden und sein Kollege eine Etage tiefer hat keinen passenden Schlüssel und ist darüber milde verblüfft. Ich kann ihn gut verstehen!
7:15 Uhr
Gewächshaus, Tür zu, Büro dunkel, keiner da.
Ich werde etwas unruhig. Mir bleiben nur noch 15 Minuten, meine Pflanzen vor den verheerenden Strahlen zu bewahren. Was kann ich tun?
Der Sicherheitsdienst in der Pförtnerloge fällt mir ein, der nachts jede, aber wirklich jede unserer Türen absperrt und wenn es nur die zur Besenkammer ist. Auf dem Weg dorthin verdränge ich mühsam die Vision, wie meine Pflanzen vampirgleich unter den sengenden Strahlen zu Staub zerfallen, oder sich wie die kleinen Filmmonster in amorphen grünen Brei verwandeln.
7:20 Uhr
„Das weiß ich nicht, ich bin neu hier!“, zerstört der uniformierte Mann meine letzte Hoffnung.
Grübelnd stehe ich vor dem Glasverschlag, als ein weiterer Frühaufsteher die Szene betritt, um einen vorbestellten Dienstwagen abzuholen.
„Das weiß ich nicht, ich bin neu hier!“, wiederholt der Pförtner sein Tagesmantra.
Immerhin bin ich nicht die einzige, deren Wünsche an diesem Morgen unerfüllt bleiben.
7:25 Uhr
Geschlagen schleiche ich zurück zum Gewächshaus. Ein letzter Blick, bloß zur Sicherheit. Und das Schicksal hat ein Einsehen. Unser Gärtner ist eben angekommen und mit Hilfe seines Schlüssels gelingt es mir in letzter Minute, meine Pflanzen vor der sengenden Verdammnis in einem Karton in Sicherheit zu bringen. Ha!
10 Minuten später verwandeln sich die so mühsam geretteten Pflanzen in meinem Mixer in amorphen grünen Brei.
Es war einmal…
…oder warum wir heute an der Erbse Pisum sativum forschen.
Einstmals ritt ein junger Prinz durch ferne Lande und erblickte in der Ferne eine grüne Hecke, die sich bis in den Himmel emporreckte.
„Was verbirgt sich hinter dieser Hecke?“, fragte er jeden, der ihm begegnete.
Die Leute erzählten, dort befände sich ein verwunschenes Schloss, in welchem eine Königstochter seit vielen Jahren schliefe, nebst ihren Eltern und deren Hofstaat.
„Ich will mir die Prinzessin einmal ansehen“, dachte sich der Prinz, schwang sich auf den Rücken seines Pferdes und erreichte schließlich die grüne Festung.
„Das sieht nach Erbsenpflanzen aus“, murmelte der botanisch versierte Prinz, sobald er die Schoten gewahrte, die allenthalben in der rankenden Hecke hingen.
Allein, das Gestrüpp war so verfilzt, da ward kein Durchkommen.
Mit kraftvollen Schlägen schwang der Prinz sein Schwert. Der Duft frisch geschnittener Pflanzen stieg ihm in die Nase, bei jedem Schwung spritzte grüner Pflanzensaft umher und rann an der Klinge seines Schwertes herab.
Im Turmzimmer angelangt, betrachtete er flüchtig die schöne Prinzessin auf ihrer Bettstatt. Beim Anblick der zahllosen grünen Sprenkel, die seinen weißgoldenen Waffenrock verunzierten, entschwand sie jedoch aus seinen Gedanken.





























