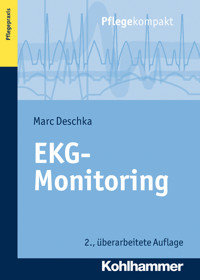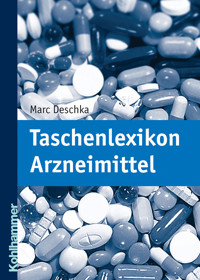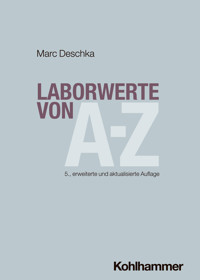
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die fünfte Auflage "Laborwerte A-Z" bietet eine inhaltlich aktualisierte und um neue Laborwerte ergänzte Übersicht über die wichtigsten medizinischen Laboruntersuchungen. Alphabetisch sortiert und mit einem integrierten Griffregister schnell auffindbar, präsentiert dieses kompakte Taschenlexikon alle praxisrelevanten Informationen zu den gesuchten Laborwerten. Neben einer verständlichen Erläuterung der praktischen Bedeutung der einzelnen Laborwerte werden Angaben zur diagnostischen Bedeutung von Abweichungen aus dem Referenzbereich sowie praktische Tipps über die Probengewinnung, das zu verwendende Probenmaterial und die korrekte Handhabung der gewonnenen Proben bis zur Analyse durch das Labor dargestellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Zur leichteren Orientierung im Text
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
Literaturverzeichnis
Der Autor
Marc Deschka ist freier Medizinjournalist und Autor diverser medizinischer Fachbücher.
Marc Deschka
Laborwerte von A–Z
5., erweiterte und aktualisierte Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels zu prüfen. Bei der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
5., erweiterte und aktualisierte Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-046186-4
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-046187-1epub:ISBN 978-3-17-046188-8
Zur leichteren Orientierung im Text
↑: Wert erhöht
↡: Wert erniedrigt
⚠: Wichtige Hinweise, praktische Tipps
Referenzbereiche von Laborbefunden sind grundsätzlich von der verwendeten Analysemethode des Laborinstituts abhängig. Bitte verwenden Sie zur Interpretation der Laborbefunde daher grundsätzlich die vom konsultierten Laborinstitut angegebenen Referenzbereiche.
A
ABO-Test
→ Blutgruppe + Bed-side Test
ACE
→ Angotensin-Converting-Enzyme
Aceton
→ Keton im Urin
ACTH
→ Adrenokortikotropes Hormon
Adrenalin
→ Katecholamine
Gruppe: »Hormone«Probenmaterial: 2 ml EDTA-PlasmaEinheit: pg/ml; alternativ: pmol/l (Faktor: 0.222)Referenzbereich: ♀/♂ 10 – 48 pg/ml
↑: z. B. Morbus Addison, hypothalamo-hypophysäres Cushing-Syndrom, Cushing-Syndrom bei ektoper ACTH-Produktion, Stress, Menstruation, Alkoholabusus.
↡: z. B. Cushing-Syndrom bei autonomem NNR-Karzinom oder -Adenom, bei sekundärer NNR-Insuffizienz als Folge einer Hypophysen-Vorderlappen-Insuffizienz.
⚠: Aufgrund starker tageszeitlicher Schwankungen sollte die Blutentnahme nüchtern und morgens zwischen 7 und 9 Uhr stattfinden. Sofortige Analyse des Probenmaterials im Labor erforderlich. Probe bis zur Analyse im Labor kühlen. Bei Versand: kühl zentrifugieren, Plasma einfrieren und tiefgefroren versenden. Blutentnahme möglichst acht Stunden nach der letzten Biotineinnahme, da diese sonst die Laborbestimmung beeinflussen kann.
AFP
→ α-[Alpha]-Fetoprotein
ALA
→ Aminolävulinsäure
Alanin-Aminotransferase
→ GPT
ALAT
→ GPT
Albumin (im Blut)(Das in der Leber zusammengesetzte Albumin macht den größten Anteil der im Blut befindlichen Eiweiße aus. Neben seiner Funktion als wichtigstes Transportprotein ist es für die Aufrechterhaltung des kolloidosmotischen Druckes und somit für die Flüssigkeitsverteilung im Körper verantwortlich. Weiterhin dient Albumin als »Reserve-Eiweiß« im Körper. Die Analyse von Albumin wird u. a. zur Verlaufskontrolle einer Lebererkrankung und zur Abklärung von Ödemen vorgenommen. Siehe auch → Eiweiß und → Eiweißelektrophorese.)
Gruppe: »Proteine«Probenmaterial: 1 ml SerumEinheit: g/lReferenzbereich: ♀/♂ 35,0 – 52,0 g/l (0 Jahre ♀/♂ 30,0 – 52,0 g/l)
↑: z. B. Exsikkose (Cave: Pseudohyperalbuminämie)
↡: z. B. Mangelernährung, Leberzirrhose, Nephrose, postoperativ, Verbrennungen, Infektionen, maligne Erkrankungen, Schwangerschaft, Diarrhoen, Aszites, Ödeme, Sepsis, Schock.
⚠: Hämolyse bei der Blutentnahme vermeiden.
Albumin (im Urin)(Der Nachweis von Albumin im Urin, die sogenannte »Albuminurie«, ist ein häufiges Symptom bei Nierenerkrankungen. Die renale Proteinurie ist durch eine gesteigerte Permeabilität der Glomerulumkapillare bedingt. Albumin ist daher ein wichtiger Parameter zur Unterscheidung glomerulärer Proteinurien und dient der Früherkennung und Verlaufskontrolle renaler Parenchymschädigungen durch Hypertonie oder Diabetes mellitus. Siehe auch → Eiweiß im Urin.)
Gruppe: »Proteine«Probenmaterial: 10 ml Probe vom 24 h-SammelurinEinheit: mg/lReferenzbereich: ♀/♂ < 20 mg/l
↑: z. B. Nephrose, diabetische Nephropathie, Pyelonephritis, Glomerulonephritis, Herdnephritis.
⚠: Angabe der Gesamturinmenge zur Analyse erforderlich.
Aldosteron (im Blut)(In der Nebennierenrinde gebildetes Hormon, das zusammen mit dem Renin-Angiotensin-System den Natrium- und Kaliumhaushalt regelt. Es bewirkt, dass die Nieren weniger → Natrium ausscheiden und dadurch Wasser im Körper zurückgehalten wird. Die Bildung und Ausschüttung wird durch das Renin-Angiotensin-System, die Hypophyse, das sympathische Nervensystem und den Blutdruck beeinflusst. Aldosteron wird im Rahmen der Abklärung einer Hypertonie, bei Verdacht auf Hyperaldosteronismus und Störungen des Natrium- und Kaliumhaushaltes bestimmt. Gemessene Aldosteronwerte sind von Körperhaltung und Tageszeit abhängig.)
Gruppe: »Hormone«Probenmaterial: 2 ml SerumEinheit: ng/dl; alternativ: pmol/l (Faktor: 27.7)Referenzbereich: 0 Jahre ♀/♂ 5.0 – 132.0 ng/dl; 21 bis 64 Jahre ♀/♂ 2.5 – 39.2 ng/dl
↑: z. B. Conn-Syndrom, Nierenarterienstenose, reninsezernierende Tumore, Maligne Hypertonie, Ödeme, Bartter- und Pseudo-Bartter-Syndrom.
↡: z. B. idiopathischer Hypoaldosteronismus, Morbus Addison, Nierenläsion, Hypophyseninsuffizienz, Hyporeninämie nach beidseitiger Nephrektomie, Therapie mit synthetischen Glukokortikoiden.
⚠: Aldosteronantagonisten möglichst 4 Wochen vor der Analyse absetzen. Möglichst 8 Tage vor dem Test keine Antihypertensiva, Diuretika, β-Blocker, Laxantien, Kortikosteroide, Lakritze, Kaliumpräparate und Antidepressiva. Die Referenzbereiche beziehen sich in der Regel auf aufrechte Körperhaltung und normale Salzzufuhr. Nach mindestens 3 Stunden Ruhe in liegender Position halbieren sich die Werte. Bei Stimulation (z. B. Orthostase, Furosemidgabe) 2 bis 6-facher Anstieg des Basalwertes. Bei Versand: Serum ggf. einfrieren und tiefgefroren versenden, da die Probe nur 3 – 4 Tage bei Raumtemperatur stabil ist.
Alkalische Phosphatase (im Blut)(= AP. Gesamtsumme verschiedener Isoenzyme, die phosphathaltige Verbindungen in ihre Einzelteile zerlegen. Die Phosphatase kommt in allen Körperzellen vor, von besonderer Bedeutung sind jedoch die Leber- und Knochenphosphatase. AP wird bei Verdacht auf cholestatische Lebererkrankungen, bei Knochenerkrankungen und Verdacht auf Beteiligung des Skelettsystems bei unterschiedlichen Grunderkrankungen bestimmt. Wenn die AP erhöht ist, kann man die Untersuchung weiter spezifizieren. Dieses ist jedoch bei Bestimmung von γ-[Gamma]-GT und → LAP meist nicht erforderlich.)
Gruppe: »Enzyme«Probenmaterial: 1 ml SerumEinheit: U/l; alternativ: µmol/s/l (Faktor: 0.01667)Referenzbereich: 0 bis 13 Tage ♀/♂ 83 – 248 U/l; 14 Tage bis 0 Jahre ♀/♂ 122 – 469 U/l; 1 Jahr bis 9 Jahre ♀/♂ 142 – 335 U/l; 10 Jahre bis 12 Jahre ♀/♂ 129 – 417 U/l; 13 Jahre bis 14 Jahre ♀ 57 – 254 U/l; 13 Jahre bis 14 Jahre ♂ 116 – 468 U/l; 15 Jahre bis 16 Jahre ♀ 50 – 117 U/l; 15 Jahre bis 16 Jahre ♂ 82 – 331 U/l; 17 Jahre bis 18 Jahre ♀ 45 – 87 U/l; 17 Jahre bis 18 Jahre ♂ 55 – 149 U/l; 19 Jahre bis 120 Jahre ♀ 35 – 104 U/l; 19 Jahre bis 120 Jahre ♂ 40 – 129 U/l
↑: z. B. Leber- und Gallenwegserkrankungen, Knochenerkrankungen, -frakturen und -metastasen, Hyperparathyreoidismus, Mononukleose, Rachitis, Medikamente wie Carbamazepin, Cyclosporin, orale Kontrazeptiva, Phenytoin.
↡: z. B. angeborener AP-Mangel, Hypothyreose.
⚠: 12-stündige Nahrungskarenz vor der Blutentnahme, um eine Verfälschung durch Darm-AP zu vermeiden. Werte durch Kontamination der Probe mit EDTA, Citrat oder Oxalat evtl. falsch erniedrigt. Hämolyse bei der Blutentnahme vermeiden.
α1[Alpha1]- und α2[Alpha2]-Globulin
→ Eiweißelektrophorese
α1[Alpha1]-Antitrypsin (im Blut)(Zur Gruppe der Serinproteaseninhibitoren gehörende Substanz, die Serinproteasen wie Elastase, Chymotrypsin, Trypsin und Thrombin durch Bildung irreversibler Komplexe inaktiviert. Die Analyse erfolgt bei Verdacht auf angeborenen α1-[Alpha1]Antitrypsin-Mangel z. B. bei verlängertem Neugeborenenikterus, beim Lungenemphysem des Erwachsenen oder auch Hepatitis oder Leberzirrhose unklarer Genese.)
Gruppe: »Proteine«Probenmaterial: 1 ml SerumEinheit: g/lReferenzbereich: ♀/♂ 0,90 – 2,0 g/l
↑: z. B. Entzündungen, Tumore, Schwangerschaft, Medikamente wie Östrogene.
↡: z. B. angeborener α1[Alpha1]-Antitrypsinmangel, frühkindliche Lebererkrankung, Leberzirrhose, Lungenemphysem, Proteinverlust.
Gruppe: »Enzyme«Probenmaterial: 1 ml SerumEinheit: U/l; alternativ: µmol/s/l (Faktor: 0.01667)Referenzbereich: ♀/♂ 28 – 100 U/l
↑: z. B. Pankreatitis, Parotitis, Peritonitis, Leber- und Niereninsuffizienz, Makroamylasämie.
⚠: Differenzierung des Amylaseanstiegs durch Bestimmung von → Lipase, da diese pankreasspezifisch ist. Blutentnahme beim nüchternen Patienten.
α[Alpha]-Amylase (im Urin)(Amylase wird über die Niere filtriert und kann daher bei erhöhten Serumspiegeln oder bei Nierenschädigungen im Urin nachgewiesen werden. Der Nachweis von Amylase im Urin kann bei flüchtigen Pankreatitiden der einzig laborchemisch mögliche Nachweis sein. Bei vermutetem sehr kurzem Anstieg der Amylase, kann die Bestimmung im Spontanurin erwogen werden. Weiterhin dient die Bestimmung der Amylase im Urin der Erkennung von Hyper- und Makroamylasämien oder als zusätzlicher Hinweis auf glomeruläre oder tubuläre Nierenschädigungen.)
Gruppe: »Enzyme«Probenmaterial: 10 ml SpontanurinEinheit: U/l; alternativ: µmol/s/l (Faktor: 0.01667)Referenzbereich: ♀/♂ < 460 U/l
↑: z. B. Pankreasschädigung, Nierenschädigung, Peritonitis, Parotitis.
⚠: Im Urin wird vorwiegend Pankreasamylase ausgeschieden.
α[Alpha]-Fetoprotein (im Blut)(= AFP. Hauptsächlich in der Leber und im frühen embryonalen Dottersack hergestelltes Glykoprotein mit ungeklärter biologischer Funktion. Ab der vierten SSW im Fruchtwasser und Blut der Mutter, ansonsten nur in geringer Konzentration beim Erwachsenen nachweisbar. Die Bestimmung von AFP erfolgt zum einen zur Erkennung von Missbildungen im Rahmen der pränatalen Diagnostik und zum anderen als Tumormarker und -verlaufskontrolle.)
Gruppe: »Proteine«Probenmaterial: 0,5 ml SerumEinheit: IU/mlReferenzbereich: 0 Tag ♀/♂ < 42000.0 IU/ml; 1 Tag bis 0 Monate ♀ < 15700.0 IU/ml, ♂ < 13600.0 IU/ml; 1 bis 11 Monate ♀ < 64.0 IU/ml, ♂ < 23.0 IU /ml; 12 Monate bis 2 Jahre ♀ < 9.2 IU/ml, ♂ < 6.6 IU/ml; 3 bis 5 Jahre ♀ < 3.5 IU/ ml, ♂ < 4.6 IU/ml; 6 bis 11 Jahre ♀ < 4.6 IU/ml, ♂ < 3.1 IU/ml; 12 bis 17 Jahre ♀ < 3.5 IU/ml, ♂ < 3.2 IU/ml; 18 bis 120 Jahre ♀/♂ < 5.8 IU/ml
↑: z. B. Leberzirrhose, Hepathopathien, Alkoholabusus, Leberzellkarzinom, Keimzelltumore, Terato-, Hoden-, Ovar- und Mammakarzinome, metastasierendes Magenkarzinom.
Bei Schwangerschaft: z. B. bei Anenzephalie, Spina bifida, Bauchwanddefekten, Neuralrohrdefekt, intrauteriner Mangelernährung und Mehrlingsschwangerschaft.
↡: Bei Schwangerschaft: z. B. bei Alkoholembryopathie, Trisomie 21.
⚠: Referenzbereiche bei Schwangerschaft in Abhängigkeit von der SSW. Blutentnahme möglichst acht Stunden nach der letzten Biotineinnahme, da diese sonst die Laborbestimmung beeinflussen kann. Zur Verlaufsbeurteilung von Tumormarkern sollten immer Laborwerte auf Grundlage der gleichen Messmethode verwendet werden.
α[Alpha]-Hydroxybutyrat-Dehydrogenase
→ HBDH
ALS
→ Aminolävulinsäure
ALT
→ GPT
AMA
→ Antimitochondriale Antikörper
Gruppe: »Metabolite«Probenmaterial: 10 ml Probe vom 24 h-SammelurinEinheit: mg/24 h; alternativ µmol/24 h (Faktor: 7.6299)Referenzbereich: ♀/♂ ≤ 6,0 mg/24 h
↑: z. B. akute Porphyrie, Blei- und Schwermetallvergiftung, Alkohol, Chemikalien, Medikamente.
⚠: Urin kühl (4 – 8 °C) und lichtgeschützt sammeln. Angabe der Gesamturinmenge zur Analyse erforderlich.
Ammoniak (im Blut)(= NH3. Produkt des Intermediärstoffwechsels, das durch Abbau von Eiweiß durch Darmbakterien entsteht und enzephalotoxisch wirkt. Die Entgiftung des Ammoniaks erfolgt in der Leber durch Bildung von → Harnstoff. Die Analyse von NH3 wird zur Differentialdiagnose unklarer komatöser Zustände, insbesondere zur Diagnose und Verlaufskontrolle des Leberkomas eingesetzt.)
Gruppe: »Metabolite«Probenmaterial: 1 ml EDTA-PlasmaEinheit: µg/dl; alternativ µmol/l (Faktor: 0.5871)Referenzbereich: 0 bis 9 Tage ♀/♂ 170 – 341 µg/dl; 10 Tage bis 1 Jahr ♀/♂ 68 – 136 µg/dl; 2 bis 16 Jahre ♀/♂ 19 – 60 µg/dl; 17 bis 120 Jahre ♀/♂ 19 – 87 µg/dl
↑: schwere Leberinsuffizienz.
⚠: Blutentnahme aus ungestauter Vene mit sofortiger Analyse des Probenmaterials im Labor; Probe bis zur Analyse kühlen, alternativ Blutentnahme direkt im Labor; bei Versand: Blut sofort abseren, Plasma einfrieren und gefroren versenden.
Amylase
→ α[Alpha]-Amylase
ANA
→ Antinukleäre Antikörper
ANCA
→ Antineutrophile zytoplasmatische Antikörper
Aneurin
→ Vitamin B1
ANF
→ Antinukleäre Antikörper
Gruppe: »Enzyme«Probenmaterial: 0,5 ml SerumEinheit: U/lReferenzbereich: 0 bis 17 Jahre ♀/♂ 33 – 112 U/l; 18 bis 120 Jahre ♀/♂ 20 – 70 U/l
↑: z. B. Sarkoidose, Leberzirrhose, Morbus Gaucher, Myelom, Diabetes mellitus, Hyperthyreose.
↡: z. B. Hypothyreose, toxische Lungenschädigung.
⚠: ACE-Hemmer möglichst vier Wochen vor der Blutentnahme absetzen.
Angiotensinkonversionsenzym
→ Angiotensin-Converting-Enzyme
Anorganisches Phosphat
→ Phosphat
Antihämophiles Globulin A (Faktor VIII)
→ Blutgerinnungsfaktoren
Antihämophiles Globulin B (Faktor IX)
→ Blutgerinnungsfaktoren
Antimitochondriale Antikörper (im Blut)(= AMA. Autoantikörper gegen Mitochondrien, die sich gegen ein auf der inneren oder äußeren Mitochondrienmembran gelegenes Antigen richten. Analyse vorwiegend bei Verdacht auf primär biliäre Zirrhose.)
Gruppe: »Autoantikörper«Probenmaterial: 1 ml SerumReferenzbereich: ♀/♂ Titer < 1:100
↑: z. B. primär biliäre Zirrhose, Lues II, chronisch aggressive Hepatitis, Pseudo-LE, CREST-Syndrom, Sjögren-Syndrom, sklerosierende Cholangitis, Diabetes mellitus Typ I.
Gruppe: »Autoantikörper«Probenmaterial: 1 ml SerumReferenzbereich: ♀/♂ Titer 1:2
↑: z. B. Wegener-Granulomatose, Panarteriitis nodosa, Churg-Strauss-Syndrom, mikroskop. Polyangiitis, Colitis ulcerosa, primär sklerosierende Cholangitis, primär biliäre Zirrhose, Morbus Crohn.
Gruppe: »Autoantikörper«Probenmaterial: 1 ml SerumReferenzbereich: ♀/♂ Titer 1:80
↑: z. B. Kollagenosen wie systemischer Lupus erythematodes (SLE), rheumatoide Arthritis, chronische Hepatitis, primär biliäre Zirrhose, chronische Hämodialyse, Lebensalter > 60 Jahre.
Gruppe: »Rheumaserologie«Probenmaterial: 1 ml SerumEinheit: U/mlReferenzbereich: 0 bis 5 Jahre ♀/♂ < 150 U/ml; 6 bis 17 Jahre ♀/♂ < 240 U/ml; 18 bis 120 Jahre ♀/♂ < 200 U/ml
↑: z. B. Streptokokkenfolgeerkrankungen wie rheumatisches Fieber, Glomerulonephritis, Tonsillitis, Scharlach, Endokarditis, Morbus Bechterew.
Antizytoplasmatische Antikörper
→ Antineutrophile zytoplasmatische Antikörper
AP
→ Alkalische Phosphatase
ASAT
→ GOT
Asialotransferrin
→ CDT
ASL
→ Antistreptolysintiter
Aspartat-Aminotransferase
→ GOT
AST
→ GOT
B
Base Excess (Basenabweichung)