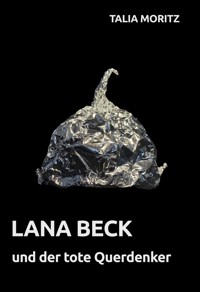6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ihr vierter Fall führt Lana Beck und Tobias Reiter am Faschingsdienstag auf den Münchener Viktualienmarkt. Eine Marktfrau liegt tot in ihrem Obst- und Gemüsestand. Warum findet sich überall an ihrer Kleidung Kokain aus Südamerika? Welche Rolle spielt ihr Sohn und seine „Viktualienmarkt-Gang“ und in welcher Verbindung stehen die Jungs zu dem Spanier Domenico da Silva? Die Suche nach Fanny Hubers Mörder gestaltet sich schwierig – ganz besonders als Lana Beck eine Entdeckung macht, die nicht nur ihr Leben nachhaltig verändert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 – Tanz der Marktfrauen
Kapitel 2 – Entdeckung
Kapitel 3 – Mord
Kapitel 4 – Reiter
Kapitel 5 – Raffael
Kapitel 6 – Beobachtung
Kapitel 7 – Familienzwist
Kapitel 8 – Eltern
Kapitel 9 – Selbstmord
Kapitel 10 – Verwirrung
Kapitel 11 – Emotionen
Kapitel 12 – Sherlock
Kapitel 13 – Alptraum
Kapitel 14 – Viktualienmarkt-Gang
Kapitel 15 – Befragungen
Kapitel 16 – Stroke Unit
Kapitel 17 – Nebenwirkung
Kapitel 18 – Provokation
Kapitel 19 – Geständnis
Kapitel 20 – Drogenhändler
Kapitel 21 – Erkenntnisse
Lana Beck
und die tote Marktfrau
Ein Unterhaltungskrimi
von
Talia Moritz
Impressum
Lana Beck und die tote Marktfrau
4. Band der Reihe “Lana Beck”
Texte: © Copyright by Talia Moritz Titelbild: © Copyright by Uli Dambeck
Verfasser/Herausgeber zu erreichen über (ladungsfähige Anschrift): Munich Boutique Advisory, Ennemoserstr. 11, 81927 München
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigungen, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Niemand kann auf Dauer eine Maske tragen.
(Seneca)
Hinweis:
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder
verstorbenen Personen und Ereignissen wären
zufällig und nicht beabsichtig.
Kapitel 1 – Tanz der Marktfrauen
Dienstag, 5. März 2018 – vormittags
Ich bin gut gelaunt, habe schon Prosecco und Bier intus, obwohl es erst 11 Uhr vormittags ist. Gleich starten die Marktweiber ihren traditionellen Tanz auf dem Viktualienmarkt, nachdem nach sieben Jahren endlich auch die Schäffler wieder aufgetreten sind. Langsam drängele ich mich mit meiner Bierflasche durch die immer weiter anwachsende Menge in Richtung Bühne vor. Die Marktweiber stehen schon bereit und der Einpeitscher, ihr Trainer, fordert das Publikum auf, Spaß zu haben. Ich persönlich finde das immer ziemlich grenzwertig, außerdem hasse ich es, wenn solche Leute immer und immer wieder begeistert und berauscht von sich selbst schreien:
„Habt ihr Spaß? Yeah. Seid ihr gut drauf? Yeah.“
Was soll das heißen? Was ist, wenn ich gerade keine Lust auf Spaß habe? Massenbegeisterung ist mir von jeher suspekt. Allerdings kann die ganze Veranstaltung durchaus Freude bereiten, wenn man genug Alkohol trinkt und jeden Schmarrn mitmacht. Ich freue mich, dass ich endlich einmal wieder am Faschingsdienstag auf den Viktualienmarkt gehen kann. Früher, in der Ausbildung, haben wir das jedes Jahr gemacht und es war immer sehr lustig.
Als ich um kurz nach zehn Uhr angekommen bin, war es noch recht entspannt. Endlich einmal kein Regen, sondern strahlender Sonnenschein – da zeigt sich München von seiner schönsten Seite. Das sonnige Wetter, das heute leider wegen eines kalten Windes an manchen Stellen unangenehm ist, was man aber erst merkt, wenn man schon unterwegs ist, sorgt zum Glück dafür, dass es die Leute auf die Straßen treibt. Allerdings ist um diese frühe Uhrzeit noch erstaunlich wenig los, ich hatte mir das Ganze wesentlich voller vorgestellt. Meist sind Veranstaltungen heutzutage besser besucht als noch vor ein paar Jahren, was natürlich kein Wunder ist, wir werden ja auch immer mehr Menschen, aber so früh sind wohl die meisten noch nicht fit nach den Feiern vom Rosenmontag. Ich hatte schon befürchtet, dass der Fasching auf dem Viktualienmarkt über kurz oder lang ähnlich gehyped würde wie das Oktoberfest, aber noch geht es. München war noch nie eine große Faschingshochburg wie Köln, Düsseldorf oder Mainz. Vor allem seit „München Narrisch“, einer Faschingsveranstaltung in der kompletten Innenstadt über drei Tage von Sonntag bis Dienstag, verteilt sich alles etwas weiter über die Altstadt bis zum Stachus. Dadurch ballen sich die Narren nicht mehr nur am Viktualienmarkt.
Kaum bin ich auf dem Gelände, hält mir schon ein junger Typ im Pilotenoutfit einen Sekt vor die Nase und schlägt vor, mich erst einmal richtig einzustimmen. Da ich ein höflicher Mensch bin, trinke ich den Sekt und nach einem netten Plausch und etwas Geplänkel stürze ich mich weiter ins Getümmel.
Ich fürchte, ich bin nicht sonderlich einfallsreich verkleidet, ich trage lediglich eine blonde Marilyn-Perücke über meinen schwarzen Haaren und roten Lippenstift. Das mit der Perücke war gar nicht so einfach, denn ich musste jede Menge Haare so unterbringen, dass man nichts mehr davon sieht. Dazu habe ich ein weißes Midi-Sommerkleid mit langen Flatterärmeln über schwarzen Lederleggins mit hochhackigen Designer-Stiefeln und einen schwarzen, warmen Kaschmir-Pulli mit V-Ausschnitt angezogen, was mein Dekolleté sehr schön zur Geltung bringt. Offensichtlich habe ich als Blondine einen Schlag bei den bereits leicht alkoholisierten Herren. Viele gucken mir allerdings nur auf meine Brüste, was mich leicht irritiert, andererseits aber auch nicht sonderlich interessiert. Männer sind mir egal. Seit Kilians Tod schaue ich weder rechts noch links. Sollen sie starren.
Keine drei Meter weiter spricht mich ein älterer Typ an, vielleicht so Mitte vierzig, gutaussehend, schlank, durchtrainiert – als Kapitän zur See in weißer Uniform. Hier wird sich gerne als Pilot, Polizist oder Kapitän verkleidet, damit erfüllen sich die Jungs wohl ihre Kindheitsträume.
Manchmal denke ich, die Bayern geben sich nicht ganz so viel Mühe mit dem Fasching. Vor Jahren war ich mit meiner Freundin Maria zum Karneval in Köln, da haben wir viele unglaublich aufwändige, selbst genähte oder gebastelte Verkleidungen gesehen. Allerdings tauchen auch auf dem Viktualienmarkt immer wieder sehr fantasievolle Kostüme in der Menge auf, vor allem die aufgeputzten, schillernden Drag-Queens mit ihren High-Heels beeindrucken allein schon aufgrund ihrer körperlichen Größe. Auch manch bunt verkleidete Gruppe mit erstaunlich kreativem Potential habe ich heute schon gesehen. Dazwischen finden sich aber auch viele Menschen ganz ohne Verkleidung in normalen, grauen Winterjacken, das gäbe es in den rheinländischen Karnevalshochburgen wohl kaum.
Mr. Captain in weiß auf jeden Fall weiß, was sich gehört. Er lädt mich auf einen weiteren Sekt ein, denn wir stehen vor dem Café Nymphenburg Sekt, einem Hotspot des „Savoir Vivre“ und „Es sich gut gehen Lassens“. Er ist mit einer ganzen Männertruppe in identischen Uniformen unterwegs und ich frage mich, ob es die wohl irgendwo im Dutzend billiger gab. Er heißt Franz, ist Versicherungsmakler und nicht mein Typ, wie ich ihm nach zwei Sekt freundlich erkläre. Er ist nicht beleidigt, verlangt allerdings einen Kuss zum Abschied. Ich finde, der steht ihm für die zwei teuren Gläser Sekt auch durchaus zu. Wenn das so weitergeht, komme ich günstig durch diesen Tag.
Vom Café Rischart, das oben auf der Terrasse einen Lautsprecher installiert hat, wird das ganze vordere Areal des Viktualienmarkts beschallt. Auch bei Fisch Witte im hinteren Bereich geht es bereits lebhaft zu, die Boxen wummern und bringen das Zelt zum Wackeln. Allerdings ist davon vor der offiziellen Bühne nichts zu hören, hier ertönen die üblichen Faschingsschlager und der Oberbürgermeister und diverse andere Honoratioren halten ihre Reden.
Seit den dramatischen Ereignissen im Dezember habe ich mich nicht mehr so amüsiert. Weihnachten war die Hölle, nach Kilians Beerdigung und dem Angriff mit den KO-Tropfen auf mich war ich sehr erschöpft und niedergeschlagen, deshalb bin ich zu meinen Eltern nach Niederbayern geflüchtet. Dort habe ich gefühlt die komplette Vorweihnachts-, Weihnachts- und Nachneujahrszeit damit zugebracht, entweder heulend in der Ecke zu sitzen oder deprimiert im Bett zu liegen. Ich weiß, dass meine Kollegen, allen voran Reiter, sich große Sorgen gemacht haben und auch meine Familie alles versucht hat, um mich aufzuheitern, aber ich habe es einfach nicht geschafft, mich aus dem tiefen, schwarzen Loch, in das ich durch die dramatischen Ereignisse gefallen war, zu befreien. Mein Bruder Momo hat ständig versucht, mich mit seiner Freundin Ela zu irgendwelchen Musikveranstaltungen zu schleppen, ich bin aber nur aus meiner Höhle gekrochen, wenn sie selbst einen Auftritt als Jazz-Duo hatten, denn dazu fühlte ich mich als große Schwester verpflichtet.
Unser Chef Dr. Achenbach hat mich im Dezember nach der Ermordung meines Verlobten Kilian und den dramatischen Ereignissen um Pater Julius alias Giuliano Farlone beurlaubt. Ich wollte das nicht, aber die Polizeipsychologin, Frau Dr. Hartmann, eine strenge Norddeutsche, mit der ich auf seine Anweisung hin sprechen musste, schrieb mich arbeitsunfähig, die blöde Kuh. Damit hat sie mir das Einzige genommen, was mich meiner Meinung nach wieder in die Spur hätte bringen können. Das Leben geht ja weiter und am besten macht man ganz normal seinen Job und gut. Das sah sie aber anders, hat mir was von Trauma, beginnender Depression und Bewältigung erzählt und dass ich nicht arbeitsfähig sei. Na vielen Dank auch.
Danach sollte ich jeden Dienstag bei ihr antanzen, was lästig war, weil ich dafür immer von Niederbayern anreisen musste. Wenn ich dann in München war, nutzte ich die Gelegenheit, um in meiner kleinen Wohnung in Neuhausen nach dem Rechten zu sehen. Erstaunlicherweise hatte ich noch nicht mal Lust, meinen Lieblingsnachbarn Raffael zu treffen oder mit ihm zu sprechen. Wann immer es möglich war, habe ich mich vor den Dienstagen mit Frau Dr. Hartmann gedrückt und den Termin unter einem Vorwand abgesagt.
Um den Gesprächen dauerhaft zu entgehen, habe ich mich im Januar mit Erlaubnis der Psychologin für sechs Wochen nach Indien zu einer Ayurveda-Behandlung abgesetzt. Schon bei einem anderen Fall mit einem toten Chefarzt hatte mir jemand von einer Ayurveda-Klinik im Norden Indiens berichtet und nun empfahl mir auch meine Freundin Maria diesen indischen Ayurveda-Arzt, das konnte ich dann nicht mehr ignorieren. Sowas ist doch kein Zufall, oder? Allerdings hatte sie mich gewarnt, dass es eine krasse und harte Erfahrung werden würde, aber ich glaube, ich habe nicht richtig zugehört. Am Ende fand ich mich unter einer Smogglocke in einem Krankenhaus mit spartanisch eingerichteten Zimmern wieder, voll beschäftigt damit, diverse, übelschmeckende Tränke zu schlucken, verschiedene Anwendungen über mich ergehen zu lassen – wobei ich zugeben muss, dass doch einiges sehr angenehm war, vor allem die Massagen – und mich ansonsten gepflegt zu langweilen und schlecht zu schlafen.
Die Inder sind ein feierfreudiges und lautes Volk, jede Nacht gab es irgendwo eine Party mit einem laut knallenden Feuerwerk. In der ersten Nacht, als ich das noch nicht wusste, habe ich mich so über die kriegsähnliche Knallerei erschreckt, dass ich reflexartig aus dem Bett gesprungen bin und nach meiner Waffe greifen wollte, weil ich dachte, wir würden angegriffen und es gäbe einen Aufstand oder Überfall. Ich habe mir erklären lassen, dass der Januar der Heiratsmonat sei und es in Indien traditionell anlässlich der Hochzeit ein Feuerwerk gäbe. Gefühlt wird dort zu dieser Zeit fast jeden Tag geheiratet.
Außerdem brennen ständig und überall offene Feuer, wo wirklich alles verbrannt wird, und wenn ich alles sage, meine ich alles. Die indische Regierung versucht das zu verbieten, scheint aber keinen besonders großen Erfolg damit zu haben. Kein Wunder, dass die Stadt unter dichtem Smog begraben liegt.
Jeden Morgen ertönten die vielfältigsten Geräusche aus den Zimmern. Vom Bad aus konnte ich auf Häuser blicken, die nicht zum Krankenhaus gehörten und die in einem eher wohlhabenden, gepflegten Wohnviertel lagen, zumindest hat mir das eine Ärztin, die ich sehr mochte, erzählt. Ich habe oft zum Fenster hinausgeschaut und beobachtet, was die Menschen so taten. Sie standen früh auf, tranken irgendetwas, dann übergaben sie sich laut und vernehmlich. Sie wuschen sich im Hinterhof, wo auch gekocht, die Wäsche aufgehängt und mit den Kindern gespielt wurde. Abgemagerte Kühe liefen zwischen den Häusern und auf den Straßen herum und auf dem Dach des Krankenhauses tobten riesige Affen, denen man besser aus dem Weg ging.
Ich durfte das Krankenhaus nicht verlassen, habe also bis auf diesen kleinen Ausschnitt von Indien nichts oder kaum etwas gesehen. Wir durften zu unserem eigenen Besten und zu unserer Gesundung auch kein Internet haben oder telefonieren. Das, kombiniert mit der kahlen Zelle mit dem Stahlbett und dem Bad ohne Dusche, war eine echte Herausforderung für mich. Die ersten Tage waren die Hölle, aber am Ende habe ich begriffen, dass man mit einem Eimer voll Wasser auch sehr gut duschen kann und dass man damit definitiv weniger Wasser verbraucht als wir Westeuropäer normalerweise beim Duschen und Baden an Ressourcen vernichten. Trotzdem war es ein erhebender Moment, zuhause wieder unter einer richtigen Dusche zu stehen. Wie glücklich und dankbar ich in diesem Moment war, dass ich in Deutschland, einem zivilisierten und weit entwickelten Land, geboren und aufgewachsen bin und hier leben darf. Nach einer langen Phase des Verzichts wird einem so einiges klar.
Definitiv gut getan hat mir in Indien die Entgiftung, auch wenn ich Ghee, also geklärte Butter, zu trinken mehr als verabscheute. Ich musste allein schon von dem Geruch würgen und empfand jeden Becher als meine gerechte Strafe für alles, was ich jemals Böses oder Falsches getan habe, eine Sühne für meine Sünden des letzten Jahres, eine Art Fegefeuer.
Mit der Zeit wurde es dann tatsächlich besser mit mir und meinem Zustand. Ich habe zwar leider im Vergleich zu den anderen viel weniger abgenommen, nur 3 kg, worüber sich alle anderen Insassen bzw. Patienten immer etwas lustig gemacht haben, da sie alle mindestens 1 kg in der Woche verloren haben. Da ich jedoch kein Übergewicht hatte, war ich froh darüber, denn ich wollte keinesfalls ein asketischer Hungerhaken werden. Der Gewichtsverlust tat mir trotzdem gut, ich fühlte mich leicht wie schon lange nicht mehr. Erstaunlicherweise schmeckte mir auch das Essen, das vegetarisch mit viel Reis und Gemüse sowie Mungbohnensuppe leider etwas eintönig war. Jeden Samstag gab es das Highlight der Woche, die beste Linsensuppe, die ich jemals gegessen habe. Man wird ja bescheiden in der Askese.
Als ich Ende Februar wieder zurückflog, ging es mir tatsächlich auch psychisch wesentlich besser. Ich hatte in Indien jede Menge Zeit gehabt, nachzudenken und zu trauern. Kurz vor dem Ende dieser interessanten Reise zu mir selbst habe ich nach dem morgendlichen Sport-Yoga mit der jungen und dynamischen Dr. Ayendra versucht, im Garten der Klinik zu meditieren, und zu meinem großen Erstaunen ist mir dabei Kilian erschienen. Er hat mich besorgt angeschaut und den Kopf geschüttelt.
„Liebste, hör auf damit, dich selbst zu hassen. Der Tod gehört zum Leben, vergeude das bisschen Zeit, das wir auf Erden haben, nicht mit Trauer, Wut oder Hass. Du kannst es nicht mehr ändern. Lebe wieder, genieße, lache, weine und habe keine Angst. Alles wird gut“.
Das hat er sehr liebevoll und sanft lächelnd gesagt, während er mir zärtlich übers Haar strich. Er nahm meine Hand, küsste sie und ließ sie langsam los, wobei er allmählich verblasste. Als ich wieder im Hier und Jetzt zurück war, erfüllte mich eine erleichterte Ruhe.
Dr. Kumar, der Gott-ähnliche Leiter der Klinik, ermahnte mich zum Abschied streng, mich an die Essensregeln zu halten. Als ich ihn fragte, wie es denn mit Ausnahmen sei, denn mein Essensplan, den ich vor der Abreise bekam, enthielt kaum etwas, das ich mochte, lachte er dröhnend.
„Lass es mich mit einem Beispiel für euch Deutsche sagen. Ihr liebt doch eure Autos so sehr. Was denkst du, welche Menge Zucker du wohl für okay hältst, um sie in deinen Benzintank zu kippen?“
Blöder Vergleich. Wie kann er einem Niederbayern sagen, er darf keine Wurst und kein Fleisch mehr essen? Unmöglich. Ich glaube, er hielt mich für ziemlich renitent.
Dr. Kumar ist ein Brahmane, also ein Angehöriger der höchsten Kaste in Indien. Noch immer legen die Inder, mehr als wir, großen Wert auf Autorität, Rang und Stellung, deshalb wird er von seinen Ärzten wie ein Gott verehrt. Das fällt uns Europäern schwer. Ein lapidares „Dont worry, all good“ reicht uns selten als Antwort auf all die Fragen, die wir als aufgeklärte Patienten so haben. In Indien ergeben sich die Menschen in ihr Schicksal und vertrauen dem Arzt voll und ganz. Die anderen auf unserem Europäer-Flur, eine wilde Mischung aus schwerkranken Menschen, abgedrehten Alternativen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und ganz normalen Leuten, konnten sich besser einfügen als ich, was mit Sicherheit auch daran lag, dass einige schon öfter hier waren und wussten, wie der Hase läuft. Sie haben mir erzählt, dass Dr. Kumar einmal bei einer Visite vor der verschlossenen Tür eines Patienten minutenlang stand und so lange gewartet hat, bis einer der Assistenzärzte kam, um ihm die Tür zu öffnen. Ein Brahmane öffnet keine Tür. Punkt.
Wir Europäer waren in der Klinik abgesondert von den indischen Patienten in einem eigenen Flügel untergebracht. Der Flur vor unseren Zimmern diente uns als Kommunikationsbereich und Balkon mit Blick auf den begrünten Innenhof. Man konnte den ganzen Tag zuschauen, wie die anderen Patienten kamen und gingen, Schüler der angeschlossenen Ayurveda-Universität herbei- und wieder wegströmten, Angestellte Wege und Rasen fegten oder Ärzte sich besprechend hin- und herliefen. Die Essensausgabe fand auf dem Flur statt und auch indische Patienten liefen an uns vorbei auf dem Weg zum Steam, einer Art vorsintflutlichem Dampfbad. Es war also immer etwas geboten und Europäer und Inder beobachteten sich vorsichtig staunend mit großer Freundlichkeit.
Nur „Gott“, also Dr. Kumar, machte uns immer wieder Ärger. Wir waren ihm nicht folgsam genug. Als Anna, eine Patientin aus Litauen, mit uns „richtiges“ Yoga, das etwas weniger hektisch als das von der dauergestressten Dr. Ayendra war, gemacht hat, wollte er sie fast hinauswerfen, weil sie nicht vorher um Erlaubnis gefragt hatte. Martin, einem untergewichtigen, asketischen Patienten, der mit seiner sehr hübschen Frau, einer ehemaligen Ballerina, da war, weil er zunehmen wollte, machte er große Vorwürfe und schimpfte lautstark, weil er es als Patient gewagt hatte, ohne seine Erlaubnis bei einem indischen Versandhändler etliche Dinge in die Klinik zu bestellen. Martin grinste jedoch nur gelassen und sagte trocken zum schimpfenden Chefarzt:
„Dr. Kumar, you know: Happy wife, happy life!”
Kumar ging im Angesicht dieser Unverfrorenheit die Luft aus und wir lachten sehr über diese Anekdote. Total schockiert war ich, als er einer Patientin mit Parkinson eines Tages lapidar mitteilte: „Today Haare ab“, denn er konnte ein bisschen Deutsch. Es gibt eine Behandlung, bei der man eine Art offenen Hut aufgesetzt bekommt, in den warmes Öl gegossen wird, und dafür müssen die Haare abgeschoren werden. Das ist schon eine überaus harte Behandlungsmethode, vor allem für eine Frau. Also ich weiß nicht, ob ich mir die Haare hätte abscheren lassen, wohl eher nicht. Aber der Leidensdruck bei Parkinson ist groß und da tut man viel für ein bisschen Verbesserung. Einer anderen Patientin, die darüber geklagt hatte, dass ihre Gelenke sich verformten, erklärte er, sie sei einfach alt, da wäre das ganz normal. Die gute Frau war gerade mal Anfang 50 und nach dem Gespräch mit ihm am Boden zerstört. Ja, Gott Kumar konnte den Charme einer Kreissäge entwickeln.
Ach ja, Indien. Ich war froh, als die sechs Wochen vorbei waren. Allerdings war es ein ziemlicher Schock, zurückzukommen in die Kälte, denn als ich vor ein paar Tagen aus dem sonnigen und fast 30 Grad warmen Ahmedabad kommend in München landete, war es noch recht kalt, auch wenn die Sonne schien. Es lagen sogar noch hier und da Reste des Schnees der vergangenen Wochen, was mich erstaunte, da die Temperatur bei deutlich über Null lag. Aber aufgehäufte Massen Schnee tauen natürlich langsamer als der Rest.
Eigentlich war Regen vorhergesagt, aber heute ist es sonnig und erstaunlich warm, wenn man sich im Windschatten aufhält. Gestern war ich wieder bei Frau Dr. Hartmann, unserer Polizeipsychologin, weil in Bayern der Rosenmontag ein ganz normaler Arbeitstag ist. Sie hat mir bescheinigt, dass ich gute Fortschritte gemacht habe und wieder arbeiten kann und ich habe mit Dr. Achenbach ausgemacht, dass ich am Aschermittwoch wieder zurück ins LKA kommen werde. Ich freue mich schon sehr darauf. Heute jedoch will ich mich noch einmal amüsieren, bevor der Ernst des Lebens mit Mord und Totschlag wieder beginnt.
Die Marktfrauen sind sehr bunt verkleidet und tanzen wie der sprichtwörtliche „Lump am Stecken“. Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen und mitzuschunkeln zu „Marmor, Stein und Eisen bricht“ und ähnlichen Evergreens. Ein Typ packt mich und schwenkt mich herum, was schwierig ist, weil es so nahe an der Bühne sehr voll ist und er mich ständig gegen irgendwelche Leute schleudert. Er ist schon sehr betrunken und ich muss leichte Gewalt anwenden, um mich zu befreien. Er hält sich verdutzt das verdrehte Handgelenk und starrt mir verwirrt hinterher. Dann dreht er sich um und schnappt sich die Nächste.
Jetzt stehe ich etwas weiter hinten neben einem alten Mann, der immer wieder murmelt:
„Kruzifix, wo is denn die Fanny? Die hat sich doch so auf den Tanz gfreit und jetzt is sie gar ned dabei, mei hoffentlich is der nix passiert …“
Er schüttelt immer wieder ratlos den Kopf und nimmt einen Schluck aus der Bierflasche.
„Wer ist denn die Fanny?“, frage ich ihn und er erschrickt. Aus wässrigen, kleinen Äuglein schaut er mich an, seine Wangen sind hochrot, seine Nase vom Alkohol dick und voller geplatzter Äderchen. Erst dachte ich, er habe sich als Penner verkleidet, jetzt erkenne ich jedoch, dass er gar nicht verkleidet und wohl wirklich ein Obdachloser ist.
„Des ist die Marktfrau vom Obststand vorne beim Kustermann, woaßt scho. Die is eigentlich voll dabei bei der Tanzgruppn, aber jetzat kann i sie ned findn“, murmelt er zahnlos.
„Vielleicht ist sie krank geworden?“, mutmaße ich und drehe mich neugierig zum Geschehen auf der Bühne um.
Offensichtlich fehlt tatsächlich eine Marktfrau, denn nun muss der Einpeitscher mittanzen, damit es sich mit den Paaren aufgeht. Das ist komisch, denn wenn eine krank würde, gäbe es doch bestimmt irgendeinen Ersatz, vorausgesetzt, sie hätte rechtzeitig abgesagt. Was könnte denn eine der Marktfrauen so kurzfristig davon abhalten, an diesem wichtigen Event teilzunehmen?
Ich drehe mich um, aber der alte Mann ist verschwunden. Nachdenklich quetsche ich mich durch die Menge, um zu Fannys Obststand zu gelangen. Das dauert ziemlich lange und bis dahin habe ich zwei weitere Biere und noch einen Sekt getrunken. Nach der langen Abstinenz in Indien, wo es selbstverständlich keinen Alkohol, sondern nur warmes Wasser gab, stelle ich fest, dass ich nichts mehr vertrage, ich bin bereits mehr als angeschickert.
Der Stand ist geschlossen, alles verlassen, nichts zu sehen. Ich versuche, durch die Plastikabdeckung etwas zu erkennen, aber das ist sehr schwierig, weil das Plastik die Sicht stark verzerrt. Plötzlich legt sich eine schwere Hand auf meine Schulter und ich erschrecke höllisch. In einem Reflex schlage ich sie weg und lege den Angreifer aufs Kreuz. Ein Clown, der neben uns steht, stößt einen empörten Aufschrei aus.
„Ja leckst mi am Oarsch, jetzt haut di scho die Marilyn mit ihren Megahupen um, ja geh weida.“
Ich bin entrüstet. Megahupen, spinnt der? Ich habe ein stabiles B, normalerweise. Im Moment allerdings, und da muss ich dem Clown rechtgeben, sind meine Brüste etwas größer als normal. Mein BH kneift etwas und meine Brüste quellen raus. Trotzdem, Unverschämtheit.
„Au, lass mich los, Beck, bist du irre?“, ruft mein lieber Kollege und Freund Tobias Reiter, mit dem ich beim LKA zusammenarbeite, schmerzerfüllt und windet sich unter mir. Ich brauche einen Moment, um ihn zu erkennen, denn er trägt eine blonde Lockenperücke und ist als Hippie verkleidet. Schnell lasse ich ihn los und nehme das Knie von seinem Rücken. Dann helfe ich ihm auf.
„Mann Alter, sorry. Du kannst mir doch nicht einfach die Hand auf die Schulter legen, ohne etwas zu sagen“, erkläre ich entschuldigend und versuche, den Dreck von ihm abzuklopfen. Gott sei Dank ist es trocken und die Verschmutzung hält sich in Grenzen. Er grinst schon wieder.
„Guter Reflex, Beck, guter Reflex. Ich sehe, du bist wieder fit. Sehr schön“, stellt er mit einer gewissen Erleichterung in der Stimme fest, indem er mich von oben bis unten mustert. „Aber bitte hör auf, an mir rumzufummeln, ich mach das schon selber“, fügt er lachend hinzu und schiebt energisch meine Hand weg. Ich schaue mich suchend um.
„Wo ist denn Hannah?“, frage ich erstaunt und sein Gesichtsausdruck verdüstert sich.
Kapitel 2 – Entdeckung
Dienstag, 5. März 2018 - nachmittags
Ich habe Reiter seit meiner Rückkehr aus Indien noch nicht getroffen und wenn ich ihn jetzt genau anschaue, muss ich feststellen, dass er grau und eingefallen wirkt. Sein Bart ist ungepflegt, unter seinen Augen liegen tiefe, dunkle Schatten und seine Haut ist fahl.
„Tobi, was ist los?“, frage ich alarmiert.
Er seufzt und winkt ab.
„Lange Geschichte.“ Er schaut ziemlich traurig.
Ich hake ihn unter.
„Ich hab Zeit. Komm mit, Tobi, wir trinken jetzt einen und du erzählst mir alles.“
Entschlossen schleife ihn zum nächsten Getränkestand. Mit zwei Bier bewaffnet stellen wir uns an die Wand von Fannys Obststand in die Sonne und beobachten das wilde Treiben um uns herum. Hier ist es relativ ruhig, da der Stand geschlossen ist. Ich lasse ihm Zeit, doch er schweigt. Also frage ich irgendwann, als ich es nicht mehr aushalte:
„Was ist los mit Hannah und dir?“
„Sie hat mich verlassen“, sagt er tonlos und nimmt einen großen Schluck aus seiner Bierflasche.
„WAS?“, rufe ich entsetzt und starre ihn fassungslos an. „Warum? Das verstehe ich nicht.“
Er zuckt mit den Schultern.
„Ich, ehrlich gesagt, schon, aber auch irgendwie nicht. Sie hat mir im Januar, kaum, dass du weg warst, eröffnet, dass sie darüber nachgedacht habe und zu dem Schluss gekommen sei, dass ein Mann mit so einem gefährlichen Beruf nichts für sie sei. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört.“
„Aber hast du denn nicht versucht, nochmal mit ihr darüber zu sprechen?“, frage ich erstaunt.
„Wozu? Sie hat ihre Entscheidung getroffen, was soll ich da noch groß diskutieren? Sie hat ja Recht, unser Beruf ist gefährlich und wegen uns ist ihr Bruder tot. Insofern durchaus verständlich, auch wenn ich es nicht fassen kann, denn zwischen uns war so viel Gefühl und ich dachte, das würde ausreichen.“ Er starrt traurig in seine halbvolle Bierflasche. „Sie hat mir noch nicht mal die Möglichkeit gegeben, mich versetzen zu lassen oder mir einen anderen Job zu suchen“, sagt er und schaut mich offen an. „Ich hätte für diese Frau alles getan, Lana, alles. Aber sie gibt mir noch nicht einmal die Gelegenheit dazu.“
Zutiefst erschüttert schüttelt er immer wieder seinen gesenkten Kopf.
Ich seufze tief auf. Dieser Drecksack Giuliano Farlone hat mit der Ermordung Kilians nicht nur mein, sondern auch Hannahs und Reiters Leben ruiniert. Es fällt mir immer noch schwer, zu akzeptieren, was passiert ist, und ich fühle mich auch immer noch schuldig, denn schließlich habe ich mich verantwortungslos verhalten, indem ich mit ihm Sex hatte, auch wenn es nur einmal war. Aber wer rechnet denn damit, dass einer, mit dem man einmal Sex hatte, sofort den Nebenbuhler mittels Killerkommando aus dem Weg räumen lässt? Schließlich konnte ich nicht ahnen, dass er ein als Priester verkleideter Mafiaspross war. Ich seufze noch einmal tief auf, lege Reiter sanft den Arm um die Hüfte und lehne mich an ihn.
„Schöne Scheiße, es tut mir soo leid“, stelle ich trocken fest und nehme noch einen Schluck aus meiner Bierflasche.
Ich hatte keine Ahnung von dieser Entwicklung! Hannah hat mir bei unseren kurzen Telefonaten nichts erzählt und da ich in Indien war, habe ich nichts davon mitbekommen. Was für eine Art Freundin ist das denn? Vermutlich wollte sie mich schonen.
Eine ganze Weile stehen wir so in der Sonne und schauen auf die feierwütige Menge. Jede Leichtigkeit ist von mir abgefallen, die Realität hat mich wieder. Wir werden immer wieder angetanzt und aufgefordert, mitzumachen. Dann prosten wir den Leuten freundlich zu, lehnen aber ab.
„Vielleicht sollten wir uns einfach amüsieren?“, frage ich Reiter und schaue zu ihm auf. Er nickt.
„Ich hole uns noch zwei Bier.“
Während ich warte, dass er zurückkommt, rutsche ich etwas zur Seite, damit wir weiter Sonne abbekommen. Ein junger Typ mit Bart im Känguru-Kostüm kommt angehoppelt und zieht aus seiner Bauchtasche eine Schnapsflasche mit zwei Gläsern.
„Komm, Marilyn“, sagt er munter, „trink einen mit mir.“
Ich muss lachen und nicke. Wir prosten uns zu und kippen einen sehr leckeren Haselnussschnaps auf einmal hinunter. Wenn das so weitergeht, fange ich meinen ersten Arbeitstag mit einem veritablen Kater an. Diese Durcheinander-Sauferei kann nicht gesund sein.
Schon hat mich das Känguru gepackt und küsst mich. Was für ein schöner Kuss. Ich bin fasziniert und verliere mich in diesem warmen, schönen Gefühl. Oh, den Typen könnte ich ewig küssen, meine Herren, der weiß, wie es geht. Genau der richtige Einsatz an Zunge, nicht zu viel Speichel und sehr viel Gefühl. Ein perfekter Kuss.
Er schaut mich einen Moment erstaunt an, dann küsst er mich gleich noch einmal. Als er sich von mir löst, sagt er:
„Wow, Marilyn, das war toll. Was für ein unglaublicher Kuss. Gibst du mir deine Nummer?“ Dabei schaut er mich mit einem frechen Grinsen an.
„Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll, aber gut, warum nicht. Hast du was zu schreiben?“
Er schüttelt traurig den Kopf.
„Nein, darauf war ich nicht vorbereitet, tut mir leid.“
„Hast du vielleicht ein Handy dabei?“
Er schlägt sich an den Kopf.
„Klar, Handy! Heute stehe ich aber echt auf dem Schlauch, sorry.“
Umständlich fummelt er ein sehr modernes und auch teures Smartphone aus seiner Bauchtasche und ich gebe meine Nummer unter dem Namen Marilyn ein.
„Wie heißt du denn?“, frage ich.
„Känguru Jonas, immer zu Diensten“, ruft er fröhlich und hoppelt davon, nicht ohne mich noch einmal sehr schön zum Abschied zu küssen.
Er ist kaum weg, da kommt Reiter zurück. Er hat überall Lippenstiftflecken und ich muss lachen.
„Hey, was ist denn mit dir passiert?“
Er winkt gutmütig ab.
„Da werden Weiber zu Hyänen und treiben mit Entsetzten Scherz“, zitiert er aus Schillers Glocke und drückt mir die beiden Bierflaschen in die Hand. Er macht mir ein Zeichen, dass er schnell in den Durchgang neben uns, der windstill ist, geht, um sich eine Zigarette anzuzünden. Dabei lehnt er sich wohl recht schwungvoll an die Tür des Standes, um einen ersten Zug zu nehmen. Plötzlich tut es einen Schlag und Reiter liegt schon wieder wie ein Maikäfer auf dem Rücken. Offensichtlich war die Tür gar nicht geschlossen, sondern nur geschickt angelehnt.
Neugierig spähe ich in den Raum dahinter, nachdem ich Reiter auf die Beine geholfen habe. Es dauert einen Moment, bis sich meine Augen an die Lichtverhältnisse gewöhnt haben, aber dann kann ich alles nach und nach gut erkennen. In dem kleinen Lagerraum stapeln sich Kisten mit Gemüse und Früchten, es schaut sehr chaotisch aus und ich kann nicht gleich erkennen, ob es sich einfach um Unordnung oder um einen Einbruch handelt. Mein Gefühl tendiert zu Letzterem.
„Was ist denn hier los?“, frage ich Reiter und er späht über mich hinweg in den Raum.
„Keine Ahnung“, sagt er schulterzuckend und scheint schon wieder das Interesse verloren zu haben.
„Da stimmt doch was nicht.“ Ich mache mich auf den Weg, um mir alles genauer anzusehen.
„Lana, du kannst doch da nicht so einfach reingehen“, ruft mir Reiter halbherzig hinterher, doch ich winke nur ab. Neugierig schaue ich mich um, dann entringt sich ein entsetztes Keuchen meiner Kehle. Da liegt jemand in einem quietschbunten Kostüm auf dem Boden, begraben unter mehreren Kisten. Ich laufe hin, um zu schauen, ob ich helfen kann, vielleicht ist Fanny, denn ich vermute nun, dass es sich um sie handelt, ohnmächtig geworden oder hatte einen Unfall. Vorsichtig beuge ich mich zu ihr hinunter und berühre sie. Sie ist eiskalt und die Leichenstarre hat bereits eingesetzt. Schnell richte ich mich wieder auf und gehe nach draußen, um einen Notruf abzusetzen und die KTU anzufordern. Sollte sie keines natürlichen Todes gestorben sein, möchte ich keine Spuren verwischen.
Reiter sichert ab, nachdem ich ihm zugerufen habe, dass wir hier eine Leiche hätten. Er steht wie ein Baum vor der Tür und lässt keinen durch, bis die Kollegen eintreffen. Der Vorteil an dem schmalen Durchgang ist, dass man ihn gut sichern kann. Ich habe mich in der Zwischenzeit vorsichtig etwas umgeschaut. Es wirkt so, als wäre jemand eingebrochen und hätte etwas gesucht. Womöglich hat sie den Einbrecher überrascht und er hat sie getötet? Es kann aber auch sein, dass sie etwas aus einer der oberen Kisten holen wollte und die stürzten dann auf sie herab und begruben sie unter sich, was ein Unfall wäre und damit völlig unspektakulär. Auf jeden Fall ist es ein Todesfall mit ungeklärter Ursache und das sollten sich ein Gerichtsmediziner und die Spurensicherung auf jeden Fall anschauen.
An der Tür hängt ein Schild mit einer Telefonnummer für den Notfall. Ich rufe dort an, es antwortet jedoch niemand.
Es dauert eine Zigarettenlänge, bis wir Bernie, unseren schlaksigen Rechtsmediziner, kommen sehen. Er schlängelt sich durch die Menge, seinen Koffer in der Hand, und lässt es sich nicht nehmen, bereitwillig eine junge Dame auf dem Weg, die dies einfordert, zu küssen. Unser Leichenfleddererstenz, immer im Einsatz. Ich muss grinsen. Meine Kollegen haben mir in der langen Zeit der Abwesenheit tatsächlich auch etwas gefehlt.
Er fällt ausnahmsweise in seinem weißen Ganzkörperkondom überhaupt nicht auf. Seine Haare sind so lang geworden, dass er sie schon zu einem kleinen Pferdeschwänzchen zusammenbinden kann.
„Grias Eich“, sagt er jovial und stellt seine Tasche ab. „Lana, bist wieder zruck aus Indien? Wolltens di da ned behalten, passt doch so gut dahin mit deinem persischen Aussehen“, lacht er mir her.
Ich verdrehe die Augen.
„Mei Bernie, du bist so deppert, die Perser schaun ganz anders aus als die Inder“, sage ich gutmütig und küsse ihn auf die Wange. „Schön, dich zu sehen“, füge ich hinzu und lächele ihn liebevoll an.
Er streicht mir sanft über die Wange.
„Guad, dassd wieda da bist“, sagt er sanft und wendet sich dann an Reiter. „Geh weida, Reiter, du schaugst ja jeden Tag bschissener aus.“
Das ist eine reichlich taktlose Bemerkung, was Reiter jedoch nur mit einem Knurren quittiert. Bernie macht sich sofort konzentriert an die Arbeit, nicht ohne uns zu Aufpasser-Diensten zu verdonnern.
„I will da koane anderen Spuren haben, also haltet‘s mir bitte die Leidln, vor allem die Bsoffenen, vom Hals“, brummt er.
Nach einer Weile kommt er zurück, um eine mit Reiter zu rauchen. Mein lieber Kollege, der in der Zeit, als er mit Hannah zusammen war, kaum mehr geraucht hat, scheint wieder voll drauf zu sein. Bernie macht dem Fotografen, der mit uns vor der Tür gewartet hat, ein Zeichen.
„Kannst loslegen, Peter. Is a wengal eng und Licht hat‘s auch ned so viel, aber das geht scho“, ruft er ihm zu.
Peter verschwindet eifrig mit seiner Kamera in dem Abstellraum, aus dem es dann dauerhaft blitzt, während ich Bernie mit Fragen löchere.
„Was war da jetzt los? Ist das ein Mord? Oder eher ein Unfall? War das ein Einbruch? Los, sag schon, woran ist sie denn gestorben? Kannst du schon was sagen, eine erste Einschätzung vielleicht?“
Bernie zieht genüsslich an seiner Zigarette, dann schaut er mich von oben herab an.
„Mei Lana, jetzt bist schon so lang dabei und immer wieder dasselbe. Etwas mehr indische Gelassenheit hätt ich jetzt scho von dir erwartet. Aber gut, pass auf. Ich glaub es war ein Mord, das kann ich aber noch überhaupt gar ned beweisen. Sie ist entweder erstickt, denn sie lag mit dem Gesicht in einem Haufen mit Kartoffeln, oder aber die Kisten, die auf sie draufgefallen sind, haben sie getötet. Ohne sie zu obduzieren und irgendwelche Spuren zu finden müsst ich eigentlich von einem Unfall ausgehen, aber irgendwas ist komisch. Die Tür ist auch gar ned aufgebrochen worden, sagen die Kollegen von der Spusi, also kann ich jetzt eigentlich nur davon ausgehen, dass sie reingegangen ist, was holen wollte, die Kisten auf sie gestürzt sind und sie mit dem Gesicht in den Kartoffelhaufen gefallen ist. Höchstmögliches Unfallpech, sozusagen. Aber trotzdem, i woaß ned recht.“
Sobald Bernie von einem Fall spricht, redet er ein halbwegs passables Hochdeutsch.
Ich nicke ihm zu.
„Danke Bernie. Mein Gefühl sagt dasselbe, irgendwas ist komisch bei der Geschichte“, überlege ich laut und drehe mich aufgeregt zu Reiter um.
„Reiter, falls es ein Mord wäre, dann könnte der Täter hier noch irgendwo rumschwirren, oder?“
Mein Kollege guckt griesgrämig, zieht nachdenklich an seiner Zigarette und verdreht die Augen, dann winkt er ab und schüttelt den Kopf.
„Vergiss es. Wie sollen wir in dem Chaos irgendwas ermitteln? Dazu haben wir viel zu wenige Leute und ich zum Beispiel halte viel von der Unfalltheorie. Lass Bernie erstmal obduzieren, dann sehen wir weiter. Jetzt gilt es, ohne großes Aufsehen die Leiche hier wegzuschaffen. Wir wollen den Leuten ja nicht ihren Spaß verderben, gell?“
Da es keine Seltenheit ist, dass beim Fasching auf dem Viktualienmarkt auch mal der Sanka kommt, lassen wir Fanny Gruber, um die handelt es sich nämlich tatsächlich, wie der Vergleich mit dem Ausweis, den sie bei sich hat, ergeben hat, nach Rücksprache mit Dr. Achenbach vom Rettungswagen in die Gerichtsmedizin bringen. Die dürfen zwar im Normalfall keine Leichen transportieren, in Ausnahmefällen kann das aber genehmigt werden.
In der Tat gucken zwar die Leute neugierig, nehmen aber bei weitem nicht so viel Notiz von der Angelegenheit als wenn die Bestatter mit ihrem Zinksarg aufgetaucht wären. Die meisten hier denken wohl, dass wir lediglich jemanden mit einer Alkoholvergiftung zur Ausnüchterung bringen.
Wir schauen erst dem Sanka nach und werfen dann einen Blick auf das wilde Faschingstreiben um uns herum.
„Also mir ist die Lust vergangen“, sage ich traurig.
„Mir auch“, brummt Reiter, „mir auch. Gehn wir heim. Bis morgen, Beck, da ist auch noch ein Tag. Wir sehen uns im Büro.“
Ich küsse ihn sanft auf die Wange, drücke seine Hand und mache mich auf den Weg zum Marienplatz zur S-Bahn. Überall sind die Leute sehr lustig bis unangenehm betrunken. Ich erwäge kurzfristig, mich einer amüsanten Männertruppe anzuschließen, die mich alle fröhlich auffordern, doch keine Spielverderberin zu sein und mit ihnen zu feiern, doch ich stelle fest, dass ich überhaupt keine Lust dazu verspüre. Also entschuldige ich mich fröhlich lachend und gehe weiter.
Da ich mir die Zugfahrt nach Hause mit all den Betrunkenen jetzt doch etwas anstrengend vorstelle, beschließe ich, einfach weiter geradeaus zu Fuß nach Neuhausen in die Elvirastraße, in der ich wohne, zu laufen, um etwas auszunüchtern. Bewegung wird mir jetzt guttun, ich muss morgen schließlich fit sein.
Kapitel 3 – Mord
Mittwoch, 6. März 2018 – vormittags
Nach dem ausgiebigen Spaziergang falle ich völlig erledigt auf meine mit Kissen bestückte Liegewiese, die mir auch als Bett dient, weil meine Wohnung so klein ist, und schlafe sofort ein. Als ich um 21 Uhr kurz wach werde, ziehe ich mich schnell aus, trinke eine Flasche Wasser und verkrieche mich wieder unter der Bettdecke.
Um sechs Uhr schlage ich die Augen auf und um den Kater, der sich deutlich bemerkbar macht, komplett zu vertreiben, gehe ich am Nymphenburger Schlosskanal joggen. Ich muss versuchen, wieder fit zu werden, denn die letzten Wochen habe ich außer Yoga nicht viel Sport getrieben. Meine erste Verbrecherjagd wird voraussichtlich ein Desaster.
Ich laufe dick angezogen meine Runde und freue mich. Das Laufen tut mir richtig gut, auch wenn es saukalt ist. Wir haben Frühlingswetter, morgens ist es noch recht frostig, aber tagsüber in der Sonne schön warm. Die sportliche Betätigung weckt meine Lebensgeister, ich bin schon viel munterer.
Wieder daheim trinke ich entspannt einen ersten Kaffee, nachdem ich geduscht habe. Meine schwarze Jeans geht nicht mehr zu. Ich habe im Moment einen etwas aufgeblähten Bauch, der verhindert ein Schließen des Knopfes.
Seit Indien nehme ich stetig zu, obwohl ich gefühlt kaum etwas esse. Das hängt sicher mit der anderen Ernährung und dem umgestellten Stoffwechsel zusammen. Ich muss zugeben, dass ich mich nicht an die Ernährungsempfehlung des indischen Gurus gehalten und ganz normal gegessen habe. Ein schöner Schweinsbraten mit Knödel und Krautsalat, eine Leberkässemmel, ein Schnitzel – daran kann doch nichts falsch sein. Es hat mir auch hervorragend geschmeckt, obwohl mir meine Mitinsassen in Indien prophezeit hatten, dass mir das nach der Zeit in Indien und der ganzen ayurvedischen Küche nicht mehr schmecken würde, aber weit gefehlt. Ich finde es jetzt noch besser als vorher.
Kumar-Gott hat bestimmt recht damit, dass ich renitent bin.
Ich muss mir dringend einen neuen BH kaufen, denn meine Brüste sind eindeutig gewachsen. Ich wusste gar nicht, dass das auch noch mit Anfang 30 passieren kann. Das ist ein eindeutiges C, das lässt sich nicht mehr leugnen. Ich bin etwas verzweifelt – ich hasse große Brüste, die sind lästig, tun weh und stören, vor allem, wenn man Verbrecher jagt. Nachdenklich trinke ich den Rest vom Kaffee, den ich mir morgens immer mit dem alten Kaffeefilter meiner Oma aufbrühe, und überlege.
Wann hatte ich eigentlich das letzte Mal so richtig meine Tage?
Das ist schon ziemlich lange her, wenn ich es recht erinnere. Kein Wunder nach dem ganzen Stress, der Körper leidet auf verschiedenen Ebenen. Die Pille nehme ich seit Kilians Tod nicht mehr, wofür auch. Vielleicht hat das alles durcheinandergebracht? Ich mache mir eine Notiz im Handy, dass ich Dr. Frankheimer, meinen Frauenarzt, anrufe und einen Termin vereinbare.
Pünktlich laufe ich im LKA ein. Die Kollegen begrüßen mich alle sehr freudig und ich brauche bestimmt eine Stunde, bis ich richtig zu arbeiten anfangen kann. Reiter schlurft mit hängenden Schultern ins Büro, hängt seine Jacke auf und schaltet den Computer ein.
„Guten Morgen“, flöte ich, „nicht gut geschlafen?“
Er brummt nur in seinen veritablen, streckenweise sehr grauen Hipsterbart, den er sich die letzten Wochen hat stehen lassen, streicht sich durch die kurzen, dunklen Haare, die noch mehr von grauen Strähnen durchzogen sind als früher, und verlässt das Büro Richtung Kaffeemaschine. Ich springe auf und folge ihm. Schweigend lassen wir Kaffee aus dem fauchenden und zischenden Automaten in unsere Tassen plätschern.
„Warst du gestern noch unterwegs?“, frage ich neugierig auf dem Rückweg, während ich meine Tasse balanciere und versuche, nicht zu kleckern. Wir wollen schließlich keinen Ärger. Dummerweise ist die Fleckenstraße vom Kaffeeautomaten zu unserem Büro schon recht ausgeprägt. Es wird nicht lange dauern und Achenbach wird uns einen Vortrag halten.
Reiter schaut mich aus blutunterlaufenen, blauen Augen an und verschüttet dabei etwas Kaffee auf seinen Schreibtisch.
„War ein Fehler“, murmelt er, dann stellt er die Tasse ab, wischt mit seinem Ärmel über die verschmutzte Schreibtischfläche und wendet seine Aufmerksamkeit dem Bildschirm zu.
Gespräch beendet, soll das wohl heißen.
Schweigend arbeiten wir. Ich brauche allein den ganzen Vormittag, um mich durch alle Mails zu wühlen. 1.895 neue Nachrichten, das ist ein Wort. Das meiste davon irrelevant, dazwischen versteckt aber immer wieder Wichtiges. Ich setze den Filter auf Absender und lösche alles, was unwichtig ist. Dann kümmere ich mich um die anderen Nachrichten, das sind allerdings immer noch 598.
Um elf Uhr klingelt das Telefon und Bernie zitiert uns in die Nußbaumstraße, wo die Rechtsmedizin beheimatet ist und die Obduktionen stattfinden. Ich bin froh, rauszukommen, und lasse liebend gerne sofort alles stehen und liegen. Reiter scheint es ähnlich zu gehen, denn er steht ebenfalls sofort auf und streift sich seine Jacke über. Unten hält er mir den Schlüssel für unseren Dienstwagen hin.
„Magst du fahren?“, fragt er und ich schaue ihn erstaunt an. Das hatten wir noch nie, bisher hat er es als sein angestammtes Recht angesehen, das Einsatzfahrzeug zu fahren. Ich grinse ihn dreckig an.
„Klar, ich glaube, ich bin wesentlich nüchterner als du.“
Er hat den Anstand, leicht zu erröten.
„Ich bin gestern noch beim Andechser hängengeblieben, es wurde spät mit viel, sehr viel Alkohol“, versucht er sich an einer Erklärung. Ich winke nur generös ab.
„Kein Problem, den Tag überstehst du schon. Aber heute Abend keinen Alkohol, bitte. Und früh schlafen gehen, ich brauche einen verlässlichen Partner.“
Ernst nickt er.
„Kein Problem, ist ja jetzt Fastenzeit, da trinke ich eh keinen Alkohol mehr“, sagt er müde und schließt die Augen. Er gibt tatsächlich während der kurzen Fahrt keinen weiteren Kommentar ab, weder zu meinem Fahrstil, was erstaunlich genug ist, noch zu unserer Umgebung. Höflich öffnet Reiter mir die Tür zum rechtsmedizinischen Institut, nachdem ich, wie ich finde, bravourös eingeparkt habe. Tim Pfeffer, Bernies gewichtiger Assistent, räumt gerade Schubladen ein. Er dreht sich um und strahlt bei meinem Anblick.
„Ja Servus Lana, auch wieder da? Das ist schön, wir haben dich schon vermisst“, ruft er und ich winke ab.
„Geh weida, Tim, das ist doch geschwindelt. Du willst nur nett sein.“
Er errötet leicht, dann grinst er spitzbübisch.
„Doch, glaub mir, das stimmt wirklich.“
Ich muss lachen.
„Ja, ja, du alter Charmeur. Wo ist denn dein Chef?“
Er deutet auf eine Tür.
„Da durch und dann bitte Raum 3“, sagt er freundlich, während er fortfährt, stoisch weiter einzusortieren.
Ich freue mich, dass er noch da ist, denn Bernhard Maria Graf, wie unser Rechtsmediziner Bernie eigentlich heißt, hatte die letzten Jahre eine hohe Fluktuation und seine bisherigen Assistenten blieben selten länger als drei Monate, was allerdings wohl daran lag, dass es Frauen waren, mit denen er grundsätzlich etwas anfing. Die Entscheidung für einen männlichen Assistenten war ziemlich schlau von Bernie. An der Tür drehe ich mich um.
„Hast du abgenommen?“, rufe ich Tim zu und er errötet leicht.
„Ja, hab ich, das freut mich, dass du das bemerkt hast“, strahlt er. Tim ist dermaßen übergewichtig, dass er immer noch fett ist, aber eben nicht mehr so sehr.
„Was machst du?“, frage ich neugierig. Vielleicht hat er einen guten Rat, so dick, wie ich im Moment bin.
„Low Carb und FdH.“ Er wirft sich stolz in die Brust und ich nicke.
„Cool, weiter so“, rufe ich ihm aufmunternd über die Schulter zu und folge Reiter, der schon vorgegangen ist.
Wir finden Bernie über Fanny Gruber, die er bereits aufgeschnitten hat, gebeugt. Er trägt einen blutverschmierten Kittel und hat eine Stirnlampe mit einer starken Leuchte auf dem Kopf. Die ganze Szene schaut etwas gespenstisch aus. Mit dem Skalpell in seinen Gummihandschuhen dreht er sich zu uns um, als wir ein lautes „Grüß Gott“ in den Raum werfen.
„Servus Lana, Servus Reiter. Habt‘s euch schon erholt von gestern?“, fragt er mit einem boshaften Unterton.
Ich muss grinsen.
„Klar, wir sind fit. Also, Bernie, was hast du für uns? Haben wir einen Fall oder nicht?“
Er schaut uns triumphierend an.
„Das war nicht leicht und ich wollte es schon als Unfall einstufen, als ich auf ihrem Hinterkopf unter den Haaren Hämatome gefunden hab, die von Fingern stammen müssen und nicht von einer Kiste oder Gemüse verursacht sein können. Jemand hat sie sehr heftig in den Kartoffelhaufen gedrückt, bis sie sich nicht mehr gerührt hat. Das bedeutet, es muss eine starke Person gewesen sein, denn Fanny Gruber, 56 Jahre alt, 165 cm groß und 65 kg schwer, war eine kräftige Frau. Sie hat eine ausgeprägte Muskulatur in Armen und Beinen, was auf starke körperliche Betätigung schließen lässt. Die Nummer mit den umgestürzten Kisten ist meiner Meinung nach nur zur Vertuschung passiert, da muss die KTU schaun, ob sie Fingerabdrücke oder ähnliches findet. Die Spuren unter ihren Fingernägeln muss ich noch auswerten. Sie scheint sich gewehrt zu haben und hat den Angreifer womöglich gekratzt. Ich wollt euch nur schnell wissen lassen, dass wir tatsächlich einen Fall haben.“
„Was heißt denn wir? Der Fall geht doch dann ans zuständige Kommissariat?“, frage ich Bernie und schaue zu Reiter, der ratlos mit den Schultern zuckt und wiederum Bernie mustert. Der schlägt sich bei meinen Worten an die Stirn:
„Ach so, ja, halt, das hab ich ganz vergessen. Ich hab Spuren von Drogen, also Marihuana und etwas Kokain, auf ihrer Kleidung gefunden, was bedeutet, dass ihr im Spiel seids. Das scheint a größere Nummer zu sein und der Fall wurde bereits ans LKA verwiesen, zumindest soweit ich weiß.“
Ich starre ihn an.
„Bist du irre? So eine wichtige Info einfach zu vergessen? Also ehrlich“, schimpfe ich.
„Sorry, ist mir durchgerutscht. Für mi is des ned ganz so relevant, deswegen ned in meim Fokus. Für eich natürlich entscheidend, des stimmt scho. Koa Absicht“, nuschelt er geistesabwesend und ist schon wieder ganz bei seiner Leiche.
Reiter packt mich am Ärmel meiner leichten, schwarzen Daunenjacke und zieht mich hinter sich her.
„Lass gut sein, Beck. Wir fahren zurück und sprechen mit den Kollegen über die Zuständigkeiten. Dann sehen wir weiter.“
Er hat natürlich – wie fast immer – recht. Also fahren wir wieder zurück und kommen gerade rechtzeitig zu einem kurzfristig angesetzten Meeting. Achenbach überträgt erwartungsgemäß Reiter und mir die Ermittlungsarbeit, unterstützt vom Vorzeigebayern Rudy Thalhammer, der nicht sonderlich begeistert ist, dass er von seinem aktuellen Fall, den er zusammen mit seinem wieselflinken Partner Ferdi Brunnthaler bearbeitet, abgezogen werden soll. Er versucht aufzumucken.
„Chef, ich bin da mit dem Ferdi grad an einer wichtigen Sache dran, könnten Sie nicht der Delia Beaufort den neuen Fall zuweisen?“
Achenbach schaut ihn verwundert an, denn normalerweise redet der Rudy nicht so viel und wehrt sich auch eher selten, wenn er was machen soll, schüttelt dann aber den Kopf.
„Nein, tut mir leid, Sie sind für den Fall genau der Richtige. Immerhin ermitteln wir auf dem Viktualienmarkt und die Leute dort sind sehr speziell. Frau Beck ist für die rein optisch eine Ausländerin und Herr Reiter ist denen zu wenig bayerisch, weil er nicht aus München kommt. Frau Beaufort“, er wendet sich an unsere nervige Kollegin, mit der keiner arbeiten möchte, „Sie unterstützen bitte in der Zwischenzeit Ferdi Brunnthaler, bis der Fall Fanny Gruber aufgeklärt ist und Rudy Thalhammer wieder zurückkommt, okay?“
Delia streicht sich affektiert über ihren straff zurückgebundenen Knoten, dem kein Härchen entweichen kann, und nickt, nachdem sie Ferdi, den sie nicht leiden kann, weil er so österreichisch direkt ist, einen wenig freundlichen Blick zugeworfen hat.
„Ja, selbstverständlich Chef“, säuselt sie und mir wird schlecht. Was für eine dämliche Kuh.
Ich glaube aber tatsächlich, dass der Achenbach mit seiner Einschätzung der Lage recht hat. Es kann nie schaden, in so einem Fall einen waschechten Münchner bei den Befragungen dabei zu haben. Natürlich sind Reiter und ich auch Bayern, aber Reiter kommt aus Oberbayern und seine Mutter ist aus Hessen zugezogen, als sie sich im Urlaub in Reiters Vater verliebt hat. Ich fühle mich als Niederbayerin, weil ich da geboren und aufgewachsen bin, doch mit meinem persischen Vater, der in den 70ern den Iran fluchtartig verlassen hat, würde mich ein Bayer nie als Bayerin ansehen, sondern immer als Ausländerin, Dialekt und Sozialisierung hin oder her. Ein „richtiger“ gebürtiger Münchner kann es rausreißen und den entscheidenden Impuls geben, dass doch der eine oder andere mit uns spricht. Da sind die Leute in dieser Stadt eigen.
Außerdem bekommen wir noch Marlon Brandner, einen Studenten, der im 3. Ausbildungsabschnitt der 2. Qualifikationsebene des dualen Studiums zum Kommissar ist, als Assistenten zugewiesen. Marlon ist 21 Jahre alt, groß und schlaksig. Seine Klamotten schlottern ihm um den Körper, die sind mindestens drei Nummern zu groß gekauft. Er hat eine scharf geschnittene Nase, graugrüne Augen und einen schmalen Mund. Der ganze Typ wirkt sehr eckig und kantig. Das Schönste an ihm sind seine dichten, rotbraunen Haare bis zum Kinn, die er sich ständig hinter die Ohren streicht, und seine klugen Augen, die wach und intelligent Sachverhalte sofort zu erfassen scheinen.
Als wir mit Marlon und Rudy im Schlepptau in ein Besprechungszimmer gehen, flüstert mir Reiter vertraulich zu:
„Der Marlon ist super, Beck.