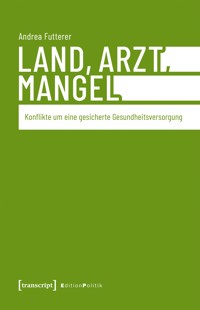
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Edition Politik
- Sprache: Deutsch
In ganz Deutschland sehen sich Kommunen herausgefordert, Lösungen für die ärztliche Unterversorgung zu finden. Strukturschwache Regionen sind besonders vom »Landarztmangel« betroffen. Vielerorts machen sich die Bürgermeister*innen der betroffenen Gemeinden ohne eine formale Zuständigkeit auf, diesen Missstand durch lokale Initiativen zu bekämpfen. Andrea Futterer wirft einen Blick auf die Hindernisse dieser Maßnahmen und zeigt, warum sie oft nur begrenzt dabei helfen, die Versorgungslage zu stabilisieren. Es wird deutlich: Soll die ärztliche Versorgung flächendeckend gesichert werden, bedarf es struktureller Interventionen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die freie Verfügbarkeit der E-Book-Ausgabe dieser Publikation wurde ermöglicht durch Pollux – Informationsdienst Politikwissenschaft
und die Open Library Community Politik 2024 – einem Netzwerk wissenschaftlicher Bibliotheken zur Förderung von Open Access in den Sozial- und Geisteswissenschaften:
Vollsponsoren: Technische Universität Braunschweig | Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg | Eberhard-Karls Universität Tübingen | Freie Universität Berlin – Universitätsbibliothek | Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek | TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek | Humboldt-Universität zu Berlin | Justus-Liebig-Universität Gießen | Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt | Ludwig-Maximilians-Universität München | Max Planck Digital Library (MPDL) | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Ruhr-Universität Bochum | Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, Hamburg | SLUB Dresden | Staatsbibliothek zu Berlin | Bibliothek der Technischen Universität Chemnitz | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | Universitätsbibliothek „Georgius Agricola“ der TU Bergakademie Freiberg | Universitätsbibliothek Kiel (CAU) | Universitätsbibliothek Leipzig | Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf | Universitäts- und Landesbibliothek Münster | Universitäts- und Stadtbibliothek Köln | Universitätsbibliothek Bielefeld | Universitätsbibliothek Erfurt | Universitätsbibliothek der FernUniversität in Hagen | Universitätsbibliothek Kaiserslautern-Landau | Universitätsbibliothek Kassel | Universitätsbibliothek Osnabrück | Universität Potsdam | Universitätsbibliothek St. Gallen | Universitätsbibliothek Vechta | Zentralbibliothek ZürichSponsoring Light: Bundesministerium der Verteidigung | Bibliothek der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | Bibliothek der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | Bibliothek der Westsächsischen Hochschule Zwickau | Bibliothek der Hochschule Zittau/Görlitz, Hochschulbibliothek | Hochschulbibliothek der Hochschule Mittweida | Institut für Auslandsbeziehungen (IfA) | Landesbibliothek Oldenburg | Österreichische ParlamentsbibliothekMikrosponsoring: Bibliothek der Berufsakademie Sachsen | Bibliothek der Evangelische Hochschule Dresden | Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig | Bibliothek der Hochschule für Bildende Künste Dresden | Bibliothek der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden | Bibliothek der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig | Bibliothek der Palucca-Hochschule für Tanz Dresden | Leibniz-Institut für Europäische Geschichte | Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) – Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit
Andrea Futterer
Land, Arzt, Mangel
Konflikte um eine gesicherte Gesundheitsversorgung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Lizenz (BYSA). Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung des Urhebers die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium für beliebige Zwecke, auch kommerziell, sofern der neu entstandene Text unter derselben Lizenz wie das Original verbreitet wird.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmaterial. Die Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellenangabe) wie z.B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. weitere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber.
Erschienen 2024 im transcript Verlag, Bielefeld
© Andrea Futterer
Umschlaggestaltung: Maria Arndt, Bielefeld
Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar
https://doi.org/10.14361/9783839471371
Print-ISBN: 978-3-8376-7137-7
PDF-ISBN: 978-3-8394-7137-1
EPUB-ISBN: 978-3-7328-7137-7
Buchreihen-ISSN: 2702-9050
Buchreihen-eISSN: 2702-9069
Inhalt
Vorwort
1Die ambulante medizinische Versorgung ländlich geprägter Regionen: ein System organisierter Unverantwortlichkeit?
2Gegenstandserläuterungen und Forschungslage
2.1Die Strukturprinzipen und wandelbare Regulierung des Gesundheitssystems
2.2Debatten zur ärztlichen Versorgung ländlicher Regionen
3Der theoretisch-konzeptionelle Zugang zur Entschlüsselung der Staat-(Zivil-)Gesellschafts-Beziehung
3.1Infrastrukturpolitik: Staatliche Gewährleistung öffentlicher Güter
3.2Die ständige diskursive Rekonfiguration der Sozialstaatlichkeit
4Methodologie, Operationalisierung und Vorgehen
5Die lokale Politisierung und Bekämpfung der ärztlichen Versorgungsdefizite
5.1Landkreis Leer, Niedersachsen
5.1.1Der mediale Diskurs in der Ostfriesen-Zeitung
5.1.2Pfad: Lose Kooperationsbestrebungen im Landkreis Leer
5.1.3Zwischenfazit
5.2Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
5.2.1Der mediale Diskurs in der Märkischen Allgemeinen Zeitung und den Potsdamer Neueste Nachrichten
5.2.2Pfad: Zurückhaltung in der kommunalen Strategiebildung
5.2.3Zwischenfazit
5.3Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
5.3.1Der mediale Diskurs im Trierischen Volksfreund
5.3.2Pfad: Die Kommunen reiben sich ab, während die KV RLP sich politisch profiliert
5.3.3Zwischenfazit
5.4Vogelsbergkreis, Hessen
5.4.1Der mediale Diskurs in der Oberhessischen Zeitung
5.4.2Pfad: Die gemeinsame Suche nach dem Vogelsberger Weg
5.4.3Zwischenfazit
5.5Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
5.5.1Der mediale Diskurs in der Altmark Zeitung und der Volksstimme
5.5.2Pfad: Mit einem Maßnahmenkatalog gegen den Ärztemangel
5.5.3Zwischenfazit
5.6Landkreis Ansbach, Bayern
5.6.1Der mediale Diskurs in Nordbayern und Fränkischer
5.6.2Pfad: Der Kreis versucht die kommunalen Bearbeitungsstrategien zu steuern
5.6.3Zwischenfazit
6Der ländliche Raum als Laboratorium für das zukünftige Gesundheitswesen?
6.1Eine schleichende Politisierung: Die hausärztliche Versorgung als Teil der regionalstaatlichen Daseinsvorsorge
6.2Resignierte Politikunternehmer und ver(un)sicherte Wohnbevölkerung: Chancen und Grenzen lokaler Gewährleistung
6.3Rückwirkung auf den eingeschlagenen Regulierungspfad und Impulse für eine gemeinwohlorientierte Versorgung
7Fazit und Ausblick
Presseverzeichnis
Landkreis Leer, Niedersachsen
Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
Vogelsbergkreis, Hessen
Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
Landkreis Ansbach, Bayern
Literaturverzeichnis
Anhänge
DNA-Kodierschema nach Kategorien mit Beispielen
Kategorie 1: Problem und Ursache
Kategorie 2: Lösung
Kategorie 3: Akteurspositionierung und Verantwortung
Teilstandardisierter Interviewleitfaden
IProblemwahrnehmung/-verortung im (Arbeits-)Alltag
IIStrukturen und politisch-institutionelle Bearbeitung
III(Konflikthafte) Aushandlungsprozesse und Akteure
IVLösung unter dem Einfluss der Zivilgesellschaft
Interviewdaten
Index
Vorwort
Nur wenige Monate vor dem Ausbruch der Covid-19 Pandemie habe ich begonnen, mich mit dem deutschen Gesundheitssystem zu beschäftigen. Es folgten in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Jahre bevor ich die vorliegende Arbeit im Sommer 2023 als Dissertation an der Universität Tübingen eingereicht habe. Einige der Konzepte, mit denen ich arbeite, wurden plötzlich gesamtgesellschaftlich diskutiert; es war die Rede von »systemrelevanten Infrastrukturen« und Menschen gingen für und gegen »mehr Staat« im Gesundheitswesen auf die Straßen. Auf eindrückliche Art und Weise wurde deutlich, dass es umfassender Informationen bedarf, um alltagsrelevante Versorgungssysteme aufrechtzuerhalten oder nachhaltig neu auszurichten. Diese betreffen die Operationsweise der Versorgungssysteme, ihre (Dys-)Funktionalitäten, (Re-)Produktionsmechanismen und die Möglichkeiten, gesellschaftlich auf sie Einfluss zu nehmen. Ich hoffe mit der vorliegenden Arbeit, hilfreiche Erkenntnisse beizusteuern.
Zum Gelingen meiner Dissertation haben viele Menschen beigetragen. Zunächst möchte ich mich bei meinem Erstbetreuer Leo Bieling bedanken, der mich stets mit kontinuierlichem Interesse und überaus produktivem Feedback unterstützt hat. Dies weiß ich sehr zu schätzen. Ebenso herzlich möchte ich mich bei meiner Zweitbetreuerin Tanja Klenk bedanken, deren Expertise sehr gewinnbringend für meine Arbeit war.
Die vorliegende Arbeit ist im Kontext des Forschungsprojekts »Gemeinwohl-relevante öffentliche Güter. Die politische Organisation von Infrastrukturaufgaben im Gewährleistungsstaat« entstanden, das von 2020–23 am Forschungsinstitut für Arbeit, Technik und Kultur (F.A.T.K.) an der Universität Tübingen durchgeführt, durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziell gefördert und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt als Projektträger operativ begleitet wurde. In diesem Zusammenhang danke ich Matthias Möhring-Hesse, der das Projekt gemeinsam mit Leo Bieling geleitet hat, für seine Unterstützung. Zudem gilt mein Dank meinen Kolleginnen Johanna Betz und Melanie Nagel für die gute Zusammenarbeit. Über die gesamte Projektlaufzeit haben uns viele studentische Hilfskräfte unterstützt. Ich hatte das große Glück, kontinuierlich mit Jan Ruck zusammenarbeiten zu dürfen, der inzwischen zu einem geschätzten Kollegen und Freund geworden ist.
Eine weitere für mich glücklich Fügung ist, dass das Forschungsprojekt räumlich im F.A.T.K. verortet war, sodass ich in vielen Gesprächen mit Werner Schmidt und Andrea Müller von ihren Erfahrungen und guten Zusprüchen profitieren durfte.
Im Rahmen des Projekts ergaben sich vielzählige, wertvolle Möglichkeiten zur Felderschließung. Ich bedanke mich bei den GroeG-Kooperationspartner:innen, den vielen Workshopteilnehmenden und insbesondere den Interviewpartner:innen für ihre Aufgeschlossenheit und Bereitschaft, ihr Wissen mit mir zu teilen. Besonderer Dank gilt zudem Thomas Gerlinger für seine konstruktive Kritik im Rahmen eines Workshops im Frühjahr 2023.
Nicht zu vergessen ist weiterhin das (Post-)Doc-Kolloquium am Arbeitsbereich Politik und Wirtschaft/Politische Ökonomie. Ich danke allen Kolleg:innen, die meine Arbeit in diesem Rahmen über die Jahre produktiv begleitet haben. Besonderer Dank gilt Sarrah Kassem für ihr Unterstützung auch über das Kolloquium hinaus.
Mein größter Dank gilt meinen Freunden und meiner Familie. Ohne eure Unterstützung wäre diese Arbeit sehr viel mühevoller zustande gekommen. Danke, dass ihr mich bestärkt und abgelenkt habt, dass ihr nicht müde wurdet, mir zuzuhören, oder es mich zumindest nicht habt spüren lassen. Danke Anna, Birdie, Celi, Eva, Franzi, Isi, Jasmin, Lutz, Mali, Marvo, Sändi, Sara, Sassi und Thomas.
Tübingen im Mai 2024Andrea Futterer
1Die ambulante medizinische Versorgung ländlich geprägter Regionen: ein System organisierter Unverantwortlichkeit?
Der Zugang zu ambulanten medizinischen Versorgungseinrichtungen ist in der Bundesrepublik nicht überall für alle gleichermaßen gegeben. Die Wege zu Praxen werden länger und mitunter dünnt das Netz an Versorgungseinrichtungen räumlich aus. Insbesondere in strukturell benachteiligten, vor allem ländlichen Regionen, gelingt es immer häufiger nicht, freiwerdende Arztpraxen wie gewohnt nachzubesetzen. Oft führt eine Praxisschließung dazu, dass die Versorgungslage von der verunsicherten Wohnbevölkerung öffentlich als mangelhaft problematisiert wird. Noch vor wenigen Jahrzehnten beschäftigte das Gegenteil des Ärztemangels die Bundespolitik. In den 1980er Jahren war Deutschland in der komfortablen Situation einer sogenannten »Ärzteschwemme«. Um der auf den Arbeitsmarkt strömenden Medizinergeneration Einhalt zu gebieten, wurden damals unterschiedliche Maßnahmen und Instrumente verabschiedet. Sie sollten regulieren, wo sich Mediziner:innen1 bestimmter Fachrichtungen niederlassen, um an der Versorgung der gesetzlich versicherten Patient:innen mitzuwirken. Ziel war es, die Niederlassungspraxis der privatunternehmerischen Ärzt:innen bedarfsgerecht zu steuern. Um die Jahrtausendwende änderte sich die Lage jedoch (vgl. Fülop et al. 2007).
Bereits 2002 veröffentlichte die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) eine Studie, in der sie einen nahenden Ärztemangel prognostizierte, der sich besonders stark im hausärztlichen Bereich auswirken werde (vgl. Kopetsch 2002). Im Folgejahr versuchte der Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) für Beruhigung zu sorgen. Die Ärzteverbände würden vereinzelte Engpässe zu einer ganzen Versorgungskrise stilisieren. Eine Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) kam zu dem Schluss, der fachärztliche Bereich sei auch weiterhin eher überversorgt und der hausärztliche Bereich ausreichend versorgt (vgl. Rabbata 2003). Eine Gegenstudie der KBV und ein öffentlicher Schlagabtausch zwischen Politik, KBV und Kassenverbänden folgten (vgl. Rieser 2003). Alsbald entwickelte sich ein öffentliches Interesse an den Entwicklungen in der ärztlichen Versorgung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelte in Reaktion auf eine erneute Warnung der Bundesärztekammer (BÄK) im Frühjahr 2004: »Warnung vor Ärztemangel« und forderte, die Arbeitsbedingungen für junge Ärzt:innen zu verbessern. In den vergangenen 20 Jahren interessierten sich die großen Tageszeitungen wie die ZEIT (vgl. Groll 2010), die Süddeutsche Zeitung (vgl. Bohsem 2014) oder Magazine wie der Spiegel (vgl. Stukenberg 2015) und der öffentliche Rundfunk (vgl. Augustin 2022; Christ 2023) mit wechselnder Aufmerksamkeit für die Versorgungsprobleme im ambulanten medizinischen Bereich. In der nationalen Berichterstattung überwog die Diagnose eines fehlenden Patentrezepts für das kränkelnde Versorgungssystem und einige wissenschaftliche Studien unterstrichen diese Schlussfolgerungen: »[K]eine der bisherigen Maßnahmen [wird] den bereits bestehenden oder in naher Zukunft eintretenden Hausarztmangel komplett kompensieren können.« (Winter 2020: 323)
Wenn eine Arztpraxis ohne Nachfolgeregelung schließt, dann ist es die jeweilige Kommune, in der das Versorgungsdefizit relevant wird, und es sind die betroffen Bewohner:innen dieser Kommune, die die wegbrechende Versorgung zu spüren bekommen. Es überrascht deshalb nicht, dass instabile Versorgungsstrukturen in den betroffenen Kommunen öffentlich thematisiert werden. Den Theorien des politischen Prozesses folgend erhöht sich die Chance, dass ein Thema auf die (kommunal-)politische Tagesordnung gelangt, wenn es offenkundig ist, die politischen Akteure die Fähigkeit besitzen, das Thema zu dramatisieren und es in Zusammenhang mit der Verletzung geltender Normen steht. Zur Politisierung ärztlicher Versorgungsdefizite bedürfte es demnach Bürger:innen, die das Defizit kommunizieren, einer Lokalpresse, die Betroffene befragt oder Ärzt:innen, die die Belastung in den Praxen an die Kommunalpolitik herantragen. Eine derartige Dramatisierung ist angesichts der besonderen Bedeutung, die die Gesundheit für die Lebensgestaltung der Menschen hat, nicht schwer vorzustellen. Da in Kommunen weniger stark ein parteipolitischer Wettbewerb herrscht als auf anderen politischen Ebenen, könnte die vorgenannte Dramatisierung bereits ausreichen, um die Versorgung zum politischen Thema zu machen. Vor dem Hintergrund einer – wenn auch recht kurzen – Vergangenheit auskömmlicher, geradezu guter Versorgungsstrukturen (vgl. Futterer 2020), dürfte eine empfundene Normverletzung, gerade vor dem Hintergrund der entrichteten Sozialversicherungsbeiträge, ihre Wirkung entfalten. Da es aber an Patentrezepten für die Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung fehlt, machen sich Kommunen auf die Suche nach regionalen Lösungen.
Der Altmarkkreis in Sachsen-Anhalt ist solch eine Region, die die ärztliche Versorgungslage bereits seit nunmehr zehn Jahren auf kommunalpolitischer Ebene beschäftigt. Immer wieder mussten Praxen ohne Nachfolgeregelung schließen. Dann bleiben Patient:innen ohne ärztliche Versorgung zurück und müssen auf umliegende Regionen ausweichen. Jüngst verabschiedete der Kreistag Salzwedel deshalb einen Maßnahmenkatalog, der rund zwei Dutzend lokale Initiativen zur Ärztegewinnung vorsieht, darunter ein Stipendium für Studierende, die sich nach dem Studium in der Altmark niederlassen, finanzielle Zuschüsse und Werbemaßnahmen und eine kommunale Kooperation mit dem ausbildenden Klinikum. Für diese umfassenden kommunalen Anstrengungen findet ein für die vorliegende Studie interviewter Arzt aus der Region den folgenden bildlichen Vergleich:
»Dieses […] Maßnahmenpaket ist wie das Training eines Sportlers aus dem Leistungszentrum Leichtathletik einer Kreisstadt, der sich vorbereitet auf einen Wettkampf gegen den Olympiakader verschiedener Länder. Wir versuchen uns hübsch zu machen als Region, wir versuchen, Grundlagen zu schaffen, dass Leute hierher wollen. Da konkurrieren wir mit den Unistädten und mit großen Kliniken. Diese Konkurrenz können wir so letztlich gar nicht bestehen.« (Interview AKSW IV)
Der Arzt weist darauf hin, dass viele der beschlossenen Maßnahmen erst in rund 10 Jahren in der Region wirken. Ein:e heute geförderte:r Stipendiat:in wird sich in frühestens zwölf Jahren niederlassen können und ob eine teure Werbemaßnahme zur Ansiedlung von Ärzt:innen führt, ist ungewiss. Angesichts dieser Aussichten und der sich zuspitzenden Versorgungsengpässe zeigt sich der interviewte Arzt wenig hoffnungsvoll: »Bei mir ist die Frustration einer soliden Resignation gewichen.« (Ebd.)
Dieser Einblick stellt keinen Einzelfall dar, wobei der relevante Landkreis paradigmatisch für jene Regionen steht, die ohnehin mit ausgedünnten sozialen Infrastrukturnetzen zu kämpfen haben. Blickt man dieser Tage in Lokalzeitungen in Ostfriesland, der Eifel, Mittelhessen, auf der Schwäbischen Alb oder in der Lausitz, so finden sich überall »weiße Flecken« (Kopetsch 2011: 89). Das Bild der weißen Flecken bezieht sich auf die Landkarten, die die Arztdichte abbilden. Die Arztdichte beschreibt das Verhältnis von Ärzt:innen zu der Bevölkerungszahl in einer Region oder einem Landkreis. Die weißen Flecken verdeutlichen, wie ungleich Ärzt:innen, insbesondere Hausärzt:innen, räumlich verteilt sind. Dabei treten niedrige Arztdichten in Nord und Süd, in alten und neuen Bundesländern auf. Die Lokalzeitungen berichten von den Effekten, die vakante Arztsitze kommunal entwickeln. Sie beschreiben, wie das »Praxissterben« die jeweilige Wohnbevölkerung verunsichert und zeichnen nach, wie sich Bürgermeister:innen der instabilen Versorgungssituationen annehmen. Dann ist von Investitionen in Werbebanner und -filme, Kooperationen zwischen Kommunen und ausbildenden Klinken und Förderprogrammen oder Stipendien die Rede. Immer wieder diskutieren Kommunalpolitiker:innen auch die Option, dass die Kommune als Trägerin einer medizinischen Versorgungseinrichtung zur Stabilisierung der Lage beitragen könnte. Kurzum: Der Landarztmangel ist ein bundesweites Phänomen, das die einzelnen, betroffenen Kommunen nach adäquaten Bearbeitungspfaden suchen lässt.
Dabei ist zu betonen, dass sich die Versorgungsprobleme mitnichten auf die Allgemeinmedizin beschränken oder auch nur der strukturschwache, vor allem ländliche Raum betroffen ist. Vielmehr werden lange Wege oder fehlende Kapazitäten auch im spezialfachärztlichen Bereich moniert, spielen disparate Zugänge zu Versorgungseinrichtungen in städtischen Räumen eine Rolle, beunruhigen Klinikschließungen die Bürger:innen und stellt die Pflege von Menschen ganze Regionen vor Herausforderungen. Zudem ist nicht jede ländliche Region von Versorgungsproblemen gleich betroffen. Nebeneinander bestehende Trends wie die »(Re-)Urbanisierung« (vgl. SVR-G 2014: 441) oder die »Neue Ländlichkeit« (vgl. Hahne 2011) unterstreichen die unterschiedlichen Entwicklungspfade von Regionen, die sich auch auf die Attraktivität für eine ärztliche Niederlassung auswirken (vgl. Ried 2016: 3).
Hausärzt:innen stellen als Generalist:innen in aller Regel einen ersten Zugang zum Versorgungssystem für die Patient:innen dar und spielen damit eine herausragende Rolle mit politisch-kulturellem Gehalt. »Diese Nähe hat etwas mit dem Bereich von Solidarität, Akzeptiertwerden, Bestärktwerden in der Zuständigkeit für die eigenen Gesundheit zu tun.« (Abholz 2004: 113) In Hausarztpraxen findet mehr als nur der Austausch von gesundheitlichen Informationen statt. Patient:innen vertrauen sich ihren Hausärzt:innen an und sind oft in zweiter Generation in Behandlung. Die Familiengeschichten, die kurzen Wege in der Gemeinde und das Vertrauen kennzeichnen das durchaus spezielle Verhältnis von Hausärzt:innen und Patient:innen. Entsprechend einschneidend ist die Irritation, wenn Hausärzt:innen ihre Praxen ohne eine Nachfolgeregelung schließen müssen, wenn Praxen über lange Zeit vakant bleiben und die Wege zur nächsten Versorgungseinrichtung weiter werden.
Eben diese Ärztegeneration, die lange für eine gute Versorgung Sorge getragen hat und davon profitierte, dass die Zulassungsbeschränkungen zum Medizinstudium in den 1960er Jahren gesenkt wurden, wird in den kommenden Jahren aus der Versorgung austreten. Eine substanzielle Ruhestandswelle steht an. Die Ärzteschaft setzt sich wie folgt zusammen: Generell ist die Arztdichte in Deutschland bei 4,5 Ärzt:innen je 1.000 Einwohner:innen im internationalen Vergleich weiterhin sehr hoch (vgl. OECD 2021). Die Gesamtzahl der Ärzt:innen in Deutschland nimmt von 237.700 berufstätigen Ärzt:innen im Jahr 1990 auf 421.300 berufstätige Ärzt:innen im Jahr 2022 kontinuierlich zu (vgl. Bundesärztekammer (BÄK) 2023). Nach Angaben der BÄK waren zum Jahresende 2020 insgesamt 416.120 Ärzt:innen berufstätig. Rechnerisch kamen 2021 somit durchschnittlich etwa 200 Einwohner:innen auf eine:n Ärzt:in; 1990 waren es noch 335 Einwohner:innen pro Ärzt:in. Der Großteil von mehr als 210.000 Mediziner:innen war im Klinikbereich beschäftigt. Im ambulanten Bereich gab es 2021 rund 164.000 Ärzt:innen, knapp 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Zugleich sank die Zahl der niedergelassenen Ärzt:innen von 2020 auf 2021 um 0,35 Prozent leicht auf rund 115.000.
Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (vgl. KBV 2023b) nahmen im Jahr 2022 rund 185.000 Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen an der vertragsärztlichen Versorgung Teil. Davon waren etwas mehr als 55.000 Hausärzt:innen. Sie bilden mit Abstand die größte Facharztgruppe, vor den Psychotherapeut:innen (rund 32.200). Noch immer arbeitet ein Großteil der Hausärzt:innen in Einzelpraxen, 2022 waren es 53,6 Prozent. 38,4 Prozent erbringen ihre Leistungen in Berufsausübungsgemeinschaften (BAG, ehemalige Gemeinschaftspraxen) und 8,5 Prozent in Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). MVZs wurden 2004 als Organisationsform gesetzlich verankert und ähneln den BAGs. Sie haben für Ärzt:innen die Vorteile, dass sie eine Anstellung ermöglichen, die Inhaberschaft von der ärztlichen Behandlungstätigkeit getrennt ist und die Behandlungen durch eine Verzahnung mit dem stationären Sektor stärker aus einer Hand erfolgen. Insbesondere die in MVZs hausärztlich tätigen Ärzt:innen nahmen im Zeitraum von 2013 (1.892) bis 2022 (4.665) um 146,6 Prozent zu. Die Anzahl der an der vertragsärztlichen Versorgung beteiligten Einzelpraxen ist in den vergangen Jahren stark zurückgegangen, von 32.319 Einzelpraxen im Jahr 2013 auf 26.784 Einzelpraxen im Jahr 2021. Die Zahl der MVZs ist von 2.490 im Jahr 2016 auf 4.179 im Jahr 2021 angestiegen, wobei 1.974 MVZs von Vertragsärzt:innen, 1.881 von Krankenhäusern und 593 von durch die KBV nicht näher bestimmten Akteuren getragen wurden.
Die Anzahl der Medizinstudierenden lag 2021 bei 98.733, wobei die Zahl der Studienanfänger:innen in den letzten zehn Jahren leicht zugenommen hat (vgl. KBV 2023c). Die Abschlüsse in der Facharztausbildung für Allgemeinmedizin stiegen in den vergangenen Jahren nach längerer Stagnation leicht an, von 1.197 im Jahr 2012 auf 1.797 im Jahr 2021. Derzeit sind zwei Drittel der Studienanfänger:innen weiblich und auch der Anteil der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärztinnen steigt kontinuierlich an. Er hat 2022 erstmals einen Anteil von mehr als 50 Prozent erreicht (vgl. KBV 2023d). Der Anteil der Frauen unterscheidet sich in den Fachbereichen in Teilen deutlich. Von 2013 bis 2022 stieg der Anteil von Frauen unter den Hausärzt:innen um 19,5 Prozentpunkte auf 49,7 Prozent an (ebd.). Neben der Feminisierung der Medizin, die das Arbeitszeitvolumen pro Kopf verringert, ziehen zunehmend mehr Mediziner:innen ein Anstellungsverhältnis der Freiberuflichkeit vor: Zwischen 2013 und 2022 ist die Anzahl der angestellten Hausärzt:innen von 1.698 auf 4.335 angestiegen. Das Durchschnittalter aller praktizierenden Hausärzt:innen lag 2022 bei 55,5 Jahren (vgl. KBV 2023e). Rund 64 Prozent der Hausärzt:innen waren 2022 über 50 Jahre alt. Der Anteil der über 60-Jährigen lag bei 36,5 Prozent. Die Hälfte der aktuell praktizierenden Hausärzteschaft wird demnach bis 2038 in den Ruhestand gehen.
Einige allgemeine nachfrageseitige Entwicklungen erhöhen den Druck auf das vorhandene ärztliche Arbeitszeitvolumen. Die alternde Gesellschaft in Deutschland ist zwar nicht grundsätzlich kränker und damit verbunden behandlungsbedürftiger als zuvor. Allerdings sind ältere Menschen häufiger mehrfach erkrankt und deshalb auf einen kontinuierliche medizinische Betreuung angewiesen. Dies macht sie davon abhängig, dass insbesondere in strukturschwachen und ländlich geprägten Regionen ihre Angehörigen Fahrdienste und Care-Arbeiten leisten. Doch diese Unterstützungsnetzwerke durch die Familie oder örtliche Gemeinschaft sind voraussetzungsvoll. Häufig ist der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in strukturell benachteiligten Regionen zudem defizitär ausgebaut und vielfach am Schulverkehr orientiert. Das erschwert es für die Patient:innen, am selben Tag zu einer medizinischen Versorgungseinrichtung und wieder nach Hause zu gelangen. Strukturell benachteiligte Gebiete sind zudem in der Regel stärker von einer allgemeinen Abwanderung der jungen Menschen betroffen, weil diese in den Städten eine Berufsausbildung aufnehmen oder nach Arbeit suchen und nicht in gleichem Maße wieder in die Regionen zurückkehren. Der medizinische Behandlungsbedarf in einer dünn besiedelten aber stark gealterten Gemeinde kann folglich insbesondere im hausärztlichen Bereich (vgl. Bauer et al. 2018) erhöht sein.
Die ungleichen Versorgungslagen beziehen sich auf den Zugang zu den medizinischen Versorgungseinrichtungen im Raum. Neben schlechter versorgten Regionen gibt es auch Regionen, die insbesondere im fachärztlichen Bereich drastisch überversorgt sind, etwa die augenärztliche Versorgung in Garmisch-Partenkirchen oder die Versorgung mit Fachinternist:innen in der Raumordnungsregion München (vgl. KBV 2023a). Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (vgl. SVR-G 2014) spricht angesichts des Nebeneinanders an Über-, Unter- und Fehlversorgung im Gesundheitswesen von einem Verteilungs- oder Allokationsproblem mit Blick auf die Ärzt:innen. Folglich stellt sich die Frage nach den Verteilungsmechanismen. Schließlich gilt für Ärzt:innen in Deutschland eine Niederlassungsfreiheit. Doch wollen Ärzt:innen gesetzlich Versicherte behandeln und die Behandlungen mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen, benötigen sie eine Zulassung. Diese erhalten sie nur, wenn sie in einer Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Mitglied sind und in den Versorgungsvertrag zwischen einer Landes-KV und den Krankenkassenverbänden aufgenommen werden. Die Zulassungen für die Vertragsärzt:innen unterliegen einer auf Bundesebene festgelegten Planungsstatistik. Deren zentrales Steuerungsinstrument ist die Bedarfsplanung. Sie weist für unterschiedliche Planungsbereiche arztgruppenbezogene Versorgungsgrade aus, die anschließend handlungsanleitend interpretiert werden. Hierfür sind spezifische Berechnungen und Abweichungsmöglichkeiten relevant, die im zuständigen Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen – einem gemeinsamen Gremium der Vertragspartner – verhandelt werden. Je nach Versorgungsgrad2 wird eine Unterversorgung, drohende Unterversorgung, Regel- oder Überversorgung festgestellt. Damit verbunden sind Zulassungen möglich, oder die Regionen werden für weitere Zulassungen gesperrt. Zudem sind die Länder-KVen in (drohend) unterversorgten Planungsbereichen dazu aufgerufen und in Teilen verpflichtet, niederlassungsfördernde Maßnahmen zu ergreifen.
Weil der hausärztlichen Versorgung ein gewichtiger Stellenwert zugeschrieben wird, ist die hausärztliche Bedarfsplanung die feingliedrigste. Bedarfsplanerisch gilt ein überwiegender Großteil der Mittelbereiche – so werden die hausärztlichen Planungsbereiche genannt – als regelversorgt. 2018 liegt nur in neun von insgesamt 971 Mittelbereichen eine bedarfsplanerische Unterversorgung vor. Die sich zuspitzenden Versorgungsprobleme in ländlichen Regionen sind vor dem Hintergrund dieser Statistik zu interpretieren. Doch öffentlich wird zunehmend von gefühlten Versorgungsmängeln gesprochen, um trotz der nicht erfüllten technischen Einzelheiten einer Unterversorgung auf die angespannte Versorgungslage vor Ort hinzuweisen. Die Aufmerksamkeit für die Unterversorgung, auch in bedarfsplanerisch als regelversorgt einzustufenden Regionen (vgl. Knieps et al. 2012), wächst seit 15 Jahren stetig an und gewinnt angesichts der zunehmenden Versorgungsdefizite an Bedeutung. Der Gesetzgeber reagierte in der jüngeren Vergangenheit mit zwei Gesundheitsreformen in den Jahren 2012 und 2015 auf die Fehlsteuerung im ambulanten Sektor. Mancherorts konnten dank der angepassten Niederlassungspraxis Lösungen für leerstehende Praxen gefunden werden. Ärzt:innen finden durchaus immer wieder junge Kolleg:innen, die ihren Patientenstamm und die Praxisräume übernehmen. Manchmal bedarf es hierzu nur der Förderinstrumente der für die vertragsärztliche Versorgung zuständigen KVen (vgl. KBV o.J.a). Hin und wieder macht ein KiTa-Platz den Unterschied für niederlassungswillige Mediziner:innen bei ihrer Standortwahl. Immer häufiger allerdings tragen diese eingespielten Abläufe nicht mehr. Dann wenden sich die besorgten Bürger:innen an die Bürgermeister:innen oder Gemeinderät:innen. Sie fordern ein, dass die Lokalpolitik sich an der Arztakquise beteiligt. Die Forderungen und die sich darin ausdrückenden Ansprüche der Wohnbevölkerung an eine adäquate zukünftige Gesundheitsversorgung bedürfen eines Adressaten. Der Landarztmangel schafft es demnach, zunehmend auf die politischen Agenden in den Rathäusern zu gelangen. Oftmals stellen sich den Kommunen drei Möglichkeiten: ignorieren, weiterverweisen, engagieren. Traditionell haben die Kommunen keine Kompetenzen in der ambulanten medizinischen Versorgung. Doch den Bürger:innen sind die KVen kein Begriff. Ihnen erscheint eine bedarfsplanerische Auffälligkeit nicht als greifbare Kritik der Niederlassungssteuerung durch die organisierte Ärzteschaft und sie stellen sich nicht die Frage, ob die Regulierung der Ärzteverteilung gegebenenfalls bundespolitisch angepasst werden müsste. Vielmehr werden die Bürgermeister:innen von den Bürger:innen als Ansprechpartner vor Ort wahrgenommen und aufgefordert, die ärztliche Versorgungslage zu stabilisieren. Schließlich ist es die lokale Wohnbevölkerung, die von fehlender medizinischer Versorgung betroffen ist, und es sind die Kommunalvertreter:innen, die Interventionen begründen und sich für ihr etwaiges Nichtstun rechtfertigen müssen.
Die Lage erinnert an Ulrich Becks im Jahre 1988 erschienenes Buch »Gegengifte«. Darin erläuterte der Soziologe, inwiefern der Protest der damaligen Anti-Atom-Bewegung auf ein größeres Phänomen verwies. Die lange von den technisch-ökonomischen Fortschritten euphorisierten Gesellschaften stünden erst am Beginn, darüber nachzudenken, inwieweit diese Großtechniken wie die Atomkraft, die politischen und gesellschaftlichen Institutionen berührten. »Die Gesellschaft selbst begegnet sich in den Gefahren, die sie erschüttern.« (Beck 1988: Klappentext) Beck ging davon aus, dass insbesondere die ökologische Debatte Fragen nach einem gesunden und vor allem demokratischen Weiterleben stellt. Er verwies darauf, dass es einigen Akteuren eher gelingt, ihre Deutungen im öffentlichen Diskurs als adäquate Beschreibungen zu positionieren als anderen. Angesichts dieser Definitionsverhältnisse müsse gefragt werden, wer Phänomene wie und mit welchen Folgen für die Begründungen von Betroffenen und die Notwendigkeit von Bekämpfungsstrategien deutet. Denn die Verantwortlichen seien oft nicht greifbar und die Zuständigen nicht adressierbar. Ethisch-moralische Regularien und technische Bewertungsmechanismen verstärkten diese »organisierte Unverantwortlichkeit« (ebd.: 100). In Becks Ausführungen schwingt viel Pathos und ein spezifischer Zeitgeist mit. Doch die beschriebene, ambivalente alltägliche Normalität, in der der politische Charakter von vermeintlich technischen Entscheidungen in den Hintergrund rückt, die einerseits Leben sichert und es andererseits bedroht, bleibt aktuell.
Der Vergleich der ökologischen Krise, die sich seit dem Erscheinen von »Gegengifte« dramatisch zugespitzt hat, mit der Versorgungskrise des deutschen Gesundheitswesens mag überraschen. Einige Parallelen zum vorliegenden Gegenstand sind erkennbar, andere werden sich erst im Folgenden aufdrängen. Denn die vergangenen dreißig Jahre der Regulierung des ambulanten Sektors haben ein Arrangement an Akteuren, Prozessen und Normen hervorgebracht, das für die vorliegende Problemstellung zentral ist. Da diese Steuerung vom Staat ausging, interessiert sich die vorliegende Studie für die Vorstellungen und Praktiken von Staatlichkeit in dieser Konstellation. Sie fragt danach, inwiefern sich der Staat für die Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung verantwortlich fühlt und zeigt. Wegen der Erscheinungsform des Landarztmangels fokussiert sich die Studie hierfür auf die kommunale Ebene, deren Engagement angesichts der Kompetenzverteilung erklärungsbedürftig ist. Sie fragt nach den öffentlich vorgebrachten Argumenten für eine lokalstaatliche Gewährleistung, etwaigen staatlichen Abwehrmechanismen und Schritten in Richtung einer kommunalen Verantwortungsübernahme sowie den dahinterliegenden Steuerungspräferenzen der beteiligten Akteure. In diesem Zusammenhang interessieren die Bedingungen, die lokalstaatliche Initiativen mit Erfolg krönen oder deren Scheitern begründen. Angesichts der zu analysierenden Staatlichkeit rückt die Frage nach deren Durchlässigkeit für unterschiedliche Interessen in den Fokus der Aufmerksamkeit. Es interessieren die Chancen sogenannter »schwacher Interessensgruppen«, auf die lokalpolitischen Prozesse Einfluss nehmen zu können. Zu ihnen zählen die Bewohner:innen von schlechter versorgten Regionen, insbesondere ältere und kranke Personen.
Die drei forschungsleitenden Fragenkomplexe lauten wie folgt:
1Wie werden ärztliche Versorgungsprobleme in strukturschwachen, vor allem ländlichen Regionen lokal problematisiert und mit welcher Begründung eine staatliche Gewährleistung der Versorgung eingefordert?
2Wie reagieren die Repräsentant:innen des lokalen Staats auf die Gewährleistungserwartungen und unter welchen Bedingungen übernehmen sie Verantwortung für die Versorgungslage? Welche zur Verfügung stehenden Instrumente werden bemüht und welche neuen Initiativen werden getestet? Was sind die Erfolgsbedingungen und Hindernisse in der Stabilisierung der Versorgung und wie reflektieren die lokalstaatlichen Akteure ihre Erfahrungen?
3Lernen die von den Versorgungsproblemen betroffenen Gruppen mit der lokalen Gewährleistungsstaatlichkeit umzugehen? Bestehen Handlungsmöglichkeiten für Träger:innen und Vertreter:innen schwacher Interessen, auf die lokale Infrastrukturpolitik Einfluss zu nehmen?
Die im Folgenden entwickelten Thesen helfen, die forschungsleitenden Fragen zu beantworten. Wegen der zentralen Bedeutung der Gesundheit für die menschliche Lebensführung, ist es zunächst wenig überraschend, dass eine wegbrechende lokale Gesundheitsversorgung die Betroffenen besorgt und sie diese Sorge öffentlich thematisieren (vgl. Gerlinger 2002: 33). »Die Frage, wie schnell und mit welchem Verkehrsmittel der nächste Hausarzt, die nächste Apotheke oder das nächste Krankenhaus erreicht wird, ist für das gesundheitliche Wohlbefinden relevant und kann unter Umständen über Leben und Tod entscheiden.« (Kriwy et al. 2020: 587) Ein analytisches Verständnis von Gesundheitspolitik geht zwar weit über das Alltagsverständnis einer Krankenversorgungspolitik hinaus (vgl. Rosenbrock/Gerlinger 2014: 15f.), doch das gesellschaftliche Alltagsverständnis von Gesundheitspolitik ist eben dieser letzten Auslegung nah (vgl. Kaiser et al. 2021: 17). Zudem wirken in ländlichen Räumen andere Faktoren darauf, ob Patient:innen mit der hausärztlichen Versorgung zufrieden sind (vgl. Weinhold/Gurtner 2018). Sie legen unter anderem mehr Wert auf ein enges Arzt-Patienten-Verhältnis. Da nicht davon auszugehen ist, dass die Wohnbevölkerung einer ärztlich (drohend) schlechter versorgten Region um die Verantwortungsstrukturen im ambulanten Versorgungssektor weiß, leitet die folgende These die Analyse der lokalen Politisierung des Landarztmangels an:
1Die lokalen Sicherstellungsprobleme werden seitens der Bürger:innen über den wahrgenommenen Mangel an Ärzt:innen politisiert. Die Betroffenen fordern von der Kommunalpolitik – insbesondere den Bürgermeister:innen – ein, sich wegen der zentralen Bedeutung der Gesundheitsversorgung für die Lebensführung an der Beseitigung der Versorgungprobleme zu beteiligen.
Angesichts einer tendenziellen Überforderung der kommunalen Ebene, ihre verpflichtenden Selbstverwaltungsaufgaben umfassend zu erfüllen (vgl. Grohs/Reiter 2014), ist eine freiwillige Übernahme von gesundheitspolitischen Aufgaben durch die Kommunen zunächst erklärungsbedürftig. Für die lokalstaatliche Problemwahrnehmung und die Reaktionen auf das eingeforderte politische Engagement zur Bekämpfung des Landarztmangels, erweisen sich einige Befragungen von Bürgermeister:innen und Landrät:innen in Baden-Württemberg (Steinhäuser et al. 2012), Niedersachsen (vgl. Kuhn et al. 2018) und Sachsen-Anhalt (vgl. Barthen/Gerlinger 2016) als anschlussfähig. In Baden-Württemberg sahen es über 90 Prozent der befragten Bürgermeister:innen als ihre Aufgabe, die hausärztliche Versorgung vor Ort zu sichern, während rund 70 Prozent der befragten, niedersächsischen Bürgermeister:innen und Landrät:innen angaben, kommunale Unterstützungsmaßnahmen zur ambulanten medizinischen Versorgung zu leisten. In Sachsen-Anhalt hingegen gaben nur 45 Prozent der hauptamtlichen Bürgermeister:innen an, dass sie es als ihre Aufgabe sehen, zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung einen Beitrag zu leisten. Trotz dieser Unterschiede ergriffen die Kommunalvertreter:innen in allen drei Bundesländern unterstützende Maßnahmen. Auf die Bedingungen des kommunalen Engagements gingen die Befragungen nicht ein. Die vorliegende Studie geht davon aus, dass neben den lokalen Diskursen die Selbstwahrnehmung und Praktiken des lokalen Staats aufschlussreich sind. Da der Bundesgesetzgeber die Rahmenbedingungen für die ambulante medizinische Versorgung festlegt und die Verbände der Ärzt:innen und Krankenkassen diese konkretisieren, dürften die fehlenden Kompetenzen der Kommunen für lokales Konfliktpotenzial sorgen. Es würde zumindest überraschen, wenn etwaige Kooperationsbemühungen zwischen den Kommunen und den KVen und Krankenkassen vollkommen reibungslos verliefen (vgl. Brandhorst et al. 2017). Denn der Gesetzgeber hat zwar regulierend auf die Fehlverteilung reagiert und den KVen einige freiwillige und verpflichtende Instrumente an die Hand gegeben. Doch diese sollen überwiegend aus dem bestehenden Budget der KVen finanziert werden. Sie haben deshalb ein Interesse daran, restriktiv mit den Fördermitteln umzugehen (vgl. Simon 2017: 169). Zugleich dürften die KVen einem ausgebauten Engagement der Kommunen skeptisch gegenüberstehen (vgl. Gerlinger 2022). Schließlich drohen kommunalpolitische Erfolgsgeschichten die anwachsenden Sicherstellungsprobleme weiter zu problematisieren und so potenziell das Versorgungsmonopol der KVen in Frage zu stellen. Es wäre demzufolge denkbar, dass die KVen versuchen, sich weitgehend aus den lokalen Initiativen zurückzuhalten. Letztlich trägt der institutionalisierte und stark regelgebundene Charakter der Bedarfsplanung das Potenzial in sich, die lokalen Diskurse zu fokussieren. Er ermöglicht es den KVen, außerhalb einer festgestellten Unterversorgung darauf zu verzichten, Fördermaßnahmen zu ergreifen, oder damit verbundene Ansprüche gar abzuwehren. Angesichts dieser Hinweise aus der Literatur leiteten die folgenden Thesen die Analyse des zweiten Fragenkomplexes an:
2Die Repräsentant:innen des lokalen Staats nehmen die Verantwortungszuschreibung an, weil die zuständigen Akteure Ansprüche zurückweisen und sich gegenüber den Kooperationsbemühungen und Forderungen der öffentlichen Akteure wenig responsiv zeigen. Die Repräsentant:innen des lokalen Staats bemühen sich, die Gewährleistungserwartungen trotz der begrenzten kommunalen Ressourcen zu erfüllen, obwohl diese die Erfolgschancen der getesteten Initiativen schmälern.
Der letzte forschungsleitende Fragenkomplex hat zwei Dimensionen. Erstens verursacht der ungleiche Zugang zu medizinischen Versorgungseinrichtungen Einschränkungen für die betroffenen Individuen zur medizinischen Versorgung. Sie betreffen junge und gesunde Menschen, die für Routineuntersuchungen längere Wartezeiten oder Wegstrecken in Kauf nehmen können. Sie betreffen aber auch Kranke, die auf eine kontinuierliche Versorgung oder Hausbesuche angewiesen sind und alte Menschen, die körperlich weniger mobil sind und deshalb vom ÖPNV oder privaten Fahrdiensten abhängig sind, um medizinisch versorgt zu werden (vgl. Vogelgesang et al. 2017). Zweitens kann bereits eine Erkrankung als »Schwäche« verstanden werden, weil sie Einfluss darauf nimmt, ob und wie die erkrankte Person ihre Betroffenheit im öffentlichen Raum artikulieren und damit verbundene Forderungen in den politischen Prozess einbringen kann. In diesem Sinne sind die individuellen und kollektiven Modi der Interessenvertretung im Kontext von räumlichen Versorgungsdefiziten relevant. Die anschlussfähigen Analysekonzepte der Selbst-, Mit- und advokatorischen Vertretung schwacher Interessen haben unterschiedliche Einflusschancen auf deren Durchsetzung im politischen Prozess (vgl. Clement et al. 2010; Klenk 2018; Toens/Benz 2019; Klenk et al. 2022). Auf Bundes- und Landesebene wurden unterschiedliche Patientenvertreterorganisationen im Rahmen der jüngeren Regulierung des ambulanten Sektors in die sektoralen Willensbildungs- und Entscheidungsfindungsgremien – wenn auch nicht-funktional – integriert (vgl. Klenk 2018: 32ff). Das hat die Organisationen gestärkt, wenngleich deren Einfluss auf die Gesundheitspolitik immer noch als randständig bewertet wird (vgl. Simon 2015). Es wird zu überprüfen sein, ob und wie diese und ähnliche Akteure kommunal auftreten, etwa die Selbsthilfe (vgl. Schulz-Nieswandt 2015; Rosenbrock 2015), Patientenvertretungen (vgl. Hänlein/Schroeder 2010) oder der Verbraucherschutz (vgl. Ewert 2019). Überdies könnten zivilgesellschaftliche Initiativen als Form der Selbstvertretung lokale Allianzen bilden, um auf den politischen Prozess einzuwirken, oder die Seniorenvertretung können schwache Interessen im politischen Prozess vertreten. Vor dem Hintergrund leiten die folgenden Thesen die Analyse des letzten Fragenkomplexes an:
3Die Träger:innen und Vertreter:innen schwacher Interessen fordern zwar kommunalpolitisches Engagement ein, sehen sich allerdings auch starken organisationellen Hindernissen ausgesetzt, ihre Interessen in den politischen Prozess einzuspeisen. Raumwirksame Instrumente staatlicher Gewährleistung, etwa kommunale Gesundheitskonferenzen, könnten diese Hindernisse abschwächen.
Die vorliegende Studie ist wie folgt aufgebaut: Kapitel zwei skizziert die Beschaffenheit des deutschen Gesundheitswesens und des ambulanten Sektors entlang seiner zentralen Strukturprinzipien und einiger folgenreicher Reformen. Dies verdeutlicht die Beschaffenheit des vom Gesetzgeber eingeschlagenen Regulierungspfads. Den stärker gegenstandsbezogenen Passagen folgt die wissenschaftliche Forschungslage zu den Effekten der jüngeren sektoralen Strukturreformen auf die Akteure, Prozesse und Normen, so sie den vorliegenden Gegenstand betrifft. Daran anschließend folgt ein Überblick zu den wissenschaftlichen Debatten, die die regionalen Disparitäten in der ärztlichen Versorgung mit den vorhandenen Instrumenten zu ihrer Linderung in Bezug setzten. In Kapitel drei werden zunächst die zentralen Begrifflichkeiten und Konzepte der vorliegenden Studie erläutert und gegenstandsbezogen miteinander verknüpft. Es folgt die Zusammenstellung des theoretisch-analytischen Zugangs. Die vorliegende Arbeit nimmt eine post-weberianische Perspektive auf Staatlichkeit ein, um die rekonfigurierten Staats-(Zivil-)Gesellschaftsbeziehungen zu entschlüsseln. Die Perspektive wird diskurstheoretisch ausbuchstabiert und die als anschlussfähig erachteten diskursiven Konstruktionen machttheoretisch unterfüttert. In Kapitel vier, dem Methodenkapitel, leiten einige Grundlagen der interpretativen Policy Analyse zur Fallauswahl und der Operationalisierung der vorangestellten theoretisch-konzeptionellen Überlegungen über. Die Diskursnetzwerkanalyse, das Vorgehen der Dokumentenanalyse und die Überlegungen zu den Experteninterviews werden dargelegt. In Kapitel fünf folgt die Analyse der Politisierung und lokalpolitischen Bearbeitung des Landarztmangels in sechs ausgewählten Landkreisen. In den Fallstudien wird zunächst der lokale Pressediskurs analysiert, bevor in einem zweiten Teil der eingeschlagenen lokale Bearbeitungspfad analysiert und ein Zwischenfazit gezogen wird. Die Diskussion der Erkenntnisse in Kapitel sechs richtet sich auf die zentral zu erklärenden Phänomene der Politisierung des Landarztmangels und der lokalpolitischen Initiativen sowie die potenziellen Rückwirkungen der Entwicklungen auf die staatliche Regulierung des ambulanten Sektors. Die Ergebnisse werden im Kontext relevanter wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Debatten diskutiert. In Kapitel sieben, dem Fazit, werden die forschungsleitenden Fragen beantwortet und die Thesen verifiziert oder falsifiziert und Forschungsdesiderate formuliert.
1Die vorliegende Studie verwendet gegenderte Personenbezeichnungen. Der Gender-Doppelpunkt hat den Vorteil, dass er die Leserlichkeit erhält. Zum selben Zweck wurden Personenbezeichnungen nur dann gegendert, wenn sie allein oder am Ende eines Wortes standen. Selbstverständlich beziehen sich alle Personenbezeichnungen stets auf alle Geschlechter.
2Ein Planungsbereich ist geöffnet, wenn der Versorgungsgrad unter 110 Prozent liegt. Ein Planungsbereich ist hingegen für weitere Niederlassungen gesperrt, wenn das der Versorgungsgrad über 110 Prozent liegt. Zusätzliche Zulassungen sind dann nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Liegt der Versorgungsgrad über 140 Prozent, soll der Zulassungsausschuss der Ärzte und Krankenkassen einer Nachbesetzung von Praxen nicht stattgeben, solange die betreffende Praxis nicht versorgungsrelevant ist. Liegt der Versorgungsgrad zwischen 75 und 110 Prozent, werden die Zulassungen nicht gesteuert. Allerdings können durch das Instrument des zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarfs Fördermaßnahmen für unterversorgte Gebiete in Teilregionen eines andernfalls gesperrten Planungsbereichs beschlossen werden. Liegt der Versorgungsbedarf in einem Planungsbereich unter 75 Prozent im hausärztlichen Bereich oder unter 50 Prozent im fachärztlichen Bereich, gilt der Bereich als unterversorgt. Dann sind die KVen angehalten, Maßnahmen zur Beseitigung der Unterversorgung einzuleiten und niederlassungsfördernde Förderungen anzubieten. Der Landesausschuss kann zudem eine drohende Unterversorgung für eine Region aussprechen, falls noch keine Unterversorgung vorliegt, diese aber aufgrund der Altersstruktur der Ärzt:innen zu erwarten ist (vgl. KBV o.J.b).
2Gegenstandserläuterungen und Forschungslage
Die Problematisierung und politisch-institutionelle Bearbeitung des Landarztmangels können nur vor dem Hintergrund der Beschaffenheit des deutschen Gesundheitssystems gewinnbringend durchdrungen werden. Die strukturelle Komponente des Problems bestimmt einige Zusammenhänge, die im Lokalen relevant werden. Deshalb folgt zunächst eine Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Literatur zur Organisation des ambulanten Sektors. Sodann werden die versorgungsrelevanten Effekte beschrieben, die in der Transformation des Sektors in Folge der Strukturreformen der 1990er Jahre begründet liegen. Die Erkenntnisse zur Regulierungsstruktur bestimmen den staatstheoretischen Ausgangspunkt, an den die Arbeit anschließt. Darauf aufbauend setzt sich der zweite Teil des Kapitels mit den Studien auseinander, die die Debatte um den Landarztmangel bestimmen oder zu befruchten versuchen.
2.1Die Strukturprinzipen und wandelbare Regulierung des Gesundheitssystems
Die Grundzüge des deutschen Gesundheitssystems reichen bis ins späte 19. Jahrhundert zurück. 1883 entstand die Krankenversicherung, ein Jahr später die Unfall- und weitere fünf Jahre später die Alters- und Invalidenversicherung. In der Hochphase des industriellen Kapitalismus konnten die Sozialversicherungen die grundsätzlichen Lebensbedürfnisse der Versicherten – damals der Arbeitnehmenden – jedoch nicht befriedigen. Die Arbeitsbedingungen in den Fabriken und die privaten Wohnverhältnisse der Menschen waren hart, die Ernährung vieler defizitär und die hygienischen Bedingungen schlecht. Krankheiten wie Tuberkulose griffen um sich und die Zahl der Säuglinge, die nach der Geburt starben, war hoch. Der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck – der deutsche Wohlfahrtsstaat wird auch »Bismarck-Modell« genannt – verfolgte mit der Sozialgesetzgebung das Ziel, die soziale Not der Arbeiterschaft zu verringern. Dazu war es nötig, einen großen Teil der unzufriedenen Arbeiterschaft für sich zu gewinnen. Die Absicherung erfolgte auch vor dem Hintergrund der sich wegen der miserablen Arbeitsbedingungen formierenden Zusammenschlüsse aus Arbeitern, wie Gewerkschaften und Parteien, die ihrerseits Konzessionen von Seiten des Kapitals einforderten. Um die politische Opposition der Sozialisten zu schwächen, erließ Reichskanzler Bismarck ein Versammlungsverbot und verbot sozialdemokratische Schriften, Vereine und Gruppierungen (Sozialistengesetze). In diesem konfliktiven Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital liegt ein genereller Grund für das Entstehen der Sozialversicherungen. Arbeiter, die aufgrund von Krankheit oder Verletzungen nicht arbeiten können, generieren keinen Profit für das jeweilige Unternehmen. Im Sinne der Reproduktion von Arbeitskraft liegt es daher im Interesse der Arbeitgeberseite, ein Mindestmaß an Absicherung zu gewähren. Weil der Versichertenstatus an das Arbeitsverhältnis und die Leistungen an die erbrachte Beitragshöhe gekoppelt war, waren umverteilende Momente oder eine Mindestsicherung aller weitgehend ausgeschlossen. Diese leistungsorientierte Ausrichtung des Sozialsystems unterscheidet sich in der klassischen Wohlfahrtstaatsforschung von stärker steuerfinanzierten Modellen. In Großbritannien und den skandinavischen Ländern ist das Sozialsystem auf die Bedürfnisse der Leistungsbeziehenden ausgerichtet. Der geläufigen Klassifikation von Wohlfahrtstaaten durch Esping-Andersen (1990) folgend ist Deutschland dem konservativen Typ zuzuordnen. Esping-Andersen unterscheidet liberale, konservativ-korporatistische und sozialdemokratische Wohlfahrtsstaaten. Relevant ist dabei das Verhältnis zwischen Staat, Markt und Familie/Haushalt in der Bereitstellung von Sozialleistungen, der Modus und die Qualität der Leistungen und die sozialpolitischen Effekte auf die Stratifikation und gesellschaftliche Machtverteilung. Jüngst wird auch von einem rudimentären (oder mediterranen) Wohlfahrtsregime und einem postsozialistischen Wohlfahrtsstaat gesprochen (vgl. Oschimansky/Berthold 2020).
Die sozialen Sicherungssysteme überdauern in ihren Grundzügen die politischen Regimewechsel seit dem Kaiserreich, wenngleich die Kostendämpfungspolitik der 1970er Jahre und die gesundheitspolitischen Strukturreformen der 1990er Jahre »widersprüchliche« (Schmid/Buhr 2015: 245f.) Entwicklungen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nach sich zogen. Deren Rückwirkungen werden in den Diskussionen zur Entwicklung vom Sozial- zum Sicherungsstaat (vgl. Nullmeier/Rüb 1993) mitverhandelt. Nach dieser Logik würde die Sozialpolitik der Sicherung des staatlichen Institutionengefüges dienen, statt die soziale Sicherheit zu fördern. Rolf G. Heinze et al. (vgl. 1999) beschreiben hingegen eine Entwicklung vom Wohlfahrts- zum Wettbewerbsstaat, wobei sie ein gewisses Maß an wettbewerblicher Akzentuierung in den Feldern der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik durchaus begrüßen. Christoph Butterwege bilanziert die liberalkonservative Restrukturierung des Gesundheitswesens kritisch (vgl. 2018: 138ff.). Insbesondere das durch die FDP-Gesundheitsminister im Kabinett Merkel II stark gemachte Ideal der Konsumentensouveränität stehe der Zielsetzung von Versorgungssicherheit im Sinne des Schutzes der Patient:innen – nicht nur der erwünschten Kunden – diametral gegenüber (ebd.: 142, 312ff.). Butterwege plädiert für Alternativen zum neoliberalen Um- oder Abbau des Sozialstaats, etwa durch eine solidarische Bürgerversicherung. Diese Debatten und die spezifischen Vorschläge zur Zukunft des Gesundheitswesens sind nur vor dem Hintergrund der Charakteristika der GKV und des ambulanten Sektors zu verstehen. Deshalb folgt eine Bestandsaufnahme der versorgungsrelevanten Grundprinzipien der GKV, bevor die lohnende funktionale Auseinandersetzung mit der Forschung zur Bedeutung von Versorgungsmängeln, deren Gründen und ihrer Bearbeitung anschließt.
Bereits zu Beginn des in seinen Grundzügen fortbestehenden Krankenversicherungssystems im späten 19. Jahrhundert kämpften die Krankenkassen und die Ärzteschaft um ärztliche Zulassungen. Wollten Ärzt:innen gesetzlich Versicherte behandeln, mussten sie Versorgungsverträge mit den Krankenkassen schließen. Diese hatten das Vertragsmonopol und entsprechend angespannt war die Stimmung innerhalb der Ärzteschaft und zwischen den Kostenträgern und Leistungserbringern (vgl. Moser 2011: 23ff.). Die Ärzteschaft sah sich im Kaiserreich einer eher wissenschaftskritischen Stimmung ausgesetzt. Wiederholte Auseinandersetzungen und vermehrte Ärztestreiks mündeten 1913 schließlich in einem Kompromiss. Das Berliner Abkommen legte für die Ärzteschaft und die Krankenkassen fest, dass die Zulassungen fortan kollektivvertraglich ausgehandelt wurden. Hierfür wurden Arzt-Patienten-Verhältniszahlen eingeführt und Ausschüsse für die gemeinsamen Vertragsverhandlungen eingerichtet. Während des ersten Weltkrieges wurden die Hürden für eine Zulassung zum Medizinstudium reduziert, um wegen der kriegsbedingten Verluste zügig neue Ärzt:innen ausbilden zu können. Erneut entbrannten Kämpfe um Zulassungen und die Ärzteschaft haderte mit den Vergütungseinbußen im Zuge der Inflation. Auch die restriktivere Abrechnungspolitik der Krankenkassen sorgte für Unmut innerhalb der Ärzteschaft. 1935 schließlich wurde die ärztliche Freiberuflichkeit geschaffen und die Ärzteschaft wurde, wie zuvor schon die Krankenkassen, als Körperschaft öffentlichen Rechts verfasst. Als sogenannte »mittelbare Staatsverwaltung« übernahm sie fortan öffentliche Aufgaben. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand eine umfassende Integration der sozialen Sicherungssysteme statt, es wird von einer »doppelten Inklusion« gesprochen (vgl. Alber 1992). Seit der Einführung der GKV wurden deren Leistungen und der Versichertenkreis beständig ausgeweitet. Heute sind rund 90 Prozent der Bürger:innen gesetzlich versichert.
Grundsätzlich fordert das deutsche Grundgesetz den Sozialstaat (Art. 20 Abs. 1 GG)1, wobei nur wenige konkrete Sozialrechte auch grundrechtlich verankert sind. Das Sozialrecht wird im Sozialgesetzbuch (SGB) kodifiziert und seit den 1970er Jahren fortwährend weiterentwickelt. Die GKV ist Gegenstand des Fünften Sozialgesetzbuches (SGB V). Der für den deutschen Sozialstaat charakteristische Bezug auf die Erwerbsarbeit ist für die GKV prägend. Sie wird hauptsächlich paritätisch von der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite beitragsfinanziert, wobei für die Verwendung der Mittel das Solidarprinzip maßgebend ist. Versicherte erbringen nach einer an ihrem Einkommen orientierten Leistungsfähigkeit Beiträge, die ihnen nach Maßgabe des Bedarfsprinzips eine medizinisch notwendige Behandlung sichern. Die eingezahlten Beiträge stehen für die aktuell Empfangsberechtigten zu Verfügung. Das Sachleistungsprinzip garantiert die bargeldlose Verfügung über alle erforderlichen medizinischen Leistungen im Krankheitsfall, wobei die Krankenversichertenkarte die Patient:innen als krankenversichert ausweist. Die Vergütung der ärztlichen Leistung erfolgt in der Regel indirekt durch die Krankenkassen. Das Organisationsprinzip der Subsidiarität ist ursächlich für die hochgradige Fragmentierung des GKV-Systems. Neben den 97 gesetzlichen Sozialversicherungsträgern2 gibt es rund 40 private Krankenversicherungen.3 Wegen der erbrachten Beiträge haben die rund 74 Mio. gesetzlich Versicherten Anspruch auf diverse Vorsorge- und Versorgungsleistungen und die freie Arztwahl.
Für die Vergütung der Ärzt:innen als Leistungserbringer durch die Krankenkassen als Kostenträger und die Organisation der Versorgung ist das Prinzip der Selbstverwaltung strukturbildend. Es betrifft im Sinne der sozialen Selbstverwaltung die innere Organisation der Körperschaften und im Sinne der gemeinsamen Selbstverwaltung deren Zusammenarbeit untereinander. Die Mitglieder der Krankenkassen wählen und bilden, je zur Hälfte, das wichtigste Organ einer gesetzlichen Krankenkasse, den Verwaltungsrat. Er beschließt den Haushalt, wählt den Vorstand, verfügt über den gesetzlich nicht festgesetzten Teil des Leistungskontingents und stellt die strategischen geschäfts- und gesundheitspolitischen Weichen der Krankenkasse. Krankenkassen sind finanziell und organisatorisch unabhängig. Es kommt allerdings zu gewissen Ausgleichszahlungen zwischen den Krankenkassen (Risikostrukturausgleich), um die Finanzierungsrisiken aufgrund regionaler und sozialer Disparitäten zu verringern und eine gleichmäßige Versorgung zu gewährleisten. Ziel ist es, das Interesse der Krankenkassen an einer »Rosinenpickerei«, also der strategischen Ungleichbehandlung von guten und schlechten Risiken, einzudämmen.
Wie die Kostenträgerseite folgt auch die Ärzteschaft einem System der Binnenregulierung. Die Ärztekammern sind für die Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie das ärztliche Berufsrecht zuständig, während die Zulassung und Vergütung der ambulant tätigen Vertragsärzt:innen den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) obliegt. Mediziner:innen, die die Behandlungen gesetzlich Versicherter mit gesetzlichen Krankenkassen abrechen möchten, müssen als Vertragsärzt:innen zur Versorgung zugelassen sein. Hierfür sind sie pflichtgemäß in einer der 17 Länder-KVen Mitglied. Mit Ausnahme von Nordrhein-Westfahlen gibt es eine KV in jedem Bundesland. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), der Dachverband der Länder-KVen, und die Länder-KVen sind nach dem Prinzip der Selbstverwaltung organisiert. Der Vorstand und die Vertreterversammlung sind die wichtigsten Gremien. Das Handeln der Länder-KVen und der KBV unterliegt der staatlichen Rechtsaufsicht.
Im Rahmen der sogenannten gemeinsamen Selbstverwaltung konkretisieren die Vertragsärzt:innen mit den Krankenassen die gesetzlichen Rahmenvorgaben zur ambulanten Gesundheitsversorgung. Der Staat hat die GKV-Akteure dafür als Körperschaften öffentlichen Rechts verfasst. Sie gelten als mittelbare Staatsverwaltung (BVerfGE, Bd. 39: 302ff.) und sind mit öffentlichen Aufgaben betraut. Wie die Verbände selbst unterliegen auch alle Gremien der gemeinsamen Selbstverwaltung der Rechtsaufsicht durch die zuständigen Behörden auf Bundes- und Landesebene. Sie können sowohl Regelungen beanstanden als auch zum Instrument der Ersatzvornahme greifen. Durch die Delegation staatlicher Aufgaben an die gemeinsame Selbstverwaltung will der Staat Sorge dafür tragen, dass die medizinische Versorgung nach den gesetzlichen Vorschriften verläuft. In diesem Sinne ist die Regulierung der GKV im Allgemeinen und des ambulanten Sektors im Besonderen staatlich geprägt. Die gewichtige Rolle, die den Verbänden und Körperschaften bei der Regulierung der GKV zukommt, veranlasst dazu, von einem korporatistischen Regulierungsmodell zu sprechen.
Zur Vergütung und Versorgungsorganisation schließt die Vertragsärzteschaft Verträge mit den Krankenkassen. Auf Bundesebene werden die sogenannten Bundesmantelverträge im höchsten Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung, dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), zwischen der KBV und dem GKV-Spitzenverband, dem Dachverband der Krankenkassen, geschlossen. Auf Landesebene verhandeln die Länder-KVen und Krankenkassenverbände Kollektivverträge, durch die auch die Gesamtvergütung festgesetzt wird. Diese wird von den Krankenkassen an die KVen ausgeschüttet. Im Gegenzug für die Vergütung sind die KVen im Rahmen des Sicherstellungsauftrags gemäß § 72 SGB V zur Gewährleistung einer ausreichenden, zweckmäßigen, wirtschaftlichen und den anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse berücksichtigenden Versorgung verpflichtet. Neben der Sicherstellung liegen die Aufgaben der KVen in der Interessenvertretung der Vertragsärzteschaft, der Mitarbeit in den Gremien der gemeinsamen Selbstverwaltung und der Gewährleistungspflicht gegenüber den Krankenkassen. Die KVen haben die Gewähr dafür zu tragen, dass die Versorgung den gesetzlichen und vertraglichen Maßgaben entspricht. Hierfür müssen sie ihre Mitglieder beraten, können aber auch Abrechnungen der Krankenkassen überprüfen (vgl. Simon 2017: 169). Die einzelnen Vertragsärzt:innen gelten als private Akteure, die nach einer Zulassung auch weiterhin überwiegend als niedergelassene Ärzt:innen in Praxen Versorgungsleistungen erbringen. Praxen können dabei Einzelpraxen, Praxisgemeinschaften, Gemeinschaftspraxen oder zur Anstellung befähigte MVZs sein. Relevant ist die Zulassung, die mit einem Versorgungsauftrag einhergeht. Die Zulassungen sind in ihrer Anzahl begrenzt. Grundsätzlich herrscht für die Vertragsärzt:innen zwar eine Niederlassungsfreiheit. Wollen sie jedoch ihre Leistungen mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen, werden die Möglichkeiten zur Niederlassung von der Bedarfsplanung gesteuert. Diese entstand Ende der 1970er Jahre.
Der in der Einleitung erwähnte Anstieg der Vertragsärzt:innen nach dem Ersten Weltkrieg ist insofern relevant, als seitdem politische Versuche bestehen, mit der vertragsärztlichen Tätigkeit verbundene Ausgaben einzugrenzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die zwischenzeitlich ausgesetzte Selbstverwaltung wieder hergestellt. Eine von der Verwaltung getrennte Sozialgerichtsbarkeit garantiert seitdem den Rechtschutz in der GKV. Wegen der expansiven Ausbildungspolitik galt der Arbeitsmarkt für Mediziner:innen in den 1950er Jahren als gesättigt. Das Kassenarztrecht aus dem Jahr 1955 regelte fortan die Beziehungen zwischen der Vertragsärzteschaft und Krankenkassen neu. Es wurden Zulassungsbezirke eingeführt und die Verhältniszahlen neu aufgelegt. Wegen des Wirtschaftswachstums wurden die sozialen Sicherungssysteme zu dieser Zeit umfassend integriert. Im Bereich der Gesundheitsversorgung wurden Leistungen ausgebaut, was unter den günstigen volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten keinen Anlass zu einer Problematisierung bot. Die verbesserte Einnahmelage der Ärzteschaft führte zu einem Zulauf an den Hochschulen im Fach Humanmedizin. Die anhaltenden Leistungsausweitungen erwirkten in Kombination mit wachsenden Versicherten trotz steigender Einnahmen bei den Krankenkassen eine Situation, die alsbald als sogenannte »Kostenexplosion« in der GKV gedeutet wurde. Angesichts dieser Entwicklungen führte das Krankenversicherung-Weiterentwicklungsgesetz von 1976 das angebotsinduzierte Instrument der kassenärztlichen Bedarfsplanung ein. Ziel war es, die Arztzahlen und die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen zu begrenzen. Die Vorläuferstruktur des heutigen G-BA erließ hierfür Richtlinien, nach deren Maßgabe die Landesausschüsse der gemeinsamen Selbstverwaltung Maßnahmen einleiten mussten. Zunächst konnten die Landesausschüsse jedoch allein eine regionale Unterversorgung feststellen.
Im Rahmen der folgenden Gesetze zur sogenannten »strukturkonservierenden Kostendämpfung« zielte der Bundesgesetzgeber darauf ab, die Ausgaben der GKV an ihre Einnahmen anzupassen, insbesondere um die Lohnnebenkosten niedrig zu halten. Das Primat der Beitragssatzstabilität war geboren. Hierfür wurden unter anderem Leistungsausgaben begrenzt, Wirtschaftlichkeitsprüfungen eingeführt und die Privatisierung von Behandlungskosten ausgebaut. Mitunter strich der Gesetzgeber Behandlungen gänzlich aus dem Leistungskatalog. Alsbald war die Rede vom Rasenmäherprinzip und Verschiebebahnhof, weil Ausgaben und Budgets gekürzt oder eingefroren und innerhalb des Sozialbudgets zulasten der GKV verlagert wurden. Auch unter der einnahmeorientierten Ausgabenpolitik gelang es der Vertragsärzteschaft jedoch über Nachverhandlungen immer wieder die eigene Vergütung zu erhöhen. Die Kostendämpfungspolitik kam ohne substanzielle strukturelle Korrekturen daher.
Das von der Ärzteschaft in den 1960er Jahren erkämpfte Verbot der Zulassungsbeschränkungen und die positive Sicht auf den ärztlichen Beruf wirkten in die 1980er Jahre nach: 1983 war der Höhepunkt an Bewerber:innen für das Medizinstudium erreicht. Zwischen 1960 und 1980 verdoppelte sich die Zahl der Mediziner:innen auf dem Arbeitsmarkt. Es bestanden große Unsicherheiten darüber, wie mit der Ärzteschwemme umgegangen werden sollte (vgl. Futterer 2020: 19f.). Zunächst sollte die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, die Vorläuferin des heutigen Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklungen im Gesundheitswesen (SVR-G), Empfehlungen zur Ausgabenentwicklung in den einzelnen Leistungsbereichen unter Berücksichtigung der Beitragssatzstabilität abgeben. Die politische Neuorientierung ging mit einer funktionalen Aufwertung der Bundesausschüsse der gemeinsamen Selbstverwaltung einher. Sie waren nun gemäß § 101 SGB V zum Erlass von Richtlinien und Maßnahmen für Über- und Unterversorgung verpflichtet.
Im Laufe der Reformen der folgenden Jahre verstetigte sich die Bedarfsplanung als zentrales Steuerungsinstrument der ambulanten medizinischen Versorgung. Heute gilt sie als das maßgebende Instrument zur rechnerischen Ermittlung der zur Patientenversorgung notwendigen Niederlassungsmöglichkeiten. Den bundeseinheitlichen Rahmen der Bedarfsplanung legt dabei seit 1993 gemäß den §§ 99–105 SGB V die Bedarfsplanungsrichtlinie des G-BA fest. Die Bedarfsplanung kann bei fehlenden Interessent:innen keine freien Sitze besetzen, aber sie kann auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Niederlassungsmöglichkeiten hinwirken. Vor Ort beruht sie maßgeblich auf den bundeseinheitlichen Vorgaben. Über zahlreiche Möglichkeiten zu Abweichungen und Anpassungen kann die gemeinsame Selbstverwaltung allerdings auf lokale Bedarfe reagieren. Hierfür erstellt sie einen Bedarfsplan.
Abbildung 1: Bedarfsplan
Quelle: KBV o.J.b
Der Bedarfsplan wird gemäß § 90 SGB V im Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen erstellt. Er ist die Grundlage für die Zulassungen und Sicherstellungsmaßnahmen, beschreibt die Bedingungen und Ziele der Bedarfsplanung, das Versorgungsniveau und die zulässigen regionalen Abweichungen. Der Landesausschuss besteht aus einem unparteiischen Vorsitzenden, zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern und je neun Vertreter:innen der Vertragsärzt:innen und der Krankenkassen. Patienten- und Ländervertreter:innen sind mitberatend ohne Stimmrecht vertreten (Abb. 1). Die Vertreter:innen der Länder haben zudem ein Antragsrecht. Sie werden von der jeweiligen obersten Landesbehörde, dem für Gesundheit zuständigen Landesministerium, entsendet. Die Rechtsaufsicht liegt ebenfalls bei den obersten Landesbehörden. Sie haben im Landesausschuss ein Mitberatungs- und Antragsrecht und das Recht, Entscheidungen innerhalb von zwei Monaten zu beanstanden. Zudem entsenden die Ministerien die Vertreter:innen, die von Seiten der Länder an den Beratungen des G-BA zur Bedarfsplanungsrichtlinie beteiligt sind.
Zunächst erstellen die KVen im Einvernehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen den Bedarfsplan. Dieser wird den zuständigen Landesbehörden für Gesundheit vorgelegt. Die Behörden verfügen über eine Gelegenheit zur Stellungnahme. Sie haben zudem ein Beanstandungsrecht, von dem sie innerhalb von acht Wochen Gebrauch machen können. Im Falle eines fehlenden Einvernehmens zwischen der KV und den Krankenkassen fungiert der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen als Schiedsgremium. Besteht der Bedarfsplan, trifft der Landesausschuss auf seiner Grundlage Beschlüsse über die Sperrung oder (partielle) Öffnung von Planungsbereichen und die Feststellung von (drohender) Unterversorgung oder Überversorgung. Diese Beschlüsse sind für die zuständigen Zulassungsausschüsse bindend.
Bei der Bedarfsplanung greifen verschiedene Zuständigkeiten und Steuerungsmöglichkeiten ineinander. Vor Ort erfolgt die Planung durch den Bedarfsplan. Die Zulassungen werden von den Zulassungsausschüssen erteilt. Diese sind zwar grundsätzlich an die Bedarfspläne gebunden, können aber in Einzelfällen, etwa über Sonderbedarfe, zusätzliche Niederlassungen ermöglichen. Hier wird der Einfluss der bundeseinheitlichen Normen deutlich. Der Planungsrahmen lässt eine Bewertung des Versorgungsniveaus zu. Die Versorgungsgrade werden je nach Planungsebene und Arztgruppe gedeutet. Dabei wird die hausärztliche Versorgung am kleinräumigsten beplant. Das soll sicherstellen, dass hausärztliche Praxen möglichst nah am Wohnort von Patient:innen aufzufinden sind. Aufgrund der zunehmenden Spezialisierung wird die sonstige fachärztliche Versorgung in größeren Einzugsgebieten als ausreichend bedarfsgerecht eingeschätzt. Der Versorgungsgrad in einem Planungsbereich wird berechnet, indem das Ist-Niveau des Einwohner-Arzt-Verhältnisses mit dem Soll-Niveau der Verhältniszahl abgeglichen wird. Der Versorgungsgrad wird in Prozent ausgedrückt und vom Landesausschuss bewertet.
Für den hausärztlichen Bereich wird der Versorgungsgrad wie folgt interpretiert: Liegt der Versorgungsgrad unter 75 Prozent, liegt eine Unterversorgung vor. Dann ist die zuständige KV angehalten, Maßnahmen zu Beseitigung der Unterversorgung einzuleiten. Der Landesausschuss kann eine drohende Unterversorgung feststellen, wenn sich diese wegen der Altersstruktur der Ärzt:innen ankündigt. Auch dann ist die Möglichkeit zu Fördermaßnahmen gegeben. Ist das Soll-Versorgungsniveau um zehn Prozent überschritten wird ein Planungsbereich für weitere Niederlassungen gesperrt. Zulassungen sind dann nur unter weiteren, besonderen Voraussetzungen möglich. Liegt der Versorgungsgrad über 140 Prozent ist der zuständige Zulassungsausschuss angehalten, Nachbesetzungsanträgen nicht stattzugeben, wenn die Praxis nicht notwendig für die Versorgung in der Region ist. Aufgrund des Instruments des zusätzlichen Versorgungsbedarfs können Maßnahmen für andernfalls unterversorgte Gebiete auch in Bereichen ergriffen werden, die in einem gesperrten Planungsbereich liegen. Der Gesetzgeber sieht diverse Maßnahmen für Gebiete mit (drohender) Unterversorgung vor. Die Zulassungsverordnung der Vertragsärzte legt fest, dass der Landesauschuss die KV auffordern muss, die Unterversorgung binnen einer von ihm zu bestimmenden angemessenen Frist zu beseitigen. Der Landesausschuss kann dabei spezifische Maßnahmen empfehlen. Nach Ablauf der Frist, spätestens jedoch sechs Monate nach Feststellung einer Unterversorgung, ist die KV gemäß § 105 Abs. 1 Satz 2 SGB V dazu verpflichtet, eine Eigeneinrichtung zu erstellen. Gelingt es nicht, die Versorgung zu sichern, kann der Landesausschuss andere Gebiete sperren, um steuernd einzugreifen. Ergänzend können die KVen gemäß § 105 Abs. 1a SGB V Sicherstellungsfördermaßen aus dem Strukturfonds finanzieren. Hierzu zählen Zuschüsse zu Investitionskosten bei Neuniederlassungen, Praxisübernahmen oder der Gründung von Zweigpraxen. Auch Stipendien für Medizinstudierende sind über den Strukturfonds förderfähig.
Die Normen, die in den Bedarfsplanungsrichtlinien des G-BA festgelegt werden, begründen – der Begriff führt in die Irre – keine Bedarfs-, sondern eine Kapazitäts- und Verteilungsplanung. Grundlage der Messung ist nicht der Versorgungsbedarf anhand der Nachfrage oder Morbidität, sondern das Angebot an ärztlichen Leistungserbringer:innen im Vorjahr der Berechnung. Dieses Angebot wird in Bezug zur Bevölkerungszahl gesetzt. Die Bedarfsplanung hat ihr Ziel, die Entwicklung der 1980er zu bremsen, erreicht, allerdings zu einem »hohen Preis« (Kopetsch 2003). Im Zusammenwirken der Kostendämpfung mit den Effekten der Strukturreformen der 1990er Jahre schmälert die Bedarfsplanung die Attraktivität einer vertragsärztlichen Niederlassung für junge Nachwuchsmediziner:innen (ebd.: 38).
Wegen der als überschaubar eingestuften Ergebnisse der Kostendämpfungspolitik (vgl. Alber 1988) gewinnt fortan ein Umstand an Bedeutung: Die soziale Sicherung ist in Deutschland nicht an die Staatsbürgerschaft, sondern an den Erwerbstätigenstatus der Versicherten gebunden. Deshalb ist gleichsam der soziale Fortschritt vom wirtschaftlichen Erfolg abhängig. Dieser Zusammenhang hat zur Folge, dass wirtschaftliche Konjunkturen eine Wirkung auf der individuellen Versicherten- und Versorgerebene entfalten. Neben allen Ansprüchen beteiligen sich gesetzlich Versicherte heute an einigen Leistungen mit ihrem Privatvermögen. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Arzneimittel und des Zahnersatzes. Ursächlich hierfür ist die in den 1960/70er Jahren prominente Interpretation steigender Kosten im Gesundheitswesen als Kostenexplosion (vgl. Rosenbrock/Gerlinger 2014: 152, kritisch: Reiners 2009a: 17ff.). Der Kostensteigerung lagen einige Anreiz- und Strukturfaktoren zu Grunde; sie wurde allerdings auch in Folge der Wirtschaftskrise von 1973/74 diagnostiziert, als niedriges Wirtschaftswachstum und steigende Arbeitsloszahlen die Volkswirtschaft prägten (vgl. Futterer 2020: 16f.). In der Folge versuchte der Gesetzgeber über eine einnahmeorientierte Ausgabenpolitik die Ausgaben im Gesundheitswesen zu begrenzen. Die verbundenen Maßnahmen zielen darauf ab, die Beitragssätze stabil zu halten, um als Belastung interpretierte Steigerungen der Arbeitgeberbeiträge zur GKV im Sinne der Lohnnebenkosten einzugrenzen. Die strukturkonservativen Gesundheitsreformen zwischen 1975 und 1992 führten Budgets auf die Vergütung unterschiedlicher Leistungsbereiche ein, nahmen Kürzungen im Leistungskatalog vor und übertrugen einige Strukturmerkmale der PKV auf die GKV (vgl. Knieps/Reiners 2015: 77ff.).
1987 kam eine vom Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission zu dem Entschluss, die ordnungspolitischen Instrumente würden den Anforderungen an eine ausreichende und qualitativ hochwertige Versorgung nicht mehr gerecht, insbesondere vor dem Hintergrund der medizinischen Entwicklungen. Es bestanden zudem Anreize, die eine angebotsseitige Leistungsreduktion oder nachfrageseitig reduzierte Inanspruchnahme verhinderten. Diverse Gesundheitsreformen hatten einen Mix von Steuerungsinstrumenten zur Folge, die Mengen-, Preis- und Strukturkomponenten der Ausgabenentwicklung zu regulieren versuchten (vgl. Rosenbrock/Gerlinger 2014: 361ff.). Das Gesundheitsreformgesetz von 1989 und die anschließende Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen sollten die Kostendämpfungspolitik neu ausrichten. Die Pläne gingen nicht auf (vgl. Reiners 1990: 22; Gerlinger/Schönwälder 2012), weshalb der damalige Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer (CSU) 1992 das Gesundheitsstrukturgesetz erließ. Zunächst wurde die freie Kassenwahl eingeführt, wodurch ein Wettbewerb zwischen den Krankenkassen um die Patient:innen entstand (vgl. Bode 2010). Der Wettbewerb brachte den Patient:innen einige Wahlfreiheiten ein (zwischen Versicherungen, Tarifen und Leistungserbringern), erhöhte aber vor allem im Zuge der folgenden Reformen auch deren Eigenverantwortung in Gesundheitsbelangen. Das Gesundheitsstrukturgesetz mündete weiterhin in einer umstrukturierten Bedarfsplanungsrichtlinie, neuen Verhältniszahlen, der Festlegung neuer Planungsbereiche und der Festlegung, dass die hausärztliche Versorgung von Allgemeinmediziner:innen und hausärztlich tätigen Internist:innen erbracht wird. Den weitreichendsten Reformpunkt für die Ärzteschaft stellt die Einführung der Budgetierung der vertragsärztlichen Honorare dar. Der Ausgabendeckel auf die Vergütung bedeutete nicht, dass die Mittel für die Gesamtvergütung nicht weiter steigen konnten. Das Gegenteil war der Fall (vgl. Futterer 2020: 22). Sie konnten allerdings nur noch in festgelegten Grenzen steigen, weil die Gesamtvergütung nicht stärker als die beitragspflichtigen Einkommen der Versicherten, die Grundlohnsumme, erhöht werden durfte.
Für die Rolle des Staates, die Regulierung und die Willensbildung im deutschen Gesundheitswesen spielt das die GKV tragende Element des Korporatismus eine zentrale Rolle. Korporatismus meint nach dem lateinischen Wortursprung corporativus, einen Körper bildend. In der politikwissenschaftlichen Auseinandersetzung beschreibt Korporatismus zunächst »bestimmte Formen der Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen an politischen Entscheidungsprozessen« (Schubert/Klein 2020). Der Einbindung von Interessenverbänden in die Politikgestaltung und der Übertragung öffentlicher Aufgaben ist über unterschiedliche Politikfelder hinweg gemein, dass die Korporationen in Form sozialer Verbände in der Erfüllung öffentlicher Aufgaben eine herausragende Stellung einnehmen. Das Repräsentationsmonopol ist für die Verbände ein gewichtiger Grund, sich auf die Bedingungen des Korporatismus einzulassen. Der Auftrag der Verbände besteht darin, als Intermediäre zwischen Bürger:innen und Staat die Mitgliederinteressen gegenüber dem Staat zu vertreten. Die Anzahl der Verbände ist beschränkt und es herrscht Mitgliedszwang.
Die Vorteile korporatistischer Steuerung für den Staat liegen auf der Hand: Er gewinnt nützliche Informationen und erhöht die Chance, für den gewonnen Konsens eine gewisse Akzeptanz (Grzeszick 2010: 23) zu sichern. Die Übernahme öffentlicher Aufgaben durch Verbände entlastet ihn. Zudem disziplinieren Korporatismen zu einer gewissen Offenheit der Verbände gegenüber der Regierungspolitik (ebd.: 46ff.). Die interne Interessenspluralität zwingt die Verbände dazu, Kompromisse zu finden, wollen sie doch nach außen als Verhandlungspartner auftreten und für den Staat attraktiv sein. Zudem verspricht der Zusammenschluss in Dachverbänden den einzelnen Verbänden einen einfacheren Zugang zur Politik und ihren Prozessen. Auf diesem Wege entwickeln insbesondere große und mitgliederstarke Verbände Interessen, die in der Theorie einem Gemeinwohl nahekommen (vgl. Czada 1994). Dass eine Gemeinwohlorientierung im Rahmen korporatistischer Regulierungsmodelle jedoch keineswegs zwingend ist, mehr noch, autoritär ausgestaltet sein kann, zeigt der staatliche Korporatismus im italienischen Faschismus (vgl. Alemann 2002; zum ideengeschichtlichen Hintergrund vgl. Czada 1994). Damals wurden die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Organisationen zur Einbindung in die autoritären Entscheidungsverfahren gezwungen. Schroeder und von Winter formulieren ihre generelle Kritik wie folgt:
»[Es] besteht eine Tendenz zur Bildung von Machtmonopolen, die strukturkonservierend und innovationshemmend wirken können. Korporatistische Arrangements werden oft damit legitimiert, dass [sie] einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Im Korporatismus kann das Gemeinwohl aber auch umgekehrt durch die Selektivität der Interessenvermittlung beeinträchtigt werden, indem sich Partikularinteressen auf Kosten unbeteiligter Dritter durchsetzen. […] Demgegenüber ist die demokratische Legitimation des Korporatismus eher gering, da Entscheidungen nicht durch Mehrheitswillen im Parlament, sondern in exklusiven Zirkeln getroffen werden[.]« (Schroeder/von Winter 2019: 481f.)
Grundsätzlich wird zwischen dem vorgenannten Staatskorporatismus und dem gesellschaftlichen oder liberalen Neokorporatismus unterschieden4. Letzterer fußt auf der freiwilligen Beteiligung der genannten Organisationen. Die Debatte um den Neo-Korporatismus kommt in den 1970er Jahren auf und fokussiert sich auf
»Produzentenverbände und deren Konzertierung mit staatlicher Politik im liberal-demokratischen Wohlfahrtskapitalismus. Es geht um das politische Steuerungspotenzial einer zwischen Regierungen, Gewerkschaften und Industrieverbänden in Institutionen der Sozialpartnerschaft ausgehandelten Wirtschafts- und Sozialpolitik« (Czada 2022).
Zu den zentralen Befunden der Neokorporatismusforschung zählt, dass der Staat Einfluss auf die Bildung von Interessengruppen und die Organisierung kollektiver Interessen nimmt, die Verbände nicht vorab eindeutig feststehende Gruppeninteressen repräsentieren, sondern sich diese erst herausbilden und Verbände sich dazu mit den Orientierungen und Forderungen ihrer Mitglieder und den Anforderungen der institutionellen Umwelt auseinandersetzten müssen (vgl. Voelzkow 2021).





























