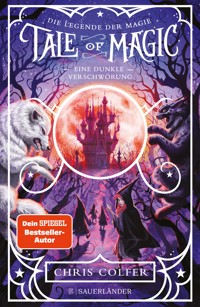8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Land of Stories
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
»In Colfers magischen Reichen steckt mehr, als Disney je zu träumen wagte.« USA Today Als Alex und ihr Zwillingsbruder Conner ein altes Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen, ahnen sie nicht, dass der dicke Schmöker ein Portal in ein magisches Reich ist. Sie geraten in eine Welt, in der es nicht nur gute Feen und verwunschene Prinzen gibt, sondern auch ein böses Wolfsrudel und eine noch viel bösere Königin. Doch ganz so einfach ist die Sache mit Gut und Böse leider nicht. Denn in all den Jahren nach dem Happy End haben die Märchenwesen einige Marotten entwickelt, was die Zwillinge in so manche verzwickte Lage bringt. Außerdem haben sie nicht den blassesten Schimmer, wie sie wieder nach Hause finden sollen. In einem geheimnisvollen Tagebuch steht die Lösung – doch hinter dem ist auch die böse Königin her …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Ähnliche
Chris Colfer
Land of Stories – Das magische Land
Die Suche nach dem Wunschzauber
Aus dem Amerikanischen von Fabienne Pfeiffer
Mit Illustrationen von Brandon Dorman
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Grandma.
Dafür, dass sie meine erste Lektorin gewesen ist
und mir im Hinblick aufs Schreiben den
besten Rat gegeben hat:
»Christopher, ich denke, du solltest warten,
bis du mit der Grundschule fertig bist,
ehe du dir Sorgen machst,
dass du als Schriftsteller scheitern könntest.«
»Eines Tages wirst du alt genug sein,
um wieder Märchen zu lesen.«
C.S. Lewis
PrologDas Treffen der Königinnen
Der Kerker war ein elender Ort. Fackeln an den Steinwänden spendeten spärliches, flackerndes Licht, und von der Decke tropfte faulig riechendes Wasser aus dem Graben, der den über dem Kerker liegenden Palast umgab. Ratten jagten auf der Suche nach Nahrung über den steinernen Fußboden. Kein Ort für eine Königin.
Es war kurz nach Mitternacht, und bis auf das gelegentliche Rasseln einer Kette war kein Laut zu hören. Durch die schwere Stille hallten leise klackernde Schritte, als jemand die gewundene Treppe in den Kerker hinabstieg.
Eine junge Frau, von Kopf bis Fuß in einen langen, smaragdgrünen Umhang gehüllt, erschien am Fuß der Stufen. Bedächtig ging sie an den Zellen entlang und zog dabei die Aufmerksamkeit der Gefangenen auf sich. Mit jedem Schritt wurde sie langsamer, zugleich zitterten ihre Hände immer stärker.
In welcher Zelle ein Gefangener untergebracht wurde, richtete sich nach dem Verbrechen, das er begangen hatte: Je tiefer die junge Frau in den Kerker vordrang, desto grausamer und gefährlicher wurden die Insassen, an denen sie vorbeischreiten musste. Ihr Blick war auf die Zelle ganz am Ende des Ganges geheftet, in der sich eine besondere Gefangene befand, die von einer eigens abgestellten, großgewachsenen Wache beaufsichtigt wurde.
Die Frau war gekommen, um dieser Gefangenen eine Frage zu stellen. Es war eine einfache Frage, und doch hatten sich Tag für Tag all ihre Gedanken darum gedreht; viele Nächte hatte sie deshalb wach gelegen, und wenn sie doch ein wenig Schlaf gefunden hatte, konnte sie von nichts anderem träumen.
Nur ein Mensch konnte ihr die Antwort geben, die sie brauchte, und dieser Mensch saß auf der anderen Seite der Eisenstäbe, auf die sie nun zuging.
»Ich möchte sie sehen«, sagte die in den Umhang gehüllte Frau zu der Wache.
»Niemand darf sie sehen«, erwiderte die Wache und schien von der Bitte beinahe belustigt. »Ich habe strikte Anweisungen der königlichen Familie.«
Die Frau nahm ihre Kapuze ab, so dass ihr Gesicht zu erkennen war. Haut weiß wie Schnee, Lippen rot wie Blut und Haar schwarz wie Ebenholz. Ihre Schönheit war im ganzen Land bekannt und ihre Geschichte sogar weit über dessen Grenzen hinaus.
»Euer Majestät, bitte vergebt mir!«, entschuldigte sich der bestürzte Wachposten. Hastig senkte er den Kopf zu einer übertrieben tiefen Verbeugung. »Ich hatte niemanden aus dem Palast erwartet.«
»Eine Entschuldigung ist nicht vonnöten«, sagte sie. »Aber bitte sorgt dafür, dass niemand von meiner Anwesenheit erfährt.«
»Natürlich«, versicherte die Wache mit einem Nicken.
Die Frau wandte sich den Gitterstäben zu und wartete, dass der Wachposten sie öffnen würde, doch er zögerte.
»Seid Ihr sicher, dass Ihr hineingehen wollt, Euer Majestät?«, fragte er. »Unmöglich, abzuschätzen, wozu sie in der Lage ist.«
»Ich muss sie sehen«, antwortete die Frau. »Koste es, was es wolle.«
Die Wache machte sich daran, an einer großen, kreisrunden Winde zu drehen, und die Stäbe wurden langsam nach oben gezogen. Die Frau nahm einen tiefen Atemzug und schritt darunter hindurch.
Sie ging einen noch längeren, noch dunkleren Gang entlang, und eine ganze Reihe weiterer Stangen und Absperrungen hoben sich und wurden hinter ihr wieder herabgelassen. Schließlich gelangte sie ans Ende des Ganges, eine letzte Gittertür wurde emporgekurbelt, und sie betrat die Zelle.
Die Gefangene saß in der Mitte auf einem Stuhl und starrte zu einem kleinen Fenster hinauf. Nie zuvor war jemand zu ihr in die Zelle gekommen, und die Gefangene musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, wer hinter ihr stand – denn es gab nur einen Menschen, der das wagen würde.
»Hallo, Schneewittchen«, sagte die Gefangene sanft.
»Hallo, Stiefmutter«, erwiderte Schneewittchen mit zitternder Stimme. »Ich hoffe, es geht dir gut.«
Obwohl Schneewittchen sich zuvor genau überlegt hatte, was sie sagen wollte, brachte sie nun kaum ein Wort heraus.
»Ich habe gehört, du bist inzwischen Königin«, sagte ihre Stiefmutter.
»Das stimmt«, antwortete Schneewittchen. »Ich habe den Thron geerbt, so wie mein Vater es wollte.«
»Nun, wie komme ich dann zu dieser Ehre? Bist du hier, um dir anzusehen, wie ich dahinsieche?«, fragte die Stiefmutter. Ihre Stimme klang herrisch und kraftvoll; selbst die stärksten Männer konnte sie damit mühelos einschüchtern.
»Ganz im Gegenteil«, sagte Schneewittchen. »Ich bin gekommen, weil ich verstehen will.«
»Was willst du verstehen?«, fragte ihre Stiefmutter barsch.
»Warum«, Schneewittchen zögerte. »Warum du getan hast, was du getan hast.«
Und als sie es endlich ausgesprochen hatte, spürte Schneewittchen, wie ihr eine Last von den Schultern genommen wurde. Endlich hatte sie die Frage gestellt, die sie so sehr beschäftigte. Damit war der schwierigste Teil bereits geschafft.
»Es gibt vieles zwischen Himmel und Erde, das du nicht verstehst«, entgegnete die Gefangene und drehte sich zu ihrer Stieftochter um.
Zum ersten Mal seit langem sah Schneewittchen das Gesicht ihrer Stiefmutter. Es war das Gesicht einer Frau, die einmal makellos schön gewesen war – das Gesicht einer ehemaligen Königin. Nun jedoch war diese Frau, die vor Schneewittchen saß, nicht mehr als eine Gefangene, deren einst anmutige Gesichtszüge sich zu einer finsteren, verhärmten Miene verhärtet hatten.
»Das mag sein«, sagte Schneewittchen. »Aber kannst du es mir zum Vorwurf machen, dass ich versuche, irgendeine Erklärung für deine Taten zu finden?«
Die letzten Jahre waren die skandalträchtigsten gewesen, die das Königreich je erlebt hatte. Jeder kannte die Geschichte der hübschen Prinzessin, die vor ihrer eifersüchtigen Stiefmutter geflohen war und bei den sieben Zwergen ein Versteck gefunden hatte. Alle wussten von dem berüchtigten vergifteten Apfel und dem kühnen Prinzen, der Schneewittchen aus ihrem Scheintod errettet hatte.
Das Geschehene an sich war nicht weiter kompliziert – ganz im Gegensatz zu den Ereignissen, die es nach sich gezogen hatte. Denn selbst als Schneewittchens Zeit schließlich vollends mit ihrer Ehe und ihrem Dasein als Königin ausgefüllt war, fragte sie sich noch immer, ob es tatsächlich – wie allgemein gemunkelt wurde – nur Eitelkeit gewesen war, die ihre Stiefmutter angetrieben hatte. Tief in ihrem Herzen wollte die neue Königin nicht glauben, dass jemand so boshaft und niederträchtig sein konnte.
»Weißt du, wie man dich dort draußen nennt?«, fragte Schneewittchen. »Außerhalb dieser Kerkermauern spricht die Welt von dir als die böse Königin.«
»Wenn die Welt mir diesen Titel verliehen hat, dann werde ich lernen müssen, damit zu leben«, gab die böse Königin zurück. »Wenn die Welt erst einmal eine Entscheidung getroffen hat, lässt sich kaum etwas dagegen tun.«
Schneewittchen war verblüfft, wie wenig ihr schlechter Ruf die Stiefmutter zu kümmern schien – doch die junge Königin wollte, dass er sie kümmerte. Sie wollte einen Beweis dafür, dass die Frau, die ihr nun gegenübersaß, noch ein wenig Menschlichkeit in sich hatte.
»Sie wollten dich hinrichten lassen, als sie von deinen Verbrechen gegen mich hörten! Das ganze Königreich wollte deinen Tod!« Schneewittchens Stimme wurde zu einem schwachen Flüstern; sie musste gegen die Gefühle ankämpfen, die in ihr hochkochten. »Aber das habe ich nicht zugelassen. Ich konnte es nicht …«
»Soll ich dir nun dafür danken, dass du mich verschont hast?«, fragte die böse Königin. »Wenn du willst, dass jemand sich dir zu Füßen wirft und seinen Dank bekundet, bist du in die falsche Zelle gekommen.«
»Ich habe es nicht für dich getan. Ich habe es für mich selbst getan«, sagte Schneewittchen. »Ob es dir gefällt oder nicht: Du bist die einzige Mutter, die ich je gekannt habe. Ich weigere mich, zu glauben, dass du das seelenlose Ungeheuer bist, zu dem der Rest der Welt dich erklärt. Vielleicht habe ich recht, vielleicht auch nicht, aber ich glaube, dass du tief in deinem Innern ein Herz hast.«
Tränen liefen Schneewittchen über die blassen Wangen. Sie hatte sich selbst geschworen, stark zu bleiben – doch nun, da sie ihrer Stiefmutter tatsächlich gegenüberstand, hatte sie die Kontrolle über ihre Gefühle verloren.
»Da täuschst du dich«, sagte die böse Königin. »Die einzige Seele, die ich je hatte, ist vor langer Zeit gestorben, und das einzige Herz, das ich besitze, ist ein Herz aus Stein.«
Die böse Königin besaß tatsächlich ein steinernes Herz, allerdings nicht in ihrem Körper. In einer Ecke der Zelle lag auf einem kleinen Tisch ein Stein von der Form und Größe eines menschlichen Herzens. Er war der einzige Gegenstand, den die böse Königin hatte behalten dürfen, nachdem man sie festgenommen hatte.
Schneewittchen kannte den Stein noch aus Kindertagen. Schon immer hatte ihrer Stiefmutter viel an ihm gelegen, und niemals hatte die böse Königin ihn aus den Augen gelassen. Nie hatte Schneewittchen ihn berühren oder gar in der Hand halten dürfen – doch nun konnte nichts und niemand sie daran hindern.
Sie ging durch die Zelle zu dem kleinen Tisch hinüber, nahm den Stein und betrachtete ihn neugierig. Er weckte so viele Erinnerungen in ihr. All die Vernachlässigung, die sie als Kind erfahren hatte, und auch die Traurigkeit, die die Stiefmutter in ihr ausgelöst hatte, stürzten auf sie ein.
»Mein ganzes Leben lang habe ich mir nur eines gewünscht«, flüsterte Schneewittchen. »Deine Liebe. Als kleines Mädchen habe ich mich stundenlang im Palast versteckt, in der Hoffnung, du würdest bemerken, dass ich verschwunden war – doch das hast du nie. Du hast deine Tage in deinen Gemächern verbracht, mit deinen Spiegeln und Hautsalben und diesem verfluchten Stein. Du hast mehr Zeit mit Fremden verbracht, die dir Mittelchen für die ewige Jugend angepriesen haben, als mit deiner Tochter. Aber warum?«
Die böse Königin gab keine Antwort.
»Viermal hast du versucht, mich umzubringen – davon dreimal sogar eigenhändig«, fuhr Schneewittchen mit fassunglosem Kopfschütteln fort. »Ich wusste, dass du es warst, als du mich als alte Frau verkleidet in der Hütte der Zwerge besucht hast. Ich wusste, dass du gefährlich warst, und doch habe ich dich immer wieder hereingebeten. Immer wieder hatte ich die Hoffnung, du würdest dich ändern. Ich habe zugelassen, dass du mir Böses tust.«
Diese Dinge hatte Schneewittchen noch nie zuvor jemandem anvertraut, und nachdem sie die Worte nun ausgesprochen hatte, konnte sie nicht anders: Sie vergrub ihr Gesicht in den Händen und weinte.
»Du glaubst, du wüsstest, wie es sich anfühlt, das Herz gebrochen zu bekommen?«, fragte die böse Königin in einem solch scharfen Ton, dass ihre Stieftochter zusammenzuckte. »Du weißt überhaupt nicht, was Schmerz ist. Du hast nie Zuneigung von mir erfahren, aber vom Moment deiner Geburt an hat das ganze Königreich dich geliebt. Andere dagegen hatten nicht solch ein Glück. Anderen, Schneewittchen, wird manchmal die einzige Liebe ihres Lebens genommen.«
Schneewittchen wusste nicht, was sie dazu sagen sollte. Von welcher Liebe sprach ihre Stiefmutter?
»Meinst du meinen Vater?«, fragte Schneewittchen.
Die böse Königin schloss die Augen und schüttelte den Kopf. »Kindliche Einfalt ist wahrhaft ein Geschenk«, sagte sie. »Ob du es glaubst oder nicht, Schneewittchen: Ich hatte mein eigenes Leben, bevor ich in deines getreten bin.«
Schneewittchen wurde still und schämte sich ein wenig. Natürlich wusste sie, dass es für ihre Stiefmutter ein Leben vor der Hochzeit mit ihrem Vater gegeben hatte, doch sie hatte sich nie wirklich Gedanken darüber gemacht, wie dieses Leben ausgesehen haben mochte. Ihre Stiefmutter hatte stets so wenig von sich preisgegeben, dass Schneewittchen schlicht keinen Anlass dazu gesehen hatte.
»Wo ist mein Spiegel?«, wollte die böse Königin wissen.
»Er soll zerstört werden«, antwortete Schneewittchen.
Mit einem Mal wurde der Stein der bösen Königin, der noch immer in Schneewittchens Hand lag, merklich schwerer. Schneewittchen wusste nicht, ob sie es sich nur einbildete oder ob es wirklich geschah; ihr Arm wurde müde davon, das steinerne Herz zu halten, und sie legte es zurück, bevor es herunterfiel.
»Es gibt so vieles, was du mir verschweigst«, sagte Schneewittchen. »So viele Dinge, die du all die Jahre vor mir geheim gehalten hast.«
Die böse Königin senkte den Kopf und starrte zu Boden. Sie blieb stumm.
»Ich bin womöglich der einzige Mensch auf dieser Welt, der Mitleid für dich empfindet. Bitte sag mir, dass es nicht verschwendet ist«, flehte Schneewittchen. »Wenn in deiner Vergangenheit etwas geschehen ist, das dich dazu gebracht hat, so zu handeln, wie du gehandelt hast – dann erklär es mir bitte.«
Noch immer bekam sie keine Antwort.
»Ich gehe nicht wieder fort, ehe du es mir erzählt hast!«, schrie Schneewittchen und erhob damit zum ersten Mal in ihrem Leben die Stimme.
»Also schön«, lenkte die böse Königin ein.
Schneewittchen nahm auf einem zweiten Stuhl in der Zelle Platz. Die böse Königin zögerte noch einen Moment, bevor sie mit ihrer Erzählung begann, und Schneewittchens Ungeduld wuchs.
»Deine Geschichte wird allen auf ewig als romantisches Märchen im Gedächtnis bleiben«, sagte sie zu Schneewittchen. »Über meine wird niemand auch nur ein zweites Mal nachdenken. Bis ans Ende der Zeit werde ich nichts weiter sein als eine würdelose, lächerliche Verbrecherin. Was die Welt jedoch nicht versteht: Ein Bösewicht ist nur ein Opfer, dessen Geschichte noch niemand kennt. All mein Handeln, all meine Taten – mein Lebenswerk und auch meine Verbrechen gegen dich – galten stets nur ihm.«
Schneewittchen spürte, wie ihr das eigene Herz schwer wurde. Ihr schwirrte der Kopf, aber die Neugier brannte in jeder Faser ihres Körpers.
»Wem?«, fragte sie so hastig, dass sie ganz vergaß, die Verzweiflung in ihrer Stimme im Zaum zu halten.
Die böse Königin schloss die Augen und ließ ihre Erinnerungen aufsteigen. Bilder von Orten und Menschen aus ihrer Vergangenheit flatterten aus ihrem Hinterkopf heran wie Fledermäuse aus einer Höhle. Es gab so vieles, was sie in jüngeren Jahren gesehen hatte, so viele Dinge, an die sie sich gern erinnert hätte, und so viele andere, die sie am liebsten vergessen würde.
»Ich werde dir meine Geschichte erzählen – oder zumindest die Geschichte jener Frau, die ich einmal gewesen bin«, sagte die böse Königin. »Aber sei gewarnt: Sie nimmt kein glückliches Ende.«
Kapitel 1Es war einmal
»Es war einmal, vor langer, langer Zeit«, sagte Mrs Peters zu ihrer sechsten Klasse. »Das sind die magischsten Worte, die je gesprochen worden sind, und sie bilden das Tor zu den großartigsten Geschichten aller Zeiten. Jeder, der diese Worte hört, fühlt sich sofort eingeladen – eingeladen in eine Welt, in der jeder willkommen und alles möglich ist. Mäuse können zu Menschen werden, Dienstmägde zu Prinzessinnen, und ganz nebenbei kann man von ihnen jede Menge Wertvolles lernen.«
Alex Bailey richtete sich gespannt auf. Mrs Peters’ Unterricht machte ihr beinahe immer Spaß, doch das war ein Thema, für das ihr Herz ganz besonders schlug.
»Märchen sind so viel mehr als alberne Gutenachtgeschichten«, fuhr die Lehrerin fort. »Für fast jedes Problem, das man sich vorstellen kann, findet sich in irgendeinem Märchen eine Lösung. Märchen sind Lektionen fürs Leben, verpackt in schillernde Abenteuer voller bunter Figuren.
›Der Hirtenjunge und der Wolf‹ führt uns vor Augen, wie wichtig und wertvoll Ehrlichkeit und ein guter Ruf sind. ›Aschenputtel‹ zeigt, dass man belohnt wird, wenn man ein gutes Herz hat. ›Das hässliche Entlein‹ lehrt uns die Bedeutung innerer Schönheit.«
Alex’ Augen waren groß geworden, und sie nickte eifrig. Sie war ein hübsches Mädchen mit leuchtend blauen Augen und kurzem, rotblondem Haar, das sie sich mit einem Haarreif stets ordentlich aus dem Gesicht hielt.
Mrs Peters hatte sich nie daran gewöhnt, wie einige der Schüler sie anstarrten – so, als würde sie eine fremde Sprache sprechen. Deshalb richtete sie oft ihren gesamten Unterricht auf die erste Bankreihe aus, in der auch Alex saß.
Mrs Peters war eine große, dünne Frau, die immer Kleider trug, deren Muster an einen altmodischen Sofabezug erinnerten. Sie hatte dunkles, lockiges Haar, das ihr so tadellos auf dem Kopf saß wie ein Hut (und von dem ihre Schüler oft sogar glaubten, dass es tatsächlich einer sei). Hinter den dicken Brillengläsern sah es immerzu aus, als kneife sie die Augen zusammen, nachdem sie so viele Jahre lang ihren Schülern strenge Blicke zugeworfen hatte.
»Leider werden diese zeitlosen Geschichten in unserer Gesellschaft nicht mehr wertgeschätzt«, sagte Mrs Peters. »In sogenannten ›Märchenadaptionen‹ werden für gewöhnlich jegliche Moral und sämtliche Lektionen, die die Geschichten ursprünglich vermitteln sollten, gestrichen und durch Lieder und tanzende Waldtiere ersetzt. Kürzlich habe ich gelesen, dass es nun eine Verfilmung geben soll, in der Aschenputtel sich als Hiphop-Sängerin durchschlägt, und einen anderen Film mit Dornröschen als Kriegerprinzessin, die gegen Zombies kämpft!«
»Cool«, flüsterte ein Schüler hinter Alex leise.
Alex schüttelte den Kopf. Es tat ihr in der Seele weh, so etwas zu hören. Sie versuchte, ihren Klassenkameraden ihren Unmut verständlich zu machen, doch leider schien es niemanden zu geben, der ihre Meinung teilte.
»Ich frage mich, ob die Welt anders aussähe, wenn alle Menschen die Märchen so kennen würden, wie die Brüder Grimm und Hans Christian Andersen sie erzählt wissen wollten«, sagte Mrs Peters. »Ich frage mich, ob die Leute etwas aus dem Herzschmerz der kleinen Meerjungfrau lernen würden, wenn sie am Ende ihrer wahren Geschichte stirbt. Ich frage mich, ob es so viele Entführungen gäbe, wenn man Kindern zeigen würde, welchen Gefahren Rotkäppchen tatsächlich begegnet ist. Ich frage mich, ob all die Störenfriede noch genauso viel Lust hätten, sich danebenzubenehmen, wenn sie wüssten, welche Folgen das für Goldlöckchen in der Geschichte mit den drei Bären gehabt hat.
Es gibt so vieles, was wir für unsere Zukunft lernen könnten und wofür wir besser gewappnet wären, wenn wir vor diesen Lehren der Vergangenheit bloß nicht die Augen verschließen würden. Vielleicht könnten wir viel einfacher unser eigenes Glück finden, wenn wir Märchen so wertschätzen würden wie früher.«
Wenn es nach Alex gegangen wäre, hätte Mrs Peters nach jeder ihrer Schulstunden mit donnerndem Applaus belohnt werden müssen. Allerdings folgte ihrem Unterricht jedes Mal nur ein gemeinschaftliches erleichtertes Aufseufzen der Schüler, die dankbar waren, dass er vorbei war. »Mal sehen, wie gut diese Klasse sich mit Märchen auskennt«, sagte die Lehrerin mit einem Lächeln und fing an, im Raum auf und ab zu gehen. »Was hat der Vater des jungen Müllersmädchens in ›Rumpelstilzchen‹ gegenüber dem König behauptet – wozu könne seine Tochter angeblich Heu spinnen? Weiß das irgendjemand?«
Mrs Peters sah sich in der Klasse um wie ein Hai, der nach verwundeten Fischen Ausschau hält. Nur eine Schülerin hob die Hand.
»Ja bitte, Miss Bailey?«, rief Mrs Peters sie auf.
»Er hat behauptet, dass sie Heu zu Gold spinnen kann«, sagte Alex.
»Sehr gut, Miss Bailey«, lobte Mrs Peters. Sie würde es natürlich niemals zugeben, aber Alex war ihre absolute Lieblingsschülerin.
Alex gab sich stets die allergrößte Mühe, anderen Leuten zu gefallen. Sie war genau das, was man sich unter einem Bücherwurm vorstellte: Ganz gleich zu welcher Tageszeit – vor der Schule, in der Schule, nach der Schule, vor dem Schlafengehen: Immerzu steckte sie die Nase in ein Buch. Ihr Wissensdurst war nicht zu stillen, und deshalb war Alex meistens die Erste, die auf Mrs Peters’ Fragen eine Antwort wusste.
Sie tat ihr Bestes, ihre Mitschüler bei jeder Gelegenheit zu beeindrucken, und wendete besonders viel Arbeit für jede Buchvorstellung und alle Referate auf, die sie vor der Klasse hielt. Das allerdings ärgerte die anderen Schüler normalerweise eher, und Alex wurde häufig dafür aufgezogen.
In einem fort hörte sie, wie die anderen Mädchen sich hinter ihrem Rücken über sie lustig machten. Ihre Mittagspause verbrachte sie in der Regel allein irgendwo unter einem Baum, mit einem aufgeschlagenen Buch aus der Bibliothek im Schoß. Und obwohl sie es nie jemandem verraten würde, fühlte Alex sich manchmal so einsam, dass es weh tat.
»Und jetzt: Kann mir jemand sagen, welchen Handel die Müllerstochter mit Rumpelstilzchen eingegangen ist?«
Alex wartete einen Augenblick, bevor sie die Hand hob. Sie wollte nicht als völlige Streberin dastehen.
»Ja, Miss Bailey?«
»Im Gegenzug dafür, dass Rumpelstilzchen das Heu in Gold verwandelt, hat sie ihm ihr erstgeborenes Kind versprochen, sobald sie Königin wäre«, erklärte Alex.
»Ziemlich happig«, meinte ein Junge hinter Alex.
»Was will ein gruseliger kleiner alter Mann überhaupt mit einem Baby?«, fragte ein Mädchen neben ihm.
»Na, mit einem Namen wie Rumpelstilzchen durfte er natürlich kein Kind adoptieren«, warf ein anderer Schüler ein.
»Hat er das Baby gefressen?«, wollte wieder ein anderer verunsichert wissen.
Alex wandte sich zu ihren ahnungslosen Klassenkameraden um.
»Ihr versteht alle gar nicht, worum es eigentlich geht«, sagte sie. »Rumpelstilzchen hat die Müllerstochter ausgenutzt, weil sie in Not war. Die Geschichte zeigt, welchen Preis man zahlt, wenn man sich auf einen schlechten Handel einlässt. Was sind wir bereit, auf lange Sicht aufzugeben, um kurzfristig etwas anderes zu bekommen oder zu erreichen? Kapiert?«
Wäre Mrs Peters’ Miene nicht so unbeweglich gewesen, hätte sie nun ein sehr stolzes Gesicht gemacht. »Sehr hübsch ausgedrückt, Miss Bailey«, sagte sie. »Ich muss sagen, in all den Jahren, in denen ich schon unterrichte, ist mir selten eine Schülerin mit so umfangreichem und tiefgehendem Wissen begegnet wie –«
Mit einem Mal ertönte aus dem hinteren Teil des Klassenzimmers ein lautes Schnarchen. Ein Junge in der letzten Reihe hing krumm über seinem Tisch; aus dem Mundwinkel lief ihm ein Spuckefaden, und er schlief tief und fest.
Mrs Peters’ Aufmerksamkeit heftete sich auf ihn wie eine Büroklammer an einen Magneten.
»Mr Bailey?«, fragte sie.
Er schnarchte weiter.
»Mr Bailey?«, wiederholte Mrs Peters und ging neben ihm in die Hocke.
Er ließ einen weiteren mächtigen Schnarcher ertönen. Ein paar Mitschüler fragten sich insgeheim, wie er solch einen Lärm überhaupt zustande brachte.
In Momenten wie diesen wünschte Alex sich, sie hätte keinen Zwillingsbruder.
»Mr Bailey!«, polterte Mrs Peters ihm ins Ohr.
Conner Bailey schreckte auf, als hätte jemand unter seinem Stuhl einen Feuerwerkskörper losgelassen, und stieß dabei beinahe seinen Tisch um.
»Wo bin ich? Was ist passiert?«, fragte er in panischer Verwirrung. Seine Blicke schossen durch den Raum, während sein Gehirn sich zu erinnern versuchte, wo er sich befand.
Wie seine Schwester hatte auch er strahlend blaue Augen und rotblondes Haar. Sein Gesicht war rundlich und mit Sommersprossen übersät, und in diesem Moment wirkte es leicht verzogen und zerknittert, wie bei einem Basset Hound nach dem Dösen.
Alex hätte ihr Bruder gar nicht peinlicher sein können. Abgesehen davon, dass sie einander ähnlich sahen und sich das Geburtsdatum teilten, waren die beiden grundverschieden. Conner hatte zwar jede Menge Freunde, allerdings im Gegensatz zu seiner Schwester in der Schule Probleme. Vor allem damit, wach zu bleiben.
»Wie schön, dass Sie sich auch wieder zu uns gesellen, Mr Bailey«, sagte Mrs Peters streng. »Haben Sie gut geschlafen?«
Conner lief scharlachrot an.
»Es tut mir so leid, Mrs Peters«, sagte er und gab sich dabei alle Mühe, möglichst aufrichtig zu wirken. »Manchmal, wenn Sie so lange am Stück reden, nicke ich einfach ein. Das ist wirklich nicht böse gemeint, aber ich kann gar nichts dagegen tun.«
»Sie schlafen mindestens zweimal in der Woche in meinem Unterricht ein«, rief Mrs Peters ihm ins Gedächtnis.
»Na ja, Sie reden wirklich viel.« Noch bevor er zu Ende gesprochen hatte, wusste Conner, dass er etwas Falsches sagte. Ein paar der anderen Schüler mussten sich in die Hände beißen, um nicht laut loszulachen.
»Ich empfehle Ihnen, wach zu bleiben, während ich unterrichte, Mr Bailey«, sagte Mrs Peters drohend. Conner hatte noch nie jemanden gesehen, der die Augen so eng zusammenkneifen konnte, ohne sie dabei ganz zu schließen. »Es sei denn, Sie wissen bereits genug über Märchen, um diese Stunde selbst halten zu können«, fügte sie hinzu.
»Wahrscheinlich schon«, sagte Conner, wieder, ohne vorher nachzudenken. »Ich meine bloß – ich kenne mich mit diesem Kram ziemlich gut aus, das ist alles.«
»Ach, wirklich?« Mrs Peters ging keiner Herausforderung aus dem Weg, und der schlimmste Albtraum aller Schüler war es, selbst in die Rolle des Herausforderers zu geraten. »In Ordnung, Mr Bailey: Wenn Sie so viel wissen, dann beantworten Sie doch die folgende Frage …«
Conner schluckte.
»Wie viele Jahre lang schläft die Prinzessin in der ursprünglichen Version von Dornröschen, bevor der erste Kuss wahrer Liebe sie aufweckt?« Mrs Peters behielt Conners Gesicht genau im Auge.
Auch die Blicke seiner Mitschüler waren auf ihn gerichtet, und alle warteten ungeduldig auf das geringste Anzeichen dafür, dass er die Antwort nicht kannte. Aber umsonst.
»Einhundert«, verkündete er triumphierend. »Dornröschen hat einhundert Jahre lang geschlafen. Deshalb war am Ende auch das ganze Schlossgelände von Dornen überwuchert und so, weil der Fluch sich auf alle im Königreich gelegt hatte und niemand sich mehr um den Garten kümmern konnte.«
Mrs Peters sah stirnrunzelnd und ausgesprochen überrascht auf ihn hinunter. Nie zuvor hatte er eine richtige Antwort gegeben, wenn sie ihn in die Mangel genommen hatte, und auch diesmal hatte sie nicht damit gerechnet.
»Versuchen Sie, wach zu bleiben, Mr Bailey. Sie haben Glück, dass ich heute schon mehr Schülern Nachsitzen aufgebrummt habe, als mir lieb ist. Aber ich kann es mir jederzeit anders überlegen«, sagte sie und ging mit energischen Schritten wieder nach vorn, um ihren Unterricht fortzusetzen.
Conner seufzte erleichtert, und die Röte wich ihm wieder aus dem Gesicht. Er fing den Blick seiner Schwester auf; sogar sie war überrascht, dass er richtig geantwortet hatte. Alex hatte nicht erwartet, dass Conner sich noch an irgendwelche Märchen erinnerte
»Und jetzt möchte ich, dass jeder in der Klasse das Lesebuch herausholt, Seite 170 aufschlägt und still für sich ›Rotkäppchen‹ liest«, wies Mrs Peters ihre Schüler an.
Die Kinder gehorchten. Conner machte es sich an seinem Tisch so gemütlich wie möglich und fing zu lesen an. Die Geschichte, die Bilder und die Figuren waren ihm allesamt wunderbar vertraut.
Zu den Dingen, auf die Alex und Conner sich stets am meisten gefreut hatten, als sie noch ganz klein gewesen waren, hatten immer Ausflüge zu ihrer Großmutter gehört. Sie lebte hoch oben in den Bergen, mitten im Wald in einem winzigen Haus, das man am ehesten als Holzfällerhütte hätte bezeichnen können – falls es so etwas noch gab.
Der Weg dorthin war lang, ein paar Stunden mit dem Auto, doch die Zwillinge genossen jede Minute. Ihre Vorfreude wuchs, während sie zwischen endlosen Bäumen hindurch die gewundenen Straßen hinauffuhren. Sobald sie die gelbe Brücke überquerten, riefen die Zwillinge jedes Mal: »Wir sind fast da! Wir sind fast da!«
Kaum waren sie angekommen, stand die Großmutter auch schon mit offenen Armen an der Tür und drückte die beiden dann so fest an sich, dass sie beinahe zerquetscht wurden.
»Schaut euch nur an! Ihr seid ja mindestens dreißig Zentimeter gewachsen, seit ich euch das letzte Mal gesehen habe!«, behauptete Grandma jedes Mal, auch wenn das nicht stimmte, und führte die beiden dann nach drinnen, wo ein Blech frisch gebackener Kekse auf sie wartete.
Ihr Vater war im Wald aufgewachsen und hatte den Zwillingen jeden Tag stundenlang von all den Abenteuern erzählt, die er als Kind erlebt hatte: von all den Bäumen, auf die er geklettert, und all den Bächen und Flüssen, durch die er geschwommen war, und von den vielen wilden Tieren, denen er gerade noch hatte entkommen können. Die meisten seiner Geschichten waren stark übertrieben gewesen, doch Alex und Conner hatten diese gemeinsame Zeit mit ihm mehr geliebt als alles andere auf der Welt.
»Irgendwann einmal, wenn ihr älter seid, zeige ich euch die ganzen geheimen Orte, an denen ich früher gespielt habe«, hatte ihr Vater sie stets geneckt. Er war ein großgewachsener Mann mit freundlichen Augen gewesen, um die sich beim Lächeln kleine Runzeln gebildet hatten – und gelächelt hatte er ziemlich oft, besonders, wenn er die Zwillinge aufzog.
Abends half ihre Mutter immer der Großmutter dabei, das Abendessen zu kochen, und nachdem alle gegessen hatten und der Abwasch erledigt war, setzte sich die ganze Familie vor den Kamin. Die Großmutter schlug ihr dickes Märchenbuch auf, und sie und der Vater lasen den Zwillingen abwechselnd Märchen vor, bis Alex und Conner einschliefen. Manchmal blieben die Erwachsenen bis zum Sonnenaufgang wach.
Sie erzählten die Geschichten mit so viel Leidenschaft und Liebe zum Detail, dass es ganz gleich war, wie häufig die Zwillinge ein und dasselbe Märchen schon gehört hatten. Schönere Erinnerungen als jene an diese Märchenstunden hätte kein Kind sich wünschen können.
Leider lag der letzte Besuch der Zwillinge bei ihrer Großmutter schon sehr lange zurück
»MR BAILEY!«, donnerte Mrs Peters. Conner war schon wieder eingedöst.
»Tut mir leid, Mrs Peters!«, rief er ebenso laut zurück und setzte sich so gerade hin wie ein Soldat, der zum Appell strammsteht. Wenn Blicke töten könnten, hätte Mrs Peters’ finstere Miene Conner ohne weiteres unter die Erde befördert.
»Und, was halten wir vom echten Rotkäppchen?«, fragte die Lehrerin ihre Klasse.
Ein Mädchen mit Wuschelkopf und großer Zahnspange hob die Hand.
»Mrs Peters?«, fragte es. »Ich bin verwirrt.«
»Und wie kommt das?«, erwiderte Mrs Peters – ganz so, als wollte sie eigentlich fragen: Was um alles in der Welt kann einen daran denn verwirren, Dummchen?
»Weil – da steht, der böse Wolf wird vom Jäger getötet«, erklärte das wuschelköpfige Mädchen. »Ich habe immer gedacht, dass der Wolf bloß traurig war, weil die anderen Wölfe in seinem Rudel sich über seine Schnauze lustig gemacht haben, und dass er und Rotkäppchen sich am Ende angefreundet haben. So war es zumindest in der Zeichentricksendung, die ich oft geschaut habe, als ich noch klein war.«
Mrs Peters verdrehte so heftig die Augen, als wollte sie in ihren eigenen Hinterkopf hineinsehen.
»Das«, zischte sie durch zusammengebissene Zähne, »ist genau der Grund, aus dem wir diese Unterrichtseinheit durchnehmen. Als Hausaufgabe«, ergänzte sie, und alle Schüler sackten gleichzeitig auf ihren Stühlen in sich zusammen, »wählt jeder sein Lieblingsmärchen aus und schreibt bis morgen einen Aufsatz über die richtige, ursprüngliche Lektion, die das jeweilige Märchen uns vermitteln will.«
Mrs Peters ging zu ihrem Pult, und in der wenigen verbleibenden Zeit bis zum Ende der Stunde machten die Kinder sich bereits an ihre Arbeit.
»Mr Bailey?«, rief Mrs Peters Conner zu sich nach vorn. »Auf ein Wort.«
Conner steckte mächtig in Schwierigkeiten, und er wusste es. Zögernd stand er auf und trottete zu Mrs Peters. Seine Klassenkameraden warfen ihm besorgte Blicke zu, als er an ihnen vorbeikam – es fühlte sich an, als wäre er auf dem Weg zu seiner Hinrichtung.
»Ja, Mrs Peters?«, fragte Conner.
»Conner, ich versuche, große Rücksicht auf deine Familiensituation zu nehmen«, sagte Mrs Peters und warf ihm über den Rand ihrer Brille hinweg einen strengen Blick zu.
Familiensituation. Ein Wort, das Conner im letzten Jahr häufiger gehört hatte, als ihm lieb war.
»Allerdings«, fuhr Mrs Peters fort, »gibt es gewisse Verhaltensweisen, die ich in meinem Klassenzimmer einfach nicht dulde. Du schläfst immer wieder im Unterricht ein, du passt nicht auf, und von deinen schlechten Noten will ich gar nicht erst reden. Deine Schwester scheint doch auch bestens zurechtzukommen. Vielleicht könntest du dir an ihr ein Beispiel nehmen?«
Dieser Vergleich fühlte sich jedes Mal an wie ein Schlag in die Magengrube. Conner war nun mal ganz anders als seine Schwester, und immerzu wurde er dafür bestraft.
»Wenn das so weitergeht, werde ich mich einmal mit deiner Mutter unterhalten müssen – verstanden?«, warnte ihn Mrs Peters.
»Jawohl, Sir – Madam, meine ich! Ich meinte Madam! Tut mir leid.« Es war einfach nicht sein Tag.
»Also gut. Dann darfst du dich wieder setzen.«
Langsam ging Conner zurück an seinen Platz und ließ dabei den Kopf noch ein wenig tiefer hängen als ohnehin schon. Er hasste es mehr als alles andere, sich wie ein Versager zu fühlen.
Alex hatte die Unterhaltung zwischen ihrem Bruder und der Lehrerin beobachtet. Sosehr sie sich auch für ihren Bruder schämte, sosehr fühlte sie doch auch mit ihm mit, wie es nur eine Schwester kann.
Alex blätterte durch ihr Lesebuch, auf der Suche nach einem Märchen, über das sie schreiben wollte. Die Bilder waren nicht so bunt und aufregend wie im Buch ihrer Großmutter, doch zwischen all den Figuren, mit denen sie aufgewachsen war, fühlte sie sich geborgen – ein Gefühl, das sie in der letzten Zeit nicht allzu oft verspürt hatte.
Wenn Märchen doch nur wahr wären, dachte sie. Dann könnte einfach jemand einen Zauberstab schwingen, und auf wundersame Weise wäre alles wieder wie früher.
Kapitel 2Der längere Heimweg
»Das war so eine tolle Unterrichtsstunde«, sagte Alex zu Conner, als sie von der Schule nach Hause gingen. Diesen Satz hörte Conner häufig von seiner Schwester, und für gewöhnlich schaltete er in diesem Moment gedanklich ab.
»Mrs Peters hat absolut recht, weißt du«, plapperte Alex so begeistert weiter, dass ihre Worte sich beinahe überschlugen. »Überleg nur mal, was andere Kinder alles verpassen, wenn sie keine Märchen kennenlernen! Oh, wie schrecklich für sie! Tut dir das nicht auch ungeheuer leid? Conner, hörst du mir eigentlich zu?«
»Jep«, log Conner. Seine ganze Aufmerksamkeit galt einem leeren Schneckenhaus, das er den Gehsteig entlang vor sich herkickte.
»Kannst du dir eine Kindheit ohne all die Figuren und Orte aus den Geschichten vorstellen?«, fuhr Alex fort. »Wir haben solch ein Glück, dass Dad und Grandma uns immerzu Märchen vorgelesen haben, als wir klein waren.«
»Riesiges Glück«, nickte Conner, auch wenn er sich nicht ganz sicher war, wozu er gerade seine Zustimmung gab.
Die Bailey-Zwillinge machten sich jeden Tag nach dem Unterricht gemeinsam auf den Heimweg. Sie wohnten in einer idyllischen kleinen Wohngegend, die von anderen idyllischen Wohngegenden umgeben war, welche wiederum inmitten einer ganzen Reihe weiterer idyllischer Wohngegenden lagen. Zusammengenommen bildeten sie ein ganzes Meer aus Vororten, in denen ein Haus dem anderen glich und doch jedes auf seine Weise einzigartig war.
Um sich beim Gehen die Zeit zu vertreiben, erzählte Alex ihrem Bruder stets alles, was ihr durch den Kopf ging: Sie ließ ihn wissen, woran sie gerade dachte und worüber sie sich Sorgen machte, fasste alles zusammen, was sie an diesem Tag gelernt hatte, und verkündete, was sie vorhatte, sobald die beiden zu Hause ankämen. Zwar ging Conner dieses tägliche Ritual auf die Nerven, doch er wusste, dass er der einzige Mensch auf der Welt war, den Alex zum Reden hatte, also gab er sich trotzdem die größte Mühe, ihr zuzuhören. Allerdings war Zuhören noch nie Conners Stärke gewesen.
»Wie soll ich mich bloß je entscheiden, über welche Geschichte ich schreiben will? Es ist praktisch unmöglich, nur eine auszuwählen!«, rief Alex und klatschte vor Begeisterung in die Hände. »Welches Märchen hast du dir für deinen Aufsatz ausgesucht?«
»Ähm«, machte Conner, und sein Kopf ruckte nach oben. Er musste erst gedanklich ihre Unterhaltung zurückspulen, um sich herzuleiten, was die Frage gewesen sein könnte.
»›Der Hirtenjunge und der Wolf‹«, nannte er das erste Märchen, das ihm in den Sinn kam.
»Das kannst du nicht nehmen«, widersprach Alex kopfschüttelnd. »Das ist das einfachste! Du musst eine Geschichte wählen, die ein bisschen kniffliger ist, um Mrs Peters zu beeindrucken. Am besten eine, deren Botschaft tiefer im Text versteckt und nicht so offensichtlich ist.«
Conner seufzte. Es war immer leichter, Alex einfach recht zu geben, als sich mit ihr zu streiten, aber manchmal ließ sich das nicht vermeiden.
»Schön, dann nehme ich ›Dornröschen‹«, entschied er.
»Interessante Wahl«, meinte Alex stirnrunzelnd. »Und was ist deiner Meinung nach die Moral der Geschichte?«
»Verscherz es dir nicht mit deinen Nachbarn, schätze ich mal«, erwiderte Conner.
Alex schnaubte verächtlich.
»Im Ernst, Conner! Das ist nicht die Kernbotschaft von ›Dornröschen‹«, sagte sie tadelnd.
»Doch, ist es sehr wohl«, erklärte Conner. »Wenn der König und die Königin einfach direkt diese dunkle Fee zur Feier ihrer Tochter eingeladen hätten, wäre der ganze Rest überhaupt nicht passiert.«
»Sie hätten das Unglück nicht verhindern können«, beharrte Alex. »Diese Zauberin war böse und hätte die kleine Prinzessin wahrscheinlich so oder so verflucht. In ›Dornröschen‹ geht es darum, dass versucht wird, das Unvermeidliche zu vermeiden. Dornröschens Eltern haben versucht, sie zu beschützen, und haben alle Spinnräder im ganzen Königreich verbrennen lassen. Sie ist so behütet aufgewachsen, dass sie nicht einmal wusste, worin die Gefahr bestand, und trotzdem hat sie sich mit der ersten Spindel, die ihr je begegnet ist, in den Finger gestochen.«
Conner dachte über diese Sichtweise nach und schüttelte den Kopf. Seine Interpretation gefiel ihm deutlich besser.
»Das sehe ich anders. Mir ist schon oft aufgefallen, wie sehr es dir zusetzt, wenn Leute dich zu irgendetwas nicht einladen, und meistens guckst du dann, als würdest du auch ein Baby verfluchen wollen.«
Alex warf Conner einen so finsteren Blick zu, dass Mrs Peters stolz auf sie gewesen wäre.
»Es gibt zwar keine falsche Deutung, aber ich muss doch sagen, dass du hier eindeutig etwas missverstanden hast«, grollte sie.
»Ich sage bloß, dass man aufpassen sollte, wen man ignoriert«, stellte Conner klar. »Ich war schon immer der Meinung, dass Dornröschens Eltern sich den Schlamassel selbst eingebrockt haben.«
»Ach?«, machte Alex zweifelnd. »Und ich nehme an, dann findest du auch, dass Hänsel und Gretel ihr Schicksal verdient hatten?«
»Ja«, antwortete Conner und kam sich dabei sehr clever vor. »Und die Hexe genauso!«
»Wie das?«, wollte Alex wissen.
»Weil«, erklärte Conner mit zufriedenem Grinsen, »man nicht in die Nachbarschaft hungriger Kinder zieht, wenn man in einem Haus aus Lebkuchen wohnen will. Es gibt jede Menge Märchenfiguren, denen es schlicht an gesundem Menschenverstand fehlt.«
Alex ließ ein weiteres missbilligendes Schnauben hören. Conner rechnete sich aus, dass er ihr noch mindestens fünfzig weitere würde entlocken können, bevor sie zu Hause ankamen.
»Die Hexe hat nicht nebenan gewohnt! Sie hat tief im Wald gelebt! Die Kinder mussten eine Spur aus Brotkrumen hinter sich auslegen, um den Rückweg finden zu können – weißt du nicht mehr? Und überhaupt war das Haus ja gerade deshalb aus Lebkuchen gebaut, weil es die Kinder anlocken sollte. Sie waren am Verhungern!«, rief Alex ihrem Bruder ins Gedächtnis. »Sieh zumindest zu, dass du weißt, wovon du sprichst, bevor du an den Geschichten herummäkelst.«
»Wenn sie am Verhungern waren, wieso haben sie dann Brotkrumen einfach auf die Erde geworfen?«, fragte Conner. »Das kommt mir ziemlich schwachsinnig vor.«
Alex schnaubte wieder.
»Und was ist dann deiner verqueren Vorstellung nach die Moral aus ›Goldlöckchen und die drei Bären‹?«, fragte sie herausfordernd.
»Ganz einfach«, gab Conner zurück. »Schließ die Tür ab! Diebe gibt es in allen Formen und Größen – nicht einmal kleinen Mädchen mit Lockenkopf kann man trauen.«
Von Alex kam ein weiteres Schnauben, und sie verschränkte die Arme vor der Brust. Allerdings musste sie sich große Mühe geben, nicht loszukichern; sie wollte nicht, dass ihr Bruder sich in seiner Meinung bestätigt fühlte.
»In ›Goldlöckchen‹ geht es um die Folgen des eigenen Handelns! Das hat Mrs Peters selbst gesagt«, sagte Alex. Obwohl sie es niemals zugeben würde, machte es ihr manchmal Spaß, mit ihrem Bruder zu streiten. »Und was, meinst du, ist die Kernaussage von ›Jack und die Bohnenranke‹?«, wollte sie wissen.
Conner dachte einen Augenblick nach und grinste dann verschlagen. »Von schlechten Bohnen kann man Schlimmeres als nur üble Blähungen bekommen«, antwortete er.
Alex schürzte die Lippen, um ihr eigenes Lächeln zu verbergen.
»Welche Lehren stecken deiner Meinung nach in ›Rotkäppchen‹?«, bohrte sie weiter. »Findest du, sie hätte ihrer Großmutter den Korb mit den Gaben einfach per Post schicken sollen?«
»Jetzt hast du das Prinzip verstanden!«, frohlockte Conner. »Wobei mir Rotkäppchen immer ein bisschen leidgetan hat. Es wird ja ziemlich deutlich, dass ihre Eltern sie nicht besonders liebhaben.«
»Wie kommst du darauf?«, stutzte Alex.
»Wer schickt denn seine kleine Tochter mit frisch gebackenem Kuchen und in leuchtend roter Jacke in einen dunklen Wald, in dem es Wölfe gibt?«, entgegnete Conner. »Die haben es ja quasi darauf angelegt, dass ein Wolf sie frisst! Die müssen ganz schön genervt von ihrem Kind gewesen sein!«
Alex versuchte mit aller Macht, ihr Lachen zurückzuhalten, doch zu Conners großer Freude entwich ihr ein leises Glucksen.
»Ich weiß, dass du mir insgeheim zustimmst«, kicherte er und stieß sie mit der Schulter an.
»Conner, es sind genau solche Leute wie du, die dem Rest der Welt die Lust auf Märchen verderben«, sagte Alex und verbannte unter großer Anstrengung das Lächeln aus ihrem Gesicht. »Leute, die Witze darüber machen, bis plötzlich die ganze Botschaft der Geschichten einfach … einfach … verlorengeht!«
Mit einem Mal blieb Alex wie angewurzelt stehen. Alle Farbe wich ihr langsam aus dem Gesicht.
»Was ist denn los?« Conner wandte sich zu ihr um.
Alex starrte ein großes Haus an. Es war ein hübsches Haus, blau verputzt, mit weißem Sockel und mehreren Fenstern. Der Vorgarten war makellos getrimmt: Es gab bunte Blumenbeete und grünen Rasen im genau richtigen Verhältnis und dazu eine große Eiche, auf die man wunderbar klettern konnte.
Wenn Häuser lächeln könnten, hätte dieses von einem Ohr zum anderen Ohr gegrinst.
»Schau mal«, flüsterte Alex und deutete auf ein Schild neben der Eiche, auf dem Zu verkaufen stand. Ganz neu war darauf ein breiter roter Klebestreifen mit der Aufschrift Verkauft angebracht worden.
»Es ist verkauft«, sagte Alex und schüttelte langsam und ungläubig den Kopf. »Es ist verkauft«, wiederholte sie. Sie wollte es einfach nicht wahrhaben.
Auch Conner war blass geworden. Einen Augenblick lang starrten die Zwillinge stumm das Haus an und wussten nicht, was sie sagen sollten.
»Wir haben doch beide gewusst, dass das irgendwann passieren würde«, meinte Conner.
»Warum überrascht es mich dann so?«, fragte Alex leise. »Ich schätze, es stand so lange zum Verkauf, dass ich fast schon geglaubt habe, es würde einfach – du weißt schon – auf uns warten.«
Conner sah, wie seiner Schwester Tränen in die Augen traten. Ihm war ebenfalls schwer ums Herz.
»Los, komm, Alex«, sagte er und marschierte weiter. »Gehen wir nach Hause.«
Alex sah noch eine Sekunde länger zu dem Haus hinüber und folgte ihm dann. Dieses Haus war nur eines der vielen Dinge, die ihre Familie in letzter Zeit verloren hatte …
Ein Jahr zuvor, nur wenige Tage vor ihrem elften Geburtstag, war Alex’ und Conners Vater auf dem Heimweg von der Arbeit bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Mr Bailey hatte eine Buchhandlung namens Bailey’s Books besessen, kaum mehr als ein paar Straßen entfernt, doch mehr als diese paar kleinen Straßen hatte es für einen großen Unfall nicht gebraucht.
Die Zwillinge und ihre Mutter hatten besorgt am Küchentisch auf Mr Bailey gewartet, als das Telefon klingelte. Alle hatten sofort gewusst, dass etwas passiert sein musste.
Alex und Conner würden niemals den Gesichtsausdruck ihrer Mutter vergessen, als sie den Hörer abnahm – ohne jedes Wort verstanden sie, dass ihr Leben niemals wieder so sein würde wie vorher. An jenem Abend würde der Vater nicht mit ihnen gemeinsam essen und auch an keinem weiteren Abend. Nie zuvor hatten die beiden ihre Mutter derart heftig weinen sehen wie damals.
Danach war alles so schnell gegangen, dass es den Zwillingen schwerfiel, sich an die genaue Reihenfolge der Ereignisse zu erinnern.
Sie wussten noch, dass ihre Mutter unzählige Telefonate geführt und Unmengen von Papierkram zu erledigen gehabt hatte. Außerdem war ihre Grandma gekommen und hatte sich um die beiden gekümmert, während ihre Mutter die Beerdigung organisierte.
Sie erinnerten sich daran, wie sie ihre Mutter an der Hand hielten, als sie beim Trauergottesdienst den Mittelgang der Kirche hinuntergingen. Und an die weißen Blumen und Kerzen und all die traurigen Gesichter, an denen sie vorbeigehen mussten. An all das Essen, das andere Leute ihnen vorbeibrachten. Sie erinnerten sich, dass alle ihnen Beileid aussprachen und sagten, wie leid es ihnen tue.
An ihren elften Geburtstag dagegen hatten die Zwillinge keinerlei Erinnerung; niemand hatte daran gedacht.
Sie erinnerten sich daran, wie ihre Mutter ihnen erklärte, warum sie die Buchhandlung verkaufen mussten, und wie sie sich ihr wunderschönes blaues Zuhause nicht mehr leisten konnten und in ein gemietetes Haus umziehen mussten.
Grandma war abgereist, nachdem die Zwillinge und ihre Mutter sich ein wenig in ihrem neuen, kleineren Heim eingelebt hatten. Die Geschwister gingen wieder zur Schule, und alles fühlte sich normal und gerade deshalb so falsch an.
Ein ganzes Jahr war seither vergangen, und noch immer verstanden sie nicht, warum ihnen all das hatte zustoßen müssen. Die Leute erzählten ihnen, es würde nach einiger Zeit leichter werden – doch wie viel Zeit sollte das sein? Mit jedem Tag ohne ihren Dad erschien den Zwillingen der Verlust schmerzlicher. Ihr Vater fehlte ihnen so sehr, dass sie manchmal das Gefühl hatten, die Traurigkeit würde ihnen aus jeder Pore kriechen.
Sie vermissten seine Wärme, sie vermissten sein Lachen, und sie vermissten seine Geschichten.
Früher war Alex, wenn sie einen besonders schlimmen Tag in der Schule hinter sich gehabt hatte, aufs Fahrrad gesprungen und zum Laden ihres Dads gefahren. Sie war durch die Eingangstür gestürmt, zu ihrem Dad gerannt und hatte gesagt: »Daddy, ich muss mit dir reden.«
Und ganz egal, ob er gerade dabei gewesen war, einen Kunden zu beraten oder brandneue Bücher ins Regal zu stellen – Mr Bailey hatte jedes Mal seine Arbeit unterbrochen und seine Tochter mit ins Lager hinter dem Laden genommen.
»Was ist los, Liebling?«, hatte er eines Tages wieder einmal mit großen, besorgten Augen gefragt.
»Ärgern die anderen Kinder dich immer noch? Ich kann in der Schule anrufen und deine Lehrerin bitten, mit ihnen zu reden.«
»Das würde nicht helfen«, schniefte Alex. »Indem sie mich öffentlich schikanieren, füllen sie eine innere Leere und Unsicherheit, die sozialer und häuslicher Vernachlässigung geschuldet ist.«
Mr Bailey kratzte sich am Kopf. »Du meinst also, dass sie einfach eifersüchtig sind, Liebling?«
»Genau«, sagte Alex. »Ich habe heute während der Mittagspause in der Bibliothek ein Psychologiebuch gelesen, in dem das erklärt wurde.«
Mr Bailey ließ ein stolzes Lachen hören. Es faszinierte ihn immer wieder, wie intelligent seine Tochter war. »Ich glaube, du bist ganz einfach schlauer, als gut für dich ist, Alex.«
»Manchmal wäre ich gern wie alle anderen. Ich will nicht länger einsam sein, Daddy. Wenn schlau und gut in der Schule zu sein bedeutet, dass ich niemals Freunde finden werde, dann wäre ich lieber mehr wie Conner.«
»Alex, habe ich dir schon einmal die Geschichte vom verdrehten Baum erzählt?«, fragte Mr Bailey.
»Nein.«
Mr Baileys Augen begannen zu leuchten, wie immer, wenn er drauf und dran war, eine Geschichte zu erzählen.
»Eines Tages, als ich noch sehr klein war, ging ich im Wald spazieren und entdeckte etwas sehr Seltsames. Da stand ein Tannenbaum, doch er sah ganz anders aus als alle Tannenbäume, die ich zuvor gesehen hatte. Statt gerade aus dem Boden zu wachsen, drehte und zwirbelte sich sein Stamm in die Höhe wie eine riesige Schlingpflanze.«
»Wie denn das?«, fragte Alex gebannt. »Das ist nicht möglich. So wachsen Nadelbäume nicht.«
»Vielleicht hatte das dem Baum niemand gesagt. Jedenfalls kamen eines Tages Holzfäller und fällten jeden einzelnen Baum rundum – außer dem verdrehten Baum.«
»Warum?«, fragte Alex.
»Weil sie ihn für unbrauchbar hielten. Man hätte niemals einen Tisch oder Stuhl oder Schrank aus seinem Holz herstellen können. Weißt du, es mag sein, dass der verdrehte Baum sich immer als Außenseiter gefühlt hatte, aber seine Einzigartigkeit hat ihn letztlich gerettet.«
»Und was ist aus dem verdrehten Baum geworden?«
»Er steht heute noch immer dort«, versicherte ihr Dad lächelnd. »Er wächst immer höher und höher und verdreht sich von Tag zu Tag mehr.«
Ein winziges Lächeln stahl sich auf Alex’ Gesicht. »Ich glaube, ich verstehe, was du mir sagen willst, Daddy.«
»Da bin ich froh. Jetzt musst du nur warten, bis die Holzfäller kommen und all deine Klassenkameraden umhauen.«
Da hatte Alex zum ersten Mal an jenem Tag gelacht. Ihr Dad hatte immer gewusst, wie er sie aufheitern konnte.
Seit sie in das gemietete Haus gezogen waren, brauchten die Zwillinge für ihren Schulweg doppelt so lange. Ihr neues Zuhause war langweilig, mit braunen Mauern und einem flachen Dach. Fenster gab es nur wenige, und der Vorgarten bestand aus einer schlichten Rasenfläche, deren Gras beinahe vertrocknet war, weil die Sprinkler nicht funktionierten.
Im Innern war das Heim der Baileys chaotisch, aber sehr gemütlich. Sie hatten viel mehr Möbel als Platz, und kein einziges Stück passte zum Haus, denn schließlich war auch keines ursprünglich dafür gekauft worden. Obwohl die Familie nun seit mehr als einem halben Jahr hier lebte, stapelten sich entlang der Wände noch immer volle Umzugskisten.
Niemand wollte sie auspacken; niemand wollte sich eingestehen, dass sie tatsächlich schon so lange da waren und weiterhin bleiben würden.
Die Zwillinge gingen sofort die Treppe hinauf und in ihre Zimmer. Alex setzte sich an ihren Schreibtisch und fing mit den Hausaufgaben an. Conner legte sich aufs Bett, um ein Nickerchen zu machen.
Hätte in einer Ecke von Alex’ Zimmer nicht das Bett mit seinen leuchtend gelben Decken und Kissen gestanden, hätte man es für eine Bibliothek halten können. An den Wänden reihten sich Bücherregale in den unterschiedlichsten Höhen und Breiten, und auf deren Brettern wiederum fand sich von Erstlesebüchern bis Enzyklopädien einfach alles.
Conners Zimmer glich eher einer Höhle, in der er – ganz passend – bei jeder Gelegenheit Winterschlaf hielt. Es war dunkel und unordentlich; zwischen Bergen dreckiger Klamotten ließ sich nur stellenweise ein Stück Teppich erkennen. Ein angebissenes Grillkäsesandwich lag auf dem Boden, und zwar schon viel länger, als es ihm guttat.
Etwa eine Stunde später hörten die Zwillinge die vertrauten Geräusche, die ihnen ankündigten, dass ihre Mutter in ihrer Pause von der Arbeit kurz zu Hause vorbeischaute. Die beiden gingen hinunter in die Küche, um sie zu begrüßen. Sie saß am Tisch, telefonierte und blätterte dabei durch einen Stapel Post, die sie gerade aus dem Briefkasten hereingeholt hatte.
Charlotte Bailey war eine hübsche Frau mit rotem Haar und Sommersprossen, die die Zwillinge zweifellos von ihr geerbt hatten. Ihre Kinder liebte sie mehr als alles andere auf der Welt. Leider bekam sie die zwei kaum noch zu Gesicht.
Als Krankenschwester in der Kinderklinik vor Ort musste sie seit dem Tod ihres Ehemanns ständig Doppelschichten übernehmen, um die Familie über die Runden zu bringen. Mrs Bailey war jeden Morgen bereits verschwunden, wenn die Zwillinge aufstanden, und kam abends erst nach Hause, wenn beide längst eingeschlafen waren. Die einzige gemeinsame Zeit, die ihr mit ihren Kindern blieb, waren die kurzen Pausen zum Mittagessen und Abendbrot, die sie zu Hause verbrachte.
Mrs Bailey liebte ihren Job, sie liebte es, sich um die Kinder im Krankenhaus zu kümmern – doch sie hasste es, dass sie deshalb weniger Zeit für ihre eigenen hatte. In gewisser Weise fühlte es sich für die Zwillinge an, als hätten sie mit dem Tod ihres Vaters beide Elternteile verloren.
»Hi, ihr zwei«, begrüßte Mrs Bailey die beiden leise und hielt dabei die Hand über das Telefon. »Hattet ihr einen guten Tag in der Schule?«
Alex nickte eifrig. Conner reckte übertrieben begeistert beide Daumen nach oben.
»Ja, ich kann am Montag die Doppelschicht übernehmen«, sagte ihre Mutter gleich darauf ins Telefon. »Kein Problem.« Das war gelogen.
Die meisten der Briefumschläge, die sie durchsah, trugen leuchtend rote Warnaufkleber, auf denen LETZTE MAHNUNG oder ZAHLUNG FÄLLIG stand.
Trotz all der Überstunden musste Mrs Bailey sich oft genug etwas einfallen lassen, damit das Geld reichte. Sie legte die Umschläge verkehrt herum auf den Tisch, so dass die Zwillinge die Beschriftung nicht lesen konnten.
»Danke«, sagte Mrs Bailey ins Telefon und legte auf. Sie wandte sich zu ihren Kindern um. »Wie geht es euch?«
»Gut«, antworteten beide wenig überzeugend.
»Was ist los?«, fragte sie und studierte aufmerksam ihre Gesichter. »Ihr wirkt ein bisschen geknickt.«
Alex und Conner sahen einander an und wussten nicht recht, was sie sagen sollten. Hatte ihre Mutter schon mitbekommen, dass ihr altes Haus verkauft worden war? Sollten sie es ihr erzählen?
»Na, kommt schon«, sagte ihre Mutter. »Was gibt’s? Ihr könnt mir alles sagen.«
»Ist schon okay«, sagte Conner. »Wir wussten ja, dass es irgendwann passieren würde.«
»Was?«, fragte Mrs Bailey.
»Das Haus ist verkauft«, antwortete Alex. »Wir haben es heute auf dem Heimweg von der Schule gesehen.«
Einen Augenblick lang sagte niemand ein Wort.
»Ach, das«, sagte Mrs Bailey dann scheinbar beiläufig. »Ja, ich weiß. Aber deswegen solltet ihr nicht traurig sein. Sobald wir die Dinge hier wieder im Griff haben, suchen wir uns ein noch größeres und schöneres Haus.«
Und damit war das Thema erledigt. Mrs Bailey war keine gute Lügnerin und die Zwillinge ebenso wenig. Trotzdem stimmten Alex und Conner ihr immerfort lächelnd und nickend zu.
»Was habt ihr heute in der Schule gelernt?«
»Unheimlich viel«, verkündete Alex mit breitem Lächeln.
»Nicht sonderlich viel«, murmelte Conner mit finsterer Miene.
»Bloß, weil du wieder im Unterricht eingeschlafen bist!«, petzte Alex.
Conner warf ihr einen bösen Blick zu.
»O Conner, nicht schon wieder«, seufzte Mrs Bailey kopfschüttelnd. »Was sollen wir nur mit dir machen?«
»Ich kann gar nichts dafür!«, verteidigte sich Conner. »Mrs Peters’ Unterricht schläfert mich ein. Es passiert einfach! Als würde mein Gehirn sich abschalten oder so. Manchmal hilft dann nicht mal mein alter Gummibandtrick.«
»Gummibandtrick?«, wiederholte Mrs Bailey.
»Ich trage ein Gummiband ums Handgelenk und lasse es jedes Mal, wenn ich müde werde, schnalzen«, erklärte Conner. »Und ich war mir sicher, dass das immer funktionieren und mich wach halten würde!«
Mrs Bailey schüttelte wieder den Kopf, wirkte allerdings vor allem belustigt.
»Tja, vergiss nicht, wie viel Glück du hast, dass du in diesem Klassenraum sitzen kannst«, sagte sie und sah Conner mit ihrem typischen »Mom-Blick« an, von dem die Zwillinge jedes Mal ein schlechtes Gewissen bekamen. »Die Kinder im Krankenhaus würden liebend gern mit dir tauschen und jeden Tag zur Schule gehen.«
»Das würden sie sich anders überlegen, wenn sie erst mal Mrs Peters kennengelernt hätten«, murrte Conner leise in sich hinein.
Gerade, als Mrs Bailey ihren Sohn weiter tadeln wollte, klingelte das Telefon.
»Hallo?«, meldete sich Mrs Bailey am Hörer. Die Sorgenfalten auf ihrer Stirn wurden mit einem Mal merklich tiefer. »Morgen? Nein, das muss ein Missverständnis sein. Ich habe früh genug Bescheid gegeben, dass ich morgen überhaupt nicht arbeiten kann; morgen ist der zwölfte Geburtstag der Zwillinge, und ich hatte vor, den Abend mit ihnen zu verbringen.«
Alex und Conner sahen einander an, beide mit gleichermaßen überraschter Miene. Beinahe hätten sie vergessen, dass sie am nächsten Tag zwölf wurden.
»Sind Sie sicher, dass es niemand anderen gibt, der die Schicht übernehmen könnte?«, fragte Mrs Bailey, und ihre Stimme klang verzweifelter, als sie es beabsichtigt hatte. »Nein, ich verstehe … Ja, natürlich … Mir ist bewusst, dass Stellen gestrichen werden … Bis morgen.«
Mrs Bailey legte auf, schloss die Augen und stieß einen tiefen Seufzer aus.
»Jetzt muss ich morgen Abend leider doch arbeiten. Aber das mache ich wieder gut! Wir feiern, sobald ich übermorgen von der Arbeit nach Hause komme, in Ordnung?«
»Das ist schon okay, Mom«, sagte Alex fröhlich – in dem Versuch, ihrer Mutter die Schuldgefühle zu nehmen. »Wir verstehen das.«
»Alles gut«, fügte Conner hinzu. »Wir haben sowieso nichts Besonderes erwartet.«
In diesem Moment kam Mrs Bailey sich wie die schlechteste Mutter der Welt vor, und dass ihre Zwillinge so verständnisvoll reagierten, machte die Sache noch schlimmer. Es wäre ihr lieber gewesen, die beiden hätten einen Wutanfall bekommen, lautstark protestiert oder überhaupt irgendeine Reaktion gezeigt, wie man sie von Kindern ihres Alters hätte erwarten können. Sie waren zu jung, um an solche Enttäuschungen schon gewöhnt zu sein.
»Oh«, sagte sie und kämpfte gegen ihre eigene Traurigkeit an. »Großartig. Dann essen wir gemeinsam … und besorgen uns einen Kuchen … und machen uns eine schöne Zeit … So, und jetzt gehe ich mal kurz nach oben, bevor ich wieder zurück zur Arbeit muss.«
Sie verließ die Küche und hastete die Treppe hinauf und in ihr Schlafzimmer.
Die Zwillinge warteten einen Augenblick, bevor sie selbst die Stufen hinaufhuschten, um nach ihr zu sehen.
Alex und Conner warfen einen vorsichtigen Blick ins Zimmer ihrer Mutter. Dort saß sie weinend auf dem Bett, in beiden Händen ein zerknülltes Taschentuch, und sprach mit einem gerahmten Foto ihres verstorbenen Ehemanns.
»O John«, schluchzte Mrs Bailey. »Ich versuche, stark zu bleiben und unsere Familie zusammenzuhalten, aber ohne dich ist das wirklich schwer. Die beiden sind so liebe Kinder. Das haben sie nicht verdient.«
Als sie die Blicke der Zwillinge auf sich spürte, trocknete sie rasch ihre Tränen. Alex und Conner kamen langsam ins Zimmer und setzten sich rechts und links von ihr aufs Bett.
»Es tut mir so leid – alles«, sagte Mrs Bailey zu ihnen. »Es ist einfach nicht gerecht, dass ihr all das durchmachen müsst, obwohl ihr noch so jung seid.«
»Alles wird gut, Mom«, erwiderte Alex. »Wir brauchen nichts Besonderes zum Geburtstag.«
»Geburtstage werden sowieso überbewertet«, fügte Conner hinzu. »Wir wissen, dass das Geld im Moment knapp ist.«
Mrs Bailey legte den beiden ihre Arme um die Schultern. »Wann seid ihr zwei so erwachsen geworden?«, fragte sie mit feuchten Augen. »Ich bin die glücklichste Mom der Welt!«
Gemeinsam betrachteten sie das Foto von Mr Bailey.
»Wisst ihr, was euer Dad sagen würde, wenn er jetzt hier wäre?« Mrs Bailey sah die Zwillinge an. »Er würde sagen: ›Gerade im Moment machen wir ein hässliches Kapitel in unserem Leben durch, aber in Büchern wird alles immer wieder besser!‹«
Alex und Conner lächelten sie an und hofften, dass das stimmte.
Kapitel 3Eine Geburtstagsüberraschung
»Stifte weg«, befahl Mrs Peters. Ihre Schüler schrieben gerade eine Mathearbeit, und die Lehrerin hatte sie dabei im Auge behalten wie eine Gefängniswärterin. »Geben Sie die Aufgabenblätter nach vorne durch.«
Conner sah auf seinen Zettel hinunter, als stünden dort ägyptische Hieroglyphen. Die meisten seiner Antwortkästchen waren leer, und in den anderen hatte er bloß herumgekritzelt, damit es so aussah, als hätte er sich wenigstens an einer Lösung versucht. Er schickte ein kleines Stoßgebet zum Himmel und reichte sein Blatt zusammen mit den anderen weiter.
Alle Aufgabenblätter landeten bei Alex, die sie für Mrs Peters zu einem ordentlichen Stapel zusammenschob. Nach Klassenarbeiten fühlte sie sich immer richtig erfrischt und munter – besonders, wenn die Aufgaben ihr so leicht fielen wie diesmal.
Der Test ihres Bruders stach ihr ins Auge, weil auf seiner Arbeit am wenigsten geschrieben stand. Alex wusste, dass Conner in der Schule immer sein Bestes gab, doch das schien nie gut genug zu sein. Sie warf ihm über die Schulter einen Blick zu und wünschte sich, sie könnte ihm helfen Und dann kam ihr eine Idee: Vielleicht konnte sie das.
Alex schielte zu Mrs Peters hinüber und sah, dass diese ganz damit beschäftigt war, die Notizen in ihrem Unterrichtsplan durchzugehen. Würde es ihrer Lehrerin auffallen, wenn Alex schnell ein paar Antworten für ihren Bruder eintrüge?
War es überhaupt Betrug, wenn man auf dem Aufgabenblatt eines anderen schummelte? Würde die gutgemeinte Geste die Schwindelei wettmachen, wenn man das Ganze im größeren Zusammenhang betrachtete?
Alex neigte dazu, sich zu lange über Dinge den Kopf zu zerbrechen – aber dafür war dieses Mal keine Zeit: Rasch füllte sie ein paar Antwortkästchen für ihren Bruder aus und schrieb dabei etwas schlampiger als normalerweise, dann reichte sie den Stapel Klassenarbeiten an Mrs Peters weiter.
Etwas so Spontanes hatte sie noch nie in ihrem ganzen Leben getan.
»Vielen Dank, Miss Bailey«, sagte Mrs Peters und sah ihr dabei in die Augen. Alex wurde ganz flau im Magen. Die kribbelige und freudige Aufregung, die sie nach ihrer Aktion gerade noch verspürt hatte, wurde nun von Schuldgefühlen überschattet.
Mrs Peters hatte ihr immer vertraut; wie hatte Alex da etwas derart Kindisches tun können? Sollte sie es zugeben? Welche Strafe würde sie dafür bekommen? Würde sie sich für den Rest ihres Lebens schuldig fühlen?
Sie warf noch einen Blick zurück zu ihrem Bruder. Conner stieß einen langen, stillen Seufzer aus, und Alex spürte, wie traurig er war und wie sehr er sich schämte; sie fühlte seine Hoffnungslosigkeit, als wäre es ihre eigene.
Die tadelnden Stimmen in Alex’ Kopf verstummten. Sie wusste, dass sie das Richtige getan hatte – nicht in ihrer Rolle als Schülerin, sondern als Schwester.
»Jeder nimmt nun bitte seine Hausaufgabe von gestern heraus«, wies Mrs Peters ihre Klasse an, »und ich möchte, dass alle ihre Aufsätze kurz vor der Klasse präsentieren.«
Die Lehrerin überrumpelte ihre Schüler regelmäßig mit solchen Blitzreferaten, damit sie sich immerzu gut auf den Unterricht vorbereiteten. Mrs Peters setzte sich auf einen Stuhl ganz hinten im Raum – näher an Conners Platz, als ihm lieb war, und zweifellos, damit sie ein Auge darauf haben konnte, dass er wach blieb.
Einer nach dem anderen trugen die Schüler ihre Hausaufgaben vor. Abgesehen von einem Jungen, der »Jack und die Bohnenranke« für ein Märchen hielt, in dem es um eine Entführung durch Außerirdische ging, und einem Mädchen, das behauptete, »Der gestiefelte Kater« sei ein frühes Beispiel für die Misshandlung von Tieren, schienen alle Kinder ihren jeweiligen Text richtig interpretiert zu haben.
»Es war so schwierig, nur eine Geschichte auszuwählen, um darüber zu schreiben«, sagte Alex, als sie voller Eifer mit ihrem siebenseitigen Aufsatz vor ihre Mitschüler trat. »Also habe ich mich für das Märchen entschieden, dessen