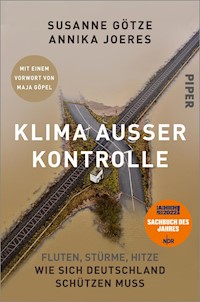Susanne Götze
Land unterim Paradies
Reportagenaus dem Menschenzeitalter
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2018 oekom, Münchenoekom verlag, Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbHWaltherstraße 29, 80337 München
Layout: Tobias Wantzen, BremenKorrektorat: Maike SpechtLektorat: Konstantin Götschel, oekom verlag
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-96238-518-7
Inhalt
Vorwort | Über das Reisen im Anthropozän
Kapitel 1Afrika: Reisen auf dem vergessenen Kontinent
Uganda | Der Baum, mein Feind
Benin | Wie Orou Yerima vom Klimawandel erfuhr
Marokko | Die Prediger der Energiewende
Kapitel 2Europa: Der Geist von Paris
Andalusien | Unter dem Walnussbaum von Jorge Molero
Barcelona | Als das Meer krank wurde
Frankreich | Das Ende des Grand Cru
Deutschland | Wie das Watt sich wandelt
Griechenland | Mit Energie aus der Krise
Finnland | Warum der Schnee sich ändert
Von Kirkenes nach Schanghai | Der neue Arktische Korridor
Von Paris nach Marrakesch | Das stille Sterben
Kapitel 3USA: Im Land der Klimaleugner
Florida Keys | Das Meer schwappt in ein Urlaubsparadies
Washington, D. C. | Die ungehörte Botschaft der Chesapeake Bay
Kapitel 4Naher Osten: Die Krise hinter der Krise
Israel/Palästina | Zeitbombe Totes Meer
Israel/Palästina | Heiliger, unheiliger Jordan
Kapitel 5Stimmen der Klimaforschung
Hans Joachim Schellnhuber | »Physiker dürfen über Moral sprechen«
Johan Rockström | »Ohne die Meere hätten wir 36 Grad mehr«
Geoffrey Parker | »Dummheit schafft Katastrophen«
Was Nationalisten und Klimaleugner verbindet | Ein Fazit
Nachwort von Prof. Dr. Mojib Latif | Eine Herausforderung für uns alle
Quellen der Infokästen
Bildquellenverzeichnis
Über die Autorin
Nachhaltigkeit bei oekom: Wir unternehmen was!
Vorwort
Über das Reisen im Anthropozän
Auf einer meiner Reisen stand ich an der Wiege der menschlichen Zivilisation, nahe der historischen Festung Masada am Toten Meer, und ließ mir von einem Meteorologen den Zusammenhang von Klimawandel und Verdunstung erklären. Vor uns erstreckte sich die zerklüftete Mondlandschaft: erhaben und majestätisch. Darin schimmerte wie eine Pfütze die Reste des einst riesigen Salzsees. Jahrtausende zogen scheinbar spurlos an dem Landstrich vorbei, dessen versteinertes Antlitz keine Regung zeigte. Ein stummer Ort als Zeuge aufkeimender menschlicher Kultur und Ausgangspunkt von Fortschritt, Zähmung und Zerstörung: Der Fund von antiken Schriftrollen in den Qumran-Höhlen ist ein Beweis dafür, dass hier schon vor mehr als 2000 Jahren Menschen siedelten.
In dieser versteinerten Kulisse beschlich mich ein beunruhigender Gedanke: Von jedem Menschen, dem ich ungefragt etwas abtrotze, etwas abverlange, bekomme ich eine unmittelbare Reaktion: Er weint, schreit, stöhnt, wehrt sich. Mit der Natur ist das anders. Sie macht keinen Mucks. Das ist vielleicht das Irreale an dem, was wir den »Klimawandel« nennen. Der Mensch gräbt, schürft, erfindet, baut und produziert. Statt mit Klagegeschrei reagiert die Natur auf ihre Art. Denn nichts bleibt ohne Folgen, nichts bleibt ungestraft.
Was für uns ein Eingriff in die Natur, menschlicher Einfluss oder ein »Fußabdruck« ist, scheint fast folgenlos; doch sie kehren als Bumerang zurück, Jahre, Jahrzehnte, manchmal erst Generationen später. Davon erzählt diese geräuschlose, asketische Mondlandschaft am Toten Meer, an dessen Ufern die geistlichen Gemeinschaften einst die ersten Grundsteine für unseren heutigen Fortschritt legten. Die stummen gelben Felsen des Judäischen Gebirges, an deren Fuße sich damals zahlreiche Oasen reihten, kommen eigenartig erhaben daher, als könnte nichts sie aus dem Gleichgewicht bringen. Doch dieser Eindruck täuscht. Das Ökosystem der Region kollabiert gerade – dank menschengemachten Staudämmen und dem Klimawandel. Die Reaktion der Natur zeigen die riesigen Einsturzlöcher entlang der Küste und das Austrocknen der letzten Oasen – die in einer atemberaubenden Geschwindigkeit trockenfallen. Forscher versuchen diese scheinbar launenhaften Reaktionen von Mutter Natur zu verstehen. Sie können nur noch dem Prozess der Zerstörung beiwohnen, der schrittweisen Auslöschung einer Landschaft.
Vielleicht inspirierte das Tote Meer auch den israelischen Historiker und Schriftsteller Yuval Noah Harari, der in seinem Bestseller »Sapiens: A Brief History of Humankind« (Eine kurze Geschichte der Menschheit) schreibt: »Wir sind Selfmade-Götter, die nur noch den Gesetzen der Physik gehorchen und niemandem Rechenschaft schuldig sind. Und so richten wir unter unseren Mitlebewesen und unserer Umwelt Chaos und Vernichtung an, interessieren uns nur für unsere eigene Annehmlichkeit und Unterhaltung und finden doch nie Zufriedenheit.«*) Harari geht hart ins Gericht mit den Sapiens. Er lässt kein gutes Haar an dem Menschen und seiner Entwicklung. Wie auch immer man seine radikalen Äußerungen bewertet: Wir stehen heute vor ökologischen Herausforderungen historischen Ausmaßes. Erstmals in der Menschheitsgeschichte haben wir es nicht mehr nur mit einem lokalen ökologischen Problem zu tun, sondern mit einem globalen, das die lokalen Probleme – wie am Toten Meer – verstärkt. Der Klimawandel findet nicht dort statt, wo er verursacht wurde. Er wirkt überall und überall mit anderen Folgen, verstärkt regionale Krisen – ein oft explosiver Cocktail für Ökosystem und Mensch. Dafür gibt es mittlerweile ein Bewusstsein bei Entscheidungsträgern, auch in der Wirtschaft. Im Privaten aber will kaum jemand Verzicht üben – das meinte Harari, als er auf die »eigene Annehmlichkeit« hinwies, die kaum zu einer wirklichen Zufriedenheit führe.
Das erste Mal darüber gewundert habe ich mich in den 1990er-Jahren. Nach dem Mauerfall legten sich meine Eltern ein Auto zu, und überhaupt gab es unglaublich viel zu kaufen. Wir schleppten jeden Donnerstag mehrere Plastiktüten mit bunten Produkten nach Hause; für uns Kinder war das ungewöhnlich, waren wir doch bisher mit nur der Hälfte der Einkäufe ebenso gut über die Runden gekommen. Jeder Einkauf war ein Ausprobieren, die Hoffnung auf Genuss, Besonderheit, Exotik. Mein Bruder und ich hüpften aufgeregt um unsere tütentragenden Eltern herum, gespannt auf die neuesten Schinkensorten und Gummibärchenmarken. Die Verpackungen beschäftigten uns eine Weile, und auch meine Eltern ließen sich hinreißen von den Versprechungen der Werbeindustrie. Schon bald jedoch verloren die bunten Etiketten ihren Reiz, das Einkaufen wurde zum Stress, meine Eltern fingen an zu schimpfen auf die schlechte Qualität, und wir waren irgendwie alle enttäuscht. Aus dieser Enttäuschung wuchsen langsam, aber stetig eine Menge Fragen in meinem Kinderkopf: Warum werden wir überschüttet mit all diesen bunten Produkten? Wieso will man uns ständig zum Kaufen überreden? Kann es sein, dass dieser ganze Überfluss ganz ohne Folgen bleibt? Zurück blieb das mulmige Gefühl, dass hier etwas nicht stimmte.
Zehn Jahre später sprach die globalisierungskritische Bewegung aus, was viele kritische Geister schon in den 1990er-Jahren dachten; die Konsum- und Handelskritik wurde Teil von Leitartikeln, und Tausende Menschen weltweit protestierten gegen die Welthandelsorganisation WTO und die Politik des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank. Dabei spielten ökologische Fragen durchaus eine Rolle; so tagten bereits seit 1995 UN-Klimakonferenzen. Aber der Klimawandel war nur ein Problem unter vielen. Auch ich war ganz auf die sozialen Verwerfungen fokussiert und reiste als Journalistin von einem Weltsozialforum zum nächsten, um mit Gewerkschaftlern aus Lateinamerika, griechischen Anarchisten oder französischen Soziologen zu sprechen.
Heute hat sich die globalisierungskritische Bewegung zerstreut, ihr größter Ableger ist die Klimabewegung geworden – und das nicht ohne Grund. Denn all jene Kassandrarufe der Globalisierungskritiker, Konsumaktivisten und Kapitalismusgegner hallen heute in einem globalen Raum wider. Die Klimakrise kennt keine Grenzen, und ihre Ausmaße erschrecken selbst Wissenschaftler und Politiker. Ein außer Kontrolle geratenes Klimasystem kann niemand bändigen, und seine Folgen lassen sich nicht durch ein paar politische Korrekturen oder Reförmchen unter Kontrolle bringen. Die Menschheit, das nimmt auch die politische Elite der Welt nun zur Kenntnis, wird für ihre verschwenderische Lebens- und Produktionsweise bezahlen müssen, wenn nicht schnell umgesteuert wird. Sätze wie dieser sind – anders als in den 1990er-Jahren – kein Ausdruck von Aktivismus mehr; mittlerweile würden nicht einmal mehr konservative Politiker diesem Satz widersprechen. Zu offensichtlich ist geworden, dass es sich hier um mehr als »nur« ein Ökoproblem handelt. Der Klimawandel stellt den gesamten westlichen Lebensstil infrage.
Sicher, noch lesen die meisten Deutschen und Europäer vom Klimawandel und von seinen Folgen nur in der Zeitung. Auch die Idee einer Transformation ist für viele noch zu abstrakt. Sie leben nach wie vor im Glauben, dass unser Lebensmodell im Grunde innovativ und fortschrittlich sei – und vielleicht ist es das auch. Und wenn es dennoch ein Problembewusstsein gibt, trösten sich viele damit, dass auch das Waldsterben irgendwann aufgehört hat und sich die meisten Katastrophenszenarien ohnehin erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts abspielen. Doch das ist ein Irrtum. Auf meinen Reisen der vergangenen zwei Jahre konnte ich viele Menschen aus verschiedenen Ländern der Welt treffen, für die der Klimawandel bereits trauriger Alltag ist. Sie leben mit der Erfahrung, verwundbar zu sein. Sie leiden, sie haben Angst, sie sind entsetzt, sie treffen Vorsichtsmaßnahmen, sie versuchen sich und ihre Familien zu schützen. Doch der Mensch wäre nicht der Mensch, wenn er nicht versuchen würde, es auch mit dieser Herausforderung aufzunehmen. Wissenschaftler und Ingenieure sind jeden Tag damit beschäftigt, sich auf die vielleicht größte Veränderung der Menschheitsgeschichte vorzubereiten. Sie planen heute die Welt von morgen – auch wenn sie teilweise selbst wie erstaunte Kinder vor der globalen Dynamik eines außer Kontrolle geratenen Klimasystems stehen. Von diesem Schrecken, aber auch vom Staunen, vom Hoffen und vom Alltag im Menschenzeitalter, dessen zerstörerische Logik an seine Grenzen stößt, erzählen die Reiseberichte aus drei Erdteilen.
*) Yuval Noah Hariri, Eine kurze Geschichte der Menschheit, DVA München 2013, S. 507 f.
Kapitel 1
Afrika: Reisen auf dem vergessenen Kontinent
In vielen afrikanischen Ländern ist es nicht ungewöhnlich, wenn sich der Punkt auf dem Navigationsgerät durch eine weiße Fläche bewegt. Abseits der großen Hauptstraßen sind nur wenige Wege vermessen oder gar von einem Google-Auto befahren worden. Dörfer und Siedlungen sind nur mithilfe Ortskundiger zu finden – und selbst sie verirren sich nicht selten. Beton- und Sandstraßen sind oft eine endlose Kette von Schlaglöchern. Wie mein Fahrer in Uganda treffend formulierte: Autofahren ist dort wie Tetris spielen. Es geht darum, das Fahrzeug geschickt zwischen den Löchern hindurchzumanövrieren, ohne alle paar Kilometer die Reifen auswechseln zu müssen. Und nach über 1.000 Kilometern gemeinsamer Fahrt kann ich sagen: Er war ein grandioser Tetris-Spieler! Im westafrikanischen Benin hatte ich weniger Glück: Auf einer Strecke von 600 Kilometern von der Küste gen Norden musste unser Team dreimal die Reifen tauschen und in abgelegenen Dörfern die zerborstenen Stellen mit Maismehl stopfen.
Jene Dörfer, die ich in Benin, Uganda und Marokko besuchte, lagen fernab der Zivilisation. Erreichen konnte ich sie nur durch mehrstündige, manchmal tagelange Anreisen, und immer blieb ich die einzige Weiße. Selten verschlägt es Abenteurer an solche Orte, noch seltener Touristen. Strom oder fließendes Wasser gibt es nicht. Die Dorfbewohner leben in kleinen aufgeräumten Hütten, magere Ziegen und Hühner sind ihr einziger Besitz.
Ist die sengende Sonne hinter den Baumwipfeln verschwunden, geht das Leben in afrikanischen Siedlungen erst so richtig los: Links und rechts der Wege laufen Hunderte Dorfbewohner. Sie tragen schwere Krüge oder schieben verrostete Fahrräder mit in Lappen gewickelten Paketen. Während ich meine Hand nicht mehr vor Augen sehe, legen sie barfuß kilometerweite Wege zurück – ohne Taschenlampen, Handys oder Kerzen. In den Hütten brennen vereinzelt Öllämpchen und alle paar Kilometer auch mal eine Glühbirne, die durch eine Solarzelle betrieben wird.
Diese Menschen wissen nichts vom Klimawandel. Sie haben noch nie ein Flugzeug bestiegen, die meisten nicht einmal ein Auto. Sie kochen mit Holz, und ihre Kinder gehen selten zur Schule. Aber sie waren die Ersten, die bemerkt haben, dass etwas nicht stimmt. »Der Regen kommt nicht mehr« oder »der Regen kommt nicht mehr regelmäßig« oder »ein starker Regen hat wieder unsere Ernte zerstört« – solche Sätze hört man in allen Dörfern. Für westliche Städter wie mich dient die Beobachtung des Wetters dazu zu entscheiden, ob man einen Pulli oder eine Jacke tragen soll und ob man lieber einen Regenschirm mitnimmt. Für diese Menschen ist die Vorhersehbarkeit des Wetters eine Frage von Leben und Tod, von Sattsein oder Hunger, von Gesundheit oder Krankheit. Dass sich das Wetter verändert, weil die Menschen im Norden seit 200 Jahren Treibhausgase in die Atmosphäre pusten, liegt für diese Dorfbewohner jenseits ihrer Vorstellungskraft. Wenn sie von Europa oder Deutschland wissen, dann haben sie nur eine vage Vorstellung davon, wie wir zu dem Wohlstand gelangt sind, den wir heute genießen – dem Wohlstand von Licht im Dunklen, einem Elektroherd oder einem eigenen Auto. Gleichzeitig wissen wir in Deutschland genauso wenig vom Alltag einer ugandischen Dorffamilie. Weder weiß ich, wie man anständig Feuer macht, noch, wie man ein Huhn schlachtet oder Mais anbaut. Überhaupt weiß ich reichlich wenig von diesen Menschen, ihren Sprachen, ihren Kulturen. Von den Interviews, die ich dort geführt habe, habe ich viel gelernt: herkömmliche Fragetechniken zu überdenken und zu lernen zuzuhören, auch wenn der Interviewte scheinbar vom Thema abkommt. Die meisten Menschen, die ich befragen konnte, hatten noch nie einen Journalisten gesehen und wussten auch nicht, was für einer Art Arbeit er nachgeht.
Am Viktoriasee in Uganda habe ich das größte Interview meines Berufslebens geführt. Dort versammelte sich die Dorfgemeinschaft unter einem großen, knorrigen Baum. Auf Plastikstühlen und Baumstümpfen bildeten die rund 50 Abgeordneten des Dorfes einen Kreis. Auf meine Fragen hin traten sie jeweils einer nach dem anderen in den Kreis und antworteten. Das Interview dauerte über zwei Stunden, und es war eines der spannendsten Gespräche, die ich je geführt habe. Später fragten mich die Menschen, was mit ihren Antworten passieren würde und ob ich Hilfe holen könne. Ich versuchte ihnen zu erklären, dass meine Texte in Deutschland gelesen würden. Dass Hilfe käme, konnte ich ihnen nicht versprechen. Tatsächlich bewirkte jedoch ein Beitrag auf Spiegel Online später, dass das fragwürdige Klimaschutzprojekt, unter dem die Menschen litten, überprüft wurde. Ein Mitarbeiter musste aufgrund meiner Recherchen seinen Posten räumen, da die Gold-Standard-Stiftung um ihren Ruf fürchtete. Und nicht nur das: Ein Bauer bekam, drei Jahre nachdem sein Haus von Sicherheitsleuten des Klimaschutzprojektes abgebrannt worden war, endlich seine Entschädigung. Doch auch das ist letztendlich nur Kosmetik. Denn das eigentliche Geschäft mit dem Klimaschutz, unter denen die Kleinbauern dort leiden, geht weiter, weil der gesamte Markt von privaten Gutachtern, Firmen oder auch NGOs kontrolliert wird. Trotz der Beteuerungen und angeblich meterdicken Berichten über die »Sozial-und Umweltverträglichkeit« sogenannter CO2-Projekte zeigt ein einfacher Besuch vor Ort ein ganz anderes Bild. Ernst genommen haben mich diese NGOs und Unternehmen nur, weil ich in persona angereist bin und Interviews geführt habe, was eigentlich die Aufgabe der Gutachter wäre. Doch es bleibt bei der einfachen Wahrheit: Menschen, die nichts haben, haben auch keine Stimme. Niemand hört auf sie, niemand interessiert sich für irgendwelche Bauern, die nicht einmal eine Mailadresse haben. In einem Gespräch mit der Firma Green Resource, die mich nach einigem Hin und Her dann doch in ihrem Büro empfing, raunte mir einer der Mitarbeiter nach einer Stunde Diskussion mit einem Augenzwinkern zu: »Diese Menschen wollen doch gar nicht arbeiten, sie sind faul und lungern nur rum. Sie wollen sich doch nicht ernsthaft für diese Leute starkmachen?« Dieser ältere Herr war selbst Ugander und in diesem Land aufgewachsen. Aber er stammt aus einer guten Familie, konnte studieren und bekam einen Posten bei dem norwegischen Unternehmen. Für ihn sind seine Landsleute, die am Viktoriasee in slumähnlichen Blechhütten wohnen, nichts als Abschaum.
Uganda
Der Baum, mein Feind
Als Chairman Jam Atube William vor 20 Jahren aus seinem Dorf vertrieben wurde, glaubte er noch an die Versprechen seiner Regierung. Der hagere Gemeindevorsteher von Bukaleba lebt seither am Ufer des Viktoriasees im Südosten Ugandas. Über 500 Menschen wohnen hier in Holzbaracken und kleinen Lehmhütten. Die Regierung versprach, dass sie bleiben könnten. Doch das Versprechen hielt sie nicht. Dort, wo sie einst ihr Gemüse pflanzten und ihre Tiere grasen ließen, steht heute ein Kiefernwald. Die nackten Stämme der nordischen Baumart stehen in Reih und Glied, an den Rändern der Plantage haben die Besitzer bereits neue Setzlinge eingegraben – und das bis vor die Türen und Fenster der Dorfbewohner. Die Bäume haben das Dorf an die Ufer des Sees gedrängt. Bukaleba sitzt in der Falle. Und mit ihm noch drei weitere Dörfer – insgesamt sind fast 1.500 Menschen zwischen den Kiefern und dem See »eingeklemmt«.
Die Kiefernwipfel erstrecken sich, so weit das Auge reicht, zwischen den Stämmen schlängeln sich die roten Sandwege für die Jeeps der »Förster«. Wäre das Rot des Bodens nicht, man könnte sich in Bukaleba wie in Brandenburg fühlen – nur bei 40 Grad im Schatten. Eine fast surreale Stille herrscht in dem künstlichen Kiefernwald, ganz so, als wäre kein Leben in ihm.
Chairman William in einer Kiefernplantage, wo seine Leute einst ihre Häuser bauten und ihr Vieh weiden ließen.
Wo ein Baum steht, kann kein Haus gebaut, keine Maisfelder oder Viehweiden angelegt werden. Irgendwann werden die Kiefern die Ufer des Sees säumen. Wenn das Holz geerntet ist, soll wieder aufgeforstet werden. Wo die Menschen von Bukaleba dann wohnen sollen, weiß niemand. Dieser Kiefernwald ist ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt des norwegischen Holzmultis Green Resource.
»Die Menschen hier brauchen das Land zum Überleben, es sind arme Leute: Fischer, Kleinbauern, die Hühner haben oder eine Kuh und etwas Gemüse anbauen«, sagt Dorfvorsteher William. »Wir warten immer noch auf das Land, das uns die Regierung nach der Vertreibung versprach – vergebens.« Früher durften sie noch Teile der Plantage nutzen, nun ist auch das verboten.
Schon bevor Green Resources in Bukaleba auftauchte, erklärte die Regierung Ende der 1980er große Teile der Gegend am Viktoriasee zum Waldschutzgebiet und begann die Bauern und die Familie von William aus den Wäldern und Buschlandschaften zu vertreiben. Seit Green Resources das Land für seine Holzplantage gepachtet hat, rücken die Kiefern immer näher an die provisorischen Hütten der Kleinbauern und Fischer heran. Die wehren sich, indem sie die Setzlinge ausreißen. Das Forstministerium ahndet das mit hohen Strafen. Es scheint ein aussichtloser Kampf für die Fischer und Bauern.
Das Holzunternehmen sitzt als ausländischer Investor am längeren Hebel. Die Plantage ist ein rentables Geschäft: Green Resource macht Kasse mit dem Verkauf von CO2-Zertifikaten an Verursacher klimaschädlicher Gase, deren Wirkung durch Baumpflanzungen ausgeglichen werden soll. Aus den Bäumen wiederum werden Holzbohlen, die sich zu Geld machen lassen – so profitiert das Unternehmen doppelt. Möglich ist das durch die weltweit wachsenden Carbon Markets, auf denen Gutschriften für den CO2-Ausstoß angeboten werden. Gekauft werden sie von Staaten, aber auch von privaten Unternehmen, die so ihre Klimaziele umsetzen können. Die Menschen aus dem Dorf Bukaleba aber haben vom neuen »Wald« nichts. Sie leben in Angst und Armut.
»Grünes Landgrabbing«, die Privatisierung von Land für den Klimaschutz, hat in armen Ländern wie Uganda System. Green Resources ist kein Einzelfall. Kommerzielle Holzplantagen sind in den letzten Jahrzehnten wie Pilze aus dem Boden geschossen. Europäische Investoren witterten ein lukratives Geschäft. Auch deutsche Unternehmen machen mit – und alle beteuern, nur Gutes im Sinn zu haben.
Nicht anders als dem Chairman von Bukaleba geht es den Viehhirten in der Kikonda-Gemeinde rund 300 Kilometer nordwestlich des Viktoriasees. Auch sie werden von einer Holzfirma bedrängt. Doch dort fängt die Vertreibung gerade erst an. Auch die Plantage von Manfred Vohrer – dem ehemaligen entwicklungspolitischen Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag – wächst. Der Lebensraum der Landwirte schrumpft. Wertvolles Buschland wird abgeholzt, um Platz zu schaffen für weitere Hunderte Hektar der Kiefernmonokultur.
In Kikonda haben die Viehhirten nach eigenen Aussagen sogar Landrechte erworben, lange bevor Vohrer mit seinem Unternehmen Global Woods nach Uganda kam. Trotzdem werden sie nun systematisch enteignet und vertrieben. »Unsere Tiere dürfen nicht im Wald grasen, und wenn sie aus Versehen hineinlaufen, dann werden sie vom Sicherheitspersonal in alle Richtungen verscheucht«, erzählt Geoffrey, ein schmaler Kuhhirte, am Rande der Plantage. Er hat mehrere Hektar Land an das Unternehmen verloren und fürchtet nun um die Versorgung seiner Familie.
Seinem Nachbarn Lawrence erging es noch schlechter: Als die Forstfahrzeuge immer näher rückten, entschied er sich, einfach zu bleiben. Daraufhin brannte man ihm sein Haus nieder. Ein Schock, der drei Jahre später noch tief sitzt. Seine Frau erzählt mit Tränen in den Augen, wie ein Mitarbeiter von Global Woods ihre Kinder verprügelte. An eine Entschädigung glaubt das Ehepaar nicht mehr. Angeblich wurde der Familie nach Veröffentlichung des Artikels auf Spiegel Online eine Entschädigung gezahlt.
Kühe vor der Plantage von Kikonda: Die Bauern werden von der Security vertrieben.
Vohrers Firma bedauert den Vorfall, sieht sich aber grundsätzlich im Recht. Die Regierung habe ihr das Land zugewiesen, also werde man dort weiterpflanzen. Der Unternehmer und die Manager bei Green Resources sehen sich als Wohltäter für das Klima, die Armen und die Entwicklung Ugandas. Tatsächlich haben sie vor über zehn Jahren die Zeichen der Zeit erkannt. Seit der Emissionshandel 2005 begann, kann man CO2