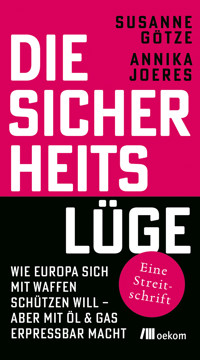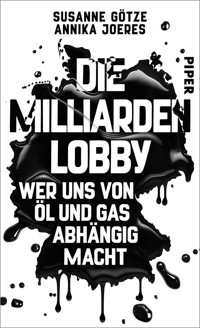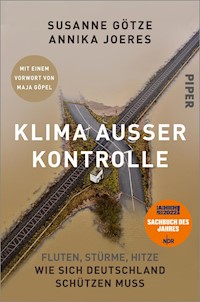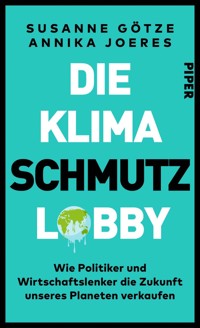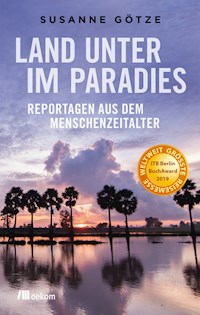27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Frankreich 1958: Der Algerienkrieg eskaliert, die links-liberale Regierung implodiert und reicht die Macht an General Charles de Gaulle weiter. Der hebt im Oktober die V. Republik aus der Taufe - und die französische Linke gesteht damit ihre Ohnmacht ein. Die Sozialisten haben den Machtantritt des konservativen Generals nicht verhindert, sondern diesen sogar mit angezettelt. Auch die Kommunisten sind isoliert und kämpfen mit dem stalinistischen Erbe. Einige Genossen erkennen ihre sozialistische Bewegung nicht wieder und beschließen, eine neue linke Bewegung aufbauen. Sie wollen de Gaulle und den Krieg offen bekämpfen, "veraltete" linke Ideologien über Bord werfen und ein "Labor" für neues linkes Denken schaffen. Parteimitglieder der Altkommunisten, Sozialisten und Trotzkisten, aber auch Künstler, Philosophen und Schriftsteller wurden Teil dieser heterogenen Bewegung, die heute als Neue Linke bezeichnet wird. Der interessierte Leser begreift nun die Ideengeschichte dieser Neuen französischen Linken, die nicht nur einen starken Einfluss auf die Ereignisse um 1968 in Frankreich ausübte, sondern deren Ansätze noch bis heute im linken Spektrum, inner- wie außerparteilich, für Diskussionsstoff sorgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 844
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Susanne Götze
Die Neue französische Linke von 1958 – 1968
Susanne Götze
Die Neue französische Linke von 1958 – 1968
Engagement, Kritik, Utopie
Tectum Verlag
Den Druck dieser Dissertation förderte die Rosa-Luxemburg-Stiftung
Susanne Götze
Die Neue französische Linke von 1958 – 1968. Engagement, Kritik, Utopie
© Tectum Verlag Marburg, 2015
Zugl. Diss. Universität Potsdam2014
ISBN: 978-3-8288-6352-1
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter
der ISBN 978-3-8288-3691-4 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlagabbildung: © Institut Tribune Socialiste
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind
im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
1Einleitung
1.1Gegenstand und Zielsetzung
1.2Methodische Überlegungen
1.3Forschungsstand und Quellen
1.4Definition des Begriffs „Neue Linke“
2Die Neue Linke in Frankreich – Abgrenzung und Einordnung
2.1Das Ende der IV. Republik: Vertrauenskrise und Algerienkrieg
2.1.1SFIO, „Parti radical“ und PCF – der Algerienkrieg und linke Politik
2.1.2Algerienkrieg und Antikolonialismus der Neuen Linken vor 1958
2.2Kommunistische Intellektuelle und ihr Bruch mit der PCF
2.2.1Isolation und Orthodoxie
2.2.3Parteiinterne oppositionelle Zeitschriften und „konspirative“ Gruppen
2.3Die Neue Linke im französischen Parteiensystem
2.3.1Vorläufer der „Parti socialiste unifié“ (PSU) 1955-1960
2.3.2Parti socialiste autonome (PSA)
2.3.3Die Gründung der PSU
2.3.4Das politische Spektrum der PSU
2.4Fazit
3Erneuerung des Sozialismusbegriffs innerhalb der Neuen Linken
3.1Vorläufer der Neuen Linken in den 1930er Jahren: die Außenseiter von PCF und „Section française de l’Internationale ouvrière“ (SFIO)
3.1.1SFIO: Von innerer Opposition bis zum Ausschluss
3.1.2PCF-Dissidenten
3.1.3„Front Populaire“ – verpasste Revolution?
3.1.4Alter und neuer Zwist: Traditionslinien
3.2Jenseits von Staat und Markt: Selbstverwaltung als zentraler Diskurs?
3.2.1Vorläufer des Selbstverwaltungsdiskurses der 1960er Jahre
3.2.2Selbstverwaltung und die Neue Linke der 1960er Jahre
3.3Fazit
4Die traditionelle Neue Linke und ihr Sozialismusverständnis
4.1SFIO-Traditionen innerhalb der PSA
4.1.1PSA und die Grundsatzdebatten um den „wahren Sozialismus“
4.1.2Neue, alte Debatten: Rosenfeld und Philip
4.2PSU
4.2.1Die PSU als Partei „neuen Typs“
4.2.2Krise, Spaltung und Neuausrichtung ab 1963
4.2.3Das „Colloque de Grenoble“ 1966 – Vernetzung und Erneuerung
4.2.4Reformismus, Revisionismus und „Planification“
4.2.5„cogestion“ vs. „autogestion“ – Selbstverwaltung statt Mitbestimmung?
4.2.6Politische Clubs in den 1960er Jahren
4.3Fazit
5Intellektuelle Avantgarde der Neuen Linken: Der sozialistische Dritte Weg im Kalten Krieg
5.1Henri Lefebvre – Vordenker der Neuen Linken
5.1.1Lefebvre und die Philosophie der Praxis
5.1.2Henri Lefebvre: Metaphilosophie (1965), Probleme des Marxismus, heute (1958)
5.1.3La Proclamation de la Commune (1965)
5.1.4Henri Lefebvre und das Verschwinden des Staates
5.2Sartre und „Les Temps Modernes“
5.2.1Jean-Paul Sartre: Zwischen Stalinismus und Neuer Linken
5.2.2Existenzialismus und Marxismus: Versuch einer Synthese
5.2.3„Les Temps Modernes“ im Verhältnis zur Neuen Linken
5.3Edgar Morin und die Zeitschrift „Arguments“
5.3.1Morin, Marx und die multidimensionalen Probleme des Menschen
5.3.2„Arguments“ als Ideenschmiede
5.3.3Soziologie und Neomarxismus
5.4Castoriadis und das Autonomiekonzept von „Socialisme ou Barbarie“: Abkehr von Marx
5.4.1Die Marx-Rezeption von SouB
5.4.2SouB als Außenseiter der Neuen Linken und die Kritik am Konzept der „néo-classe ouvrière“
5.4.3Das Scheitern von SouB
5.5Fazit
6Zusammenfassung
6.1Ausblick: Die Neue Linke und 1968
Résumé :La Nouvelle Gauche française de 1958 à 1968 - Engagement, critique, utopie
1.1Introduction
1.2Méthodologie
1.3Etat de la recherche et sources
1.4Définition de la notion de « Nouvelle Gauche »
2.Résumé des résultats obtenus
Siglen/Abkürzungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
IArchivalien
IIZeitgenössische Literatur und Artikel, gedruckte Quellen, Briefe und Werke
IIIZeitungen und Zeitschriften
IVBiographien, Biographische Handbücher und Autobiographien
VDarstellungen
VIAufsätze/Artikel Zeitschriften
VIILexika
VIIIVorlesungen/Dissertationen
IXGeführte Interviews
XOnline-Ressourcen
1Einleitung
1.1Gegenstand und Zielsetzung
Die Partei „Parti socialiste unifié“ (PSU) löste sich November 1989 selbst auf und beendete damit eine politische Tradition der französischen Linken, die unter grundsätzlich anderen Vorzeichen 1960 begann. Als 1989/90 die dem Anspruch nach sozialistischen Regime der sowjetischen Einflussgebiete jenseits des „Eisernen Vorhangs“ kollabierten, stürzte trotz der bereits weitverbreiteten Resignation gegenüber den einstigen sozialistischen Hoffnungsträgern auch für die Linke in den westeuropäischen Ländern eine Idee zusammen. In den 1990er Jahren sprach man daher gern vom „Kommunismus“, der im Kampf gegen den „Kapitalismus“ letztendlich der Unterlegene gewesen sei.1 So erklärten Historiker wie Francis Fukuyama (1992) das „Ende der Geschichte“2 und die endgültige Vorherrschaft eines demokratisch-marktwirtschaftlichen Modells. Ausdrücke wie „Erschöpfung utopischer Energien“3 deuteten auf den relativen Bedeutungsverlust von politischen Idealen, Utopien sowie der marxistischen Vorstellung eines Klassenkampfes hin. Das „tina“-Prinzip (there is no alternative)4 ist seitdem ein beliebtes Argument gegen soziale bzw. antikapitalistische Protestbewegungen, und Sozialismus wie Marxismus waren als Weltanschauungen schlicht mit dem „Schmutz der Geschichte“ behaftet und somit für viele untragbar geworden. Gegen diese Pauschalisierung der aus dem Kalten Krieg resultierenden Gegenüberstellung von „Kapitalismus“ und „Kommunismus“ widersprachen vor allem jene, die sich schon vor 1989 weder mit dem sogenannten Realsozialismus noch mit dem westlichen Modell der Marktwirtschaft identifizieren konnten. In der französischen Linken war es unter anderem die Partei PSU, die aus diesem Widerspruch heraus entstand und bis 1989 nach einem alternativen Sozialismusmodell suchte.
In dem fünf Jahre nach dem Berliner Mauerfall erschienenen Band „Kritische Philosophie gesellschaftlicher Praxis. Auseinandersetzungen mit der Marxschen Theorie nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus“ kam der Marxismus-Experte und Philosoph Wolfdietrich Schmied-Kowarzik auf die Marxrezeption im 20. Jahrhundert zurück: Karl Korsch5 zitierend erklärte er: „die parteiverordnete Philosophie des Sowjetmarxismus [...] hat das philosophische Denken im Osten liquidiert und es der Philosophie im Westen leicht gemacht, diese Art ideologischer Weltanschauung zu übergehen.“6 Angesichts des Zusammenbruchs des Realsozialismus verwies Schmied-Kowarzik in seinem Aufsatz auf eine Marx-Tradition, die jenseits von Stalinismus und Parteisozialismus einen humanistisch-emanzipatorischen Ansatz verfolgte. Diesen emanzipatorischen Ansatz eines „humanistischen Sozialismus“ über den allgemein pauschalisierenden „Ideologieentwurf“ des Marxismus im Westen zu retten, sei die zukünftige Herausforderung an der Schwelle des 21. Jahrhunderts.
Eben jenen Anspruch, die marxistischen und sozialistischen Konzepte vor einer einseitigen machtpolitischen Verfremdung (Stalinismus) zu retten bzw. ihre Inhalte neu zu beleben, hatten die Akteure der Neuen französischen Linken, die in dieser Arbeit untersucht werden sollen, schon in den 1960er Jahren. Die Tradition des von Schmied-Kowarzik genannten antiautoritären und antistalinistischen „humanistischen Sozialismus“ begann jedoch weitaus früher als die Zeitspanne dieser Arbeit darzustellen vermag. Deshalb geht diese Arbeit auch in einigen Kapiteln auf die Vorgeschichte der Neuen Linken in Frankreich seit den 1920er Jahren ein.
Eine Neue Linke etablierte sich als politische Strömung eines alternativen Sozialismusansatzes in den 1960er und 1970er Jahren nicht nur in Frankreich. Dabei wird der Begriff allgemein vor allem mit der Studenten- und Friedensbewegung von 1968 assoziiert – ein historisches Datum, an dem im westlichen Europa und den USA die Ideen der Neuen Linken auf die Straße getragen wurden und somit in die Öffentlichkeit gelangten. Dennoch wurden die Proteste von 1968 von Bewegungen getragen, die sich beispielsweise in den USA schon in den 1960er Jahren um verschiedene Themen wie die schwarzen Befreiungsbewegung, die Antikriegs- und die der Bürgerrechtsbewegung formierten.7 Gemeinsam war den Neuen Linken der verschiedenen Länder, eine neue Sozialismuskonzeption zu erarbeiten und sich von der etablieren, klassischen Linken abzugrenzen.8
Diese Arbeit wird sich trotz der sich teils parallelen, teils zeitversetzten Entwicklungen der Marxkritik und dem Aufkommen einer undogmatischen, antiautoritären sozialistischen Bewegung in verschiedenen Ländern Europas (u. a. Italien, Deutschland) und den USA ausschließlich auf die Entwicklung der Neuen Linken in Frankreich beziehen.9 Dabei geht es darum, die spezifischen Merkmale, Organisationsformen und theoretischen Debatten der Akteure nachzuzeichnen. Aufgrund der begrifflichen Unschärfe der „französischen Neuen Linken“, für die sich in der bestehenden Literatur keine befriedigende Definition findet, wird im Folgenden, ausgehend von einer Eingrenzung anhand von theoretischen wie formalen Kriterien, eine Auswahl getroffen, die sich auf den derzeitigen Forschungsstand, Archivmaterial sowie Zeitzeugengespräche stützt.10 Im Gegensatz zur Bewegung von 1968, die ausgesprochen ausführlich untersucht ist,11 ist der Forschungsstand über die Neue Linke weitaus unübersichtlicher und umfasst vor allem eine Reihe von Abhandlungen zu spezifischen Teilbereichen. Dabei dominieren Darstellungen, die die Ereignisse um 1968 in den Vordergrund stellen und teilweise sogar die Gefahr einer auf die Mai-Revolte in Paris hindeutenden Betrachtung, die eine unvoreingenommene Perspektive auf die Entwicklung der politischen Linken seit Ende des Zweiten Weltkrieges somit nicht zulassen.
Eine umfassende Darstellung der französischen Neuen Linken vor 1968 gibt es in deutscher Sprache jedoch bisher nicht. Wie in Kapitel 1.2 gezeigt werden soll, existiert auch in Frankreich noch keine Monographie, die versucht, die ideengeschichtlichen Aspekte und politischen Hintergründe der Neuen Linken sowie ihre Verankerung im Nachkriegsfrankreich zusammenhängend darzustellen. Die Vorgeschichte vom politischen Mai 1968 ist daher weit weniger untersucht als die „Kulturrevolution“ selbst und ihre gesellschaftlichen Folgen. Diese Arbeit liefert zudem eine umfassende Untersuchung zur Partei PSU, die einen bedeutenden Teil der französischen Neuen Linken darstellte. Eine detaillierte Darstellung der Entstehung und politischen Organisation der Partei fehlt in der deutschen Forschungslandschaft bisher vollständig. Auch in Frankreich existiert bisher keine Monographie zur PSU und ihrem politischen Programm in den 1960er Jahren.12
Die Besonderheit der Neuen französischen Linken vor 1968 machte aus, dass sie keine rein politische Bewegung war, sondern eine Reihe von bekannten Intellektuellen zu sich zählen konnte, die die Debatten durch soziologische und philosophische Beiträge bereicherten. Diese wurden die Grundlage weitreichender Auseinandersetzungen und theoretischer Diskussionen innerhalb der Neuen Linken. Daher beschäftigt sich die Arbeit zu einem großen Teil mit französischer Intellektuellengeschichte der 1950er und 1960er Jahre. Ausgewählte Akteure, die der Neuen Linken besonders nahestanden, wie Henri Lefebvre, Jean-Paul Sartre, Edgar Morin oder Cornelius Castoriadis, zählen bis heute zu den bedeutendsten Denkern der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Frankreich und Europa. Ihre Schriften wurden in unzählige Sprachen übersetzt und stellen auch über Frankreich und den Kontext der Neuen Linken hinaus eine wichtige kulturelle und intellektuelle Referenz dar.
Obwohl es sich bei dem untersuchten Gegenstand um einen linken „Mikrokosmos“ handelt, fällt die Dichte und Vernetzung der unzähligen politischen und intellektuellen Akteure auf. Dies ist dem speziellen soziohistorischen Kontext Frankreichs geschuldet, wie Anna Broschetti anmerkt.13 Die frühe politische und wirtschaftliche Zentralisierung des Landes und die Herausbildung eines starken Bildungsbürgertums förderte die Entwicklung einer eng verbundenen Künstler- und Intellektuellenszene in Paris. Die republikanisch-laizistische Tradition Frankreichs seit der Französischen Revolution hat zudem durch öffentliche Bildungseinrichtungen und dem Prinzip der Meinungsfreiheit zu den grundlegenden Voraussetzungen intellektuellen Lebens beigetragen. Die Fülle an politischen Zeitschriften, Clubs, Akademien und Zirkeln allein in der politisch linken Szene ist dabei besonders auffällig. Zwar konzentriert sich diese Arbeit auf die 1960er Jahre, jedoch zeigt ein Blick in das Kapitel 3.1 „Vorläufer der Neuen Linken in den 1930er Jahren: die Außenseiter von PCF und SFIO“, wie vielfältig und reichhaltig die intellektuelle Produktion von Schriften, Zeitschriften und die Formierung von linken Aktionsgruppen schon in den 1930er Jahren war.
Diese Arbeit untersucht jedoch im Wesentlichen die zehn Jahre vor 1968, die gleichzeitig die zehn ersten Jahre der V. Republik darstellen. Dabei spielt 1968 selbst aufgrund der Fülle der bereits vorgenommenen Untersuchungen nur eine Nebenrolle und wird nicht separat behandelt, sondern als Zäsur gesehen. Die Arbeit wird anhand der skizzierten Fragestellung die Neue Linke ausschließlich vor den Maiereignissen untersuchen, um ihre Genese nachzuzeichnen, wobei das Jahr 1968 als Referenzhorizont in der Untersuchung ständig präsent bleibt. Der Soziologe und für die Neue Linke zentrale Intellektuelle, Alain Touraine, merkt bezüglich des Jahres 1968 im Rückblick an, dass die Mai-Ereignisse einen eindeutigen Bruch für die linken politischen Bewegungen darstellten:
„[...] le mouvement de Mai fut aussi une rupture, une brèche, comme l’ont dit Cornélius Castoriadis, Claude Lefort et Edgar Morin. En lui, la révolte et l’utopie furent souvent plus visibles que la définition d’un nouveau conflit central.“14
Daher konzentriert sich diese Arbeit vor allem auf die organisatorische Entstehung und die ideengeschichtliche Herleitung der Ideen und Konzepte der Neuen Linken und geht auf die Entwicklung der Gruppierungen und Parteien in der III. und IV. Republik ein, statt die Folgen von 1968 für die Neue Linke zu analysieren. In Frankreich ging, wie Ingrid Gilcher-Holtey es formuliert, „dem Mai 1968 [...] der Mai 1958 voraus.“15Zwischen der Rückkehr von Charles de Gaulles an die Macht und den zehn Jahren vor den Ereignissen der Studentenrevolte und der Massenstreiks, die in Frankreich im März 1968 begannen, formierten sich die Zirkel, Zeitschriften, Studienzentren und – darin ist Frankreich eine Ausnahme – eine Partei der Neuen Linken – die PSU:
„In Frankreich – und nur hier – führte, unter den Bedingungen einer spezifischen politischen Konstellation, die theoretische und politische Kritik an den traditionellen Linksparteien, den Sozialisten und Kommunisten, zur Gründung einer Organisation der in ihren Grundorientierungen eigentlich antiorganisatorischen Neuen Linken.“16
Die Gründung der PSU und ihrer Netzwerke im Kontext einer eher parteienskeptischen Grundstimmung sowie der Kritik vieler Akteuere der Neuen Linken am repräsentativen Demokratiemodell werden daher in dieser Arbeit eine zentrale Rolle spielen. Die zehn Jahre zwischen 1958 und 1968 waren eine Zeit der Orientierung für die französische Linke insgesamt, die sich nach dem Ende der IV. Republik in einer geschwächten Position befand. SFIO, PCF und die „Parti radical“ befanden sich seit 1958 in der Opposition.
Ausgehend von der politischen Situation der parlamentarischen und außerparlamentarischen Linken soll untersucht werden, wie sich die Akteure der Neuen Linken von der traditionellen Linken konzeptionell absetzten und wie sie sich organisierten. Es soll eine verbindliche Eingrenzung darüber gegeben werden, welche Akteure zur Neuen Linken gehörten und welche politische und intellektuelle Rolle sie innerhalb der Bewegung bis 1968 spielten.
Die Untersuchung geht dabei den Fragen nach, in welcher Tradition sich die unterschiedlichen Strömungen der Neuen Linken verstanden und welche Kritik sie an der traditionellen Linken übten, die vor allem durch die Parteien SFIO, PCF und „Parti radical“ verkörpert wurden. Im Kontext des Kalten Krieges und der damit einhergehenden Konfrontation zwischen dem US-amerikanischen Modell einer kapitalistischen Marktwirtschaft sowie dem sowjetischen System auf Grundlage marxistischer-leninistischer Wertevorstellungen soll anhand der Neuen Linken gezeigt werden, inwiefern diese eine Revision linker bzw. orthodoxer marxistischer Positionen anging und gleichzeitig dem ökonomischen Modell des Kapitalismus gegenüber kritisch eingestellt blieb.
Eine zentrale These der Arbeit ist demnach, dass die Neue Linke zu Beginn der V. Republik den Versuch eines Dritten Weges weiterführte, den Jean-Paul Sartre schon 1946/47 mit seinem „Rassemblement démocratique révolutionnaire“ (RDR) anschob.17 Der Begriff des „troisième voie“ soll dazu dienen, die Gemeinsamkeiten der Konzepte eines neuen demokratisch-sozialistischen Modells, der Weiterentwicklung des Marxismus sowie der Unterscheidung von klassisch-sozialdemokratischen bzw. sozialistischen Ideen begrifflich zusammenzufassen. Sicherlich birgt der Begriff „Dritter Weg“ eine Unmenge an Schwierigkeiten, denn auch die Akteure selbst bezeichneten sich keinesfalls als „Dritte-Weg-Denker“. Deshalb wird im Verlauf dieser Arbeit genau untersucht, inwiefern dieser Begriff, der in der Geschichte des 20. Jahrhunderts für sehr unterschiedliche ideologische Strömungen verwendet wird, auf die historische Situation und die programmatische Ausrichtung der Neuen Linken zutreffend ist. Da in dieser Abhandlungdiejenigen Strömungen, Bewegungen, Parteien und Zirkel betrachtet werden, die im genannten Zeitraum sowohl in Opposition zum kapitalistisch-westlichen System wie auch zum sozialistisch-osteuropäischen System standen, muss diskursanalytisch untersucht werden, welche neuen Bedeutungen die Akteure den „alten“, traditionell sozialistischen und marxistischen Begriffen gaben.
Ziel der Arbeit ist es, die ideologischen Ausrichtungen, programmatischen Konzepte und politischen Strategien der Neuen Linken herauszuarbeiten sowie notwendige Abgrenzungen gegenüber linksradikalen und reformistischen Kräften vorzunehmen. Dabei dienen folgende Fragen als Leitmotiv der Untersuchung: Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten hatten die Akteure der Neuen Linken in Frankreich und welche unterschiedlichen Strömungen und Tendenzen lassen sich ausmachen? In welcher politischen und philosophischen Tradition verstanden sich die Vertreter der Neuen Linken? Inwiefern kann man konzeptionell von „Neomarxismus“ sprechen und auf welche Werke und Denkansätze bei Marx wurde sich bezogen? Wie viel Revisionismus steckte in den Konzepten der Neuen Linken? Inwiefern waren diese Vorschläge eine Neubelebung oder Revision von Marx? Welche anderen Denker wurden herangezogen, um einen „neuen Sozialismus“ zu entwerfen? Welche Diskurse waren dabei zentral und wie entwickelten sich diese in den zehn Jahren des untersuchten Zeitraumes?
Aus Gründen des Umfangs können in der Arbeit nichtalle Organisationen, Gruppen und Intellektuellen der Neuen Linken im Detail berücksichtigt werden. Um eine repräsentative Übersicht über die Heterogenität und das mehr oder weniger lose Netzwerk der Neuen Linken zu erstellen, werden daher einzelne Vertreter und Organisationsformen vorgestellt. Aus den vorhandenen Organisationsformen (Parteien, Intellektuelle, Zeitschriften und Aktionsgruppen) wurde für diese Arbeit eine nähere Untersuchung der Partei PSU als einer der zentralen Akteure der Neuen Linken gewählt, auf deren Entstehungs- und Parteigeschichte näher eingegangen wird. Zudem werden die verschiedenen politischen Etappen der Partei mit der vor allem diskursanalytischen Untersuchung der parteiinternen Debatten und des Parteiprogramms kombiniert. Diese Arbeit geht zudem unter der skizzierten Fragestellung näher auf die Gruppe „Socialisme ou Barbarie“, die Zeitschriften „Arguments“ und „Les Temps Modernes“ sowie die Biographien und wissenschaftlichen Arbeiten von Henri Lefebvre, Jean-Paul Sartre und Edgar Morin ein.
Dabei konzentriert sich die Analyse auf die Frage, inwiefern neue ökonomische, soziologische, politische und philosophische Visionen sozialistischen Denkens entworfen wurden. Es soll zudem beleuchtet werden, wie sich die Akteure gegenüber anderen linken Organisationen abgrenzten und wo sie ihre Alleinstellungsmerkmale verorteten. Dabei spielt bei der PSU die organisatorische Frage nach der Stellung der Partei innerhalb des politischen Systems eine Rolle – bei den Intellektuellen hingegen eher die Wahrnehmung von den Aufgaben der Wissenschaft in linker Theorie und Praxis. Die Organisationsfrage ist hinsichtlich der Ideologiekritik der Neuen Linken ein zentrales Thema und stehtbei der Untersuchung der Konzepte und Programme dementsprechend im Vordergrund. Da sich die Neue Linke vor allem durch einen radikalen Antistalinismus auszeichnete, spielte die Frage der Notwendigkeit einer revolutionären „Avantgarde“, einer einzelnen Arbeiterpartei sowie staatlicher Organisation und Bürokratie überhaupt eine herausragende Rolle.
1.2Methodische Überlegungen
Diese Arbeit soll unter der skizzierten Aufgabenstellung eine ideengeschichtliche Untersuchung mit politischer Geschichtsschreibung verbinden. Neben der systematischen Analyse der politisch linken Parteien und Bewegungen des Nachkriegsfrankreichs soll die Kritik der Neuen Linken anhand von zeitgenössischen Schriften, philosophischen Abhandlungen und politischen Programmen diskursanalytisch untersucht werden.
Achim Landwehr rekurriert bei seiner historischen Diskursanalyse vor allem auf Michel Foucault und Pierre Bourdieu. Dabei unterscheidet sich die historische Anwendung der klassischen sprachlichen Diskursanalyse in Anwendung und Ziel des Gegenstandes.18 Bei der historischen Diskursanalyse kann es demnach nicht allein um den Gebrauch der Sprache gehen, sondern vor allem um den zeitlichen Kontext und die Entstehung von Diskursen im strukturalistischen Sinne.19 Bei Foucault tritt dabei der sprachwissenschaftliche Ansatz in den Hintergrund, um dem historischen und funktionalen Charakter von Sprache hervorzuheben. In dieser Arbeit sollen Elemente der historischen Diskursanalyse mit ideengeschichtlichen Ansätzen kombiniert werden. Dabei werden die Quellen danach befragt, was deren „wirkliche“ Aussage gewesen ist, um die Absicht des „sprechenden Subjekts“ zu filtern (Ideengeschichte). Gleichzeitig sollen die Aussagen der Quellen in ihrem Kontext untersucht werden (Ort/Zeit) und die Verbindungen zu anderen Aussagen und Quellen aufgezeigt werden (historische Diskursanalyse).20 Dabei geht es auch in dieser Arbeit weniger um die Frage von Mentalitäten oder „leitenden Interessen“, sondern darum, die Aussagen an sich als Gegenstand der historischen Analyse zu verwenden.21 Damit werden, wie Landwehr beschreibt, spekulative Aussagen über eventuelle individuelle Interessenfragen ausgeblendet. Bei der Quellenanalyse der historischen Reden, Anträgen, Berichten, Briefen oder Veröffentlichungen der Neuen Linken wird der Text als solcher somit zwar in den historischen Zusammenhang gestellt und seine Urheber in ihrer jeweiligen biographischen Situation beleuchtet, jedoch wird vermieden, über diese Informationen hinaus den Text hermeneutisch weiter zu interpretieren. Stattdessen werden Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Aussagen aufgezeigt, um so Diskurse auszumachen, die die Neue Linke in dem Zeitraum von 1958 bis 1968 geprägt haben. Dazu werden verschiedene der Neuen Linken zuzuordnende Texte zusammengetragen, die den Korpus bilden. In dieser Arbeit wird hinsichtlich der leitenden Diskurse der Neuen Linken vor allem auf einschlägige Zeitschriften („Arguments“, „Les Temps Modernes“, „Socialisme ou Barbarie“ oder auch „Tribune Socialiste“) rekurriert, Veröffentlichungen der zeitgenössischen Akteure berücksichtigt sowie in Archiven auf Quellenmaterial zurückgegriffen (Briefe, Protokolle, Berichte, Manuskripte, Anträge u. a.).
In den Kapiteln 2 bis 4 werden Erkenntnisse vor allem mit einer politikwissenschaftlichen und ideengeschichtlichen Analyse gewonnen, bei denen nicht die Texte, sondern die politischen Hintergründe der Fragestellung im Vordergrund stehen – auch dafür wurde eine Reihe von Quellenmaterial genutzt. In Kapitel 5 wird diskurstheoretisch vorgegangen, indem vor allem die zeitgenössischen Texte an sich im Zentrum der Analyse stehen. Dabei werden die Aussagen der Texte als Vermittler historischer Umstände gewertet.22
Die Analyse der zu untersuchenden zeitgenössischen Texte konzentriert sich auf die Fragen um das neue Marx-Verständnis, die Kritik am Stalinismus und der PCF sowie die Kritik am traditionellen sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Denken. Bei der Diskursanalyse wird vor allem auf die Frage nach der Auseinandersetzung um marxistische Begriffe wie „Klasse“, „Revolution“ und „Klassenkampf“ eingegangen. Darüber hinaus liegt das Augenmerk auf der Weiterentwicklung des marxistischen Ansatzes. Die Auflösung klassischer sozialistischer Konzepte von staatlicher Steuerung und der historische Neuigkeitswert ihrer Analysen und theoretischen Ausarbeitungen werden geprüft.
Nach der Eingrenzung und Definition des Terminus „Neue Linke“ wird in Kapitel 2 auf die historischen Rahmenbedingungen eingegangen. Einerseits werden die Gründe für das politische Ende der IV. Republik und die Eskalation des Algerienkrieges beschrieben, andererseits die internen und außerparlamentarischen Widerstände gegen die Regierungspolitik der SFIO und der „Parti radical“ nachgezeichnet. Da der Algerienkrieg ein wichtiger Ausgangspunkt für die Konstituierung einer Reihe von Organisationen der Neuen Linken darstellte, werden zudem auch die Antikriegsproteste erörtert. Zudem wird in Kapitel 2 der Bruch der dissidentischen Kommunisten mit der PCF beschrieben und die Gründe für die Entstalinisierung dieser Minderheit innerhalb der PCF näher beleuchtet. Das Unterkapitel 2.3 befasst sich schließlich mit der Formierung der parlamentarischen Opposition der Neuen Linken („Nouvelle Gauche“, „Union de la gauche socialiste“, „Parti socialiste autonome“) und dem Prozess der Gründung der PSU im Jahr 1960.
Der dritte Teil der Arbeit setzt sich mit den ideengeschichtlichen Vorläufern der Neuen Linken in den 1930er Jahren auseinander und zeigtkonzeptionelle Parallelen und personelle Verbindungen zur Neuen Linken in den 1960er Jahren auf. Zudem wird der zentrale Diskurs um die Selbstverwaltung ins Zentrum der Analyse gerückt, um deren Ausgangspunkte und seinen Verlauf von Ende der 1940er Jahre bis Ende der 1960er Jahre nachzuvollziehen.
In Kapitel 4 geht es um die nähere ideengeschichtliche Untersuchung der ideologischen Debatten innerhalb der PSA und der PSU. Dafür werden die historischen Auseinandersetzungen von gemäßigteren und radikalen Kräften der sozialistischen Bewegung Frankreichs näher beleuchtet. Neben dem Grundkonflikt zwischen den bekanntesten Vertretern Jules Guesde und Jean Jaurès wird auch auf die Entstehung der PCF eingegangen, um ideengeschichtliche Leitmotive herauszuarbeiten. Anhand der Debatten und Lagerbildungen innerhalb der PSU wird analysiert, wie die ehemaligen SFIO-Mitglieder mit ihrem ideologischen Erbe umgingen und inwiefern sie versuchten, es zu „modernisieren“ und auf ein neues programmatisches Fundament zu stellen. Zudem wird die PSU in der Kontinuität der linken Bewegungen und Parteien verortet und ihr Beitrag an der Restaurierung der sozialistischen Ideologietradition näher betrachtet.
Der letzte Teil beschäftigt sich näher mit ausgewählten zeitgenössischen Publikationen der für die Neue Linke zentralen Intellektuellen (Henri Lefebvre, Jean-Paul Sartre, Edgar Morin, Cornelius Castoriadis und Claude Lefort). Dabei wird auf die theoretische Konzeption der Texte näher eingegangen, ihre Entstehung in den historischen Kontext eingeordnet und die biographischen Hintergründe der Autoren sowie ihre politische Vernetzung und Rezeption innerhalb der Neuen Linken dargestellt.
1.3Forschungsstand und Quellen
Die Neue Linke in Frankreich vor 1968 wird in der Sekundärliteratur zwar in ihren zahlreichen Teilbereichen behandelt, aber selten als gesellschaftlich zusammenhängende Strömung wahrgenommen. Deshalb besteht die Herausforderung dieser Arbeit darin, die bestehenden Einordnungen und Teiluntersuchungen meist französischer Sekundärliteratur zu sichten und mit den gewonnen Erkenntnissen aus Archivmaterialien, zeitgenössischen Texten und Zeitzeugeninterviews zu verbinden. Darstellungen und Primärtexte werden auf die in Kapitel 1.1 formulierten Thesen und Fragen untersucht, welche Merkmale der Neuen Linken zugeschrieben werden können und welche Konzepte und Kritiken von ihren Akteuren formuliert wurden. In der bestehenden Sekundärliteratur werden dagegen die konzeptuellen Diskurse oftmals nur am Rande abgehandelt. Zwar wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass gerade diese Ansätze zwischen den Blöcken des Kalten Krieges und jenseits der etablierten Institutionen wichtige theoretische und mobilisierende Grundlagen für die Bewegungen im Mai 1968 legten, eine tiefergehende Darstellung, die die Neue Linke als zusammenhängendes Netzwerk mit gemeinsamen theoretischen Ausgangspunkten beschreibt, fehlt jedoch. Dafür gibt es reichhaltige Sekundärliteratur hinsichtlich der Ereignisse um 1968, zur Geschichte der IV. und V. Republik, zur Intellektuellengeschichte Frankreichs im Allgemeinen sowie ein umfangreiches Repertoire an zeitgenössischen Texten und zugänglichen Archiven, auf die im Folgenden noch näher eingegangen wird.
In Frankreich ist die Erforschung der Geschichte der PSU in den letzten Jahren in Bewegung gekommen. Aus einer Reihe von Kolloquien sind Sammelbände zur Geschichte der Partei entstanden, die vor allem sehr detailreiche Studien über die Regionalgeschichte der PSU und die politische Struktur der Partei enthalten.23 Besonders umfassend und aufschlussreich sind die Beiträge des Kolloquiums vom 8. und 9. November 2010 in Science Po Paris24 unter der Leitung von Jean-François Sirinelli, Laurent Jalabert, Marc Lazar, Gilles Morin und Noëlline Castagnez, die 2013 veröffentlicht wurden.25 Bei der Mehrheit der weiteren Veröffentlichungen befinden sich unter den Autoren nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Zeitzeugen, deren wissenschaftliche Objektivität deshalb zumindest in Frage gestellt werden muss.26 Dieses Problem besteht auch für die ältere Literatur über die PSU: Die Mehrheit der Veröffentlichungen ist von ehemaligen Mitgliedern der Partei geschrieben worden, die teilweise selbst als Wissenschaftler und Historiker tätig waren, unter anderem Jacques Kergoat und Emmanuel Le Roy Ladurie, oder von Politikern wie Jean Poperen, Marc Heurgon oder Michel Rocard.
Die erste Phase der Auseinandersetzung mit der PSU setzte nach 1970 ein, in erster Linie von Politikern und Historikern, die selbst Mitglied der Partei oder an deren Gründung beteiligt gewesen waren, etwa Édouard Depreux,27Michel Rocard28 oder Jean Poperen.29 In den 1980er Jahren schrieben dann erste PSU-Mitglieder wie Parteimitbegründer Gilles Martinet30 und Emmanuel Le Roy Ladurie31 ihre Memoiren. Die Partei selbst kümmerte sich auch um Jubiläumsbände, in denen vor allem die Auseinandersetzung in der Presse festgehalten sind.32 ZurForschung und Dokumentation der PSU haben zudem Guy Nania33 und Roland Cayrol/Yves Tavernier34 beigetragen.
In den 1990er Jahren versuchten sich ehemalige Mitglieder wie Marc Heurgon an einer umfassenden Geschichte der PSU, deren zweiter Teil aber aufgrund des Todes von Heurgon nicht zustande kam.35François Kesler, ebenfalls ehemaliges PSU-Mitglied und emeritierter Hochschulprofessor, schrieb 1990 eine Abhandlung zum Einfluss der PSU auf die französische sozialistische Partei (PS).36 Eine Dissertation zum Thema PSU hat Antoine Lilti im Jahre 1993 vorgelegt37, wohingegen meist die Dissertation von Gilles Morin (1991) in der einschlägigen Literatur zitiert wird.38 Neben den bereits genannten aktuellen Veröffentlichungen zwischen 2010 und 2013 haben ehemalige Mitglieder der PSU 2013 das „Institut Tribune Socialiste“ (ITS) gegründet, in dem nun das Archiv der PSU aufgebaut werden soll. Bisher lagen die Archivalien der Partei in verschiedenen Institutionen, die für diese Arbeit konsultiert wurden: Archives nationales, Centre d’études et de recherches sur les mouvements trotskystes et révolutionnaires internationaux (CERMTRI), Centre d’histoire Science Po (CHEVS), Centre d’histoire sociale du XXe siècle (CHS), Centre d’histoire du travail (CHT) und das Archiv OURS Paris, Fondation Jean Jaurès. Neben dem neuen PSU-Archiv veröffentlicht das ITS auch entsprechende Bände zur Parteigeschichte.39
Für die Gruppe „Socialisme ou Barbarie“ sowie Zeitschriftenprojekte wie „Arguments“ ist das Archiv IMEC (Institut Mémoires de l’édition contemporaine) unverzichtbar, da dort nicht nur die Originalausgaben, sondern auch Korrespondenzen und Redaktionsprotokolle eingesehen werden können. Für die Arbeit sind weitere Zeitschriften gesichtet worden, u. a. „Les Temps Modernes“, „France-Observateur“, „Tribune Socialiste“ (Wochenzeitung der PSU), „Le Courrier du PSU“ (internes PSU-Parteiblatt), „Nouvelle Critique“ und „Témoignage Chrétien“, die sich teilweise in der BNF und den genannten Archiven befinden.
Zur Neuen Linken im Allgemeinen wurde Ende der 1970er Jahre auch im angelsächsischen Raum publiziert, unter anderem von Charles Hauss („The new left in France“, Westport 1978) und insbesondere Tony Judt („Marxism and the French Left: Studies on Labour and Politics in France 1830-1982“, Oxford 1986).
Einen wichtigen Beitrag zur Kommunismusforschung in Frankreich hat auch Marc Lazar mit seinen zahlreichen Bänden über die Kommunistische Partei Frankreichs und die Linke in der Nachkriegszeit geliefert (u. a. „La gauche en Europe depuis 1945 : invariants et mutations du socialisme européen“, Paris 1996).
Unverzichtbar für die theoretischen Debatten der Neuen Linken ist der 2003 erschienene Band „Autogestion. La dernière utopie ?“ von Frank Georgi, der die verschiedenen Spektren der Selbstverwaltungsdebatte aufzeigt. Zur Intellektuellenkultur in Frankreich müssen in jedem Fall die Abhandlungen von Jean-François Sirinelli (u. a. „Les intellectuels en France : de l’affaire Dreyfus à nos jours“, Paris 2002) und Christophe Prochasson(„Les Intellectuels et le socialisme, XIXème-XXème siècle“, Paris 1997) einbezogen werden. Der wichtigste französische Beitrag zu „Socialisme ou Barbarie“ ist von Philippe Gottraux veröffentlicht worden.40
Jedoch ist die Sekundärliteratur von deutschen Historikern zur Neuen Linken in Frankeich eher spärlich. Diese Darstellung ist daher ein Novum in der Forschungsliteratur, da die deutsche Sozialismusforschung die PSU bisher weitgehend ignorierte.41 Eine wichtige Referenz zum Thema „Neue Linke“ sind die Veröffentlichungen von Ingrid Gilcher-Holtey, die eine umfassende Skizzierung vieler wichtiger Gruppen und Akteure der französischen Neuen Linken vornimmt und auch auf Zeitzeugeninterviews zurückgreift.42 Für die Geschichte des linksintellektuellen Milieus des Nachkriegsfrankreichs ist Thomas Krolls Monographie zur Geschichte der kommunistischen Intellektuellen in Westeuropa ein wichtiger Beitrag.43 Christoph Kalter veröffentlichte 2011 hingegen einen umfassenden Band seiner Dissertation zur Dekolonialisierung und dem Konzept der „Dritten Welt“ in Frankreich. Darin spielt auch die PSU eine Rolle. Die Analyse beschränkt sich aufgrund Kalters Aufgabenstellung jedoch ausschließlich auf die Diskussionen innerhalb der Partei zum Thema Entwicklungspolitik und der Frage der Solidarität mit sogenannten sozialistischen „Dritte-Welt-Ländern“.44 Trotz seines älteren Erscheinungsdatums Bruno Schochs ist „Marxismus in Frankreich seit 1945“ (Frankfurt am Main/New York 1980) noch immer noch eine lohnenswerte Einführung in die vielfältigen Debatten, Strömungen und Diskurse um und in der PCF. Gleiches gilt für Sunil Khilnanis „Revolutionsdonner. Die französische Linke nach 1945“ von 1995. Bezüglich der Intellektuellen- und Marxismusgeschichte gibt neben Ingrid Gilcher-Holteys Werken auch Otto Kallscheuers „Marxismus und Erkenntnistheorie in Westeuropa. Eine politische Philosophiegeschichte“ (Frankfurt am Main/New York 1986) einen Überblick. Eine wichtige Arbeit lieferte Andrea Gabler 2009 mit ihrer Monographie über die Zeitschrift „Socialisme ou Barbarie“, deren erste umfangreiche deutsche Bearbeitung in ihrem Band „Antizipierte Autonomie. Zur Theorie und Praxis der Gruppe ’Socialisme ou Barbarieʽ (1949-1967) erschien. Unverzichtbar sind zudem auch die Arbeiten von Roberto Ohrt über die Szene der Situationisten (u. a. „Das große Spiel. Die Situationisten zwischen Politik und Kunst“, Hamburg 1999). Bisher existiert speziell über die PSU nur ein Aufsatz auf Deutsch, ein übersetzter Artikel des ehemaligen PSU-Mitgliedes und Historikers Jacques Kergoat aus dem Jahr 1982.45
1.4Definition des Begriffs „Neue Linke“
Der Begriff „Neue Linke“ muss zuerst zeitlich verortet werden, um Verwechslungen zu vermeiden. Denn die „New Left“ oder „New Labour“ von Tony Blair46 oder die ebenfalls teilweise als „Neue Linke“ bezeichnete Neuformierung der „Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit“47 haben nur noch bedingt etwas mit der Neuen Linken gemeinsam, die sich in den 1950er und 1960er Jahren herausbildete. Zudem gibt es nationale Besonderheiten, die auch einen Vergleich von den verschiedenen Bewegungen in Europa und den USA sehr schwierig gestaltet. In der Literatur gibt es auch für die „erste“ Neue Linke der 1960er Jahre keine einheitliche Definition. Der Begriff „Neue Linke“ (New Left) wurde von dem US-amerikanischen Soziologen Charles Wright Mills Ende der 1950er Jahre erstmals in die Diskussion gebracht. Er beschrieb damit ein neues linkes Denken jenseits der realsozialistischen marxistischen Orthodoxie und reformistisch-westlichen Ansätzen, das in den 1950er Jahren von Intellektuellen aus verschiedenen westlichen Ländern formuliert wurde und nach neuen sozialistischen Politikmodellen suchte.48
Jedoch bleibt unscharf, welche Akteure dieser Neuen Linken in den verschiedenen Ländern zugerechnet werden können und wo genau die nationalen Besonderheiten lagen. Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, diesem Begriff zumindest für Frankeich mehr Substanz zu geben und zu begründen, warum bestimmte linke Strömungen zu diesem Kreis gezählt werden können und andere Strukturen hingegen nicht unter die Definition fallen.
Zudem gibt es in der Sekundärliteratur, aber auch in zeitgenössischen Dokumenten eine Reihe von Bezeichnungen („deuxième gauche“, „troisième secteur“, „gauchiste“, „Dritter Weg“, „extrême gauche“, „Linksozialisten“), unter denen ebenfalls die Neue Linke bzw. ein Teil der Neuen Linken verstanden wird. Im Verlauf dieser Arbeit werden die jeweiligen Bezeichnungen näher beleuchtet und auf die französische Neue Linke angewendet, um eine Eingrenzung und theoretische Einordnung vorzunehmen.
Ingrid Gilcher-Holtey, Autorin von verschiedenen Studien zur 1968er Bewegungen, meint in Übereinstimmung mit Zeitzeugen wie Claude Lefort und Edgar Morin, dass der Begriff „Neue Linke“ „auf der Grundlage dieser internen Differenzierung als gemeinsamer Oberbegriff verwendet werden“ könne. Vor allem weil sich die Mehrheit der PSU bzw. ihrem Umfeld zurechnete und sie gemeinsame „Wert- und Handlungsorientierungen“ besaßen.49 Die meisten der von der Autorin im Rahmen dieser Arbeit befragten Zeitzeugen und Wissenschaftler konnten sich ebenfalls mit dem Begriff anfreunden, auch wenn immer wieder betont wurde, dass die Bezeichnung posthum entstanden ist, als es quasi schon gar keine Neue Linke mehr gab.50 Dennoch gibt es bei genauerem Hinsehen Probleme bei der Definition des Begriffs, da es keine detaillierte Beschreibung gibt, wer mit dieser Neuen Linken gemeint ist und was die gemeinsamen Merkmale sind. Aus diesem Grund werden neben der Bezeichnung Neue Linke eine Reihe von Begriffe verwendet, die auf die französische Linke angewendet, durchaus diskutabel sind.
Im deutschen Sprachgebrauch rekurrieren einige Autoren statt auf „Neue Linke“ auf den Begriff des „Linkssozialismus“, womit verschiedene Bewegungen in Europa zusammengefasst werden sollen – trotz ihrer politischen Unterschiede.51 Dabei verstehen die Autoren darunter die „Stellung links von der Sozialdemokratie und ihre Eigenständigkeit gegenüber kommunistischen (eurokommunistischen oder Moskau-orientierten) Parteien [...].“52 Die von Jürgen Baumgarten verfassten Kriterien für den Linkssozialismus treffen vor allem auf die französische Partei PSU zu, während Zeitschriften, Intellektuelle und andere Gruppierungen außen vor gelassen werden. Linkssozialismus bezieht sich bei Baumgarten demnach explizit auf Parteien, die am parlamentarischen Prozess teilnehmen. Christoph Jünke hingegen fasst die Definition in seinem Band etwas breiter und erklärt, dass der Begriff nicht programmatisch, sondern nur historisch zu begreifen sei:
„So betrachtet bezeichnet der Linkssozialismus eine ganze, durchaus heterogene Reihe historischer und auch politisch-theoretischer Strömungen, Individuen und Ansätze, die sich seit den 1920er/1930er Jahren innerhalb und außerhalb der beiden Hauptströmungen der linken, sozialistischen Arbeiterbewegung positioniert haben, um, in der Regel, damit deutlich zu machen, dass diese Hautströmungen auf unterschiedliche Weise ihre sozialistischen Ursprünge verlassen haben, und dass es gelte, diese zu erneuern.“53
Linkssozialisten hielten am „Marxschen Antikapitalismus und an der marxistischen Theorie“ fest und versuchten, „die Arbeiterbewegung von links zu erneuern“. Im Gegensatz zu sozialen Bewegungen, die oft aus den linkssozialistischen Bewegungen hervorgegangen seien (Frauenbewegung, Umweltbewegung), sei der Linkssozialismus an „das Schicksal der klassischen revolutionären Arbeiterbewegung gebunden [...].“54 Jünke weist zugleich auf die Definitionsschwierigkeiten des Begriffes hin, der es noch nicht in die „einschlägigen Lexika und Nachschlagewerke“ geschafft habe. Jünkes Begriff der Linkssozialisten ist auf die Neue französische Linke anwendbar, auch wenn er in seinem Band in Bezug auf die französischen Linkssozialisten ausschließlich der Gruppe „Socialisme ou Barbarie“ ein spezielles Kapitel widmet.55 Dies mag jedoch auch der fehlenden Bearbeitung der Neuen französischen Linken in der deutschen Forschungsliteratur geschuldet sein. Es ist jedoch fraglich, ob der Begriff ins Französische übertragbar ist, ohne dass andere sprachliche Konnotationen damit einhergehen („socialiste de gauche“). Aus diesem Grund ist der Begriff „Linkssozialismus“ als hilfreich zu werten, jedoch weder als eindeutig noch als ohne weiteres auf andere politische Kulturen anwendbar.
Da die Neue Linke in Frankreich eine Alternative zu bestehenden traditionellen linken Konzepten suchte und im Kontext des Kalten Krieges das sowjetische sowie das westliche politische Modell kritisierte, liegt es nahe, auf den Begriff des „Dritten Weges“ (troisième voie) zurückzugreifen.
Problematisch ist hierbei jedoch, dass die Metapher des „Dritten Weges“ einen breiten Assoziationsspielraum zulässt und daher auch von den verschiedensten Gruppen als Begriff für die eigenen politischen Konzepte benutzt wurde. Diese Uneindeutigkeit macht einerseits die Schwierigkeit und Brisanz des Begriffs aus, andererseits entfaltet er gerade dadurch eine ungeheure Suggestivkraft. Hans Vorländer versuchte sich 2001 an einer Definition dieses in unterschiedlichen politischen Kontexten gebrauchten Begriffes:
„Es gibt zwei Wege, die in die Irre, und nur einen Weg, der zum Ziel führt. Dieser Weg muss nicht der mittlere Pfad sein, gleichwohl liegt in der Metapher des Dritten Weges die Vorstellung eingeschlossen, dass der Dritte Weg auch der vernünftige, die Extreme vermeidende und insofern dann doch der mittlere ist.“56
Der „Dritte Weg“ ist somit ein „Unterscheidungsbegriff“, er grenzt sich von den „diskreditierten oder erschöpften Extremen“ ab und sucht eine Alternative.57 Darin liegt jedoch ein weiteres Problem der Dritte-Weg-Konzepte: die Abhängigkeit von der „Folie des Versagens des ersten und zweiten Weges“.58 Ausgangssituation eines „Dritten Weges“ ist demnach immer das Zerwürfnis mit den gegenwärtigen politischen Verhältnissen und die Entwicklung eines neuen Gesellschaftsmodells. Dieses ist jedoch nicht völlig neu, sondern definiert und leitet sich aus dem Versagen der bestehenden Ordnung her: „Wer sich auf den 3. Weg begibt, ist auf der Suche nach einer politischen und gesellschaftlichen Alternative in einer bereits polarisierten Welt der Argumente und Ideen.“59 Ergebnis ist eine „gemäßigte Version“60 oder eine Erweiterung der bestehenden politischen Wirklichkeit oder eine andere Akzentuierung – keineswegs aber ein völlig neues Gesellschaftskonzept. Im 20. Jahrhundert wurde das Konzept des „Dritten Weges“ von sowohl liberalen und konservativen als auch marxistischen Theoretikern formuliert. Die von Wilhelm Röpke61 entwickelte „neoliberale Schule“ kann genauso hinzu gezählt werden wie Strömungen des Nationalneutralismus, Austromarxismus, Neomarxismus, Eurokommunismus und des Reformkommunismus sowie teilweise die Neue Linke.62
Jünke erklärt zum Begriff des „Dritten Weges“, dass dieser meist als Alternativsuche zwischen Kapitalismus und Sozialismus verstanden werde, hinsichtlich der linken Bewegungen jedoch als Suche jenseits von Sozialdemokratie und orhodoxem Realsozialismus verortet werden müsse.63 Da der Begriff „Dritter Weg“ sehr allgemein verstanden wird, wird er in dieser Arbeit nur sehr sporadisch angewandt, um bestimmt theoretische Konzeptionen einzuordnen. Trotzdem er in Bezug auf die Idee der Neuen Linken an sich passend erscheint – eine neue alternative Gesellschaftsordnung jenseits bestehender Konzepte zu entwickeln – trifft er jedoch im Detail nicht auf alle Akteure zu. Teilweise handelt es sich, beispielsweise innerhalb der PSU, um eine Art Reformismus und andererseits, innerhalb von Kreisen wie „Socialisme ou Barbarie“, eher um eine Radikalisierung von bestimmten Positionen. Es kann also nicht davon gesprochen werden, dass die Akteure der Neuen Linken einen gemeinsamen „Dritten Weg“ gesucht haben.
In diesem Zusammenhang taucht noch ein weiterer Begriff auf, der in die Nähe der Neuen Linken gerückt werden könnte: der Eurokommunismus. Dieser wird jedoch ausschließlich auf die Kommunistischen Parteien in Europa angewandt, die sich im Laufe der 1960er und 1970er Jahre von der dogmatischen, stalinistischen Doktrin abwandten und sich im politischen Feld neu zu definieren versuchten und spielt deshalb in dieser Arbeit keine besondere Rolle.64
Untersucht man den Begriff „Neue Linke“ ausschließlich aus französischer Perspektive, finden sich sehr unterschiedliche Herangehensweisen und Begrifflichkeiten, auch wenn viele von ihnen miteinander kombiniert werden können. Der Historiker und ehemaliger PSU-Mitstreiter Michael Löwy erklärte im Interview, dass die Neue Linke sich vor allem von alten Termini aus der linken Geschichte abgrenzte, auch wenn in Frankreich alte und neue Linke in der Bewegung von 1968 teilweise wieder zusammengefunden haben:
„Ce n’est que plus tard dans les années 1960 que le terme a pris un sens plus précis, avec l’essor du SDS en Allemagne, le SDS aux USA, la ’New Left Review‘ en Angleterre, etc. La Nouvelle Gauche se distinguait aussi des courants plus anciens et ’historiques‘ de tendance Linksradikal, comme les trotskistes et les anarchistes, même si parfois il y avait des recoupements (comme la tendance SR du PSU). En France il y aura une osmose entre ’Nouvelle Gauche‘ et ces courants ’anciens‘, par exemple dans le Mouvement du 22 Mars en 1968.“65
Löwy verwies darauf, dass die Neue Linke sich von den linksradikalen Strömungen abgegrenzt habe – ein wichtiges Kriterium, das ihre Verortung im ideologiekritischen Bereich betont.
Somit ist die Neue Linke nicht Teil jener „revolutionären Bewegung“, wie sie der Linksintellektuelle, Anarchist und Aktivist Roland Biard im Vorwort seines „Dictionnaire de l’extrême-gauche“ beschreibt:
„L’extrême-gauche […] est la frange politique enfermée dans l’idéologie. Il s’agit de mouvements révolutionnaires qui veulent le renversement brutal et violent de l’ordre existant, la disparition du capitalisme et de l’oppression, mais qui s’enferment dans des schémas préconçus et mis sur pied en laboratoire. Ce phénomène représente une bonne partie de l’extrême-gauche contemporaine. Nous l’appellerons dans ce qui suit l’extrême-gauche ’idéologique‘.“66
Der Begriff „ideologisch“ ist für die Abgrenzung der Neuen Linken von zentraler Bedeutung. Das, was die große Mehrheit der Vertreter der Neuen Linken versuchten, war gerade mit vorhandenen Ideologien und marxistischen Denkschablonen zu brechen – dies machte ihre theoretische Stärke, aber auch ihre organisatorische Schwäche aus. Die Neue Linke sollte sogar als eine Denkrichtung definiert werden, die als Reaktion auf die Verkrustung der linken Denkstrukturen im Kalten Krieg und als Folge von Stalinismus und orthodoxer Rhetorik entstand und sich somit der Ideologiekritik verschrieb. Jedoch reflektiert diese Abgrenzung nicht zwangsläufig die Außenwahrnehmung der Neuen Linken: Ein Beispiel ist die Auflistung der PSU in den Wahlstatistiken, wo sie unter der Bezeichnung „extrême gauche“ geführt wurde.
Roland Biard grenzt die PSU als ein Sammelbecken der Neuen Linken von der „ideologischen Linken“ ab, da diese nicht auf einer „Rekonstruktion der Ideologie“ aus gewesen wäre. Er bezeichnet die PSU als „Gegen-Linke“:
„Le PSU et les organisations qui l’ont précédé sont pour nous le second volet de l’extrême-gauche : la contre-gauche.“67
Kalter bezeichnet die Neue Linke und insbesondere die PSU als „neue radikale Linke“, was zumindest mit der hier erarbeiteten Definition in Frage gestellt werden soll, da sich der „Radikalitätsgrad“ je nach Organisation der Neuen Linken stark unterschied und damit Gruppen wie SouB und die PSU schlicht auf eine Stufe gestellt und die entscheidenen Unterschiede zwischen den Organisationen ignoriert werden.68
Über die Begriffe der „Linksradikalen“ oder „Linksextremen“ kommen wir zum „gauchisme“, der – teilweise wahllos – für verschiedene linke Strömungen gebraucht wird. Für den Historiker Richard Gombin kann man unter den Begriff jene Bewegungen fassen, die den Marxismus-Leninismus revidieren und Alternativen anbieten, sich jedoch nicht auf diesen als Doktrin stützen.69 Zudem sind „gauchistes“ jene, die strikt revolutionär sind, im Sinne eines totalen und sofortigen Umsturzes der kapitalistischen Gesellschaft. Deshalb schließt Gombin jene Bewegungen vom „Gauchismus“ aus, die eine sozialdemokratische, ergo reformorientierte Gesinnung haben, sowie jene, die zwar die Kommunistische Partei als solche bzw. den Stalinismus kritisieren, sich jedoch weiterhin in der Tradition des Marxismus-Leninismus verorten. Sich von der Partei als solche zu distanzieren – im Sinne der Kritik an der Umsetzung des marxistisch-leninistischen Gedankengutes – sei zwar ein „Gauchismus“ in Bezug auf die Partei, jedoch nicht im theoretischen Kontext – für Gombin geht es dabei vorrangig um die theoretische Abgrenzung. Als Beispiele nennt er die Gruppen von Maoisten und Trotzkisten, die zwar der PCF abgeschworen, doch weiterhin eine marxistisch-leninistische Ideologie verfolgt haben.70 Diese Gruppen bezeichnet der Autor auch als „extrémisme“, da diese die „kommunistische Doktrin“ radikalisieren, aber nicht durch ein neues Denken ersetzen würden. Nach Gombin gehen die Vertreter des „Gauchismus“ nicht davon aus, dass es eine marxistische Theorie gegeben habe, die einfach falsch interpretiert wurde, sondern sie betrachten sowohl die Sozialdemokratie als auch die Kommunistischen Parteien als kapitalistische Institutionen, die dazu beitrügen, das kapitalistische System effizienter zu gestalten und/oder seine Macht besser zu konzentrieren.71
Die PSU als einen zentralen Teil der Neuen Linken verortet er dagegen als sogenannten „Zwitter“ aus soziodemokratischer Programmatik und revolutionär-bolschewistischen Elementen. Die Gruppen der Trotzkisten und Maoisten hätten hingegen die meisten linken alternativen Konzepte wie die Selbstverwaltung oder den „demokratischen Plan“ als nicht revolutionär ergo nicht „links“ genug eingestuft.72
Die Überlegungen von Gombin erscheinen insofern hilfreich, als dass klar die Unterscheidung zwischen den Kritikern der Kommunistischen Parteien unterschieden wird, deren Anliegen es war, die „reine Lehre“ zu retten, und jenen Gruppen, die über die Parteikritik hinausgingen, um ein neues Sozialismuskonzept zu entwerfen, wobei sie sich je nach Entwicklungsstadium mehr oder weniger von marxistischen Begriffen und Grundannahmen inspirieren bzw. anleiten ließen. Wichtig ist zudem, dass es gerade in der Neuen Linken, insbesondere in der zu behandelnden PSU, nicht selten eine Mischung als gauchistisch-revolutionären und sozialdemokratisch-reformistischen Ansätzen gab. Als ideales Beispiel für den von Gombin definierten „Gauchismus“ können die Anfänge der Gruppe „Socialisme ou Barbarie“ gelten, auch wenn diese sich dann immer weiter von der „reinen Lehre“ des Leninismus und Trotzkismus entfernten und sich somit der Neuen Linken annäherten.73
Durch diese Definition der linksradikalen und linksextremen Bewegungen wird eingegrenzt, welche Bewegungen nicht zu der Neuen Linken gehörten und deshalb in der Arbeit nur am Rande behandelt werden, darunter Maoisten, Trotzkisten und anarchistischen Strömungen. Rätekommunisten stehen an der Schnittstelle zwischen radikaler und Neuer Linke, da viele Elemente ihres Denkens in die zentrale „autogestion“-Debatte einflossen.74
Jedoch finden sich weder in der trotzkistischen Bewegung „neue Elemente“ einer kritischen Ideologie75 noch bei Maoisten und Trotzkisten anti-hierarchische Grundstrukturen und eine Betonung auf Selbstverwaltungsstrukturen und somit Ansätze grundsätzlicher Staatskritik. Statt der Suche nach einer Neudefinition der sozialistischen Theorie orientieren sich diese Strömungen an althergebrachten Ideologien und Führern (Leo Trotzki) oder neuen Vorbildern und ideologischen Schablonen (Mao-Tsetung und die rote Mao-Bibel). So kann konstatiert werden, dass Ideologiekritik und undogmatische Sozialismusvorstellungen jenseits eines zentralistisch-leninistischen Weltbildes nicht Teil dieser Bewegungen sind und sich dadurch von der neuen Linke unterscheiden. Sicherlich gab es auch innerhalb der neuen Linken in Organisationen wie der PSU einzelne Minderheiten, die jenen herkömmlichen linken Traditionen nahestanden – vor allem die Trotzkisten –, jedoch blieben deren Ideen der großen Suche nach einer neuen Sozialismusvorstellung untergeordnet.
Als weiteren Terminus für die Neue Linke spricht Ian H. Birchall auch von der „unabhängigen Linken“, die es schonseit den 1930er Jahren gegeben habe76 – angefangen mit der Kritik an der UdSSR (Interesse für Zeitzeugen aus UdSSR wie Victor Kravtshenko oder Victor Serge) und nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung des„Rassemblement démocratique révolutionnaire“ (RDR), in welchem sich Politiker und Intellektuelle aus unterschiedlichen politischen Kontexten zusammenfanden, da sie sich weder der PCF noch der SFIO verpflichtet fühlten. Zur unabhängigen Linken zählten für Birchall vor allem ehemalige Trotzkisten wie Rousset oder Intellektuelle um „Les Temps Modernes“ wie Sartre, Merleau-Ponty oder Lefort. Allerdings weitet Birchall seinen Begriff nicht auf die 1960er Jahre aus und kommt nur sporadisch auf diese Bezeichnung zurück.
In ideengeschichtlicher Hinsicht müssen zudem die philosophischen Ansätze der Intellektuellen der Neuen Linken scharf von anderen „Marxismen“ der 1960er Jahre abgegrenzt werden. Als wichtigster Gegenspieler des sogenannten existentialistischen oder humanistischen Marxismus von Jean-Paul Sartre und Henri Lefebvre muss der Philosoph und Marxist Louis Althusser genannt werden. Der strukturalistische Materialismus Althussers, der sich vor allem auf den „reifen“ Marx des Kapitals bezieht und sich in seinen Schriften „Pour Marx“ 1965 scharf von „humanistischen Marxismus“ abgrenzt,77 ist zwar ebenfalls ein Versuch der Erneuerung des wissenschaftlichen Marxismus, jedoch ein umfassender philosophischer Gegenentwurf zur Neuen Linken. Dabei gibt es bei Althusser und Sartre entscheidende Parallelen wie beispielsweise die Einbeziehung der Psychoanalyse. Grundlegend ist jedoch die Weigerung Althussers,die Frühschriften von Marx als Referenzrahmen für sein Schaffen zu nehmen.78
Als ein weiterer gegensätzlicher Pol zu Louis Althusser kann auchHenri Lefebvre genannt werden. Während ersterer sich auf das Studium von Marx verlegte, um diesen mit strukturalistischen Ansätzen als Wissenschaft sui generis zu etablieren, arbeitete Lefebvre als Philosoph der Neuen Linken die humanistische Seite von Marx auf, um dies als Grundlage für einen erweiterten Marxismus zu nutzen, der auf die „Praxis“ verweisen und somit ein konkretes Instrument für sozialkritische Analysen und Veränderungsprozesse liefern sollte. So beriefen sich Lefebvre wie auch andere Vertreter der Neuen Linken in den 1960er Jahren wie Sartre, Guérin und Castoriadis vor allem auf die Frühschriften von Marx, wohingegen die Schule Althussers auf die Spätschriften wie „Das Kapital“ abstellte:
„Le moment historique [...] voir le brusque passage d’un marxisme humaniste, frondeur, iconoclaste et utopiste à un marxisme qui proclame sa scientificité et en décline les certitudes. Le passage en question est doublement paradoxal, en ce qu’il substitue une figure de Marx à une autre.“79
Zudem wurden von den Theoretikern der Neuen Linken im Gegensatz zum „klassischen Marxismus“ oder zum strukturalistischen Ansatz von Althusser noch andere Denker wie Proudhon in die Theoriebildung miteinbezogen.80 So habe schon Simone Weil, Teil der nach Birchall „unabhängigen Linken“ der 1930er Jahre, im Jahr 1937 darauf hingewiesen, dass die Arbeiterbewegung nur lebendig werden könne, wenn der Marxismus erweitert werde:
„Je ne crois pas que le mouvement ouvrier redevienne dans notre pays quelque chose de vivant tant qu’il ne cherche pas des doctrines, mais une source d’inspiration dans ce que Marx et les marxistes ont combattu et bien follement méprisé : dans Proudhon, dans les groupements ouvriers de 1848, dans la tradition syndicale, dans l’esprit anarchiste.“81
Diese, wie Weil es nannte, „lebendige“ Seite des Sozialismus definierte sich durch eine Offenheit der Theorie, einem Humanismus und ein starkes Demokratiebedürfnis sowie durch die Ablehnung jeglicher autoritärer Organisationsformen.
In den 1970er Jahren kam zu den bereits erwähnten Begrifflichkeiten der politischen Linken noch der Terminus der „zweiten Linken“ (deuxième gauche) hinzu, den Michel Rocard in seiner Rede 1977 auf dem Parteitag der PS in Nantes in die Debatte brachte82 und so die Werte der „unabhängigen Linken“ wiederaufnahm:
„[…] la deuxième gauche, décentralisatrice, régionaliste, héritière de la tradition autogestionnaire, qui prend en compte les démarches participatives des citoyens, en opposition à une première gauche, jacobine, centralisatrice et étatique […] .“83
Diese Definition legt den Akzent noch ein wenig mehr auf den Begriff der „Dezentralisierung“ und „Regionalisierung“ in direkter Opposition zur autoritären „zentralistischen“ Linken. Allerdings wird der Begriff „zweite Linke“ heute fast ausschließlich in Bezug auf die PSU und Michel Rocard verwendet. Während diese „zweite Linke“ durch Michel Rocard – den Mitbegründer der PSU und deren ehemaliger Vorsitzender – personifiziert wird, repräsentiert die „erste Linke“ François Mitterrand. Diese „erste Linke“ war vor Mitterrands Führung der „Parti socialiste“ (PS) vor allem durch das marxistisch-orthodoxe Lager innerhalb der SFIO geprägt. Die „Rocardiens“ rechneten sich zur „zweiten Linken“, um dieser „ersten Linken“ eine Alternative entgegenzusetzen, wie Robert Chapuis in seinem Band über Rocard ausführt.84 Letzterer erklärte später nach dem Kongress in Nantes, dass diese Bezeichnung nicht immer politisch vorteilhaft, aber trotzdem als Abgrenzung wichtig gewesen sei:
„J’ai moi-même – j’ai pensé après que c’était une erreur : […] fait à Nantes, en 1977 au congrès du PS, un discours sur les deux cultures qui a permis à tous nos impuissants adversaires culturels de nous immoler en rase campagne puisque nous leur avions fourni des arguments. Mais justement, nous avions aussi fourni notre propre définition.“85
Jedoch wird der Begriff „zweite Linke“ fast ausschließlich für die Sozialisten verwendet, die Ende der 1950er Jahre aus der SFIO austraten und in den 1970er Jahren wieder in die PS zurückkamen und somit dem politischen Weg von Rocard folgten bzw. seine Anhängerschaft bildeten. Für Rocard ist die klassische, demnach erste Linke, eine „Heirat zwischen Marxismus und Jakobinismus“.86 Diese Sozialisten hätten den Kapitalismus beseitigen wollen, ohne ihn zu studieren – deshalb seien die Sozialisten während der „Front Populaire“ und in der IV. Republik gescheitert.87
Teilweise wird zur „zweiten Linken“ aber auch die Gewerkschaftsbewegung um die CFDT gezählt, wie der Band von Patrick Rotman „La deuxième gauche. Histoire intellectuelle et politique de la CFDT“ nahelegt.88 Die Gewerkschaftsbewegung – insbesondere die CFDT-Gruppe „Reconstruction“ – ist vor allem aufgrund ihrer zentralen Rolle in der Debatte um das Thema „autogestion“ ein wichtiger Akteur dieser „dezentralistischen“ „zweiten Linken“.
Der Sozialist Jean Poperen verwendet statt „zweite Linke“ den Ausdruck „dritten Sektor“. Dies schließt nicht nur die SFIO, sondern vor allem auch die PCF mit in die Definition ein und erklärt die neue Linke als eine Linke zwischen bzw. jenseits der zwei großen linken Parteien:
„Le troisième secteur n’est ni un accident ni une excroissance, il est l’expression politique de réalités sociologiques et idéologiques nouvelles, parfois contradictoires, mais qui ont au moins en commun de ne point se couler dans les moules anciens.“89
Das entscheidende Kriterium für eine Definition der Neuen Linken ist daher in erster Linie die Enttäuschung über die traditionellen Parteien. Denn wie in dieser Arbeit gezeigt wird, hatte die Mehrheit der Akteure eine Parteimitgliedschaft entweder in der SFIO oder der PCF hinter sich – teilweise reichte diese Erfahrung schon in die 1930er Jahre zurück, teilweise lösten sich die Mitglieder erst Ende der 1950er Jahre von ihrer „Mutterpartei“. Das „Neue“ der Neuen Linken bestand also vor allem darin, sich gegen die „alte“, „traditionelle“ oder „erste“ Linke abzugrenzen:
„Nous étions écrasés entre la pensée du PC qui refusait toute étude de la société, qui imposait des dogmes en contradiction flagrante avec la réalité […] et une vague atlantiste, réactionnaire, qui emportait une SFIO en profonde dégénérescence ... Les intellectuels [...] ne pouvant accepter le langage de bois du PC ni les turpitudes des socialistes du droit […] “90
Die „zweite Linke“ war somit ein Teil der Neuen Linken und die nähere Bezeichnung für sozialistische Politiker, die später als Minorität in die PS übergingen und dort teilweise die Konzepte der PSU einbrachten. Was die Bezeichnung „Dritter Weg“ betrifft, kann diese ebenfalls in den Begriff der Neuen Linken integriert werden. Jedoch müsste dieser spezifisch auf bestimmte Konzepte angewendet werden, da die Neue Linke insgesamt zu heterogen zusammengesetzt war und deshalb keine gemeinsamen politischen Programme verfolgte. Ideengeschichtlich hat sich die Neue Linke aus der unabhängigen Linken im Frankreich der 1930er Jahre entwickelt. Gemeinsam ist den unterschiedlichen Akteuren der Neuen Linken der Versuch, neue linke politische Programme zu entwickeln und die marxistische Doktrin zu öffnen und weiterzudenken. Deshalb kann davon gesprochen werden, dass die Neue Linke einen erweiterten, interdisziplinären Marx-Ansatz entwickelte und darüber hinaus frühsozialistische, anarchistische und rätekommunistische Konzepte in die Theoriebildung mit aufnahm. Da es in der Neuen Linken sowohlkonservative als auch linksradikale Strömungen gab, entwickelten sich je nach Orientierung aus diesen neuen marxistischen Ansätzen entweder politische Konzepte, die der Sozialdemokratie nahe standen (Rocard) oder die basisdemokratisch und marxistisch-libertär ausgerichtet waren („Socialisme ou Barbarie“). In der PSU hingegen fanden sich gemäßigte wie revolutionäre Linke wieder. Sie kann daher als eine Art Zentrum oder Kristallisationspunkt der verschiedenen Strömungen der Neuen Linken gesehen werden und steht daher in den folgenden Kapiteln im Vordergrund der Untersuchung.
Notes
1In der Arbeit wird der Begriff „Kommunismus“ vor allem in Zusammenhang mit den Kommunistischen Parteien (KP) Europas und der Sowjetunion verwendet, da dies zur Selbstbezeichnung jener gehörte. Für das politische System der ehemaligen Sowjetunion wird der Begriff des „Realsozialismus“ gebraucht, der zwar zuerst in der DDR in den 1970er Jahren eingeführt, dann aber von westlichen Historikern übernommen wurde. Vgl. Ziemer, Klaus: Real existierender Sozialismus, in: Nohlen, Dieter (Hrg.): Lexikon der Politik, Bd. 7, Berlin 2004, S. 535. Die dem Marxismus nahestehende Bewegungen, Ideen und Konzepte außerhalb der KPs hingegen werden in der Arbeit als „sozialistisch“ und ihr Gesellschaftsideal als „Sozialismus“ bezeichnet.
2Fukuyama, Francis: The end of history and the last man, New York 1992.
3Furth, Peter: Phänomenologie der Enttäuschungen, Ideologiekritik nachtotalitär, Frankfurt am Main 1991, S. 7.
4Diese Abkürzung geht auf Margaret Thatcher zurück und wurde von der globalisierungskritischen Bewegung aufgenommen. Vgl. Ziegler, Jean: Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent, Paris 2002, S. 315.
5Marxistischer Theoretiker, Kritiker des Stalinismus (1886-1961).
6Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich: Karl Marx und die Kritische Philosophie gesellschaftlicher Praxis am Vorabend des 21. Jahrhunderts, in: Eidam, Heinz; Schmied-Kowarzik Wolfdietrich (Hrg.): Kritische Philosophie gesellschaftlicher Praxis - Auseinandersetzungen mit der Marxschen Theorie nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus, Würzburg 1995, S. 34.
7Vgl. Teodori, Massimo (Hrg.): The new left. A documentary history, London 1969. Teodori beschreibt die Linke in den USA in den 1950er Jahren als zunächst durch die Konfrontation mit der UdSSR paralysiert, weshalb sich erst im Zuge der 1960er Jahre langsam verschiedene soziale Bewegungen herausbildeten. Vgl. ebenda, S. 6.
8Schmidke, Michael: Der Aufbruch der jungen Intelligenz. Die 68er Jahre in der Bundesrepublik und in den USA, Frankfurt am Main 2003, S. 34.
9Wobei diese Bewegungen beispielsweise in Italien erst nach 1969 an Größe und Bedeutung gewannen. Einen guten Überblick zu diesem Thema bietet Baumgarten, Jürgen: Linkssozialisten in Europa. Alternativen zu Sozialdemokratie und Kommunistischen Parteien, Hamburg 1982. Zur italienischen Bewegung „il manifesto“ siehe ebenda, S. 1.
10Vgl. Kapitel 1.3 Forschungsstand und Quellen.
11Neueste Publikationen zum Jahrestag 2008 unter anderem Dammame, Dominique; Gobille, Boris; Matonti, Frédérique; Pudal, Bernard: Mai - juin 1968, Paris, 2008; Loyer, Emmanuelle: Mai 68 dans le texte, Paris, 2008; Lindenberg, Daniel: Choses vues – Une éducation politique autour de 68, Paris 2008; Cespedes, Vincent: Mai 68, La philosophie est dans la rue !, Paris 2008.
12Wie in1.3 gezeigt wird, existieren in Frankreich jedoch umfangreiche Darstellungen zu Teilen derParteigeschichte sowie ihrer politischen Verortung und Organisation. Jedoch wurden die Mehrzahl der Darstellungen bis zur Veröffentlichung dieser Arbeit vor allem von Zeitzeugen und ehemaligen Aktivisten verfasst.
13Broschetti, Anna: Sozialwissenschaft, Soziologie der Intellektuellen und Engagement, in: Gilcher-Holtey, Ingrid (Hrg.): Zwischen den Fronten: Positionskämpfe europäischer Intellektueller im 20. Jahrhundert, Berlin 2006, S. 202-203.
14Touraine, Alain: Le mouvement de mai ou le communisme utopique, Paris 1998, S. 7. Dies betonten auch Jean-Claude Gillet und Jean-François Kesler im Interview mit der Autorin.
15Gilcher-Holtey, Ingrid: Phantasie an die Macht, Frankfurt am Main 1995, S. 96.
16Ebenda.
17Ebenda, S. 100. Gilcher-Holtey bezeichnet den RDR als ersten Versuch einer „dritten Kraft“, die auf der Suche nach einem „Dritten Weg“ zwischen den Blöcken gewesen sei. Jedoch greift sie den Begriff für die Neue Linke insgesamt nicht mehr auf. Weitere Ausführungen zum Begriff „Dritter Weg“ in Kapitel 1.3. Forschungsstand und Quellen.
18Landwehr, Achim: Geschichte des Sagbaren. Einführung in die historische Diskursanalyse, Tübingen 2001, S. 71.
19Ebenda, S. 72.
20Ebenda, S. 81.
21Ebenda, S. 103.
22Vgl. ebenda, S. 108-109.
23Castagnez, Noëlline; Jalabert, Laurent; Lazar, Marc/Morin, Gilles; Sirinelli, Jean-François (Hrg.): Le parti socialiste unifié. Histoire et postérité, Rennes 2013; Sauvageot, Jacques (Hrg.): Le PSU : des idées pour un socialisme du XXIe siècle ?, Rennes, 2013; Gillet, Jean-Claude/Michel Mousel (Hrg.): Parti et mouvement social : le chantier ouvert par le PSU, Paris 2011; Kernalegenn, Tudi; Prigent, François/Richard, Gilles; Sainclivier, Jacqueline (Hrg.): Le PSU vu d’en bas. Réseaux sociaux, mouvement politique, laboratoire d’idées (années 1950-années 1980), Rennes 2010; Barralis, Roger; Gillet, Jean-Claude (Hrg.): Au cœur des luttes des années soixante. Les étudiants du PSU, Paris 2010.
24L’Institut d'études politiques de Paris.
25Le parti socialiste unifié. Histoire et postérité, Rennes 2013.
26Das gilt vor allem für die Bände, die von Jean-Claude Gillet, Roger Barralis und Jacques Sauvageaot herausgegeben wurden.
27Souvenir d’un militant : de la sociale-démocratie au socialisme, un demi-siècle de lutte 1918-1968, Paris 1972.
28Le PSU et l’avenir socialiste de la France, Paris, 1969; PSU, Des militants du PSU, Paris 1971.
29La gauche française: le nouvel âge 1958-1965, Paris 1972; L’unité de la gauche 1965-1973, Paris 1975.
30Cassandre et les tueurs, Paris 1986.
31Paris-Montpellier: PCF-PSU, 1945-1963, Paris 1982.
32Archives d’espoir : 20 ans de PSU, 1960-1980.
33Le PSU avant Rocard, Paris 1973; Un Parti de la Gauche, le PSU, Paris 1966.
34„Sociologie des adhérents du PSU“, 1969.
35Histoire du P.S.U., La fondation et la guerre d’Algérie, 1958-62, Paris 1994.
36De la Gauche dissidente au nouveau Parti socialiste : les minorités qui ont rénové le Parti socialiste, Toulouse 1990.
37Le PSU et la Gauche (1960-1968), Université Paris 1, 1993.
38Morin, Gilles: De l’opposition socialiste à la guerre d’Algérie au PSA (1954-1960). Un courant socialiste de la SFIO au PSU, Thèse, Paris 1 Sorbonne 1990-1991.
39U. a. Le PSU s’affiche, Cahier de l’ITS, Paris 2013.
40Socialisme ou barbarie: un engagement politique et intellectuel dans la France de l’après-guerre, Lausanne 1997.
41Vgl. Kapitel 1.2 Methodische Überlegungen und 1.3 Forschungsstand und Quellen.
42Gilcher-Holtey, Ingrid: Zwischen den Fronten: Positionskämpfe europäischer Intellektueller im 20. Jahrhundert, Berlin 2006; Gilcher-Holtey, Ingrid: „Die Phantasie an die Macht“. Mai 1968 in Frankreich, Frankfurt am Main 1995.
43Kroll, Thomas: Kommunistische Intellektuelle in Westeuropa: Frankreich, Österreich, Italien und Großbritannien im Vergleich (1945-1956), Köln 2007.
44Kalter, Christoph: Die Entdeckung der Dritten Welt, Dekolonialisierung und neue radikale Linke in Frankreich, Frankfurt am Main 2012, S. 347 ff.
45Kergoat, Jacques: Die Parti Socialiste Unifié (PSU) in Frankreich, in: Baumgarten: Linkssozialisten in Europa, S. 107.
46Vgl. Giddens, Anthony: The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Cambridge 1999.
47Ehemalige deutsche Partei. Wurde 2004 gegründet und vereinigte sich 2007 mit der PDS zu der Partei „Die Linke“, die in den Medien oft als „Neue Linke“ bezeichnet wird. Vgl. Vollmer, Andreas: Arbeit & soziale Gerechtigkeit – die Wahlalternative (WASG): Entstehung, Geschichte und Bilanz, Baden-Baden 2013.
48“That’s why we’ve got to study these new generations of intellectuals around the world as real live agencies of historic change. Forget Victorian Marxism, except whenever you need it; and read Lenin again (be careful) — Rosa Luxemburg, too.“, in: Wright Mills, Charles: Letter to the New Left, in: New Left Review (Nr. 5/1960), S. 18-23.
49Gilcher-Holtey, Ingrid: Phantasie an die Macht, Frankfurt am Main 1995, S. 96.
50Das betont u. a. Jean-Claude Gillet, Jean-François Kesler, Michel Rocard. Interview der Autorin mit Gillet und Kesler in Paris, 14.1.2014; 29.6.2013, 4.9.2013. Gilcher-Holtey betont auch die theoretischen Parallelen zwischen der Neuen Linken in Frankreich, Groß Britannien, den USA und Deutschland. Vgl. Gilcher-Holtey, Ingrid: La contribution des intellectuels de la Nouvelle Gauche à la définition du sens de Mai 68, in: Dreyfus-Armand, Geneviève; Frank, Robert; Lévy, Marie-Françoise; Zancarini-Fournel, Michelle (Hrg.), Les Années 68. Le temps de la contestation, Paris/Brüssel 2000, S. 89.
51Vgl. Baumgarten: Linkssozialisten in Europa, S. VII (Vorwort); Jünke, Christoph (Hrg.): Linkssozialismus in Deutschland. Jenseits von Sozialdemokratie und Kommunismus?, Hamburg 2010.
52Baumgarten: Linkssozialisten in Europa, S. VII, VIII.
53Jünke: Linkssozialismus in Deutschland, S. 9.
54Ebenda, S. 13.
55Gabler, Andrea: Arbeitserfahrung und revolutionäre Politik: Socialisme ou Barbarie, in: ebenda, S. 139.
56Vorländer, Hans: Dritter Weg und Kommunitarismus, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (Nr. 16-17/2001), S. 16.
57Ebenda.
58Sturm, Roland: Der Dritte Weg – Königsweg zwischen allen Ideologien oder selbst unter Ideologieverdacht?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (Nr. 16-17/2001), S. 3.
59Ebenda.
60Ebenda.
61