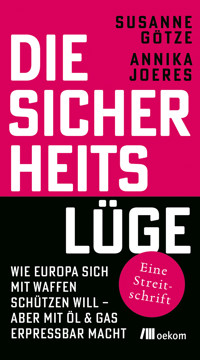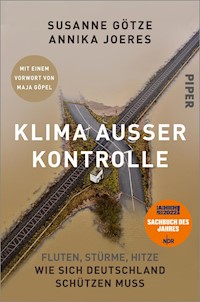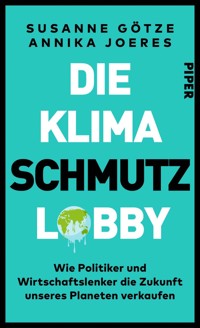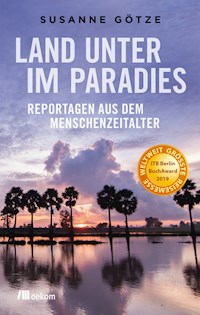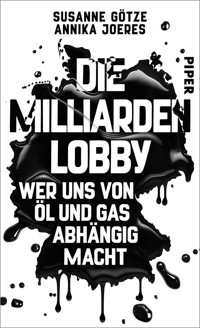
21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die mächtigen Gegner einer lebenswerten Zukunft Deutschland ist abhängig vom Öl und Gas autoritärer Regime – sonst blieben viele Heizungen im Winter kalt, Autos ständen still und so manches Produkt wäre nicht verfügbar. Die Importe fossiler Brennstoffe befeuern jedoch nicht nur die Klimakrise – sie drängen Deutschland auch zu Verträgen mit diktatorischen Staaten und damit in eine gefährliche Abhängigkeit. Susanne Götze und Annika Joeres decken auf, wer hinter diesen schmutzigen Deals steckt, wer alternative Energiekonzepte aus reiner Profitgier bekämpft und so wissentlich unseren Wohlstand gefährdet und unsere Sicherheit aufs Spiel setzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: stock.adobe.com und Shutterstock.com
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen ohne Alternativtexte:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Einleitung
Teil 1 Die Bremser
Das Gebäudeenergiegesetz und die Heizungslobby
Eine Wärmepumpe im kalten Harz
Warum die deutsche Politik eine Heizungswende verschlief
Lobbyangriff auf die GEG-Reform
Die Medienkampagne gegen das Heizungsgesetz
Zukunft Gas und die folgsamen Stadtwerke
Viessmann & Co: Die Rolle der Heizungslobby
Politische Folgen des Wärmedesasters
Wie Klimaziele und fossile Importe zusammenhängen
Das Verbrenner-Aus und die Autolobby
Zu Gast in Nizza
Das Verbrennerauto – das importabhängigste Produkt von allen
Ohne Mineralölimporte stehen Verbrennerautos still
Weltweite Infrastruktur für heimischen Verkehr
Wie jede Tankfüllung vom internationalen Ölmarkt abhängt
Die Lobbyisten für Verbrennerautos
Die Lobbyschlacht in Brüssel
Wer kümmert sich um die Zulieferer?
Die Lobbyisten für E-Fuels
Der Lobbyplayer: Die eFuel-Alliance
Die Anti-Elektroauto-Lobby: Mehr Straßen, Tunnel und Parkhäuser
So viel unabhängiger fahren E-Autos
Eine kulturelle Bremse: heiß geliebte Autos
Dünger, Dieseltraktoren und die Landwirtschaftslobby
Warum Brötchen Erdgas benötigen
Deutschlands Abhängigkeit
Warum der Weizenpreis am Ölpreis hängt
Dünger – die importierte Fruchtbarkeit
Die Nutznießer des Düngerbooms
Landmaschinen sind Dieselschlucker
Der wirksamste Schritt: Fleischkonsum senken
Die Nord-Stream-Pipelines und die Gaslobby
In die Röhre geschaut
Brüssel warnte die Deutschen – vergeblich
Warum Gas viele Menschen reich macht
Deutsch-russische Gasfreundschaft
Lancierte Studien, um Nord Stream zu bewerben
Das überhastete Stopfen des Gas-Lochs
Panikwochen im Bundeswirtschaftsministerium
Die Chance der Krise wurde verspielt
Angst vor Sabotage an Pipelines
Neue Abhängigkeiten: Deutsches LNG-Lobbying
LNG-Terminals: Stranded Assets?
Historische Chance der LNG-Lobby
Mehr Gas und mehr Sicherheitsrisiken als je zuvor
Unsichere Lieferungen aus dem Nahen Osten
Milliardär und Krisenprofiteur: Der griechische Tankerkönig
LNG – ein Gas mit fataler Wirkung auf den Klimawandel
Der Fluch des Schiefergases
Teil 2 Die Gedankenmanipulierer
Rechtspopulisten – fossiler Autoritarismus
Propaganda und Mythen
Die AfD und die Klimawandelleugner
USA: Organisation des Rollbacks der politischen Rechten
Wie die Trumpisten das fossile Rollback in die EU tragen
Die autoritäre Stabilisierung der »imperialen Lebensweise«
Die unpatriotische Liebe der AfD zu russischem Gas
Thinktanks – »Ohne Öl und Gas geht es nicht, weil …«
Der Einfluss von Denkfabriken und Verbänden
Zu Gast bei den Marktradikalen
Der Bundeskanzler in der Höhle des Löwen
Klimaschutz als neuer Gegner der Marktliberalen
Selbst das Bundesverfassungsgericht wird angegriffen
Marktradikale in den USA: Jahrzehntelange Kampagnen
Wie marktradikale Netzwerke Klimaaktivistinnen und -aktivisten angreifen
Erste Risse im Atlas-Network-Universum
Von deutsch-russischen Verbänden bis zur deutsch-arabischen Ghorfa
Die Aserbaidschan-Connection: Wie in einem James-Bond-Film
Die Klimaschutzbremser und das Öl
Wissenschaft – gekaufte Studien
Probate Lobbywerkzeuge
Auftragsstudien: Legal und alltäglich
Die Universitäten nehmen das Geld – und schweigen
Die Präsenz marktradikaler Lobbyisten in den Medien
Einflussreiche Männerzirkel
Teil 3 Die Scheinlösung
Falsche Wasserstoff-Versprechen – Neue Abhängigkeiten
Wasserstoffheizungen und ihre Krux
Wasserstoff: Die große Unbekannte der deutschen Energiewende
Wasserstoffimporte: Neue Abhängigkeiten oder machen es die Energiewendeplayer besser?
Die Leipziger Wasserstoff-ready-Turbine: Viel PR um nichts?
Teuer und knapp: Wie abhängig lassen wir uns machen?
Flexible Kraftwerke: Wie viel Wasserstoff ist nötig?
Alte Lobbys in neuem Gewand
Der Nationale Wasserstoffrat – ein einseitiges Gremium
Der Lobby-Fall: Veronika Grimm
Die Brüsseler Wasserstoffhysterie
Drehtüreffekte in der EU-Kommission
Ausblick
Fünf Schritte zur Unabhängigkeit
Heizen mit erneuerbarer Energie
So kann Deutschland unabhängiger werden
Das muss die Politik lösen
Das kann jeder Einzelne tun
Neue Abhängigkeiten verhindern
Mobil sein ohne Öl
So kann Deutschland unabhängiger werden
Das muss die Politik lösen
Das kann jeder Einzelne tun
Neue Abhängigkeiten verhindern
So geht Landwirtschaft ohne fossilen Dünger, Öl und Gas
So kann Deutschland unabhängiger werden
Das muss die Politik lösen
Das kann jeder Einzelne tun
Neue Abhängigkeiten verhindern
Ökostrom statt Erdgas und Kohle
So kann Deutschland unabhängiger werden
Das muss die Politik lösen
Das kann jeder Einzelne tun
Neue Abhängigkeiten verhindern
Industriestandort ja – aber autark
So kann Deutschland unabhängiger werden
Das muss die Politik lösen
Neue Abhängigkeiten verhindern
Dank
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Einleitung
Gefangen in der Abhängigkeit: Die Milliarden-Lobby und ihre Helfershelfer
Deutschland geht täglich ein riskantes Spiel ein, um seinen Energiebedarf aus dem Ausland zu decken. Pipelines für Öl und Gas, Häfen und Förderplattformen können zum Ziel von Sabotageakten werden; einst zuverlässige Gaslieferanten wie Russland fallen weg, die USA erpressen ihre früheren Verbündeten mit fragwürdigen Deals. Unsere hohe Abhängigkeit ist ein Sicherheitsrisiko.
Dieses Buch deckt auf, welche Lobbyisten und Politiker sich weiterhin für teure und risikobehaftete Öl- und Gasimporte einsetzen – und damit die stabile Versorgung mit Strom, Waren und Wärme gefährden.
Um Europas Energiehunger zu stillen, verlaufen etwa vor der Küste Norwegens fast 9.000 Kilometer lange Pipelines, teils in vergleichsweise flachen Gewässern. Zwei Unterwasserleitungen führen von Norwegen zur deutschen Küste und decken fast die Hälfte des deutschen Gaskonsums. Militärexperten warnen, dass solche Pipelines ein leichtes Ziel für Gegner Europas sind. Ihr Ausfall wäre für Deutschland eine ähnliche Katastrophe wie der Eklat der Nord-Stream-Leitungen im Jahr 2022. Dieser löste eine der verheerendsten Energiekrisen des Landes aus.
Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine deckt Deutschland zudem seinen Gasverbrauch mit Flüssiggas, zumeist aus den USA. Doch auch diese Alternative ist nicht sicher. Ein Flüssiggastanker benötigt Wochen, um den Atlantik zu überqueren. Diese Schiffe wirken wie schwimmende Hochhäuser: Sie ragen bis zu 60 Meter in die Höhe, was dreimal so hoch ist wie ein Berliner Mietshaus, und sind 300 Meter lang, was der Höhe des Eiffelturms entspricht. 2022 tankte die »Flex Vigilant«, ein unter der Flagge der Marshallinseln fahrender Tanker, in Louisiana am Sabine Pass etwa 170.000 Kubikmeter Flüssiggas.[1] Ursprünglich sollte die Ladung nach China gehen. Doch auf hoher See änderte der Betreiber den Kurs: Europa bot höhere Preise. Putin hatte monatelang die Gaslieferungen durch die Nord-Stream-Pipelines gedrosselt und schließlich gestoppt. Und die EU-Mitgliedsstaaten brauchten dringend Nachschub.
Tanker, deren Inhalte am Spotmarkt der Börse gehandelt werden, können spontan ihre Route ändern, wenn ein anderer Händler plötzlich bereit ist, mehr zu bezahlen.[2] So geschah es auch zu Beginn der Energiekrise im Jahr 2022. Damals schossen die Preise pro gehandelter Megawattstunde nach Russlands Angriff auf die Ukraine in die Höhe. So verzehnfachte sich der Gaspreis im Großhandel.[3] Die Tanker steuern dorthin, wo sie die höchste Marge erzielen. Viele Haushalte, die mit Gas heizten, mussten für warme Wohnzimmer mehr Geld auf den Tisch legen.
Dann griff der Staat ein und steckte 30 Milliarden Euro Steuergelder in die Energiepreisbremse, um Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Das war zweieinhalbmal so viel wie die jährlichen Förderbeträge für erneuerbare Energien betragen, rund achtmal so viel wie die Investitionen in den Schienenausbau oder die Summen für die Generierung von grünem Wasserstoff im Jahr 2023.[4] Mit diesen Milliarden hätte man die Deutsche Bahn modernisieren oder die Energiewende voranbringen können.
Doch ohne diese Hilfen, das wusste auch die Ampelregierung, wären Massenproteste ausgebrochen. Denn viele Bürgerinnen und Bürger hatten nicht die Wahl, auf Gas zu verzichten. Sie wurden über Jahrzehnte vom fossilen Energiesystem abhängig gemacht. Diese Krise hat gezeigt, wie tief Deutschland hierin feststeckt – und dass der Staat im Ernstfall alles tun muss, um das System notdürftig zu kitten.
Dabei bot der Krisenmoment 2022 eigentlich eine Chance, diese Abhängigkeit endlich zu durchbrechen. Nach dem Beginn des Ukrainekriegs stiegen die Aktien der erneuerbaren Energien, weil Anleger massive Investitionen der Politik erwarteten.[5] Doch die Regierung kümmerte sich vor allem um neue Gaslieferanten. Der erwartete »massive« Ausbau von Wind- und Solarenergie blieb aus, auch wenn die erneuerbaren Energien unter der Ampelregierung stark im Fokus standen. Der Markt hatte offenbar mit größeren Anstrengungen gerechnet. Bereits Monate später konnten Konzerne, die mit fossilen Rohstoffen ihr Geld verdienen, Milliardenprofite verzeichnen und sie investierten danach sogar weniger und nicht mehr in ihre erneuerbaren Sparten.
Die Energiekrise von 2022 erinnert an die Ölkrise der Siebzigerjahre. Damals schossen die Ölpreise ebenfalls binnen Wochen auf Rekordhöhen. Seitdem hat sich strukturell wenig geändert: Westliche Industrieländer brauchen dringend und ununterbrochen Öl und Gas – ohne sie bricht das System zusammen. Fachleute bezweifeln, dass die Krise von 2022 ein Ausreißer war. Sie hat vielmehr den macht- und geopolitischen Kern der fossilen Energiegeschäfte entblößt. Sicherheit gab es nicht – das wollen wir in diesem Buch verdeutlichen.
Deutschland ist verwundbar
Ereignisse wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine, Konflikte im Nahen Osten oder Donald Trumps jüngster Wahlsieg zeigen Deutschlands Verwundbarkeit. Dieses Buch enthüllt eine oft verdrängte Wahrheit: unsere gefährliche Abhängigkeit von Staaten, Lieferanten und Weltmarktpreisen. Und es zeigt auf, welche Akteure an Öl und Gas trotz guter Alternativen festhalten wollen. Sie treiben uns damit in eine unsichere Zukunft, in der viele gewohnte Annehmlichkeiten wie Heizen mit Gas oder Autofahren mit Benzin zum Sicherheits- und Wohlstandsrisiko werden.
In unserem Buch Die Klimaschmutzlobby (2020)[6] haben wir Politiker und Wirtschaftslenker benannt, die fortschrittliche Gesetze bremsen und blockieren und damit die Klimakrise verschärfen. Einige dieser Protagonisten spielen auch hier in diesem Buch eine wichtige Rolle: Eine Politik, die auf ein »Weiter-so« setzt und keine ehrgeizige Klimapolitik betreibt, macht zugleich abhängig von Importen, sei es Erdgas, Mineralöl oder Steinkohle. Fünf Jahre nach unserem ersten Buch zur Anti-Klimaschutz-Lobby blicken wir auf eine immer unsicherer werdende Welt: der Russlandkrieg, Huthi-Milizen, die Schiffe im Nahen Osten angreifen, und ein amerikanischer Präsident, der den Welthandel mit Zöllen ausbremsen könnte. Angriffe auf die kritische Infrastruktur nehmen zu, wie der Fall der beschädigten Unterwasserstromleitung in der Ostsee Ende 2024 zeigt. Ein Tanker der russischen Schattenflotte schleifte mutmaßlich absichtlich seinen Anker kilometerweit über den Meeresboden.[7] Das wirkt vergleichsweise harmlos, wenn man bedenkt, was passiert, wenn Gaspipelines betroffen sind. Eine solche verläuft von Norwegen durch die Nordsee und liefert 40 Prozent des deutschen Erdgases. Wäre diese Leitung beschädigt, träfe das Deutschland ähnlich hart wie 2022.
Das zeigt: Eine Energiepolitik, die durch fossile Brennstoffe auf Importe angewiesen ist, nährt unsere Abhängigkeit von anderen, teils autokratischen Ländern und ihren Öl- und Gasvorräten. Das macht uns politisch verwundbar und birgt das Risiko von Preisausschlägen, die der Staat dann mit Steuergeldern abfedern muss.
Das alte System rund um fossile Rohstoffe führt nicht nur zu tödlichen Überschwemmungen und tropisch heißen Nächten, sondern auch zur geopolitischen Abhängigkeit von Staaten und Ereignissen, auf die wir keinen Einfluss haben – oder kurz gesagt: Es macht uns erpressbar.
Unser Alltag hängt am Öl- und Gastropf
Je stärker unser Alltag in Deutschland am Tropf von Importen hängt, umso erpressbarer sind wir. Sollten einmal die Erdgastanker europäische Häfen meiden, Öltanker blockiert oder Pipelines sabotiert werden, schießen die Preise innerhalb von Tagen auf Rekordhöhen und Speicher leeren sich. Dann müssen Haushalte ihre Heizungen drosseln, Lebensmittel und energieintensive Produkte verteuern sich. Ohne Dünger, der mit enormen Mengen Erdgas hergestellt wird, brechen Ernten ein und so existenzielle Dinge wie Brot werden teuer. Wer Benziner fährt, muss bei jeder Fahrt überlegen, ob sie wirklich notwendig ist, wenn die Preise steigen. Regale mit Lebensmitteln und Textilien, solche in Baumärkten und Tabakläden leeren sich, wenn die Transportkosten in die Höhe schießen. Treibstoffengpässe und Schlangen vor Tankstellen kennen wir eher aus Entwicklungsländern, im sogenannten Westen ist es zwar unwahrscheinlich, dass Importe über Nacht ausbleiben, doch Versorgungslücken und rasante Preissteigerungen bleiben reale Risiken. Selbst bei scheinbar verlässlichen Partnern wie den USA kann ein Regierungswechsel alles umwerfen und langjährige Partnerschaften binnen weniger Monate beenden. Der Wahlsieg von Donald Trump belegt das: Die »America-first«-Politik des Populisten könnte langfristig die Lieferung von Flüssiggas nach Deutschland gefährden oder verteuern. Schon kurz vor seiner Amtseinführung drohte Donald Trump der Europäischen Union mit Zöllen, falls sie nicht mehr amerikanisches Öl und Gas abnimmt.[8] Die EU müsse das enorme US-Defizit im bilateralen Handel »durch den groß angelegten Kauf unseres Öls und Gases ausgleichen«, so Trump bereits im Dezember 2024 (siehe Kapitel »Rechtspopulisten – fossiler Autoritarismus«).
Auch die Erfolge der FPÖ in Österreich, die Marine Le Pens in Frankreich und die der AfD in Deutschland destabilisieren den Welthandel. Sie alle streben eine Rückkehr zu nationalen Grenzen und Zöllen an. Paradoxerweise fördern gerade diese Nationalisten Öl, Gas und Kohle, obwohl man diese Rohstoffe weltweit beschaffen muss. Auch für die Kernkraft muss Uran importiert werden. Diese vermeintlich patriotischen Politikerinnen und Politiker erhöhen somit die Abhängigkeit ihrer Landsleute vom Ausland.
Profiteure dieser kurzsichtigen Politik sind Öl- und Gaskonzerne sowie alle Glieder der fossilen Lieferkette, die wir in diesem Buch genau benennen. Die Leidtragenden sind letztlich die Bürgerinnen und Bürger: Sie zahlen bei Schwankungen auf dem Weltmarkt hohe Preise, während ihre Regierungen Steuergelder einsetzen, um Krisen rund um fossile Energien abzufedern, oder mit autoritären Staaten kooperieren, um den Energiehunger zu stillen.
Auch die Internationale Energieagentur (IEA) sieht in ihrem aktuellen Ausblick die weltweite Energiesicherheit nach wie vor als bedroht an. Das Risiko neuer Verwerfungen sei »sehr hoch«.[9] Einst wurde die IEA gegründet, um die Ölkrise 1973/74 zu meistern, über viele Jahrzehnte setzte sie auf fossile und nukleare Energie. Heute aber betont sie: Nur mit erneuerbaren Energien könnte die künftige Versorgung gesichert werden.
Die neue Regierung
Eine Partei, die sich lange gegen Wind- und Solarkraft sträubte, regiert heute in Berlin: die CDU.
Mit Friedrich Merz ist ein überzeugter Marktliberaler zum Kanzler gewählt. Um ihn scharen sich Mitstreiter wie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der faktenfrei behauptet, Solar- und Windkraft führten zur Deindustrialisierung Deutschlands und trieben Unternehmen ins Ausland.[10] Zu Merz’ engstem Kreis zählen auch dezidierte Gegner der Energiewende, etwa die von der Metallindustrie finanzierte Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) (siehe Kapitel »Thinktanks – ›Ohne Öl und Gas geht es nicht, weil …‹«).
Posten von Friedrich Merz vor seiner Zeit als Bundeskanzler
Merz wird nun mit den Sozialdemokraten regieren.[11] In dieser Großen Koalition besetzen Personen Schlüsselpositionen, die bislang nicht für fortschrittliche Energiepolitik stehen. Sie halten mehrheitlich an Erdgas zum Heizen und Erdöl zum Autofahren fest – oder glauben daran, dass ein zukünftiger CO2-Preis diesen Konsum von selbst reduzieren könnte. Kaum ein Mitglied dieses schwarz-roten Bündnisses hat sich in den letzten Jahren dafür eingesetzt, Deutschland unabhängiger von fossilen Importen zu machen, Nahrungsmittel ohne große Gasimporte zu sichern oder mit weniger Energie auszukommen. Die Gefahr besteht: Mit dieser Regierung gehen weiterhin Milliarden Dollar an Erdgasmultis in den USA unter Donald Trump und an andere teils autoritäre Lieferländer wie Russland oder Aserbaidschan. Dabei erklärte Merz noch am Wahlabend, es sei seine absolute Priorität, »dass wir Schritt für Schritt Unabhängigkeit erreichen von den USA«.[12] Er zielte dabei aber auf eine militärische Unabhängigkeit, nicht auf Energieimporte. Bei der derzeit steigenden Abhängigkeit vom amerikanischen Flüssiggas könnte diese schwierig werden – vor allem, weil Donald Trump bereits drohte, die Europäer seien verpflichtet, mehr davon abzunehmen. Energie-Abhängigkeit – das zeigen alle politischen Entwicklungen – ist zu einer gefährlichen Wette auf stabile politische Verhältnisse geworden.
Konservative Parteien hadern traditionell mit dem Abschied von alten Technologien wie der Atomkraft und von fossilen Kraftstoffen. Doch synthetische Kraftstoffe und neue AKWs sind schlicht zu teuer. Das bestätigen inzwischen sogar frühere Betreiber von Kernkraftwerken. Auch in anderen Bereichen klammert sich die CDU an importierte fossile Energien: Sie will das europaweite Verkaufsverbot für neue Verbrenner ab 2035 (siehe Kapitel »Das Verbrenner-Aus und die Autolobby«) kippen und das Gebäudeenergiegesetz (GEG), auch als »Heizungsgesetz« bekannt, zurückdrehen (siehe Kapitel »Das Gebäudeenergiegesetz und die Heizungslobby«). Wir zeigen auf, welche Lobbyverbände und Denkfabriken diese Ankündigungen der CDU vorangetrieben haben – mit dem Risiko, Deutschlands Haushalte sowie die Autofahrerinnen und Autofahrer weiter von Gas- und Ölimporten abhängig zu machen.
Auch die aktuelle SPD-Spitze zeigt wenig Interesse an Klimaschutz und erneuerbaren Energien. Fraktionschef Lars Klingbeil gilt vielen in der SPD-Gruppe Klimagerechtigkeit eher als Bremser von Klimaschutz. In Niedersachsen befürwortete er den sechsspurigen Ausbau der Autobahn 7 und lehnte eine neue Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover ab. Und niemand der Genossen und Genossinnen hat eine fortschrittliche, unabhängig machende Energiepolitik, etwa eine Beibehaltung des Heizungsgesetzes, zur Bedingung für eine gemeinsame Regierung gemacht. So läuft Deutschland Gefahr, unter Schwarz-Rot auf den bisherigen Mengen an Importen von Öl und Gas zu verharren.
Die Profiteure der milliardenschweren Importe
Das besiegelte Ende der Kohleindustrie, verbunden mit dem Förderungsstopp bis 2030 im rheinischen Braunkohlegebiet und bis 2038 in der Lausitz, erweckt den Eindruck, Deutschland verabschiede sich vom fossilen Zeitalter. Doch noch immer werden knapp 80 Prozent unserer Energie mit Öl, Steinkohle, Braunkohle und Erdgas gedeckt.[13] Abgesehen von Braunkohle müssen all diese Rohstoffe importiert werden – auch aus diktatorisch regierten und autokratischen Ländern. Auch wenn Handelspartner auf den ersten Blick zuverlässig wirken, so zeigen unsere Recherchen: Jedes Barrel Öl für Tankstellen und jeder Kubikmeter Gas für Heizungen durchläuft den globalen Handel – und stärkt am Ende auch Autokratien.
Beispiel Gas: Zunächst fördern und handeln internationale Konzerne wie ExxonMobil, Shell, Wintershall Dea oder BP den Rohstoff. In Deutschland übernehmen ihn dann Händler, wie das Gazprom-Nachfolgeunternehmen SEFE und Uniper, gefolgt von Netzbetreibern wie Open Grid Europe, E.ON oder zahlreichen Stadtwerken, die das Gas zu Industrie und Haushalten bringen. Öl legt einen ähnlich langen Weg zurück – von den Förderländern über Mineralölhändler zu Tankstellen. Jede Krise am anderen Ende der Welt könnte die Preise in Deutschland sofort in die Höhe treiben.
Wir haben die Milliarden-Lobbys und die Liefer- und Abhängigkeitsketten für alle Bereiche unserer Gesellschaft recherchiert: Hinsichtlich Heizen, Verkehr, Ernährung – und hinsichtlich der generellen Gasversorgung, die Industrie und Privathaushalte gleichermaßen dringend brauchen. Eine vergleichsweise neue, aber ebenso umstrittene Energiequelle ist grüner oder blauer Wasserstoff. Dabei zeigte sich überall: Bevor diese Energien deutsche Heizungen, Fabrikhallen oder Autotanks erreichen, gehen sie durch unzählige Hände von Händlern und Profiteuren rund um den Globus.
Aktuelle Studien zeigen, dass die Krisen der letzten Jahre vor allem den ohnehin Wohlhabenden und Privilegierten genutzt haben: Das vermögendste ein Prozent der US-Bevölkerung kassierte über die Hälfte der Gewinne von Öl- und Gaskonzernen. Oder in weiteren Zahlen: Zehn Prozent strichen 84 Prozent der Gewinne ein. Die fossilen Profite verschärften zudem andere Ungleichheiten: Weiße profitierten deutlich stärker als Schwarze. [14]
Auch die deutschen Kohle, Gas- und Stromkonzerne wie E.ON, EnBW und die schließlich verstaatlichte Uniper zählen seit Jahrzehnten zu den profitabelsten deutschen Konzernen.[15] Während Familien mit Gasheizungen und alten Autos um Wärme und Mobilität bangen, boomt die fossile Industrie: 2023 erzielten die fünf größten Öl- und Gaskonzerne der Welt einen Rekordgewinn von 128 Milliarden Dollar, investierten aber nur vier Prozent ihres Budgets in erneuerbare Energien. Ironischerweise machte gerade die grüne Branche in den Krisenjahren weniger Profite.[16]
Und wo viel Geld fließt, sind auch viele professionelle Lobbyisten aktiv. Wie bereits in Die Klimaschmutzlobby decken wir auch in diesem Buch die verborgenen Akteure mächtiger Industrien auf und nennen sie beim Namen. Diese sind auch in wissenschaftlichen Instituten, in Beraterkreisen von Regierungen, in Stadtwerken und im Kanzleramt aktiv.
Sie sorgen dafür, dass ihre Rekordgewinne auch künftig weiterfließen. Ihre PR-Strategen haben es geschafft, Erdgas und Öl als sichere Energiequellen zu labeln. Selbst die Gaskrise von 2022 war diesem Image kaum abträglich. Die hohen Energiepreise belasten aber nun schon seit Jahren produzierende Gewerbe und Menschen mit niedrigem Einkommen, die sich Brot, Benzin und Wasserboiler immer weniger leisten können: Heute leben rund 100 Millionen Menschen in Europa in Armut.[17] Von unseren gas- und ölabhängigen Gesellschaften profitiert in allen Ländern nur eine kleine Minderheit: die Milliarden-Lobby.
Heimische Energiequellen mindern Krisen
Auch die EU erkennt inzwischen an, dass dieses Öl- und Gassystem zu »Krisen« führt und nur erneuerbare Technologien und ein sparsamer Stromverbrauch bei einer Kehrtwende helfen.[18] Doch sie tut nicht genug, um heimische Industrien zu stützen: Viele Windrad- und Solarpanelbauer sind pleite oder verlagern ihre Produktion ins Ausland. Einer von ihnen, der Schweizer Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen Meyer Burger Technology, sagt heute: »Während die ganze Welt Industriepolitik macht, glaubt Europa an den freien Markt.«[19]
Meyer Burger Technology musste mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen, insgesamt verloren ausgerechnet in der boomenden Solar- und Windenergiebranche in Deutschland im vergangenen Jahrzehnt Zehntausende Menschen ihre Jobs. Aber während aufgrund einiger tausend bedrohter Arbeitsplätze in der Kohleindustrie jahrelang um den Ausstieg gerungen wurde und Milliarden an Entschädigungen flossen, blieb die Reaktion auf den Verlust in der Branche der erneuerbaren Energien aus – selbst die Gewerkschaften schwiegen. Hier zeigt sich erneut die Macht der Lobbys, die erneuerbare Energien öffentlich abwerten: Früher standen Fördertürme im Ruhrgebiet und Tagebaue in der brandenburgischen Lausitz für den Stolz der Arbeiterschaft und prägten eine ganze Kultur. Heute gelten Solar- und Windenergieprojekte als Verschandelung von Landschaften und als angeblich grüne Parteiprojekte. Lügen über Infraschall von Windrädern und über brennende Elektroautos kursieren.
Die katastrophalen Folgen von Gas, Kohle und Öl werden verdrängt
Bei Erdöl und Gas (und auch Kohle) hingegen werden die tatsächlichen negativen Folgen seit Jahrzehnten verdrängt. Im April 2010 explodierte im Golf von Mexiko die Ölbohrplattform Deepwater Horizon, elf Menschen starben, 800 Millionen Liter Öl flossen ins Meer. Damals verschmutzte der ölige Schlamm rund 2.000 Kilometer Küste in Louisiana, Texas, Florida, Alabama und Mississippi, Bilder schwarz verschmierter Pelikane gingen um die Welt. Der Ölteppich war halb so groß wie Deutschland.[20] Das änderte allerdings nichts an der Nachfrage nach Öl, keiner forderte einen sofortigen »Ölausstieg«. Auch die zerstörten Landschaften in den USA für aktuelle Flüssiggaslieferungen und die gesundheitsschädlichen Emissionen von Fördertürmen durch das Abbrennen von Restgasen werden ausgeblendet. Luftverschmutzung, vorrangig durch Autos, Kohle- oder Gaskraftwerke verursacht, führt allein in Europa laut Behörden zu rund 400.000 vorzeitigen Todesfällen pro Jahr, diese werden mit Asthma, Herzerkrankungen und Schlaganfällen in Verbindung gebracht.[21]
Die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin Cara Daggett charakterisiert die »Partnerschaft« zwischen westlichen Demokratien und fossilen Brennstoffen als hochproblematisch. Diese »Kohlenstoffdemokratien« verheimlichten die »vernichtende Schlagseite« von Erdöl, Gas und Kohle. Diese würde unsichtbar gemacht, etwa durch unterirdische Pipelines. Arme Anwohnerinnen und Anwohner von Industrieanlagen litten besonders unter giftiger Luft, entstellter Natur und Lärm. Auch über die autoritären Regime hinter den Exporten, etwa in Saudi-Arabien oder anderen Golfstaaten, gebe es in den westlichen Gesellschaften kaum Diskussionen. »Dies ermöglicht vielen Menschen im Westen, ihre Mitschuld am fossilen Autoritarismus zu ignorieren und fossile Brennstoffe und liberale Demokratien als natürliche und unabdingbare Partner anzusehen.«[22]
Energie aus Kohle und Gas hat eine lange Geschichte – auch deshalb hat es die Milliarden-Lobby leicht, sie zu verteidigen. Der indische Schriftsteller Amitav Ghosh[23] sieht die Energiepolitik von Gas und Öl eng mit dem kolonialen und imperialen Verhalten des Westens in den vergangenen 150 Jahren verknüpft. Ghosh geht noch weiter: Rohstoffe wie Öl und Gas seien die Basis für die »strategische Hegemonie der Anglosphäre«. Genau deshalb investiere China massiv in erneuerbare Energien. Ohne Öl wäre das Land völlig unabhängig vom Westen – und seine Macht würde weiter wachsen. Chinas Aufstieg zur führenden Kraft der erneuerbaren Energien folgt also eher machtpolitischen als klimapolitischen Zielen.
Deshalb müssen wir fossile Brennstoffe nicht nur aus Klimagründen meiden, sondern auch aus Sicherheitsgründen. Andere Staaten haben längst erkannt: Es geht um Freiheit. Ein Land, das seine Energie selbst kontrolliert, bleibt unabhängig von den Machtspielen und Preiskämpfen anderer. Wir decken mit dieser Recherche einflussreiche Lobbyverflechtungen auf – und zeigen die Stellschrauben, an denen gedreht werden müsste, damit Deutschland künftig energiepolitisch souverän sein kann.
Teil 1 Die Bremser
Das Gebäudeenergiegesetz und die Heizungslobby
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Die Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) wurde im Koalitionsvertrag der Ampelregierung für 2025 angekündigt und dann um ein Jahr auf 2024 vorgezogen. Während der Zeitspanne vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Verabschiedung nahm die Regierung zahlreiche ehrgeizige Beschlüsse zurück. Anbei die wichtigsten Punkte:
Die Wärmewende wurde zeitlich nach hinten verschoben: Statt einer flächendeckenden Pflicht ab 2024, nach der alle neu eingebauten Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien hätten laufen müssen, gilt diese nun zunächst nur für Neubauten in Neubaugebieten. Für Bestandsgebäude wurde die Einführung der 65-Prozent-Regel an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt, die, je nach Größe der Kommune, auf 2026 bzw. 2028 verschoben worden ist. Verwässert wurde auch der Passus zu Gasheizungen. Ursprünglich waren strikte Einschränkungen für den Einbau neuer Gasheizungen vorgesehen. In der finalen Version dürfen fossile Gasheizungen bis zur Fertigstellung der kommunalen Wärmeplanung weiterhin installiert werden. Für Ölheizungen ist ab 2029 eine schrittweise Nutzung von sogenanntem »grünem Heizöl« vorgeschrieben, dabei werden fossilem Erdöl raffinierte pflanzliche und tierische Fette beigemischt, etwa Rapsöl, Altspeisefette und andere Reststoffe. Ölheizungen, die nach Mitte 2026 bzw. 2028 eingebaut werden, müssen von Anfang an 65 Prozent »grünes Heizöl« nutzen. Beim Einbau von Öl- und Gasheizungen müssen sich die Eigentümer beraten lassen.Zudem wurden Härtefallregelungen und längere Übergangsfristen eingeführt. Diese gelten insbesondere für Wohnungseigentumsgemeinschaften und bei Etagenheizungen. Die GEG-Reform ist nun weitaus flexibler beim Ausstieg aus der Nutzung von fossilen Brennstoffen und lässt länger den Einbau von Öl- und Gasheizungen zu als der erste Entwurf.
Eine Wärmepumpe im kalten Harz
Es ist ein frostiger Januarmorgen im Ostharz bei Alexisbad. Auf den Fichten und Tannen liegt frischer Schnee, der Waldboden ist vereist, ein Flüsschen rauscht das Selketal hinunter, am Ufer ragen Eisspitzen ins Wasser. Mitten in diesem Winterwald steht einsam ein Forsthaus. An der Holzfassade rankt der Efeu und hinter den Mauern haben es die Besitzer wohlig warm. Das alte Haus aus dem 19. Jahrhundert ist nur teilweise isoliert, nicht unterkellert, auf den Böden liegen dicke Holzdielen, die Räume sind 3,50 Meter hoch. Wie soll man so ein Gebäude nur beheizen?
Im Garten steht kein Öltank und auch ans Gasnetz ist das alte Haus nicht angeschlossen. Stattdessen sorgen vier 50 Meter tiefe Löcher für die wohlige Wärme an diesem Wintertag. Die Anlage entzieht ihrer Umgebung Wärme – in diesem Fall aus dem Erdboden – und gibt sie über ein Kältemittel an die Heizungsanlage ab. Und das mitten im Wald, autark und unabhängig von fossilen Brennstoffen.
»Ich habe die Diskussion um die Wärmepumpen noch nie verstanden, das ist doch nichts Neues.« Das sagte meine (Susanne Götzes) Mutter Anfang 2023. Sie lebte damals bereits seit zwei Jahrzehnten in dem mit einer Wärmepumpe beheizten Forsthaus im Harz.
Durch die Republik ging zu diesem Zeitpunkt ein Aufschrei, der sogenannte »Heizungshammer« war Thema in Talkshows, im Bundestag und an Kneipentischen, Wärmepumpen wurden über Nacht zum Schreckgespenst der Nation. Am 27. Februar 2023 leakte die BILD-Zeitung den ersten Entwurf des novellierten Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Danach verbreitete der Springer-Verlag, aber auch andere Medien regelrecht Panik: »Zwangs-Wärmepumpe« oder »Habeck will uns die Heizung wegnehmen« sind nur einige der haarsträubenden Titelzeilen rund um die Diskussion zur Reform des GEGs (siehe Kasten zum GEG). Das Ziel der Novelle: Weg von Öl- und Gasheizungen, hin zu Alternativen, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Etwa Wärmepumpen, die mit Strom statt fossilen Brennstoffen laufen und vor allem die Umgebungswärme der Luft, Erde oder aus Flüssen nutzen.[24]
Doch Wärmepumpen kannte zu dem Zeitpunkt kaum jemand, alle Menschen waren Öl- und Gasheizungen gewohnt. Eine Dämonisierung derselben war deshalb relativ einfach. Und so wurde die Reform innerhalb weniger Wochen zu einer staatlichen Zwangsmaßnahme umgedeutet, die Bürgerinnen und Bürger etwas wegnehmen – und ihnen neue Technologien wie die Wärmepumpe aufzwingen will. Nachdem jahrzehntelang überhaupt nicht über die Folgen gesprochen wurde, die Heizsysteme in Bezug auf das Klima haben, herrschte nun totale Verunsicherung und Angst. Das wurde durch Desinformationen zur Wärmewende befeuert. Bei Menschen hingegen, die bereits klimafreundliche Lösungen bei sich zu Hause installiert hatten, sorgte die irrationale Diskussion für Kopfschütteln. Zudem war doch eigentlich klar, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral werden muss?
Meine (Susanne Götzes) Mutter ließ sich im Jahr 2000 eine Wärmepumpe in ihr Haus einbauen – und widerlegte damit bereits 23 Jahre vor der »Heizungshammer-Diskussion« die meisten Kritikpunkte an der Technologie. Die heute 69-Jährige bezog um die Jahrtausendwende mit ihrem Mann das Forsthaus im Harzer Selketal in Sachsen-Anhalt – am kältesten Punkt des Tals, eine Alleinlage mitten im Wald. Im Winter kriecht die Sonne dort nur für drei Stunden am Tag über die Bergspitzen. Ansonsten ist es von November bis März ziemlich dunkel – und kalt. Benötigt wurde also eine leistungsfähige Heizungsanlage. Aber ein Gasballon im Garten kam aus ästhetischen Gründen nicht infrage, und ein Öltank im Naturschutzgebiet schon gar nicht.
Ihr damaliger Energieberater war weitsichtig und überredete sie zur ersten Wärmepumpe in der Gegend. Im Jahr 2000 wussten die meisten Eigenheimbesitzer noch nicht einmal, was das war, auch die meisten BILD-Redakteure hatten damals wohl noch nie etwas davon gehört.
Wegen der alten Holzdielen war auch eine Fußbodenheizung nicht möglich. Also setzte das Ehepaar auf große Heizkörper. Für die Wärmepumpe bohrte eine Firma die vier 50 Meter tiefen Löcher in den Garten. Seitdem läuft die Wärmepumpe problemlos. Sie musste bislang weder repariert noch gewartet werden, selbst ein Schornsteinfeger ist nicht nötig. Mittlerweile läuft sie fast ein Vierteljahrhundert. Die sehr hohen Räume waren immer warm, selbst wenn in manchen Wintern im Tal bis zu minus 25 Grad herrschten. Nur der Stromverbrauch war stets etwas höher – aber dafür waren die beiden nicht auf Öl oder Gas angewiesen.
Eine solche Wärmepumpe im Harz war damals zwar noch eine Ausnahme. Doch das Beispiel zeigt: Wärmepumpen laufen in Deutschland schon seit Jahrzehnten. Und noch früher wurden sie erfunden. Bereits im 19. Jahrhundert tüftelten Ingenieure in ganz Europa an Prototypen, die erste patentierte Wärmepumpe der Welt entwickelte der Schweizer Heinrich Zoelly. Er ließ sich eine elektrisch angetriebene Wärmepumpe patentieren, die Wärme aus dem Boden entnahm. Die erste der Welt wurde 1937/38 ins Züricher Rathaus eingebaut. Der Grund war trivial: Das Gebäude steht quasi mit den Füßen halb im Fluss Limmat und hat deshalb keinen Kohlenkeller. Mittlerweile wurde zwar eine neuere Wärmepumpe installiert, aber die historische läuft immer noch bis zu einer Stunde pro Woche.
Durch den Boom der fossilen Energien geriet aber auch diese Erfindung für Jahrzehnte in Vergessenheit. Die meisten Deutschen hörten erstmals im Jahr 2023 etwas von ihr – also 23 Jahre, nachdem die erste Wärmepumpe im Selketal installiert wurde, und 86 Jahre nach dem Einbau der ersten weltweiten Wärmepumpe in Zürich.
Warum die deutsche Politik eine Heizungswende verschlief
Die Ignoranz dieser Technologie liegt auch an der deutschen Politik der vergangenen Jahrzehnte. Die deutsche Wärmewende wird unter Fachleuten nicht ohne Grund als »schlafender Riese« bezeichnet. Während in Skandinavien teils weit über die Hälfte aller Haushalte bereits mit einer Wärmepumpe heizt, lag der Anteil 2023 in Deutschland nur bei rund fünf Prozent.[25] Im Jahr 2024 brach der Absatz nach dem Wachstum im Vorjahr sogar ein – ein Grund dafür war auch die verunsichernde Diskussion über das GEG.
Die Geschehnisse in den rund fünf Monaten bis zur Verabschiedung des Heizungsgesetzes zeigen beispielhaft, wie die Branche fossiler Rohstoffe und einzelne Strippenzieher erfolgreiche Kampagnen fahren. Und in diesem Kapitel wollen wir rekonstruieren, wie es dazu kam – und wer den »schlafenden Riesen« nicht wecken wollte.
Jahrzehntelang fasste die Politik das Thema »Wärme« als heißes Eisen gar nicht erst an. Heizen ist etwas Urprivates, alle Veränderungen reichen direkt ins Wohnzimmer der Wählerinnen und Wähler. Da traute sich vor der Ampelregierung niemand ran. In der gesamten Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel (2005–2021) – die nur das Nötigste für den Klimaschutz tat – bewegte sich im Wärmesektor ziemlich wenig. Der Anteil aller erneuerbarer Energiequellen stieg in ihrer Amtszeit von rund zehn auf rund 16 Prozent – in 16 Jahren.[26] Zum Vergleich: Beim Strom kletterte der Ökoanteil von etwas über zehn auf fast 50 Prozent. Der Grund: Beim Strom kann es ein Parallelsystem aus fossilen und erneuerbaren Quellen geben, zur Not werden Windräder eben abgeschaltet, wenn die Netze nicht ausgebaut sind. Der Ausbau erneuerbarer Energien im Stromsektor wird deshalb von Expertinnen und Experten auch als »low hanging fruit« (»einfach zu erreichendes Ziel«) beschrieben.
Die Wärmewende muss hingegen viel kleinteiliger und lokaler geplant werden, auch weil bisher nur 15 Prozent der deutschen Haushalte durch Fernwärme versorgt werden. Die Mehrzahl der Häuser besitzt hierzulande ihre eigenen Blockheizkraftwerke, Ölheizungen oder Gasetagenthermen. Deshalb wird die Wärmewende zu einer individuellen Entscheidung, über die jeder nachdenken muss. Wird Fernwärme genutzt, hängen Zehntausende Wohnungen an einem zentralen Wärmenetz – bisher etwa durch Abwärmenutzung von Kohlekraftwerken –, dann ist es einfacher, dieses auf eine Großwärmepumpe umzustellen. Als Hausbesitzer merke ich den Unterschied dann gar nicht. Ähnlich ist es beim Strom: Der Endverbraucher weiß meist nicht einmal, ob nun Öko- oder Kohlestrom aus der Steckdose kommt. Er muss erst mal nichts tun. Da Fernwärme aber in Deutschland so rar ist, stellt das Umrüsten der Gasnetze die Kommunen vor viel größere Herausforderungen als der Zubau von Windrädern. Hinzu kommt, dass frühere Bundesregierungen Gasheizungen noch aktiv förderten: Bis 2019 wurden im Programm »Energieeffizient Bauen und Sanieren« Gasheizungen mit Tausenden Euro gefördert, bis Mitte 2022 zudem noch Gas-Hybridheizungen, die zusätzlich noch im sogenannten »Marktanreizprogramm« subventioniert wurden. Das bedeutet: Die alte Bundesregierung hat viele Jahre für eine klimaschädliche und politisch riskante Wärmequelle geworben – anstatt etwa ausschließlich Wärmepumpen, Geothermie, Biogas oder Solarschlaufen zu bezuschussen. Vielen Verbrauchern wurde sogar lange suggeriert, dass Erdgas umweltfreundlich und eine grüne Alternative sei. Auch deshalb musste Deutschland zu Beginn des Ukrainekrieges feststellen, wie abhängig es von russischem Gas war.
Kein Wunder also, dass folglich der Gebäudesektor (ebenso wie der Verkehr – ebenfalls kleinteilig und von individuellen Entscheidungen wie der Pkw-Nutzung abhängig) seine Klimaschutzziele bisher stets verfehlte – trotz von der Regierung aufgelegter Sofortprogramme. Letztere schaffte die Ampelregierung ab, die überschüssigen Emissionen sollen künftig von anderen Bereichen wie Industrie oder Energieversorgung ausgeglichen werden. Das ändert aber nichts daran, dass zu viele Emissionen vor allem durch ältere, ungedämmte Häuser in die Atmosphäre gehen. So beträgt die Lücke zum Etappen-Klimaziel im Jahr 2030 bei Gebäuden bereits im Jahr 2024 rund 30 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente.
Zum Zeitpunkt des »Heizungshammer«-Aufschreis gab es in Deutschland rund 5,7 Millionen Gasthermen und rund vier Millionen Ölkessel – das macht fast zehn Millionen Heizungen, die fossile Brennstoffe nutzten. Laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) heizten damals über 90 Prozent der Deutschen noch mit fossilen Brennstoffen oder Holz.[27]
In fossiler Abhängigkeit ausgedrückt heißt das: Jeden Winter produzieren wir durch das Verheizen von Gas schätzungsweise durchschnittlich 50 Millionen Tonnen CO2 (je nach Witterung mehr oder weniger). Mit jeder Wärmepumpe mehr wird in Deutschland weniger Gas verbrannt und damit wäre es weniger abhängig von Importen. Damit machen jene, für die Gas ein Geschäftsmodell ist, aber auch weniger Profite. Würden alle Gasheizungen durch Wärmepumpen ersetzt werden, würde das laut unserer Rechnung einen geschätzten Einnahmeverlust von 28 Milliarden Euro für die Gaslieferanten bedeuten – pro Jahr. Vom Gasverkauf leben die Großhändler, Energiekonzerne und auch die Stadtwerke. Und rund 28 Milliarden Euro jährlich ist eine Summe, für die es sich zu bremsen lohnt.
Dabei war der Gasausstieg beim Heizen eigentlich keine Überraschung. Bereits im Koalitionsvertrag von 2021 kündigten die Ampelparteien die Reform des GEGs an. Dort stand: »Zum 1. Januar 2025 soll jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden.« Dass die Reform um ein Jahr vorgezogen werden sollte, hatte vor allem mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zu tun. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz der Bundesrepublik Deutschland (BMWK) wollte, so erzählen es uns Insider aus dem Ministerium, die Gelegenheit eines Gasausstiegs beim Schopfe packen. Immerhin verteuerten sich die Gaspreise durch den Krieg erheblich, die Abhängigkeit von Russland wurde der ganzen Republik schlagartig bewusst. Der Zeitpunkt schien ideal. Das hätten viele Energiewende-Befürworter im Ministerium damals gedacht, berichten uns verschiedene Quellen.
Doch 2022 herrschte in ganz Deutschland die Angst, dass man wegen des fehlenden russischen Gases im Winter nicht ausreichend heizen könnte. Die Regierung stellte damals 200 Milliarden Euro bereit, um die Preise für Strom, Gas und Fernwärme angesichts der hohen Energiekosten zu deckeln. 200 Milliarden Euro – das ist rund die Hälfte des gesamten Bundeshaushaltes 2022. Diese Milliarden flossen nicht, um die Infrastruktur in Deutschland zu erneuern, Bahntrassen zu bauen oder Ladestationen für Elektromobilität zu schaffen. Es ging einzig darum, den Strom- und Gaspreis für ein paar Monate niedrig zu halten. Kurz: Es wurde nichts Bleibendes geschaffen. Eine ziemliche Luxusausgabe angesichts der in Deutschland dringend benötigten Investitionen. Dabei hätte der Gedanke schon damals naheliegen müssen, sich von diesem teuren und dazu noch klimaschädlichen Brennstoff so schnell wie möglich zu lösen.
Das gelang übrigens in anderen Ländern durchaus: Im Frühjahr 2023 – mitten in der deutschen Debatte ums GEG – fuhr ich (Susanne Götze) nach Dänemark, in die Kleinstadt Esbjerg.[28] Im Hafen hatte die Kommune dort direkt gegenüber dem alten Kohlekraftwerk die größte auf CO2 basierende Meerwasser-Wärmepumpe der Welt gebaut. Mittlerweile werden mit ihr rund 100.000 Menschen mit Wärme versorgt. Ergänzt wird das Ganze noch durch ein Pellet-Kraftwerk, das zu bestimmten Spitzenzeiten einspringt, wenn besonders viel Wärme gebraucht wird. Das Projekt ist technisch hochinteressant: Hier werden Fernwärme und die Wärmepumpen-Technologie zusammengedacht – immerhin muss dann nicht jedes Haus seine eigene Anlage einbauen. Damit hat die Stadt den Ausstieg aus der Nutzung von Kohle geschafft. Für den Strom sorgt unter anderem eine Reihe von Windrädern auf dem Meer. Beim Gespräch im Rathaus von Esbjerg mit Bürgermeister Jesper Frost Rasmussen war aber noch etwas anderes interessant: Gefragt danach, was er über die deutsche Wärmepumpen-Diskussion denke, sagte er nur kopfschüttelnd: »Diese Argumente hatten wir hier auch alle – aber das war vor fünf Jahren. Seit dem Ukrainekrieg wollen die meisten Dänen energieunabhängig werden.« Ob es in Esbjerg Widerstand gegen die Großwärmepumpe gab? »Nein, die Bürgerinnen und Bürger haben das sogar von uns verlangt«, so Rasmussen. Wenn er wiedergewählt werden wolle, müsse er sogar auf Wärmepumpen setzen. Die umliegenden Gemeinden würden nun auch bei ihm anklopfen. In Dänemark ist die Wärmewende allerdings etwas einfacher. Schon seit Jahrzehnten hat das Land einen hohen Anteil von Fernwärmenetzen.[29]
Die Deutschen hingegen zogen keine Lehren aus dem Gaskrisen-Schock. Doch das wusste man im Wirtschaftsministerium Ende 2022 noch nicht. Zu dem Zeitpunkt sah man nach dem russischen Angriffskrieg ein »historisches Fenster« für einen Wandel der Heizsysteme, so eine unserer Quellen aus dem BMWK. Allerdings habe sich das durch den folgenden heftigen Widerstand und die Medienkampagne recht schnell wieder geschlossen. »Wir waren zu naiv«, so erklärt es der Insider.