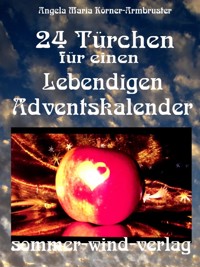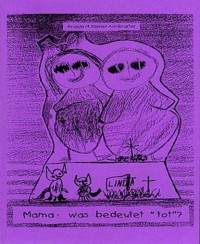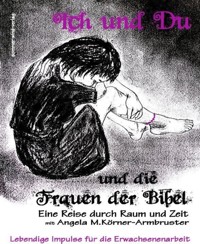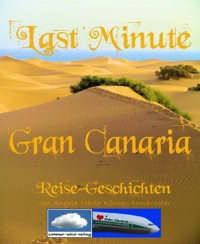
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Das Reise-Buch Gran Canaria ist ein lebhaft-lebendiger Reise-Führer durch Dünen und Schluchten, Dörfer und Kultur und führt kanarisches und deutsches Leben vergnüglich-nachdenklich zusammen. 25 Frauen machen den Leser mit ihren Lebensgeschichten und ihren Erlebnissen auf der herrlichen Insel bekannt – ganz ohne Jahreszahlen und Öffnungszeiten. Das Reise-Buch Gran Canaria eignet sich wunderbar als Lektüre vor, während, nach oder anstatt der Reise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Last Minute Gran Canaria
Reise - Geschichten
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenAnnika aus Rantum
„Fahr du man wech, wir machen datt“ hat Annikas Vater gesagt und ihr das Last-Minute-Ticket in die Hand gedrückt. Ein Hotel braucht sie nicht, denn ihr Chef lässt sie aus Mitleid zum halben Preis in Puerto de Mogán in seine Ferienwohnung. Calle Timanfaya klingt viel imposanter als der heimatliche Geschworenenweg und Annika fragt sich, warum sie auf Gran Canaria in einer Lanzarote-Straße wohnt. Natürlich würde der Chef nie zugeben, dass seine Großzügigkeit nur Mitleid ist, sondern redet von „treuen Diensten“ und „verdientem Ausspannen“.
Nun sitzt sie hier am Hafen und starrt auf ein quietschgelbes U-Boot und das Gedöns, das die Menschen machen. Peinlich ist das, richtig peinlich. Um das Boot und die Fahrt und das Erlebnis scheint es nicht zu gehen, nur darum, dass man auf dem Erinnerungsfoto gut aussieht und so blecken sie vor ihren Handys die Zähne. Abgesehen davon, dass Annika nie, aber auch wirklich niemals in so eine enge, stinkende Blechbüchse steigen würde, ärgert sie auch, dass die Tiere und das Wasser belastet werden.Neben Annika liegt ein schmales Büchlein in sphärischem Zartblau. „Lauf zum Glück in dir” steht drauf und es lag auf dem Nachttisch der Frau Doktor. Nicht, dass Ines einen Doktortitel hätte – aber sie lässt sich nur zu gern so ansprechen. Wenn der Mann schon so oft in der Praxis und so selten zu Hause ist, will sie wenigstens Frau-Doktor-vorne-und-Frau-Doktor-hinten betüddelt werden.
Drin steht viel übers Achtsam sein und Buddhismus und ganz entspannt im Hier und Jetzt und dann gibt es noch fünf weise Anleitungen, die Annikas Alltag verändern sollen und dass Laufen so toll sei. Also die Sache mit dem Weg und dem Ziel und das alles.
Weil sie nichts anderes zu tun hat, probiert sie seit drei Tagen das meditative rumlaufen, aber sie hat scheinbar keine innere Balance und keine innere Stärke und rennt sich die Seele aus dem Leib und wird dabei nicht weise und ruhiger wird sie auch nicht. Sie kennt inzwischen jeden Stein beim Bootshafen, schimpft auf den Verkehr der carretera und macht erst an der Playa Amadores Halt. Annikas Gesicht wirkt kein bisschen entspannt, sondern so verschlossen, dass sie vor lauter sprich-mich-nicht-an eine Ritterrüstung an hat. Die grimmige Miene liegt nicht am Buddhismus und nicht am Hafen - es sind die Gedanken an Rantum, die sie zornig machen. Zornig und traurig.
„Wir machen datt“ - damit meint der Vater den Umzug. 32 Jahre hat Annika auf der Insel gelebt. Sie hat dort krabbeln und laufen und tanzen und schwimmen und Judo gelernt und ihre Freunde waren da und ihr Sandkasten und ihr Ponyhof und schließlich auch ihr Mann und ihre Kinder. Und nun?
„Sylt geht vor die Hunde. Die Insel der Reichen und Schönen ist nicht mehr meine Insel.“ Von ihren Freunden lebt niemand mehr in Rantum und auch nicht in Tinnum. Auch Vater und Mutter kennen ihre Nachbarn nicht mehr. Da grüßt niemand mehr, denn die Ferienwohnungen stehen leer oder sie werden von Menschen bewohnt, die wie ein einäugiger Pirat von Keitum Besitz ergreifen. Mit diesem einen Auge sehen sie das Meerkabinett und den Inselzirkus, aber mit dem anderen sind sie blind für die „Ureinwohner“. Dazu kommt der perverse Dirndl-Alpen-Boom, der wie eine Seuche ausgebrochen ist.
Annika aber kann die Augen nicht mehr verschließen. Der Schlussverkauf hat schon lange begonnen. Viel zu viele der gebürtigen Sylter sind aufs Festland geflohen, weil sie das Theater mit Strandsauna und Akademie am Meer satt haben. Weil sie keinen Job mehr haben. Weil sie keine 900 Euro für eine 40-Quadratmeter-Wohnung berappen können. Weil sie sich einsam fühlen auf diesem Rummelplatz.
Noch vor Kurzem hat sie mit ihrer Fackel bei der Mahnwache am Rathaus gestanden und auf ein Einsehen gewisser Leute gehofft, aber inzwischen ist ihr klar: es geht nicht um die Inselbewohner, es geht um die Kohle. Und die kommt von den Tagesgästen und den Urlaubern. Das Geld bringen eben die, die 1000 Euro für eine Nacht in so einer aufgemotzten Luxussuite bezahlen können. Die, die sich für 300 Euro am Tag einen Flitzer mieten und damit immer im Kreis rum fahren. Gesehen werden ist das A und O.
Während sich die Einen damit brüsten, dass sie mit „nur“ sechswöchiger Vorbestellungszeit in der Sannsibar einen Tisch bekommen haben, schleichen sich Familien und Rentner zur „Tafel“. Während die Einen ihre verwöhnten Kinder für zweieinhalb Tausend Euro monatlich ins Internat nach List schicken, muss Annika ihre Kinder eine halbe Stunde über die Insel kutschieren lassen, weil eine Grundschule nach der anderen geschlossen wird. Die Schule steht nämlich auf einem tollen Gelände, auf dem man Appartements errichten kann. Oder eine Disco. Oder einen Schönheitsbunker.
Für wen wird denn dauernd der Sand hoch gepumpt, ausgekotzt, plattgewalzt? Für die Fremden. Und warum? Damit Sylt ja keinen Meter verliert, damit man ganz viele Quadratmeter verscherbeln und verpachten und versauen kann. Damit die Betuchten weiterhin ihr arrogantes Spiel spielen können. „Wenn sie nur ein einziges Mal drüber nachdenken würden, dass das Trinkwasser knapp wird, weil die Golfplätze immer saftig grün sein müssen. Wenn sie sich dafür interessieren würden, dass man inzwischen mitten im Landschaftsschutzgebiet Wasserbohrungen macht – aber wahrscheinlich wäre es ihnen piepegal, wenn sie es wüssten.“
Der luxuriöse Untergang der Insel ist einfach zu traurig. Die Gier nach immer mehr Geld macht alles kaputt. Wer hier arbeitet, steht im Morgengrauen auf, fährt übern Damm, schaut zornig auf die Leute, die in seiner ehemaligen Wohnung hausen und fährt wieder übern Damm zurück. Normale Menschen können sich Sylt nicht mehr leisten.
„Können? Wollen! Ich mag einfach nicht mehr zuschauen, wie alles Vertraute mit Füßen getreten wird und verschwindet.“
Der Luxus der Reichen und die Armut der Insulaner passt nicht mehr zusammen. Die Einen nehmen und trumpfen auf, die Anderen geben und ducken sich. Und deshalb muss Annika gehen. Nach Bremen. Bremen ist schön, zweifellos. Aber Sylt ist schöner. Nein, stimmt nicht, Sylt war schöner. Das war ihre Heimat. Aber nun wachsen da statt Wollgras und Kartoffelrose Ferienhauskolonien aus dem Boden und für Annika und ihre Familie ist kein Platz mehr.
„Denk an was Schönes und erhol dich, Deern“ hat die Mutter mit Tränen in den Augen geflüstert. Und deshalb sitzt Annika auf dieser wackeligen Bank und entspannt sich so sehr, dass sie schon ganz verkrampft ist. Auf Sylt gibt es jetzt das ultimative Feeling mit Wavemusic und Osterchillen und Grill-und-Chill und Südtiroler Speck und italienisches Tomatensugo und man warmt sich up und prostet sich mit einem Glas Sekt für 25 Euro zu. Alles ist ganz legendär, traditionell und edel. Kultstatus hat sowieso alles, was man tut und die Nacht wird zum Tage und jeder ist ein Gourmet.
Jens hat in der Eisenkanne bedient und gekündigt. Einfach so einen super Job hingeworfen.
„Wie kannst du nur?“ fragte Annika entsetzt. „Wir brauchen das Geld!“
„Ich kann eben nicht mehr“ hatte er gebrüllt und erst nachts, kurz vor dem Einschlafen hat er von einem aufgetakelten Gourmet-Pärchen mit schneeweißer Hose und den obligatorischen blau-weiß-geringelten Pullovern, die man sich so wahnsinnig lässig um die Schultern legt, erzählt. Sieben Stück Kuchen hatten sie sich bringen lassen. „Weil wir uns nicht entscheiden können!“
Jens hat so getan, als ob er am Nebentisch Brösel wegschnippt. Das Dämchen hat von drei Kuchen ein Häppchen genommen, zwei Kuchen hin und her gedreht und die anderen zwei gar nicht angeschaut. Monsieur schaute angewidert auf Heidelbeertorte und Sturmbeutel, ließ seinen Pharisäer kalt werden, weil der Rum minderwertig sei und dann warfen sie einen 50-Euro-Schein auf den Tisch und stolzierten davon.
„Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr – ich muss hier weg! Lewwer duad üs Slaav!“
Ja, lieber tot als Sklave, das hatten schon die Vorfahren verkündet. Also weg von Algen, Tümmlern und Seemannsgarn. Weg von Kreuzkröte und Pfuhlschnepfen, weg von Tinnumburg und Morsumkliff, von St.Severin und Denghoog mit dem reizenden Fremdenführer.
Aus ist es mit Rüm Hart, Strandflocken oder Krähenbeeren. Vorbei ists mit Söl’ring, vorbei mit Senenskiin, den die anderen Sonnenschein nennen. Jetzt ist Riin angesagt: Regen. Jetzt muss sie sich an die Weser, die Stadtmusikanten und den Roland gewöhnen.
Der neue Vermieter ist Hasenzüchter und hat ihr beim Unterzeichnen des Mietvertrages über seine Weißen Riesen und die Riesenschecken erzählt und dass die aus Flandern stammen und eine total tolle Fellqualität und ne super schöne Wamme haben. Eine Wamme ist ein Fettbauch – also das, was Annika nach dieser Woche haben wird. Denn Annika praktiziert hier Frustessen, nein: Frustfressen.
Magdalenas und weiße Brötchen, fette Salami und Blutwurst, die nach Lebkuchen schmeckt. Gofio, saftige Feigen und zuckersüße Datteln. Puddingteilchen und Stockfisch und diese verflixt leckeren, belegten Brötchen, die sie tapas nennen und die viel zu klein sind. Und vor allem Süßspeisen. Sie futtert sich durch und dann geht es ihr gut und sie legt sich faul an den Strand. Dass es hier auf dieser Insel kaum anders zugeht als auf Sylt, dass es hier auch Bettenbunker und Nepp, unterbezahlte Jobs und Arbeitslose und viele Unzufriedene gibt, kommt ihr keine Sekunde lang in den Sinn.
Erst als sie mit dem geliehenen Motorroller nach Santa María de Guía fährt, schaut sie hinter die touristische Kulisse. Die Einheimischen kürzen den langen Namen ab und sagen nur Guía. Natürlich gibt es bunt angestrichene und hübsch renovierte Häuser. Es ist eine richtig nett anmutende Altstadt mit kleinen Gassen und Guía hat wie alle Dörfer die alles beherrschende Kirche. Aber da ist auch viel abschreckend Normales. Wohnsilos, grau, beige, hässlich. Kein Farbklecks, kein Blumentopf, nicht mal Gardinen bringen etwas Gemütlichkeit. Sind das „Sozialwohnungen“? Und in den modernen, knallbunten Mehrfamilienhäusern an der lauten Straße wohnen dann die Jungen, die bei Mama ausgezogen sind und über die hässliche Autobahnbrücke in die Hauptstadt in ein Büro, eine Boutique oder eine Bank fahren?
Und dort, unter dem riesigen Baum, die drei Alten? Sie haben früher wahrscheinlich Kraken, Ziegenbarsche und Papageienfische gefangen und schauen jetzt träge aufs Meer hinab, reden nur wenig. Haben sie aufgehört zu arbeiten, weil sie müde sind, oder weil es keine Fische, keine Arbeit mehr für sie gibt? Sind sie zufrieden, oder warten sie nur, bis der Tag vergeht oder bis am Sonntag die Lose gezogen werden? Sie stützen sich auf ihre Spazierstöcke und kauen buñuelos de queso tierno. Die Krapfen schmecken – aber gefällt ihnen der große Platz mit den verchromten Geländern, den blitzenden Straßenlaternen? Hat den ein aufstrebender Jungarchitekt gestaltet oder wurde da gemeinsam diskutiert?
Meckern sie auch über diese vielen Neuerungen und den Gemeinderat, der zulässt, dass man aus ihrem Dorf eine Betonwüste macht? Schimpfen sie, dass vor der Kirche zwar Drachenbäume sind, aber wenig Bänke und viele Parkplätze und sogar eine Parkuhr? Und dass da jemand eine Seven-Up-Werbung aufs Haus gesprüht hat? Oder beklagen sie, dass die Kinder keine Zeit mehr haben, um mit den Eltern ans Meeresschwimmbad an der Playa de Roque Prieto zu fahren, weil sie den Touristen die Casa de Los Quintana zeigen müssen und das alte Haus von Nestor Álamo. Das ist 300 Jahre alt und man hat viel Geld rein gesteckt, damit es ein repräsentatives Museum für den Schriftsteller gibt. Hätten sie lieber gehabt, dass man die Ermita de San Sebastián neu streicht?
Annikas Fantasie geht weiter. Finden die beiden alten Männer mit den ausgefransten Strohhüten, die genüsslich ihre Lengüillos verspeisen, das ganze Getue um den Cenobio de Valerón gut oder sagen sie gelangweilt: „Ach, was die Leute nur mit diesen alten Kornkammern haben. Ist doch nur altmodisches Zeugs, das keiner mehr braucht!“ Lästern sie belustigt über die Touristen, die viel Geld für ein kanarisches Messer ausgeben und fragen sich, was so ein Belgier oder ein Schwede mit einem Viehzüchtermesser anfängt?
Annika vergleicht Tinnum mit Guía, den Strandhafer und die Lorbeerbäume. Sie denkt an die Fischer auf Sylt und die Käsebauern in Guía und dass sie beide von der Natur leben. Der Queso de Flor de Guía macht das Dorf nämlich so berühmt. Man macht ihn aus Kuh- oder aus Schafsmilch und seinen besonderen Geschmack bekommt er von Distelblüten und irgendeinem Saft. Annika hat ihn gesehen, wie er in Höhlen auf wackeligen Schilfgestellen reift. Der Käse ist irre teuer, schmeckt aber fantastisch und passt gut zu dem Fisch, den sie am schiefen Stand bei einem nahezu zahnlosen Charmeur probiert.
„Vieja”, sagt er und grinst breit und als sie nickt und sich anerkennend den Bauch reibt, streckt er ihr einen Teller entgegen. „Pescado encebollado“ sagt er ein paar mal und Annika bestätigt si, si, cebollo und sie spricht es sogar richtig schön ssebojjo aus. Zwiebeln, das versteht sie und das sieht sie. Er legt noch eine Art Fladenbrot dazu und hebt drei Finger in die Luft. Drei Euro sind angemessen für so eine große Portion, noch dazu eine so schmackhafte Portion.
Annika liebt Fisch. Sylt und Fisch gehören zusammen. Der Großvater und sein Boot, gegrillter Fisch am Strand, gebratene Muscheln und Friesenmatjes und natürlich Hörnumer Labskaus mit Roter Beete. Und Pannfisch. Und schon hat sie wieder Heimweh und fährt ans Meer zurück.
„Warum hab ich mich nur zu dieser Reise breitschlagen lassen“ ärgert sie sich. Der einzige Trost des Tages: sie hat, wie viele andere Besucher auch, solch ein echtes cuchillo, ein reich verziertes kanarisches Messer, erstanden. Für ihre beiden Mädchen hat sie winzige Körbchen für den Kaufladen gekauft, die aus Binsen geflochten werden. Morgen wird sie Muscheln sammeln und in die Körbchen legen. Glänzende Pinienschuppen hat sie bereits und zwei schöne Federn. Sie schimmern leicht grünlich und sind gewiss von einem Papagei. Möwenfedern braucht sie nicht, die gibt es daheim in Hülle und Fülle.
Daheim. Sie kann es keine zwei Minuten aushalten, ohne an Sylt zu denken. Wenn sie am Samstag in Hamburg landen wird, ist alles fertig. Jens holt sie ab, dann fahren sie nach Bremen in die neue Wohnung und sie will dann vernünftig sein und nicht jammern und sich auch nicht mehr vor der abschreckend hohen Kriminalitätsrate fürchten.
Annika weint und schluchzt und kann gar nicht mehr aufhören. Da bleibt eine junge Frau vor ihr stehen und überschüttet sie mit vier Millionen spanischer Wörter. Annika versteht nur „dolores“. Natürlich hat sie Schmerzen, ganz tief innen und in jeder Faser - aber dafür braucht man keinen Arzt und sie schüttelt den Kopf. Die Frau lächelt aufmunternd, nickt und sagt verstehend: „Ah – amor!“ und geht weiter.
Nun muss Annika ein wenig schmunzeln. Schmerzen und Liebe, so einfach lässt sich das zusammenfassen. Die Liebe zur Insel, zur Heimat tut weh. Basta. Das erklärt sie ein wenig später auch einer alten Dame, die neben ihr Platz genommen und ein Päckchen Taschentücher auf Annikas Schoß gelegt hat.
„Ich verstehe Sie gut“ bestätigt sie ruhig und legt ihre magere, faltige Hand ganz leicht auf Annikas Arm. Sie spricht mit einem leichten Akzent.
„Ich habe auch meine Heimat verloren. Bürgerkrieg. Mein Haus, meine Familie, alles. Ich bin mit falscher Pass geflohen, war von einem Land in einen anderen geschubst und bin am Ende in Winterdeutschland gestrandet. Wie ein einsamer, kranker Wal war ich in dieser fremden Land und verstand nicht die Kultur und nicht die Sprache und das Essen schmeckte mir nicht. Alle hatten Mitleid, aber helfen konnte mir kein Mann. Nur die Zeit. Und mein Verstand. Ich habe jeden Morgen als ersten und jeden Abend als letzten gedacht: schau nach vorne, es gibt immer eine Lösung.“
Versonnen blickt sie aufs Meer hinaus und ein Lächeln verschönt ihr faltiges Gesicht. „Und es gab immer eine Lösung.“
Annika hat aufgehört zu weinen. Die schlichten Worte berühren sie tief. Ohne Hass, ohne Klage hat die Dame das erzählt und in Annika etwas zurecht gerückt.
„Die Frau hat alles zurückgelassen, mit nichts neu angefangen – und ich hab Jens und die Mädchen und doch immer noch meine Eltern und mein Elternhaus und Geld und Arbeit. Eigentlich geht es mir doch gut, oder?”
„Was ist das?“ fragt die Dame jetzt und zeigt mit ihrem schwarzbraunen Finger auf die Körbchen.
„Für meine Kinder. Für den Kaufladen. Aber ich muss noch mehr sammeln, sie sollen viele schöne Inselsachen für ihr Spiel haben“ erklärt Annika.
„Ich kann Ihnen zeigen, wo es winzige herzlige Steinchen gibt, vielleicht eine halbe Stunde von hier bei Strand entlang. Aber ich will Ihnen nicht auf die Nerven trampeln.“
Annika lacht befreit auf.
„Ich glaube, meine Nerven halten viel aus.“
Heimlich lässt sie das Buddha-Buch, das unter der Jacke verborgen lag, in ihrer Tasche verschwinden.
„Ich bin bereit. Gehn wir?”
Britta aus Hamburg
Superglatt und gerade liegt das blau-weiß-gestreifte Strandtuch auf dem Sand. Kein Hügelchen, keine Fältchen sind zu sehen. Ebenso gerade liegt Britta auf dem Handtuch. Ein paar Hügelchen, keine Fältchen sind zu sehen. Rechts vom Handtuch liegt, Kante an Kante, ein Taschenbuch. Auf dem Buch, Kante an Kante, ein Brillenetui. Die Brille darin ist nach Gebrauch sorgfältig mit einem Spezialtuch gereinigt worden.
Zuvor hat Britta die Brille natürlich angepustet, damit nicht etwa ein Sandkörnchen darauf ist und die Gläser verkratzt. Alles ist in schönster Ordnung. Auch an Britta ist alles in Ordnung. Kein Stückchen Haut ist ohne Sonnenschutz, kein Härchen macht sich selbständig. Britta sieht aus, als wäre sie vom Himmel gefallen. Nein, nicht gefallen. Dann läge sie wohl leicht verrenkt oder etwas krumm und schief da. Nein, diese unglaublich dünne Frau muss vom Himmel geschwebt sein, denn nicht einmal zwischen ihren Zehen befindet sich ein Sandkörnchen. Jedem Betrachter ist klar: diese Gestalt ist nicht durch den tiefen Sand gewatet, gestrauchelt, gestakst.
Um Britta herum herrscht trubeliges Maspalomas-Gewühle. Man spielt Beach-Volleyball, gräbt Burgen mit Krokodilsgräben und sammelt Muscheln, die nicht da sind. Und die, die nichts tun, schauen denen zu, die etwas tun.
„Mama, ist die Frau tot?“ fragt ein Dreijähriger neugierig, weil sich auf dem Friesenhandtuch so gar nichts regt.
„Nein, das glaub ich nicht“ hofft die Mutter. „Sie ist nur mit braun werden beschäftigt.“
„Oder sie ist sehr müde, weil ihr Zimmer auch direkt über dem blöden Küchenfenster ist“ brummt der Vater.
„Sie meditiert“ vermutet die Tante.
„Was ist metieren?“
„Da ist nur der Körper da und die Gedanken sind anderswo.“
Die Tante hat fast recht. Britta ist in Gedanken wirklich weit weg. Sie steht auf einer Bühne in Lissabon und spielt Tschaikowskys Violinkonzert Nummer 35. Jede Note, jede Pause wird überdacht. Britta hatte das böse Wörtchen Burn-Out in flammenden Buchstaben vor sich gesehen und dieses Last-Minute-Ticket als Medizin gebucht. Natürlich konnte sie ihre geliebte Geige nicht in den Urlaub mitnehmen und so kann sie auch nicht üben und deshalb muss sie wenigstens gedanklich voll dabei sein. Eine Woche ohne Training kann verheerend sein. Wenn sie in dieser einen Woche etwas Wichtiges vergisst? Wenn ihre Finger steif werden?
„Britta Bovensen zeigt eine grüblerisch-sperrige Auseinandersetzung mit der Komposition und zeichnet sich durch ein untrügliches Gespür für pointierte Überraschungen aus“ hatte der Kulturkritiker geschrieben und von effektvoller Virtuosität gesprochen und dass Britta „nervig und schlank im Strich“ sei. Er lobte ihre depressive Dynamik und die auffallend differenzierte Vibratokultur bei den fulminanten Kadenzen und dass er Brittas bildhafte Intensität schätze und Britta hat dieser Artikel so gut gefallen, dass sie ihn elf mal gelesen und auswendig gelernt hat.
Nur eines ist schade: dass nirgendwo das Wort „perfekt“ gestanden hat.
Und genau deshalb grübelt Britta nun Tag für Tag, was sie falsch gemacht hat und geht im Geist immer wieder das Konzert durch. Wo war sie schlecht? Wo war sie unsauber? Wo hat sie gezaudert? Es ist ein Elend und es macht Britta sehr unruhig! Wütend steht sie auf, geht ins Hotel zurück und streicht die vom Zimmermädchen gemachten Betten erst mal richtig glatt.
Ohne Pause schwimmt sie 100 Bahnen im Pool, dann radelt sie im Spa-Bereich eine halbe Stunde und achtet sehr genau darauf, dass sie nie unter 200 Watt fällt. Während sie strampelt, sagt sie den Zauberlehrling auf. Gestern war das Lied von der Glocke dran, aber der Zauberlehrling ist rein textlich besser.
„Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch, und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch“ hatte der Geheimrat einst gereimt und das gefällt ihr, denn sie hält viel von Geistesstärke. Was sie dem Lehrling allerdings nicht verzeihen kann, ist das Gestümpere. Wenn Britta etwas tut, tut sie es perfekt. Da gibt es kein Halb, da gibt es nur Ganz.
„Übung macht den Meister“ hat schon der Großvater gesagt und die Tränen der lütten Deern ignoriert, wenn sie beim Boccia die Törchen nicht treffen wollte.
„Was Ännchen nicht lernt, lernt Anne nimmermehr“ hatte Großmutter gesagt und die Kreuzstiche auf dem feinen Tüchlein wieder aufgetrennt.
„Ich muss ins Kontor und schauen, dass meine Angestellten alles richtig machen“ hatte der Vater den Kindern seine Arbeit erklärt.
„Ich schimpfe nicht, ich helfe dir nur, besser zu werden“ hatte die Mutter bei den Hausaufgaben klargestellt und zum dritten Sieg bei „Jugend musiziert“ die ersehnte Mitgliedschaft im Paddelverein geschenkt. Heimlich, denn der Vater hätte niemals erlaubt, dass die Violinenhändchen durch einen solch brutalen Sport in Gefahr gebracht werden. Wenn Holz, dann Ahorn und Ebenholz, aber nicht so etwas grobes wie Kiefer!
Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich ein Hamburger Kind ein Paddelboot wünscht. Schließlich sieht es schon aus dem Kinderwagen heraus die Boote auf der Alster dahingleiten und das sieht so leicht, so träumerisch, so schwebend aus. Das muss einfach schön sein!
So hat Britta natürlich auch gedacht und insgeheim war der Wunsch dabei, vor der strengen Familie wegzupaddeln. Nur eine Stunde lang den Aufpassern entrinnen und tun, was man möchte und wie man es möchte. Vielleicht sogar auf der Außenalster, wo alles so schön ruhig und stressfrei ist.
Aber die Freude währte nicht lange, denn gleich die erste Stunde brachte die bittere Ernüchterung. Ach was, die erste Stunde – die erste Minute! Britta wurde schon beim Griff zum Paddel gerügt, weil dieser anscheinend total falsch war und Sven hatte herablassend „So wird das nie was“ gesagt. Am Liebsten hätte sich Britta vor Enttäuschung und Scham gleich ins Wasser gestürzt.
Als sie nach dieser Schnupperstunde „Ich hab mich geirrt, das Paddeln ist wohl doch nichts für mich“ zur Mutter sagte, war die Antwort klar und einfach gewesen: „Was man begonnen hat, führt man auch zu Ende.“ Als die blutigen Blasen an den zarten Kinderhänden auftauchten, änderte die Mutter ihre Meinung – doch in Brittas Kopf war bereits eingeprügelt: „Man darf nie aufhören zu rudern, sonst treibt man zurück!“
Britta war zwar erst acht Jahre alt, aber sie wusste: zurücktreiben ist Unmöglichkeit. Man darf nie aufhören, man muss sich mehr anstrengen, man muss die Zähne zusammenbeißen, man muss nach vorne schauen, man muss ein Ziel haben, man muss sich verbessern wollen. Wie weit? Ganz klar: bis man perfekt ist. Beim Vokabeltest. Bei den Bundesjugendspielen. Beim Knopf-annähen. Beim Briefeschreiben. Beim Geschenkebasteln. Beim Tanzkurs. Beim Abitur sowieso.
Als bei Britta das erste Mädchenblut floss, wurde dies von ihr sofort als nicht-perfekt eingestuft und mit Sechzehn hatte sie ihren Körper endlich unter Kontrolle und dieses nicht-perfekte, diese monatliche Störung weg gedacht, abgeschafft, ausgemerzt. Dieser Erfolg beflügelte Britta sehr. „Ich kann alles bezwingen, alles kontrollieren, alles erreichen.“
Alles. Tokio, Sydney, Mailand. Bühnen, die Ruhm und Ehre bedeuten. Natürlich auch Geld und gesellschaftliche Anerkennung. „Der Erfolg fällt euch nicht in den Schoß“ hieß es am Konservatorium und Brittas persönlicher Einpeitscher zitierte stets mit vor Ehrfurcht zitternder Stimme einen berühmten Italiener und forderte, dass der Schüler den Meister überflügeln müsse.
Ja, Britta ist ernsthaft, zielstrebig, unnachgiebig, erfolgreich und stets aufs Wesentliche konzentriert. Niemand könnte sagen, dass sie flatterhaft, unbeständig oder gar unverlässlich ist. Dann schon eher verschlossen, unnahbar, kühl.
Ihre Geschwister denken, sie sei ein Kuckuckskind. Ihr leiblicher Vater denkt, sie sei ihm fremd geworden. Ihr Doktorvater denkt, sie sei ihm unheimlich. Ihr Agent denkt, sie sei eine Maschine. Falls sich einmal ein Mann in ihr Bett verirrt, denkt er, sie sei von einem anderen Stern. Ihr Hausarzt denkt, sie sei krank. Ihr Therapeut denkt, sie sei reif für die Psychiatrie. Sie selbst denkt, dass der Weg zur Perfektion nur durch knallharte Selbstkritik funktioniert.
Der Mann, den sie aus Versehen geheiratet hat, denkt nicht nur. Er sagt auch, was er denkt. „Mag sein, dass du perfekt bist – aber liebenswert bist du nicht und die Leute, mit denen zu tun hast, bestaunen deine Leistung, aber sie bewundern dich nicht. Wenn man jemanden bewundert, ist da auch Gefühl dabei und wenn man mit dir zu tun hat, begreift man schnell, dass Gefühle keinen Platz haben.“
Er hat seinen Koffer mitgenommen und ein Buch dagelassen.
„Lies es“ steht auf der ersten Seite. „Vielleicht verstehst du dann, warum ich gehe. Aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich das nicht.“
Britta war sehr verblüfft darüber, dass in ihrem Leben etwas nicht perfekt geklappt hat und in ihrer Verwirrung tat sie das Gleiche wie ihr Mann. Sie dachte an Flucht und buchte Last-Minute das erste was ihr in die Finger kam. Im Flugzeug nahm sie Björns Buch zur Hand. Blauer Himmel, blaues Meer, weißer Sand, ein rot-weiß-gestreifter Liegestuhl und der fragwürdige Titel: „Das Leben ist nicht perfekt“.
Und dieses Buch soll ihr wirklich eine Antwort geben? Britta zweifelt daran. Sie hat ja nicht mal eine Frage gestellt! Unlustig blättert sie, liest hier einen Satz und dort einen kleinen Abschnitt. Es scheint kein Fachbuch zu sein und Wissen und neue Erkenntnisse vermittelt es auch nicht. Merkwürdig. Warum soll sie es dann lesen?
Der Autor sagt, man solle ein Mal in der Woche die Armbanduhr und das Handy weg sperren, Sonnenuntergänge anschauen und mit Kindern spielen. So ein Blödsinn! Er findet bergsteigen himmlisch und Versprecher reizend. Er meint, dass Sorgenfalten von zu viel Sorgfalt kommen und dass Unzulänglichkeit mehr Wert sei als Vollkommenheit. Dass man auf dem Bauch liegen und einer Hummel beim Frühstück zuschauen soll. Und was hat man außer Grasflecken davon?
Britta hat genervt aus dem Fenster geschaut und wollte lieber an die nächste Konzertreise als an diese lächerlichen Ratschläge denken, als in der Reihe hinter ihr ein Gespräch begann.
„Nur weil er in allem so schrecklich perfekt ist, musst du dich doch nicht gleich scheiden lassen?“
„Doch, genau deshalb!“
„Weshalb?“
„Weil es schrecklich ist. Er spült sauberer als ich, er mäht den Rasen besser, er trifft beim Kegeln besser, er kann besser pfeifen und sein Brot geht höher auf als meines. Er weiß ohne Joker und ohne Publikum bei jedem Quiz die richtige Antwort und rechnet schneller im Kopf als ich mit dem Taschenrechner.“
„Jaja, es ist nicht einfach, perfekt zu sein - aber irgendwer muss es sein und warum sollte dieser irgendwer nicht dein Dieter sein?“
„Weil mich das total deprimiert. Weil ich mich daneben so unbedeutend fühle. Weil es mir schon gar keinen Spaß mehr macht, mit ihm Schach oder Federball zu spielen. Weil scheinbar nur ich Fehler hab und er keine.“
„Also - ich mag deine Schwächen...“
„Ich nicht. Sein perfekt-sein lähmt mich und dieses immer-noch-besser-als-letztes-Mal-sein-wollen macht mich rasend. Für ihn ist alles ein Wettkampf, er muss sich immer vor sich selbst und anderen beweisen.“
„Ist er dann auch der perfekte Liebhaber?“
„Nein. Dafür hat er keine Zeit. Oder ich bin nicht würdig, dass er mit mir...“
Zum Glück war da die Flugbegleiterin mit einem Snack gekommen und hatte das Gespräch beendet. Aber tief drin in Britta hat etwas zu brodeln begonnen. Wenn sie das Hotel-Buffet begutachtet, wenn sie eine Kirche anschaut – immer wieder ertappt sie sich bei einer Wertung.
„Gestern waren die Melonen größer. Die Kirche in Teror ist kostbarer geschmückt als die in Las Palmas. Der rechte Surfer kann mehr Figuren als der Linke. Das Netz im blauen Fischerboot ist voller als im Roten.” Und immer kommt so ein kleiner Gedanke hinterher. „Ich würde mich um gleichbleibende Qualität bemühen. Ich würde mehr üben, dann könnte ich auch diesen Looping. Ich würde noch mal rausfahren, dann hätte ich mehr Verdienst.”
Und schwirrt ganz leise die Frage „Und dann?“ durch ihren Kopf und dann weiß Britta keine vernünftige Antwort darauf.
Jetzt ist die Urlaubswoche schon zur Hälfte vorbei und Britta ist in Las Palmas vor einem Museum gelandet. Ein Plakat verkündet, dies sei das Geburtshaus von Benito Pérez Galdós und Britta hat diesen Namen noch nie zuvor gehört. Dabei muss er berühmt sein, denn er hat es auf den 1000-Pesetenschein geschafft. Dicker Schnauzer, wacher, freundlicher Blick. Auf den meisten Bildern trägt er einen Hut und sieht aus wie ein Bauer oder ein Märchen erzählender Großvater.
„Wie komm ich denn auf so was? Ich kenne doch gar keine Großväter, die Märchen erzählen?“ wundert sich Britta und betritt, obwohl sie es gar nicht vorhatte, den schattigen Innenhof. Eine mächtige Palme reckt sich weit nach oben in den Himmel, ein gewundener Treppenaufgang, dicke alte Holzbalken. Oben steht man Aug in Aug mit dem Grün der Palme und die Sonne wirft ein Blatt-Fächer-Muster an die getünchte Wand. Ganz still ist es, Britta ist alleine, keiner scheint sich heute für den Autor zu interessieren. Doch, eine kleine Eidechse ist noch da und huscht über die verwitterten Steinfliesen um die Ecke, schlittert kurz auf den alten Holzdielen und wetzt geradeaus ins Museum hinein.
Hat der Schriftsteller da gestanden und zu romantischen Damen hinab geschaut? Oder war er einer, der gerne tief ins Glas blickte und dann Probleme mit der steilen Treppe bekam? Britta ist neugierig auf seine Wohnung und tritt durch den gewölbten Bogen ein. Erstaunt betrachtet sie das Sammelsurium. Einhundert Jahre ist er jetzt tot und seine Nachfahren haben unzählige Bilder von ihm und von den Schauspielern seiner Stücke aufgehängt. Solche Fotos gibt es von Britta auch. Geige, Blumen, Handschütteln, in die Kamera lächeln.
In der Bibliothek sind außer seinen vielen Büchern auch Briefe, Notizzettel, Geschenke, vor allem aber Bücher über Bücher. Alt, in Leder gebunden, kostbar aussehend. Ihre Schwester würde sagen „Die nehm ich alle mit!” denn hier stehen genau die Regale, die Svenja so gut gefallen. Manche haben oben eine Art Balkon und eines wird von Fledermausflügeln geziert. Zumindest sieht es aus wie Fledermausflügel. Natürlich würde Svenja auch die Bücher mitnehmen. Schwere Bände, die ehrenvoll gealtert sind und allmählich ihre Farbe verändert haben. Und die Gemälde erst! Der Mann hatte Geschmack. Und Geld wohl auch. Oder waren das alles Geschenke von Verehrern?
Ein gemütlicher roter Sessel, ein Tischchen daneben für die Lieblingsbücher. Überall stehen Stühle und Sofas, grad so, als ob der gute Mann ständig lesend herumgelaufen und gedankenverloren niedergesunken sei. Ach, das ist alles so schön romantisch! Britta, die sonst eher für Bauhausarchitektur und schnörkellose Möbel schwärmt, findet es überaus heimelig. Ihre Fantasie macht wilde Sprünge. Sie sieht ihn da sitzen, Oliven kauen, herben Wein schlürfen und er liest einen Bericht über Kolumbus oder … was ist das? Oh weh! Jetzt ist es aus mit der Idylle, unten versammelt sich eine Schulklasse. Teenager, laut und selbstbewusst. Zwölfte Klasse, Deutsch-LK. Ach nein, natürlich Spanisch-LK! Nichts wie weg hier!
Sie werden jetzt laut diskutieren, dass sein Großvater Sekretär der Inquisition war und der Onkel über Napoleon schrieb. Dass er in Madrid Jura studieren wollte und sich mehr für Straßencafés und Theater und Mädchen interessierte als für Paragrafen. Dass er gegen Todesstrafe, Bürgerkrieg und Regierung war und trotz aller Affären Junggeselle blieb und sich von seiner Schwester versorgen ließ und Beethoven auf dem Klavier spielte. Dass er viel reiste, mit der Königin zu Tisch saß und Abgeordneter im Parlament wurde und die einfachen Leute schätzte.
Über all das würde der Lehrer wohl reden und darüber denkt auch Britta nach. Wenn dieser Mann so vielseitig war, war er dann auch gewissenhaft? Oder hat er alles angefangen und halbfertig liegen lassen? Wer so viele Bücher schreibt, kann doch nicht auch perfekt Klavierspielen? Oder war er mit sich und seiner Leistung unzufrieden, weil er nicht genug Zeit hatte, um alles perfekt zu machen? Oder wird man bei allem, was man perfekt tut, auch perfekt unglücklich? Oh weh, da ist das Wort schon wieder. Perfekt. Wollte dieser Benito überhaupt perfekt sein? Britta bleibt erschreckt mitten auf dem Gehweg stehen. „Was hab ich denn plötzlich für Gedanken? Das hat mich doch sonst nicht interessiert?“
Völlig kopflos schlägt sie eine andere Richtung ein. Nur weg hier! Diese geschichtsträchtigen Häuser machen sie ganz konfus.
„Wo ist denn nur das neue Museum? Das wird mich wieder zur Vernunft bringen!“
Doch statt ans Centro Atlántico de Arte Moderno kommt sie zur Plaza de Cairasco. „Was ist das für entsetzliche Musik? So ein wirres Zeug!“ denkt sie, doch weil beim Gabinete Literario pfeifende, klatschende und tanzende Zuhörer den Weg versperren, bleibt sie notgedrungen stehen. Immerhin ist eine Geige dabei und so ist ihr Interesse geweckt. Es ist ein gutes Instrument und es wird auch gut gespielt, das erkennt sie. Nur – was soll das sein? Zigeunermusik? So schräg, so quer. Ständig wechselt die Melodieführung, und welches ist überhaupt das Thema? Wo ist das Schema? Britta ist irritiert. Spielt hier jeder, was er will?
Nein, so ist es nicht und plötzlich gelingt es ihr, nicht an Mozart oder Brahms zu denken und sie hört, wie sich Geige und Klarinette unterhalten und gegenseitig anstacheln und die Klarinette trillert und quiekt und lacht und schluchzt und die Geige weint und lockt und tröstet und die Menschen tanzen und lachen und fassen sich an den Händen.
Gott, was ist das für eine Stimmung! Britta schaut sich fassungslos um. Jung und Alt stehen hier und sind verschwitzt und alle sehen glücklich und zufrieden aus und für einen winzigen Moment sieht sich Britta selbst auf der Bühne und schaut auf ihr eigenes Publikum hinunter, wie sie alle in schwarz und ganz würdevoll dasitzen und kunstbeflissen dem technisch ach so schwierigen Bruch-Konzert in g-Moll lauschen. Keiner von denen sieht glücklich oder zufrieden aus, keiner umarmt plötzlich seinen Nebensitzer.
Genau das aber geschieht hier vor diesem Jugendstilcafé. Jeder scheint plötzlich jeden zu kennen und dann dann passiert es. Ein schmerbäuchiger Mittsiebziger mit fettigen schwarzen Locken und Kaffeefleck am Hemdkragen drückt Britta einen schmatzenden Kuss auf die Wange, brüllt ihr etwas mit „Klezmer“ und „la vida“ ins Ohr und tanzt mit ihr drei, vier Mal im Kreis herum, ehe er sie direkt vor den Musikern wieder loslässt.
Der Geiger lacht ihr zu, verneigt sich ein wenig und schickt ein Küsschen herüber. Britta sieht sein schneeweißes, weit offenes Hemd, seine schwarzen Augen, seine Finger hüpfen über die Saiten und sein nackter Fuß in der Ledersandale stampft aufs Pflaster und sie klatscht und klatscht und trällert die fröhliche Melodie mit und tief in ihr drin ist immer noch die tiefe Stimme des alten Herrn, die unablässig „la vida, la vida“ brummt. Und sie weint und singt und tanzt, bis sie keine Luft mehr bekommt und taumelt und hilfesuchend hinter sich greift.
Doch da ist niemand mehr, weil die meisten inzwischen weitergegangen sind und so springt der Geiger herbei und fängt sie auf. Die Klarinette schluchzt, die Drehleier übernimmt den Part der Geige, der Kontrabass bleibt beim Puls der Ewigkeit und Britta lehnt ihren Kopf an die fremde Schulter.
„La vida“ murmelt sie leise und der Geiger stützt sie, pustet ihr behutsam die verschwitzten Haare aus der Stirn und antwortet wie aus einer anderen Welt „Si - perfecto!“
Carmen aus Hannover
Vierzehn Dünen stecken schon in ihrem Tütchen, dazu zwei mal Mogán und ein Mal Puerto Rico. Sechs Mal Las Palmas. Carmen ist süchtig nach Ansichtskarten, die sie daheim in bunten Schachteln für Regentage hortet. Nicht säuberlich geordnet, sondern bunt durcheinander. Kopenhagen liegt friedlich neben Tunis, Davos neben San Francisco. Rom schließt Freundschaft mit Paris und Antalya mit Brüssel. Jetzt hortet sie Karten von Gran Canaria. Der Stapel ist schon so dick wie ein Taschenbuch, doch das ist noch lange nicht genug. Sie will unbedingt die Mühle von Fatagá und den Palmitos Park mit der witzigen Papageienshow. Teror und seine Plaza del Pino fehlt noch und vor allem Santa María de Guía. Ihr Traum ist eine Karte vom Käseladen, in dem sie ein Stück des berühmten Blumenkäses gekauft hat.
Queso de Flor heißt diese Spezialität aus Schafs- oder Kuhmilch bei den Einheimischen, deren Geheimnis ein jeder kennt: ein Schluck Artischockensaft sorgt für den unverwechselbaren Geschmack. Señor Romeros reibt am Ende liebevoll jeden Laib mit Olivenöl ein. Dann liegt er da, sieht verlockend aus und wird in aller Gemütsruhe verkostet. Mit winzigen Schlückchen Wein. Im Stehen. Garniert mit alten und neuen Geschichten. „Das ist eben ein Stück Inselkultur!“
Statt Käsekultur findet Carmen jedoch nur knackige Hinterteile und ölige Vorderansichten minderjähriger Mädchen. Peinlich und überhaupt nicht witzig. „Wer kauft denn so was?“ fragt sie sich entnervt und steuert einen freien Tisch im Roma an. Nachmittags brüllen keine Uralt-Hits in ihr Ohr und keine Travestieshow versucht Urlauber anzulocken. Da zählt nur der „con leche“ oder - je nach Geschmack - der „café solo“. Carmen will ihn solo, also schwarz mit einem Glas Wasser. Mit dieser Bestellung ist sie schon ein klein wenig mehr als der normale „Gringo“. Schon am dritten Tag wird sie mit Handschlag begrüßt, zum Tisch gebracht und es heißt: „Como siempre?“ Wie immer?
Na klar, wie immer. Eigentlich ist doch alles „wie immer“. Die lautstarke Lebensfreude der Spanier, die zu nachtschlafender Zeit die Völkerverständigung schwierig macht. Der unglaubliche Plunder, der in den zimmergroßen Lädchen die Augen zum Tränen bringt. Die gefälschten Sonnenbrillen und Uhren. Und die menschlichen Heuschrecken, die sich mit Heißhunger auf Touristen stürzen, um ihnen Lügengeschichten über Appartements oder Hauptgewinne aufzutischen. Carmen kommt es so vor, als seien diese modernen Wegelagerer mit jeder Saison noch dreister. Heute morgen hatten sie eine Viererkette gebildet, damit ihnen ja kein Urlauber entkommen kann. Einfach schrecklich!
Doch dann hatte Nico eine blendende Idee gehabt. Als er angesprochen wurde, breitete er total begeistert die Arme aus, riss den Kerl mit dem blütenweißen Hemd an sich und brüllte ihm ins Ohr: „Ah, Polski! Polski gutt!“ Das Gesicht des Schnösels war sehenswert! Der Kiefer rastete beinahe aus und sofort waren sie uninteressant und durften unbehelligt zum Strand. Vielleicht ist dieses Jahr doch nicht alles so wie immer? Carmen wird nachdenklich.
„Vielleicht sollten wir uns mehr Mühe geben, dass es nicht como siempre wird?“
Sie sind Last-Minute her geflogen, dann kann man doch auch Last-Minute die Pläne über den Haufen werfen, wenn sie nichts taugen? Besser spät, als nie!
„Wir haben ja den Corsa gemietet, wir sind eigentlich frei, oder? Morgen ist der 4.August, ein Feiertag. „Bajada de la Rama“ steht im Reiseführer. Wie? Ein Fest für die Margarine, obwohl hier nur mantequilla aufs Brot kommt?“
Im Reiseführer steht: „Das „Hinabbringen des Zweiges“ ist ein altkanarischer Brauch. Aus den Bergen hinter Agaete werden Pinienzweige zum Meer hinuntergetragen, wo man mit ihnen ins Wasser peitscht, um Regen zu erbitten.