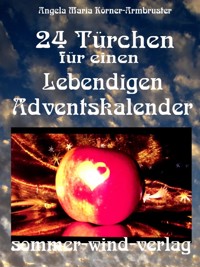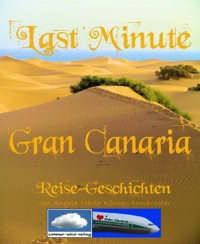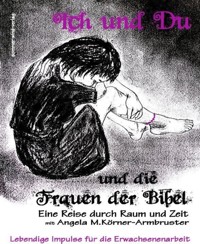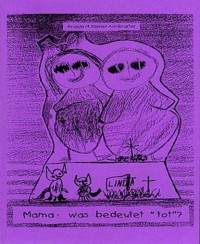
2,99 €
Mehr erfahren.
Was sagen wir zu unseren Kindern bei diesem schwierigen Thema - und was sagen wir nicht? Mit diesem Büchlein haben Sie einen prima Leitfaden für einen angstfreien Zugang zu guten Gesprächen. Die Autorin Angela Maria Körner-Armbruster schreibt hier mit der Erfahrung einer betroffenen Mutter, Erzieherin und Referentin. Sie richtet als Mensch und Autorin gerne ihren Blick auf jene, die Hilfe brauchen. Sie schaut nicht weg, sondern hört zu. Wenn andere verstummen, beginnt sie – als Journalistin und Autorin - zu schreiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mama - was bedeutet "tot"
Ein Ratgeber
Gewidmet allen Mutigen die ihren Kindern auch auf diesem schweren Stückchen Lebensweg liebevoll helfend die Hand reichen wollenBookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorwort – Trauer, was ist das?
Vorwort – Trauer, was ist das?
Es gibt eine Unmenge schöner Zitate von berühmten Menschen. Wir lesen sie gerne, wir verschicken sie gerne und dennoch oder gerade deshalb stellen wir uns oft diese Frage und wir fragen auch nach den Wegen der Trauer.
Wir wissen, dass jeder seine ureigene Art hat zu trauern, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt.
Wir erfahren, dass uns der Umgang mit Trauernden in unserer ganzen Menschlichkeit fordert und wir spüren: es gibt keinen endgültigen Trost.
Der Trauerweg hat zwar einen Anfang, aber kein Ende.
Es gibt verschiedene Phasen, die wir unterschiedlich bewusst erleben und im Laufe der Zeit zeigen sich Veränderungen. Immer wieder steht etwas anderes im Vordergrund.
Wir können mit Sicherheit sagen: die Trauer wandelt sich und wir verwandeln uns mit ihr auch.
Auf jeden Fall ist ein Trauerfall immer eine Bewährungsprobe für eine Beziehung. Manchmal kommen während dieser Zeit Wünsche und Defizite zum Vorschein, die schon lange verschüttet liegen und endlich ausgesprochen werden wollen.
Jeder Umgang mit der Trauer kostet Kraft – ist aber auch eine Chance, die wir nicht verstreichen lassen dürfen.
Albert Schweitzer sagte in seinen Straßburger Predigten: „Wir alle müssen uns mit dem Gedanken an den Tod vertraut machen, wenn wir zum Leben wahrhaft tüchtig werden wollen.”
Ich biete Ihnen mit diesem Buch keinen ausgefüllten Rezeptblock mit Garantiestempel. Ich wünsche mir vielmehr, dass Ihnen das Büchlein eine Anregung ist zum nach-denken, um-denken, hinein-denken. Und dass es Ihnen Mut macht!
Meine eigenen Erfahrungen und Ausschnitte aus Briefen und Gesprächen möchten Sie auf Ihrem persönlichen Weg begleiten. Ich wünsche Ihnen alles Gute dabei!
Ihre Angela Maria Körner-Armbruster
Kinder und Trauer
Kinder und Trauer
Wir haben uns vorgenommen, ein Tabu zu brechen und mit unseren Kindern über das Leben, das Sterben und den Tod zu sprechen. Wie schwierig dieses Vorhaben ist hat jeder schon erlebt.
Beim Dalai Lama lesen wir: „Wenn man von Anfang an über den Tod nachdenkt und sich darauf vorbereitet, kann solche Vorbereitung in der Stunde des Todes wirklich helfen.”
Noch vor wenigen Jahren wurde die Meinung vertreten, dass man Kinder unter zehn Jahren keinesfalls mit des Todesproblematik konfrontieren darf. Zum Glück hat sich diese Einstellung gewandelt. Die Angst vor seelischen Belangen ist kleiner geworden, „man” spricht endlich darüber. „Man” hat seinen Therapeuten und weiß, wie viele Probleme durch Lügen, Vertuschen und Heimlichkeiten entstehen.
Wir können es überhaupt nicht verhindern, dass sich Kinder Gedanken über den Tod machen. Zeitung und Fernsehen sind voll davon. Und zwar von Menschen, die auf „unnatürliche Weise” durch Gewalteinwirkung irgendeiner Art sterben mussten.
Es ist schlichtweg unmöglich, dieses Thema auszuklammern.
Eine „beiläufige” Art den Tod zu erfahren, geht mit dem Leben in der Kleinfamilie und mit dem Vorhandensein von Pflegeheimen verloren. Wenn wir unseren Kindern die Begegnung mit einem „natürlichen” Tod ausklammern, nehmen wir ihnen eine wichtige Lebenserfahrung, die zum Wachsen und Reifen gehört. Dazu haben wir kein Recht - auch wenn wir das wohlbekannte „Beste” für sie wollen. Weil wir das wollen, sind wir bemüht, von Anfang an ein Grundvertrauen aufzubauen, das prägend für das ganze Leben ist.
Um uns in die kindliche Gedanken- und Gefühlswelt einfinden zu können, betrachten wir einmal ihre Entwicklung:
Ein Kinderleben ist durchaus nicht rosarot und harmonisch. Schon die Geburt macht Angst, danach kommen Hunger und Durst, Dunkelheit und Blähungen, Einsamkeit und ein riesiger Berg von Unbekanntem. Die Liebe der Eltern und die Geborgenheit ist schon für das Baby lebensnotwendig.
Das Kleinkind ist sehr ich-bezogen, das wissen alle Eltern nur zu gut. Ein Zweijähriges ist fest davon überzeugt: Die Sonne scheint nur, weil ich heute mit meinem neuen Dreirad fahren möchte!
Mit wachsendem Verstand findet das Kind Zusammenhänge außerhalb seiner Person und das große Entdecken, Fragen und Lernen beginnt.
Etwas später empfindet es dunkel, dass es in einer Beziehung zu seiner Umwelt steht, dass es einen großen Rahmen gibt, in dem jeder Mensch seinen Platz hat. In Worte fassen lässt sich das natürlich nur sehr schwer.
Bis Zeitbegriffe erkannt werden, dauert es noch, und Vaters Arbeitszeit erscheint „unendlich” lang. Während dieser Phase kann der Tod in seiner Endgültigkeit noch nicht ermessen werden. Ein wenig später wird dies jedoch bewusst. Die Tatsache, dass Oma nicht wiederkommt, wird allerdings ohne großes Fragen akzeptiert.
Erst im Kindergartenalter beginnen die vielen Fragen, dann hat das Kind den Wunsch, etwas zu durchschauen. Während dieser Phase ist es von der Vergänglichkeit des Körpers nicht sonderlich beeindruckt - einem Grundschulkind allerdings wird dieser Gedanke fürchterlich vorkommen.
Dies ist nun die Zeit, in der das eigene Leben betrachtet und in Frage gestellt wird, in der das Kind Parallelen sucht zwischen früher, heute und morgen. Erschrecken Sie nicht, wenn Ihr Kind Todesanzeigen liest, es ist auch eine Form der Auseinandersetzung.
Wieder ein paar Jahre später kommen dann ethische Wertvorstellungen hinzu.
Mit solchen Gedanken im Hinterkopf lassen sich ein paar einfache „Regeln” aufstellen:
Sprechen Sie überzeugt
Wählen Sie Ihre eigenen Worte, übernehmen Sie keine Phrasen. Das Kind spürt das und wird es als unglaubwürdig empfinden
Wählen Sie die Worte und den Zeitpunkt (Alter und Entwicklung) richtig
Zeigen Sie Ernsthaftigkeit nicht durch eine „Trauerflorstimme”, sondern indem Sie ihrem Kind in die Augen schauen
Haben Sie gerade keine Zeit (Supermarkt?) - dann nehmen Sie die nächste Gelegenheit wahr, vergessen Sie es nicht
Schicken Sie das Kind nicht weiter („Der Papa weiß das besser...”). Denken Sie daran: das Kind hat SIE ausgewählt, das ist so etwas ähnliches wie der Nobelpreis und den weist man auch nicht zurück...
Sprechen Sie in einfachen und kurzen Sätzen
Vermeiden Sie weit hergeholte Beispielgeschichten
Antworten Sie nur auf die Frage. Wenn wieder Platz im Köpfchen ist, kommt das Kind von selbst wieder Stellen Sie ruhig eine! kleine Gegenfrage: „Wie stellst du es dir vor“? Dann sind Sie sicher, dass es die Frage richtig versteht, Sie wissen von den Vorstellungen des Kindes und überfordern es nicht
Fragen Sie auch, woher das Kind sein „Wissen” bezieht. Kindergarten, Schule, Spielplatz, Fernsehen? „Das verstehst du nicht!” sagen Sie natürlich nicht. Passen Sie statt dessen Ihre Erklärung an, so dass sie verstanden wird
Vermeiden Sie jede Art von Wertung („Der Herr Maier hat nicht Recht“ oder „Sabine soll nicht so dummes Zeug reden“)
Natürlich dürfen Sie antworten: „Das weiß ich nicht!” Aber nur, wenn Sie hinzufügen, warum nicht. Und nur, wenn es nicht zur Standardantwort wird. Denn sonst sind wir wieder am Anfang des Kapitels!
Ich bin sicher, dass es Ihnen gelingt, Ihr Wohlwollen ohne Worte zu vermitteln, so dass das Kind sich „traut” seine Fragen zu stellen. dass es die Sicherheit hat, dass es gar nichts Verkehrtes fragen kann.