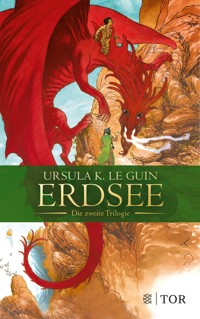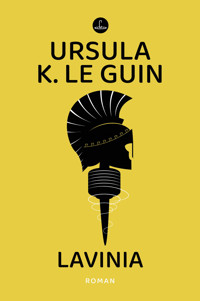
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Memoranda Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Carcosa
- Sprache: Deutsch
Lavinia, die Tochter des Königs von Laurentum, wird von den Fürsten der umliegenden Ländereien umworben, doch das Schicksal hat ihr bestimmt, dass sie einen Fremden heiraten soll. Dieser Fremde heißt Aeneas, ist nach dem Trojanischen Krieg um die halbe Welt gereist und langt nun an der italischen Küste an. Zusammen mit seinem großen Gefolge lässt er sich dort nieder. Neuankömmlinge und Einheimische ringen um ein gutes Miteinander, doch ein blutiger Konflikt scheint unvermeidbar. Die Verantwortung, einen Weg zum Frieden zu finden, lastet auf den Schultern der Königstochter. Diese allerdings hat ganz andere Vorstellungen von der Rolle, die ihr zugedacht ist. "Lavinia" ist weit mehr als eine bloße Neuerzählung von Vergils Aeneis aus weiblicher Sicht. Ursula K. Le Guin schildert auf einfühlsame, zutiefst poetische Weise, wie eine selbstbewusste junge Frau sich der überwältigenden Wirkmacht des Schicksals entgegenstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aus dem
amerikanischen Englisch
übersetzt von
Matthias Fersterer
Impressum
Deutsche Erstausgabe
Titel der Originalausgabe: Lavinia
Erstmals erschienen 2008 bei Harcourt in New York
Die Arbeit des Übersetzers an diesem Text wurde
vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
© 2008 by Ursula K. Le Guin
© der Übersetzung 2025 by Matthias Fersterer
© der Landkarte 2025 by Jeff Mathison
© dieser Ausgabe 2025 by Carcosa Verlag, Wittenberge
Alle Rechte vorbehalten
Mit freundlicher Genehmigung der Agentur Paul & Peter Fritz, Zürich, und der Agentur Ginger Clark Literay, Orange, New York // Verlag und Herausgeber danken Jeff Mathison für die gute Zusammenarbeit // Unser besonderer Dank gilt Helmut W. Pesch für die stilvolle Einarbeitung der deutschen Begriffe in die Landkarte
Carcosa Verlag ist ein verschwistertes Imprint von
Memoranda Verlag | Hardy Kettlitz | Ilsenhof 12 | 12053 Berlin
www.carcosa-verlag.de | www.memoranda.eu
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns ausdrücklich vor.
Lektorat: Karen Nölle
Korrektorat: Franz-Josef Knelangen
Umschlaggestaltung: s.BENeš [www.benswerk.com]
Layout & Satz: Hardy Kettlitz
ISBN: 978-3-910914-44-5 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-910914-45-2 (E-Book)
LAVINIA
sola domum et tantas servabat filia sedes,
iam matura viro, iam plenis nubilis annis.
multi illam magno e Latio totaque petebant
Ausonia …
Eine Tochter nur, reif nun für einen Mann,
volljährig nun und heiratsfähig, führte den großen
Haushalt. Viele aus dem weiten Latium und
aus ganz Ausonien umwarben sie …
Im Mai meines neunzehnten Jahres ging ich zu den Salzgärten an der Flussmündung, um Salz für den Opferschrot zu holen. Tita und Maruna begleiteten mich, und mein Vater schickte einen alten Haussklaven und einen Jungen mit Esel, um das Salz nach Hause zu tragen. Es sind nur ein paar Meilen die Küste hinauf, aber wir wollten dort übernachten, weshalb wir den armen kleinen Esel mit Vorräten bepackt hatten und den ganzen Tag brauchten, um dort anzukommen und unser Lager auf einer grasbewachsenen Düne über dem Strand von Mündung und Meer aufzuschlagen. Wir fünf aßen ums Feuer geschart, erzählten Geschichten und sangen Lieder, während die Sonne im Meer versank und der Mainebel blauer und blauer wurde. Dann schliefen wir unter dem Seewind.
Ich erwachte im ersten Dämmerlicht. Die anderen schliefen noch fest. Die Vögel stimmten gerade ihren Morgenchor an. Ich stand auf und ging hinunter zur Flussmündung. Dort schöpfte ich ein wenig Wasser, goss es als Opfergabe zurück, bevor ich trank, und sagte den Namen des Flusses, Tiber, Vater Tiber, und auch seine alten, geheimen Namen, Albu, Rumon. Dann trank ich, und mir schmeckte das leicht brackige Wasser. Der Himmel war jetzt so hell, dass ich die langen, schweren Wellen an der Sandbank, wo sich Flussstrom und Flut trafen, erkennen konnte.
Weiter draußen auf dem dämmrigen Meer sah ich Schiffe – große schwarze Schiffe, hintereinander von Süden kommend, bogen in die Flussmündung ein. Seitlich hoben und senkten sich lange Reihen Ruder wie Flügelschlag im Zwielicht.
Ein Schiff nach dem anderen durchschnitt die Wellen vor der Sandbank, stieg und fiel, eines nach dem anderen hielt geradewegs auf mich zu. Ihre langen, gebogenen, dreimal gefächerten Schiffsschnäbel waren aus Bronze. Ich kauerte mich in den salzigen Uferschlick. Das erste Schiff fuhr in den Fluss ein, an mir vorbei, zog dunkel über mir dahin, stetig im Takt der fließend dumpfen Ruderschlägen auf dem Wasser. Die Gesichter der Ruderer waren beschattet, aber ein Mann auf dem hohen Achterdeck zeichnete sich gegen den Morgenhimmel ab, blickte voraus.
Sein Gesicht ist ernst, aber unbewehrt; er schaut nach vorn ins Dunkel, er betet. Ich weiß, wer er ist.
Als das letzte Schiff mit dem weich wuchtenden Auf und Ab der Ruder an mir vorüberfuhr und inmitten der dicht bewaldeten Ufer verschwand, sangen die Vögel überall laut, und der Himmel über den Hügeln im Osten war hell. Ich kletterte wieder zu unserem Lager hinauf. Niemand war wach; die Schiffe hatten sie im Schlaf passiert. Ich erzählte ihnen nicht, was ich gesehen hatte. Wir gingen hinunter zu den Salzpfannen und gruben von dem schlammig grauen Schlick genug für einen Jahresvorrat Salz aus, luden ihn in die Körbe der Esel und machten uns auf den Heimweg. Ich gönnte ihnen keine Pause, und sie murrten und trödelten ein wenig, aber wir waren reichlich vor dem Mittag zu Hause.
Ich ging zum König und sagte: »Eine große Flotte Kriegsschiffe ist im Morgengrauen den Fluss hinaufgefahren, Vater.« Er sah mich traurig an. »So bald«, war alles, was er sagte.
Ich weiß, wer ich war, ich kann dir erzählen, wer ich gewesen sein könnte, jetzt aber existiere ich nur in dieser Folge von Wörtern, die ich niederschreibe. Ich bin mir des Wesens meiner Existenz nicht sicher und staune, dass ich schreibe. Gewiss, ich spreche Latein, aber habe ich es je schreiben gelernt? Unwahrscheinlich. Eine Person meines Namens, Lavinia, hat es zweifellos gegeben, aber sie mag sich so sehr von der Vorstellung, die ich von mir habe oder die mein Dichter von mir hatte, unterschieden haben, dass es mich bloß durcheinanderbringt, an sie zu denken. Soweit ich weiß, hat mein Dichter mir überhaupt erst Realität verliehen. Bevor er schrieb, war ich eine völlig nebulöse Figur, kaum mehr als ein Name in einem Stammbaum. Er machte mich lebendig, machte mich zu mir selbst und versetzte mich so in die Lage, mich an mein Leben und an mich selbst zu erinnern, und das tue ich, lebhaft, mit allen möglichen Gefühlen, die ich intensiv spüre, während ich schreibe, vielleicht ja deshalb, weil die Geschehnisse, an die ich mich erinnere, erst Wirklichkeit werden, wenn ich sie aufschreibe oder indem er sie aufschrieb.
Aber er hat sie nicht aufgeschrieben. In seinem Gedicht hat er mein Leben ausgespart. Er gab mir so wenig Raum, weil ihm erst im Sterben aufging, wer ich war. Ihm ist kein Vorwurf zu machen. Es war zu spät, als dass er ergänzen, überdenken, die Halbsätze vervollständigen, das Gedicht, das er für unvollendet hielt, hätte vollenden können. Ich weiß, es dauerte ihn; ich dauerte ihn. Dort, wo er jetzt ist, dort unten jenseits der Dunkelflüsse, wird ihm vielleicht jemand erzählen, dass auch Lavinia um ihn trauert.
Ich sterbe nicht. Dessen bin ich mir fast sicher. Mein Leben ist zu sehr in der Schwebe, um zu etwas so Unbedingtem wie dem Tod zu führen. Ich habe nicht genug echte Sterblichkeit. Zweifelsohne werde ich letzten Endes vergehen und in Vergessenheit geraten, so wie es mir schon längst ergangen wäre, wenn der Dichter mich nicht ins Leben gerufen hätte. Vielleicht werde ich dann zu einem falschen Traum, der wie eine Fledermaus kopfüber am Blattwerk des Baums vor dem Tor zur Unterwelt hängt, oder zu einer Eule, die durch die dunklen Eichen von Albunea huscht. Ich werde mich aber nicht vom Leben losreißen und ins Dunkel gehen müssen wie er, armer Mann, zuerst in seiner Phantasie, dann als sein eigener Schatten. Wir alle müssen unser Nachleben durchdauern, sagte er einmal zu mir, oder zumindest lässt sich das, was er zu mir sagte, so deuten. Aber drunten in der Unterwelt so trüb dahinzudämmern und darauf zu warten, vergessen oder wiedergeboren zu werden – das ist kein wahres Sein, noch nicht einmal ein halbwahres, so wie jenes, von dem ich hier schreibe und von dem du liest, und nicht einmal ansatzweise so wahr wie in seinen Worten, den glänzenden, lebendigen Worten, in denen ich seit Jahrhunderten lebe.
Und doch ist meine Rolle darin, das Leben, das er mir in seinem Gedicht verlieh, so glanzlos, außer in dem einen Augenblick, als mein Haar Feuer fängt – so farblos, außer wenn meine Mädchenwangen erröten wie Elfenbein, mit Purpurfarbe befleckt – so kreuzbrav, dass ich es nicht mehr aushalte. Wenn ich schon Jahrhundert um Jahrhundert weiterexistieren muss, dann muss ich wenigstens einmal ausbrechen und sprechen. Er ließ mich kein einziges Wort sagen. Ich muss ihm das Wort abnehmen. Er gab mir ein langes, aber kleines Leben. Ich brauche Raum, brauche Luft. Meine Seele streckt sich bis in die alten Wälder meines Italiens, hoch in die sonnenbeschienenen Hügel, in die Lüfte des Schwans und der wahr sprechenden Krähe. Meine Mutter war verrückt, ich nicht. Mein Vater war alt, ich jung. So wie Helena von Sparta verursachte ich Krieg. Sie den ihren, weil sie zuließ, dass Männer, die sie wollten, sie entführten. Ich den meinen, weil ich mich nicht vergeben, mich nicht nehmen ließ, sondern meinen Mann und mein Schicksal selbst wählte. Der Mann wurde berühmt, das Schicksal dunkel; keine schlechte Bilanz.
Trotzdem glaube ich manchmal, dass ich schon längst tot sein muss und diese Geschichte in einem Teil der Unterwelt, von dem wir noch nichts wussten, erzähle – ein trügerischer Ort, an dem wir meinen, wir wären lebendig, würden alt, erinnerten uns an unsere Jugend, als die Bienen schwärmten und mein Haar Feuer fing, als die Troer kamen. Wie nämlich kann es überhaupt sein, dass wir alle miteinander sprechen können? Ich erinnere mich, wie die Fremden vom anderen Ende der Welt den Tiber hinauffuhren, in ein Land, von dem sie nichts wussten: Ihr Gesandter kam ins Haus meines Vaters und hielt geschliffene Reden in fließendem Latein. Wie ist das möglich? Können wir alle alle Sprachen? Das kann nur für die Toten gelten, deren Land unter allen anderen Ländern liegt. Wie kommt es, dass du mich, die ich vor fünfundzwanzig oder dreißig Jahrhunderten lebte, verstehst? Kannst du Latein?
Dann wieder glaube ich, nein, es hat nichts mit Totsein zu tun, nicht das Totsein ermöglicht uns, einander zu verstehen, sondern die Dichtung.
Wenn du mich getroffen hättest, da ich noch als Mädchen zu Hause lebte, dann hättest du wohl denken können, das blasse Bild, das mein Dichter von mir zeichnete, wie mit Messinggriffel in eine Wachstafel skizziert, wäre völlig hinreichend: Mädchen, Königstochter, heiratsfähige Jungfer, keusch, still, gehorsam, bereit, sich dem Willen eines Manns zu fügen, bereit wie ein Feld im Frühjahr für den Pflug.
Ich habe nie gepflügt, aber unseren Bauern mein Leben lang dabei zugesehen: Der weiße Ochse trottet im Joch voran, der Mann packt den langen hölzernen Sterz, der bockt und sich aufbäumt, während er versucht, die Schar in Erde zu zwingen, die so sanft, so bereit aussieht und doch so hart, so fest ist. Unter Einsatz seines ganzen Gewichts und seiner ganzen Kraft müht er sich ab, einen Kratzer zu machen, tief genug, um das Gerstenkorn zu halten. Er plagt sich, bis er ganz außer Atem ist, vor Erschöpfung zittert und sich nur noch in die Furche legen und auf der harten Brust seiner Mutter zwischen den Steinen schlafen möchte. Ich musste nie pflügen, hatte aber auch eine abweisende Mutter. Die Erde wird den Pflüger am Ende in die Arme nehmen und tiefer schlafen lassen als das Gerstenkorn, meine Mutter aber hatte keine Umarmung für mich.
Ich war still und sanft, denn wenn ich das Wort ergriffen, meinen Willen gezeigt hätte, dann hätte sie sich womöglich daran erinnert, dass ich nicht meine Brüder war, und darunter hätte ich zu leiden gehabt. Ich war sechzehn, als sie starben, der kleine Latinus und der Säugling Laurens. Sie waren meine Lieblinge, meine Püppchen gewesen. Ich spielte mit ihnen, vergötterte sie. Meine Mutter Amata wachte lächelnd über uns, während die Spindel in ihren Fingern sich hob und senkte. Sie ließ uns nicht bei unserem Kindermädchen Vestina und den anderen Frauen, wie es sich für eine Königin geziemt hätte, sondern blieb aus Liebe den ganzen Tag bei uns. Oft sang sie, während wir spielten. Manchmal hielt sie mit dem Spinnen inne, sprang auf, nahm mich und Latinus bei der Hand, tanzte mit uns, und wir lachten alle. »Meine Krieger«, nannte sie die Jungen, und ich dachte, sie würde auch mich Krieger nennen, weil sie so glücklich war, wenn sie sie so nannte, und ihr Glück auch unseres war.
Wir wurden krank: zuerst der Säugling, dann Latinus mit seinem runden Gesicht, seinen großen Ohren und klaren Augen, dann ich. Ich erinnere mich an die seltsamen Fieberträume. Mein Großvater, der Specht, flog zu mir, klopfte an meinen Kopf, und ich schrie vor Schmerz. Nach einem Monat ging es mir besser, ich wurde wieder gesund; aber das Fieber der Jungen sank und stieg, sank and stieg. Sie wurden dünn, siechten dahin. Erst schienen sie auf dem Weg der Besserung, Laurens trank in vollen Zügen an der Brust meiner Mutter, Latinus kroch aus dem Bett, um mit mir zu spielen. Dann kam das Fieber wieder und packte sie. Eines Nachmittags hatte Latinus Krämpfe, das Fieber war ein Hund, der eine Ratte zu Tode schüttelt, er wurde zu Tode geschüttelt, der Kronprinz, die Hoffnung Latiums, mein Spielgefährte, mein Liebling. In der Nacht darauf schlief das dünne Brüderchen ruhig, das Fieber war gesunken; am nächsten Morgen starb es in meinen Armen, rang nach Luft, zitterte wie ein Kätzchen. Und meine Mutter wurde verrückt vor Kummer.
Mein Vater sollte nie verstehen, dass sie verrückt war.
Er trauerte bitterlich um seine Söhne. Er war ein warmherziger Mann, und die Jungen waren, aus Sicht eines Mannes, seine Nachkommen. Er weinte um sie, zuerst laut, dann lange Jahre in Stille. Zur Linderung hatte er seine königlichen Pflichten und die Riten zu vollziehen, fand Trost in den wiederkehrenden Ritualen und Rückhalt durch die alten Ahnengeister seines Hauses. Und ich war ihm Trost, vollzog als Königstochter die Rituale mit ihm; und er liebte mich sehr, sein erstgeborenes, spätgeborenes Kind. Denn er war viel älter als meine Mutter.
Sie war achtzehn, als sie heirateten, er vierzig. Sie war eine Prinzessin der Rutuler aus Ardea, er der König von ganz Latium. Sie war schön, leidenschaftlich und jung; er ein Mann in den besten Jahren, gutaussehend und stark, ein siegreicher Krieger, der den Frieden liebte. Es hätte eine sehr glückliche Verbindung werden können.
Er warf ihr nicht vor, dass die Jungen gestorben waren. Er warf mir nicht vor, dass ich nicht gestorben war. Er trug seinen Verlust und setzte die Hoffnung, die in seinem Herz verblieben war, auf mich. Er machte weiter, von Jahr zu Jahr grauer und grimmiger, aber nie lieblos, nie schwach, außer wenn es um meine Mutter ging: Er ließ sie gewähren, ignorierte ihre Willkür, schwieg zu ihrer Tobsucht.
Ihr tosender Schmerz fand keine menschliche Antwort. Sie war mit einem Mann zurückgeblieben, der ihr weder zuhören noch mit ihr sprechen konnte, mit einer sechsjährigen schluchzenden Tochter und vielen elenden, angsterfüllten Frauen, die, wie es für Bedienstete und Sklavinnen nur angebracht ist, fürchteten, dass sie für den Tod der Kinder bestraft werden könnten.
Für ihn hatte sie nur Verachtung übrig; für mich nur Zorn.
Ich kann mich an jedes einzelne Mal erinnern, als ich die Hand oder den Körper meiner Mutter berührt habe oder sie mich berührt hat, seit meine Brüder gestorben waren. Sie schlief nie wieder in dem Bett, in dem sie und mein Vater uns gezeugt hatten.
Nachdem sie viele Tage ihr Gemach nicht verlassen hatte, tauchte sie wieder auf, scheinbar kaum verändert, prächtig wie eh und je, mit glänzendem schwarzen Haar, cremeweißem Gesicht, stolzem Auftreten. In Gesellschaft war sie stets unnahbar und ein wenig hochmütig gewesen; sie spielte die Königin unter den Gemeinen, und ich staunte, wie sie mit den Männern, die ins Haus des Königs drängten, so ganz anders umging als spinnend, singend, lachend, tanzend mit uns Kindern. Gegenüber den Hausleuten war ihr Betragen gebieterisch, eigensinnig, hitzig gewesen, aber diese verehrten sie, weil sie nicht gehässig war. Nun begegnete sie ihnen wie uns meist kalt und ungerührt. Wenn aber ich oder mein Vater sprachen, dann sah ich oft den Hass in ihrem Gesicht, den verzweifelten, angewiderten Zorn, bevor sie den Blick abwandte.
Sie trug die Bullas der Jungen um den Hals, kleine Amulettbeutel mit einem winzigen tönernen Phallus, den Jungen als Glücksbringer und Schutzzauber tragen. Sie bewahrte die Bullas in goldenen Amuletten unter ihrer Kleidung auf. Sie nahm sie nie ab.
Die Wut, die sie in Gesellschaft verbarg, schlug mir oft im Frauenflügel des Hauses als heftige Gereiztheit entgegen. Der Spitzname »Kleine Königin«, mit dem mich viele ansprachen, erzürnte sie besonders, und bald nannte mich niemand mehr so. Sie sprach nicht oft mit mir, wenn ich sie aber verärgerte, dann wandte sie sich plötzlich gegen mich und gab mir in barschem Tonfall zu verstehen, dass ich dämlich, hässlich, lächerlich ängstlich sei. »Du fürchtest dich vor mir. Ich hasse Feiglinge«, sagte sie. Manchmal versetzte sie meine Gegenwart in regelrechte Raserei. Dann schlug sie auf mich ein oder schüttelte mich, sodass mein Kopf vor und zurück ruckte. Einmal zerkratzte sie mir im Zorn das Gesicht mit den Fingernägeln. Vestina zog mich weg von ihr, brachte sie in ihr Gemach, beruhigte sie und eilte zurück, um die langen, blutenden Risse in meiner Wange abzuwaschen. Ich war zu überwältigt, um zu weinen, aber Vestina schluchzte um meinetwillen, während sie Salbe auf die Wunden strich. »Es wird keine Narben geben«, sagte sie unter Tränen: »Bestimmt wird es keine Narben geben.«
Ruhig antwortete meine Mutter vom Lager ihres Schlafgemachs: »Das ist gut.«
Vestina sagte mir, dass ich erzählen sollte, die Katze hätte mich gekratzt. Als mein Vater mein Gesicht sah und wissen wollte, was passiert war, sagte ich: »Silvias alte Katze hat mich gekratzt. Ich hielt sie zu fest an mich gedrückt, als ein Hund vorbeikam und sie erschreckte. Es war nicht ihr Fehler.« Wie Kinder so sind, fing ich an, die Geschichte selbst halb zu glauben, und schmückte sie mit allen möglichen Einzelheiten aus, etwa, dass ich allein war, als es passierte, im Eichenhain, gleich bei Tyrrhus’ Gehöft, und den ganzen Heimweg über gerannt war. Ich wiederholte, dass weder Silvia noch der Katze etwas vorzuwerfen war. Ich wollte nicht, dass die beiden in Schwierigkeiten gerieten. Könige bestrafen schnell, als Mittel gegen ihre Angst. Silvia war meine liebste Freundin und Spielgefährtin, und die alte Hofkatze säugte einen Wurf Kätzchen, der ohne sie gestorben wäre. Also musste es allein mein Fehler sein, dass mein Gesicht zerkratzt war. Und Vestina hatte recht: Ihre Beinwellsalbe war gut; die langen roten Furchen verschorften, heilten und ließen keine Narbe zurück, außer einer schwachen Silberspur auf dem linken Wangenknochen unterhalb des Auges. Der Tag wird kommen, an dem Aeneas die Narbe mit dem Finger nachfährt und mich fragt, woher sie stammt. »Eine Katze hat mich gekratzt«, antworte ich. »Ich hielt sie, und ein Hund hat sie erschreckt.«
Ich weiß, dass weit größere Könige weit größerer Reiche kommen werden als Latinus von Latium, mein Vater. Flussauf bei Sieben Hügeln waren früher zwei kleine, mit Erdwällen befestigte Ortschaften, Janiculum und Saturnia; dann kamen griechische Siedler, bauten am Hang und nannten ihre befestigte Siedlung Pallanteum. Mein Dichter versuchte, mir diesen Ort so zu beschreiben, wie er ihn kannte, als er noch lebte, oder besser, wie er ihn kennen wird, wenn er einst leben wird, denn obwohl er im Sterben lag, als er zu mir kam, und nun schon lange tot ist, wurde er noch nicht geboren. Er ist bei denen, die jenseits des Flusses des Vergessens warten. Noch hat er mich nicht vergessen, wird mich aber vergessen haben, wenn er schließlich geboren werden und durch das milchig trübe Wasser schwimmen wird. Wenn er sich mich dann erstmals vorstellt, wird er nicht wissen, dass er mir einst im Wald von Albunea begegnen wird. Auf jeden Fall erzählte er mir, dass künftig dort, wo jetzt das Dorf ist, die Sieben Hügel und die Senken dazwischen samt allen Flussufern über Meilen hinweg von einer unvorstellbaren Stadt bedeckt sein werden. Dort wird es prächtige Tempel aus Marmor und Gold auf den Hügelkuppen geben, breite Bogentore, unzählige Figuren, aus Marmor gehauen und aus Bronze gegossen; mehr Menschen werden an einem Tag über das Forum dieser Stadt gehen, sagte er, als ich zu meinen Lebzeiten in allen Ortschaften und Gehöften, auf allen Wegen, Festen und Schlachtfeldern Latiums je zusammen sehen würde. Der König jener Stadt wird der größte Gebieter der Welt sein, so groß, dass er den Namen König verachten und nur als der kraft heiliger Macht eingesetzte hehre Herrscher, als Augustus, bekannt werden wird. Alle Völker aller Länder werden vor ihm niederknien und ihm Tribut zollen. Das glaube ich, weiß ich doch, dass mein Dichter immer die Wahrheit sagt, wenn auch nicht immer die ganze. Nicht einmal ein Dichter kann die ganze Wahrheit sagen.
Aber in meiner Kindheit war seine große Stadt eine schmucklose kleine Siedlung, gebaut an den Hang eines felsigen Hügels, von Höhlen durchzogen und von dichtem Gestrüpp überwachsen. Ich war einmal mit meinem Vater dort, eine Tagesfahrt flussauf mit dem Westwind. Der dortige König, Euander, ein Verbündeter von uns, war aus Griechenland geflohen und auch hier in Schwierigkeiten geraten – er hatte einen Gast getötet. Dafür hatte er hinreichend Grund gehabt, aber so etwas vergisst unser Landvolk nicht. Er war dankbar für die Gunst meines Vaters und tat sein Bestes, um uns zu bewirten, lebte aber viel ärmlicher als unsere wohlhabenden Bauern. Pallanteum war ein dunkles Palisadendorf, dicht gedrängt unter Bäumen zwischen dem breiten gelben Fluss und den bewaldeten Hügeln. Natürlich bereiteten sie uns ein Festmahl, Rind und Reh, servierten es aber höchst seltsam: Wir mussten auf Bänken an schmalen Tischen liegen, anstatt alle gemeinsam an einer Tafel zu sitzen. So machen es die Griechen. Und das heilige Salz und der heilige Schrot standen nicht auf dem Tisch. Das trieb mich während des gesamten Festmahls um.
Euanders Sohn Pallas, der ungefähr in meinem Alter war, damals elf oder zwölf, ein netter Junge, erzählte mir die Geschichte eines bestialischen Riesen, der einst oben in einer Höhle hauste und nur im Zwielicht herauskam, um Vieh zu stehlen und Leute in Stücke zu reißen. Er wurde nur selten gesehen, hinterließ aber große Fußabdrücke. Ein griechischer Held namens Hercle war vorbeigekommen und hatte den Riesen getötet. Wie er geheißen habe, fragte ich. Cacus, antwortete Pallas. Ich wusste, dass das der Feuerhüter war, der Anführer einer Klanschaft, der für die Leute aus der Umgebung mit Hilfe seiner Töchter dafür sorgte, dass Vesta weiter brannte, so wie mein Vater. Aber ich wollte der Geschichte des Griechen, die viel spannender war als meine, nicht widersprechen.
Pallas fragte mich, ob ich die Höhle einer Wölfin sehen wollte, und ich sagte ja. Er führte mich zu einer Höhle namens Lupercal, ganz in der Nähe des Dorfs. Sie war Pan geweiht, sagte er, so nannten die Griechen wohl unseren Großvater Faunus. Auf jeden Fall ließen die Siedler Wölfin und Welpen wohlweislich in Ruhe, und auch sie ließ die Siedler in Ruhe. Sie griff nicht einmal ihre Hunde an, obwohl Wölfe Hunde hassen. Es gab reichlich Wild für sie in jenen Hügeln. Hie und da riss sie im Frühling ein Lamm. Dies wurde als Opfergabe betrachtet, und wenn sie kein Lamm riss, opferten sie ihr einen Hund. Ihr Rüde war im vergangenen Winter verschwunden.
Es war wohl nicht das Klügste, dass zwei Kinder am Eingang ihrer Höhle standen, denn sie hatte Welpen und war da. Die Höhle roch sehr streng. Im Innern war es stockdunkel und still. Während ich mich an die Finsternis gewöhnte, sah ich die beiden kleinen, unbewegten Feuer ihrer Augen. Sie stand da, zwischen uns und ihren Jungen.
Pallas und ich wichen langsam zurück, ohne unseren Blick von ihren Augen abzuwenden. Ich wollte nicht gehen, obwohl ich wusste, dass ich sollte. Schließlich drehte ich mich um und folgte Pallas, wenn auch langsam. Ich blickte noch oft zurück, um zu sehen, ob die Wölfin aus ihrem Bau herauskäme und dunkel, mit durchgedrückten Läufen dastände, die liebevolle Mutter, die grimme Königin.
Bei diesem Besuch auf den Sieben Hügeln verstand ich, dass mein Vater ein viel größerer König als Euander war. Später wurde mir klar, dass er zu seiner Zeit mächtiger als alle Könige hier im Westen war, auch wenn er, verglichen mit dem hehren Herrscher, der noch kommen sollte, vielleicht nichtig war. Er hatte sein Reich mit straffer Hand durch Krieg und Grenzsicherung errichtet, lange bevor ich geboren wurde. In meiner Kindheit gab es keine nennenswerten Kriege. Lange war Friede. Gewiss, es gab Fehden und Kämpfe zwischen den Bauern und an den Grenzen. Wir sind ein rauer Menschenschlag, aus Eiche geboren, wie es hier im westlichen Land heißt; die Gemüter sind hitzig, Waffen stets zur Hand. Gelegentlich musste mein Vater eingreifen, um einen Bauernzwist, der zu ungestüm geworden war oder ausuferte, zu schlichten. Er hatte kein stehendes Heer. Mars lebt in den Ackerfurchen und an den Ackergrenzen. Wenn es Schwierigkeiten gab, rief Latinus seine Bauern von den Feldern, und sie kamen mit den alten Bronzeschwertern und Lederschilden ihrer Väter, bereit, bis zum Tod für ihn zu kämpfen. Wenn sie den Streit beigelegt hatten, kehrten sie auf ihre Felder und er in sein hohes Haus zurück.
Das hohe Haus, die Regia, war der große Schrein der Stadt, ein heiliger Ort, denn unsere Schutzgottheiten der Vorräte und unsere Ahnen waren zugleich die Penaten und Laren der Stadt und des Volks. Leute aus ganz Latium kamen, um mit dem König zu beten, zu opfern und zu tafeln. Das hohe Haus war von weither in der Landschaft zu sehen, ragte zwischen großen Bäumen über die Mauern, Türme und Dächer.
Die Mauern von Laurentum waren hoch und stark, weil es, anders als die meisten Städte, nicht auf einem Hügel errichtet worden war, sondern auf dem fruchtbaren Flachland, das zu den Lagunen und zum Meer hin abfiel. Graben und Erdwall waren umgeben von Äckern und Weiden, und vor dem Stadttor lag eine weite offene Fläche, auf der sich Athleten übten und Männer ihre Pferde abrichteten. Wer aber durch das Tor Laurentums ging, ließ Sonne und Wind hinter sich und trat in tiefen, wohlriechenden Schatten ein. Die Stadt war ein großer Hain, ein Wald. Jedes Haus stand zwischen Eichen, Feigen, Ulmen, schlanken Pappeln und ausladenden Lorbeerbäumen. Die Straßen waren schattig, belaubt und schmal. Die breiteste Straße führte hinauf zum Haus des Königs, das groß und stattlich auf hundert Säulen aus Zedernholz thronte.
Auf einem Regal an den Wänden des Eingangsflurs waren Bildnisse aufgereiht, vor Jahren von einem etruskischen Verbannten als Gabe für den König geschnitzt. Es waren Geister, Ahnen – der zweigesichtige Janus, Saturnus, Italus, Sabinus, Großvater Picus, der zwar in den rotköpfigen Specht verwandelt worden war, dessen Statue ihn aber in einer steif geschnitzten Toga zeigte, den heiligen Stab und Schild in der Hand –, eine Doppelreihe grimmig wirkender Figuren aus gesprungener und geschwärzter Zeder. Sie waren nicht groß, aber außer den kleinen tönernen Penaten die einzigen menschlichen Abbilder in Laurentum, und sie erfüllten mich mit Angst. Oft kniff ich die Augen zu, wenn ich zwischen diesen langen dunklen Gesichtern mit den leeren, starren Blicken entlanglief, unter Äxten, bebuschten Helmen, Speeren, Riegeln von Stadttoren und Galionsfiguren, alles Kriegstrophäen, an den Wänden aufgehängt.
Der Gang der Abbilder mündete ins Atrium, einen niedrigen, großen, dunklen Raum, das Dach mittig zum Himmel geöffnet. Links lagen der Ratssaal und der Speisesaal, die ich als Kind nur selten betrat, dahinter die königlichen Wohnungen; geradeaus stand der Vesta-Altar, dann kamen die kuppelförmig gemauerten Vorratskammern. Ich bog rechts ab und rannte vorbei an den Küchen, hinaus auf den großen mittigen Innenhof, wo unter dem Lorbeer, den mein Vater in jungen Jahren gepflanzt hatte, ein Brunnen sprudelte. Zitronenbäume, Seidelbastbüsche, Thymian-, Oregano- und Estragonsträucher wuchsen dort in großen Töpfen, und Frauen arbeiteten, plauderten, spannen, webten, spülten Krüge und Schalen im Brunnenbecken. Ich rannte zwischen ihnen unter den Kolonnaden aus Zedernpfeilern hindurch zur Frauenseite des Hauses, zur besten Seite, meinem Heim.
Wenn ich darauf achtgab, die Aufmerksamkeit meiner Mutter nicht auf mich zu ziehen, dann hatte ich nichts zu befürchten. Als ich begann, zur Frau zu reifen, hatte sie manchmal auch freundliche Worte für mich übrig. Und es gab dort viele Frauen, die mich lieb hatten, Frauen, die mir schmeichelten, die alte Vestina, die mich verwöhnte, andere Mädchen, mit denen ich ein Mädchen sein, und kleine Kinder, mit denen ich spielen konnte. Und – ob Frauenflügel oder Männerflügel – es war das Haus meines Vaters und ich nur die Tochter meines Vaters.
Meine beste Freundin war aber kein Mädchen aus der Regia, sondern das jüngste Kind des Viehbauern Tyrrhus, der die Herden meiner und seiner Familie hütete. Das Gehöft war eine Viertelmeile von den Stadttoren entfernt, ein weitläufiges Gelände mit vielen Nebengebäuden, und zwischendrin, eingebettet wie ein alter grauer Ganter inmitten einer Schar Wildgänse, das Haupthaus aus Holz und Stein. Von den Küchengärten zwischen den flachen, von Eichen gekrönten Hügeln ausgehend, erstreckten sich die Pferche, Koppeln und Weiden der Rinder. Der Hof war ein Hort unaufhörlicher Geschäftigkeit, an dem überall den ganzen Tag gearbeitet wurde; wenn aber nicht gerade die Schmiede angefeuert war und der Amboss schallte oder in der Nähe Rinder eingepfercht darauf warteten, kastriert oder zum Markt getrieben zu werden, dann herrschte dort tiefe Ruhe. Das ferne Muhen aus den Tälern und das Gurren der Turteltauben und Ringeltauben aus den Eichenhainen nah dem Haus sorgten für ein unablässig weiches Hallen, in das andere Geräusche einsanken und wieder verhallten. Ich liebte diesen Hof.
Silvia leistete mir zwar manchmal Gesellschaft in der Regia, aber beide waren wir lieber auf ihrem Hof. Im Sommer lief ich fast jeden Tag dorthin. Tita, eine Sklavin, die ein paar Jahre älter war als ich, begleitete mich als die Wächterin, die mein Status als jungfräuliche Prinzessin erforderte, aber sobald wir ankamen, gesellte sich Tita zu ihren Freundinnen auf dem Gehöft, und Silvia und ich rannten los, um auf Bäume zu klettern, den Fluss aufzustauen, mit den Kätzchen zu spielen, Kaulquappen zu fangen oder durch die Wälder und Hügel zu ziehen, frei wie die Spatzen.
Meine Mutter hätte mich lieber zu Hause behalten. »Welchen Umgang pflegt sie? Kuhherden!« Aber mein Vater, ein geborener König, scherte sich nicht um ihren Dünkel. »Lass das Kind laufen und stark werden. Es sind gute Leute«, sagte er. Tyrrhus war ein vertrauenswürdiger, fähiger Mann, der seine Weiden ebenso fest im Griff hatte wie mein Vater sein Reich. Sein aufbrausendes Temperament bekamen nur seine Leute zu spüren; er beging alle Feiertage großzügig, wahrte die Gebräuche und opferte den Geistern des Orts und den heiligen Stätten. In den alten Kriegen hatte er einst an der Seite meines Vater gekämpft und hatte noch immer etwas von einem Krieger an sich. Aber er war warmherzig und butterweich, wenn es um seine Tochter ging. Ihre Mutter war kurz nach ihrer Geburt gestorben, und sie hatte keine Schwestern. Sie wuchs als Liebling ihres Vaters, ihrer Brüder und aller Hausleute auf. In vielerlei Hinsicht war sie mehr Prinzessin als ich. Sie musste nicht jeden Tag stundenlang spinnen oder weben und hatte keine zeremoniellen Pflichten. Die alten Köchinnen führten die Küche, die alten Sklavinnen den Haushalt für sie, die Mädchen putzten den Herd und schürten das Feuer für sie; sie hatte alle Zeit der Welt, frei über die Hügel zu laufen und mit ihren Haustieren zu spielen.
Silvia wusste wunderbar, mit Tieren umzugehen. Abends kamen die kleinen Eulen auf ihr getrillertes Hu-u-u, hi-i-i hin und ließen sich einen Augenblick auf ihrer ausgestreckten Hand nieder. Sie hatte eine junge Füchsin gezähmt; als sie zur Fähe herangewachsen war, ließ sie sie frei, aber die Füchsin brachte Jahr für Jahr ihre Welpen, damit wir sie sehen konnten, und ließ sie im Zwielicht auf dem Gras unter den Eichen umherspringen. Sie zog ein Hirschkalb groß, das ihre Brüder auf der Jagd gefangen hatten, weil die Hunde seine Mutter gerissen hatten. Silvia war zehn oder elf, als sie das Kitz anbrachten. Sie zog es hingebungsvoll auf, und es wurde ein prächtiger Hirsch, zahm wie ein Hund. Er trottete jeden Morgen in den Wald, kam aber stets zur Abendessenszeit zurück; sie ließ ihn in das Esszimmer kommen und von ihrem hölzernen Teller essen. Silvia liebte ihren Cervulus. Sie wusch und bürstete ihn, schmückte sein stattliches Geweih mit Weinranken im Herbst und Blumenkränzen im Frühling. Hirsche können gefährlich sein, dieser aber war sanft und fügsam, vertrauensseliger als ihm guttat. Silvia knüpfte ihm als Erkennungszeichen ein breites weißes Leinenband um den Hals, und alle Jäger in den Wäldern Latiums kannten Silvias Cervulus. Selbst die Jagdhunde erkannten ihn und schlugen nur noch selten auf ihn an, nachdem sie dafür gescholten und bestraft worden waren.
Es war wunderbar, in den Hügeln einen großen Hirsch, die Geweihkrone balancierend, ruhig aus dem Wald auf uns zuschreiten zu sehen. Er kniete sich nieder, legte die Nase in Silvias Hand, faltete die langen, zarten Läufe unter sich ein und lag zwischen uns, während wir seinen Nacken streichelten. Er roch süßlich streng nach Wild. Seine Augen waren groß, dunkel und ruhig; ganz wie Silvias Augen. So war es im Saturnischen Zeitalter, sagte mein Dichter, in der Goldenen Zeit der ersten Tage, als keine Angst in der Welt war. Silvia schien eine Tochter jener Zeit zu sein. Mit ihr auf den sonnigen Hängen zu sitzen oder über die Waldwege, die ihr so vertraut waren, zu laufen, war meine größte Freude. Im ganzen Land unserer Kindheit gab es niemanden, der uns Böses wollte. Landvolk, die Ackerleute, grüßten uns von den Feldern oder den Schwellen ihrer Rundhütten. Der barsche Imker behielt eine Honigwabe für uns zurück, die Meierin hatte einen Schluck Sahne für uns, die Viehhirten spielten sich vor uns auf, indem sie auf Stierkälbern ritten oder über die Hörner einer alten Kuh sprangen, und der alte Schäfer Ino lehrte uns, Hirtenflöten aus Haferstroh zu basteln.
Manchmal im Sommer, wenn der lange Tag sich bis in den Abend zog und wir wussten, dass wir uns auf den Heimweg zum Hof machen sollten, lagen wir beide bäuchlings auf dem Hang und drückten unsere Gesichter ins harsche trockene Gras, in den harten klumpigen Boden und sogen den unendlich vielschichtigen Geruch von süßem Heu und bitterem Humus ein, den Geruch der warmen Sommererde, unserer Erde. Dann waren wir beide Saturns Kinder. Wir sprangen auf und rannten den Hügel hinab, nach Hause – wer schneller an der Furt ist!
Als ich fünfzehn Jahre alt war, besuchte König Turnus meinen Vater. Er war mein Vetter, der Neffe meiner Mutter; sein alter, gebrechlicher Vater Daunus hatte ihm im Jahr zuvor die Krone der Rutuler übergeben, und wir hatten von seiner prächtigen Krönungszeremonie in Ardea, der nächstgelegenen Stadt südlich von Latium, gehört. Die Rutuler waren unsere engen Verbündeten, seit Latinus Daunus’ Schwester Amata geheiratet hatte, aber der junge Turnus schien seinen eigenen Weg gehen zu wollen. Als die Etrusker von Caere ihren Tyrannen Mezentius vertrieben hatten, einen Rohling, dem nichts heilig war, nahm Turnus ihn auf. Ganz Etrurien war erzürnt, dass Turnus einen Tyrannen aufgenommen und beschützt hatte, der seine Macht so übel missbraucht hatte, dass selbst die Laren und Penaten seines Hauses sich von ihm abgewendet hatten. Dies böse Blut beunruhigte uns, weil Caere gleich jenseits des Flusses lag. Die etruskischen Städte waren mächtig, und wir hatten uns nach besten Kräften gut mit ihnen zu stellen.
Mein Vater besprach dies mit mir, während wir zum heiligen Hain von Albunea gingen. Dieser lag östlich von Laurentum, am Fuß der Hügel, eine Tageswanderung entfernt. Wir waren bereits mehrmals gemeinsam dorthin gegangen; ich stand ihm bei den Ritualen bei, in denen er unsere Ahnen und die Mächte des Walds und der Quellen ehrte und günstig stimmte. Auf diesen einsamen Wanderungen sprach er mit mir wie mit seiner Erbin. Auch wenn ich seine Krone nicht würde erben können, sah er keinen Grund, warum ich nicht etwas über Politik und Regierungsführung lernen sollte. Immerhin würde ich nahezu sicher einmal Königin irgendeines Reichs werden. Vielleicht sogar von dem der Rutuler.
Er sprach nicht über diese Möglichkeit, aber die Frauen taten es. Vestina war sich von dem Moment an, als sie von König Turnus’ Besuch hörte, sicher: »Er kommt unserer Lavinia wegen! Er kommt freien!«
Meine Mutter sah Vestina über den großen Korb mit Rohwolle, die wir alle zupften, hinweg scharf an. Wolle zupfen, die Knötchen und Klümpchen eines gewaschenen Vlieses auseinander ziehen, sodass die vereinzelten Fasern kardiert werden konnten, war immer meine liebste Handarbeit; es ist leichtes, gedankenloses Tun, und das saubere Vlies riecht süßlich, die Hände werden weich vom Wollfett, und am Ende türmt sich im Korb eine große, luftige, helle, haarige, flauschige Wolke.
»Genug davon«, sagte meine Mutter. »Nur Bauern sprechen bei Mädchen ihres Alters übers Heiraten.«
»Es heißt, er ist der bestaussehende Mann Italiens«, sagte Tita.
»Und er reitet einen Hengst, den sonst niemand reiten kann«, sagte Picula.
»Und sein Haar ist golden«, sagte Vestina.
»Er hat eine Schwester, Juturna, so schön wie er, aber es heißt, sie habe geschworen, nie den Fluss zu verlassen«, sagte Sabella.
»Was für schwatzhafte Gänse ihr seid!«, sagte meine Mutter.
»Ihr müsst ihn als Kind gekannt haben, Königin?«, fragte Sicana, die Lieblingsdienerin meiner Mutter.
»Ja, er war ein aufgeweckter kleiner Junge«, erwidert Amata. »Mit sehr starkem Willen.« Sie lächelte leicht, wie so oft, wenn sie vom Zuhause ihrer Kindheit erzählte.
Ich stieg hinauf auf den Wachturm an der Südostecke des Hauses, über den königlichen Wohnungen, von dem sich hinunter auf die Straßen und über die Stadtmauern und das Stadttor schauen ließ. Ich sah die Besucher am Tor eintreffen und über die Via Regia heraufkommen, alle zu Pferd mit glänzender Brustplatte und wippendem Kamm. Dann lief ich hinunter ins Atrium und stand bei den Hausleuten, während mein Vater Turnus begrüßte. Ich erhaschte einen langen Blick auf ihn, auf seine Männer und auf seinen hochbebuschten Helm. Er sah prächtig aus, gut gebaut und muskulös, mit lockigem rotbraunem Haar, dunkelblauen Augen und stolzer Haltung. Wenn er einen körperlichen Makel hatte, dann dass er für seinen starken, breiten Brustkorb eher kleingewachsen war, sodass sein Gang ein wenig gockelhaft wirkte. Seine Stimme war tief und klar.
An diesem Abend wurde ich zum Essen in den großen Saal gerufen. Meine Mutter und ich zogen unsere feinsten leichten Gewänder an, während die Frauen um uns herum schnatterten und an unseren Haaren zippelten. Sicana legte für meine Mutter den großen Halsschmuck aus Gold und Granat bereit, Latinus’ Hochzeitsgeschenk für sie, aber sie schob ihn beiseite und legte eine Kette und Ohrringe aus Silber und Amethyst an, ein Abschiedsgeschenk von ihrem Onkel Daunus. Sie wirkte ausgelassen und strahlend. Ich dachte, dass ich mich wie gewöhnlich hinter ihr würde verstecken können, verdeckt und geschützt von ihrer gebieterische Schönheit.
Während des Mahls aber, als Turnus mit meinem Vater und meiner Mutter gesellig Konversation betrieb, sah er mich an. Er starrte nicht, sondern sah mich wieder und wieder mit leichtem Lächeln an. Ich schämte mich wie noch nie. Seine stechenden blauen Augen jagten mir zunehmend Angst ein. Immer wenn ich mich aufzuschauen getraute, sah er mich an.
Bislang hatte ich nicht über Liebe und Heirat nachgedacht. Was gab es da zu überlegen? Wenn es an der Zeit wäre, würde ich verheiratet werden und herausfinden, was es mit Liebe, Kinderkriegen und dem ganze Rest auf sich hatte. Bis dahin machte ich mir keine Gedanken darüber. Silvia und ich neckten einander und scherzten über einen gutaussehenden jungen Bauern, der ihr schöne Augen machte, oder über ihren ältesten Bruder Almo, der manchmal mit uns herumhing, um sich mit mir zu unterhalten; das waren aber bloß Worte, die nichts zu bedeuten hatten. Keiner im Haus, in der Stadt, im ganzen Land durfte mich ansehen, wie Turnus mich gerade ansah. Mein Reich war die Jungfräulichkeit, dort war ich zu Hause, unbehelligt und beschützt. Kein Mann hatte mich je erröten lassen.
Nun spürte ich, wie ich knallrot wurde, von den Haarwurzeln über die Brüste bis zu den Knien. Ich duckte mich vor Scham. Ich konnte nichts essen. Das Belagerungsheer stand vor den Mauern.
Im Porträt des Dichters von mir als scheuer stummer Jungfer hätte Turnus mich zweifelsohne wiedererkannt. Meiner Mutter, neben der ich saß, war mein Unbehagen wohl bewusst, und es schien ihr nicht zu missfallen; sie nahm hin, dass ich mich wegduckte, und plauderte mit Turnus über Ardea. Ich weiß nicht, ob sie meinem Vater ein Zeichen gab oder ob es seine Entscheidung war, aber sobald die Fleischteller abgetragen waren, der Junge die Opfergabe ins Feuer geworfen hatte und die Bediensteten mit Wasserkrügen und Mundtüchern die Runde machten und die Weinkelche zum Nachtisch füllten, bedeutete er meiner Mutter, mich wegzuschicken.
»Wir verlieren die Blüte des Banketts«, wandte der königliche Besucher gefällig ein.
»Das Kind braucht Schlaf«, sagte mein Vater.
Turnus erhob das Glas – den doppelgriffigen Goldkelch von Cures mit eingravierter Jagdszene, Beute von einem der Kriegszüge meines Vaters, unser bestes Stück – und sagte: »Träume süß, schönste der Töchter von Vater Tiber!«
Ich saß da wie gelähmt.
»Ab mit dir«, raunte mir meine Mutter mit der Andeutung eines Lachens zu.
Ich schlüpfte hinaus, so schnell ich konnte, barfuß, weil ich nicht anhalten wollte, um meine Sandalen anzuziehen. Ich hörte Turnus’ volltönende Stimme hinter mir in der Halle, nicht aber was er sagte. Mir klangen die Ohren. Die Nachtluft im Innenhof war wie kaltes Wasser, das mir ins hitzige Gesicht und über den Körper gegossen wurde, sodass ich keuchte und erzitterte.
Im Frauenflügel stürzten sich natürlich alle Mädchen und Frauen auf mich, erzählten mir und einander, wie prächtig und gutaussehend der junge König war, wie stark und hochgewachsen, wie er seinen Helm, ein großes Schwert und eine riesenhafte vergoldete bronzene Brustplatte in die Eingangshalle gehängt hatte, und wollten wissen, was er bei Tisch gesagt hatte und ob ich ihn mochte. Ich konnte nicht antworten. Vestina half mir, sie zu verscheuchen, sagte, ich sähe fiebrig aus und gehöre ins Bett. Nachdem ich sie schließlich davon überzeugt hatte, mich allein zu lassen, konnte ich mich auf mein Bett in meiner kleinen stillen Kammer legen und mir Turnus besehen.
Es war freilich töricht zu fragen, ob ich ihn mochte. Ein junges Mädchen, das einen Mann, einen gutaussehenden Mann, einen König traf, der ihr erster Brautwerber sein könnte, ist ihm nicht zugeneigt oder abgeneigt. Das Herz klopft, das Blut pocht, und sie sieht ihn – sieht nur ihn: vielleicht wie ein Hase einen Habicht sieht, vielleicht wie die Erde den Himmel sieht. Ich sah Turnus wie eine Stadt einen prunkvollen Fremden, einen Heerführer vor dem Stadttor sieht. Dass er da war, dass er gekommen war, war wundervoll und schrecklich zugleich. Nichts würde je wieder wie früher sein. Aber noch gab es keine Notwendigkeit, das Tor zu entriegeln.
Turnus blieb einige Tage, aber ich begegnete ihm nur noch einmal. Er verlangte meine Anwesenheit an seinem letzten Abend, und so wurde nach mir geschickt, aber nicht, um mit den Gästen und der Gesellschaft zu essen, sondern für den Nachtisch, um Gesang und Tanz beizuwohnen. Ich saß neben meiner Mutter, und wieder sah Turnus mich oft und unverhohlen an. Er lächelte uns zu. Sein Lächeln war ein angenehmes kurzes Aufblitzen. Als er die Tänzerinnen betrachtete, beobachtete ich ihn. Mir fiel auf, wie klein seine Ohren waren, dass sein Kopf wohlgeformt, sein Kiefer kantig und stark war. Vielleicht würde er später einmal Hängebacken bekommen. Sein Nacken war angenehm, glatt. Ich beobachtete, dass er gegenüber meinem Vater, der neben ihm alt wirkte, aufmerksam und respektvoll war.
Meine Mutter war zehn oder zwölf Jahre älter als ihr Neffe, aber heute Abend war ihr das nicht anzusehen; ihre Augen leuchteten, sie lachte. Sie und Turnus verstanden sich gut, fühlten sich wohl miteinander. Sie plauderten quer über den Tisch, die anderen Gäste stimmten ein, und mein Vater hörte ihnen wohlwollend zu.
Am Tag nach Turnus’ Abreise schickte mein Vater nach mir und meiner Mutter. Wir gingen auf dem Portikus vor dem Speisesaal auf und ab; er hatte alle Leute, die sich für gewöhnlich um ihn scharten, weggeschickt. Es war ein regnerischer Frühlingstag, und er trug seine Toga, weil er mit zunehmendem Alter fror. Er schritt eine Weile schweigend neben uns, dann sagte er: »Der Rutulerkönig setzte vergangenen Abend dazu an, mir zu sagen, dass er um deine Hand anhalten wolle, Lavinia. Ich ließ ihn nicht fortfahren. Ich sagte, dass du noch nicht in einem Alter seist, in dem es mir zustünde, übers Freien oder Heiraten zu sprechen. Er wollte natürlich mit mir verhandeln, aber ich ließ es nicht zu. Ich sagte, meine Tochter ist zu jung.«
Er sah uns beide an. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich sah meine Mutter an.
»Du hast ihn nicht ermutigt?«, fragte Amata, kühl und gefasst, wie sie immer mit ihrem Gemahl sprach.
»Ich habe nicht gesagt, dass sie für immer zu jung sein würde«, erwiderte mein Vater in seiner milden, trockenen Art.
»König Turnus hat seiner Braut viel zu bieten«, sagte sie.
»Das hat er. Der Boden ist gut dort unten. Es heißt auch, er sei ein guter Kämpfer, wie sein Vater.«
»Ich bin mir sicher, dass er ein tapferer Krieger ist.«
»Und wohlhabend.«
Wir gingen weiter den Portikus entlang. Der Regen prasselte auf den Innenhof, die Blätter an den Zitronenbäumen nickten. Unter dem großen Lorbeer war es noch immer recht trocken, eines der Hausmädchen saß dort, spann und sang ein langes Spinnlied.
»Du würdest dem Jungen also deine Gunst erweisen, wenn er in einem anderem Jahr wiederkäme?«, fragte mein Vater meine Mutter.
»Vielleicht«, sagte sie kühl. »Wenn er bereit ist zu warten.«
»Und du, Lavinia?«
»Ich weiß nicht«, erwiderte ich.
Er legte mir die Hand auf die Schulter. »Mach dir keine Sorgen, mein Liebes«, sagte er. »Es eilt nicht mit diesen Dingen.«
»Wie würdest du Vesta weiter hüten?«, fragte ich – und brachte es nicht über mich, zu sagen: »wenn ich wegginge, um zu heiraten.«
»Nun, darüber müssen wir nachdenken. Wähle ein Mädchen und beginne, es in den Pflichten zu unterweisen.«
»Maruna«, sagte ich, ohne zu zögern.
»Eine Etruskerin?«
»Ihre Mutter ist Etruskerin. Du hast sie von einem Raubzug jenseits des Flusses mitgebracht. Maruna ist hier aufgewachsen. Sie ist fromm.« Damit meinte ich verantwortungsbewusst, pflichtergeben, ehrfurchtsvoll. Mein Vater hatte mir Bedeutung und Wert des Worts beigebracht.
»Gut. Nimm sie mit, wenn du das Feuer hütest, den Herd säuberst und das heilige Salz machst. Fang an, sie all das zu lehren.«
Meine Mutter hatte nichts dazu zu sagen; es obliegt der Königstochter, das Herdfeuer zu schüren. Ich weiß, es war bitter für meine Eltern, dass der Junge, der das Altarfeuer mit unserem Essen speiste und die Segnung sprach, wenn wir uns allabendlich zu Tisch setzten, nicht ihr Sohn war, wie es sich eigentlich gehörte, sondern nur ein Bediensteter. Nun mussten auch die Sorge für das Feuer und die Vorratskammern an eine Stellvertreterin, an eine Sklavin gehen.
Mein Vater stöhnte leicht, seine große, warme, harte Hand immer noch auf meiner Schulter. Meine Mutter schritt teilnahmslos weiter. Als wir kehrtmachten, um wieder auf den Säulengang zu treten, sagte sie: »Es wäre gut, den König nicht zu lang warten zu lassen.«
»Ein Jahr oder zwei oder drei«, sagte Latinus.
»Oh«, entfuhr es ihr ungehalten. »Drei Jahre! Der Mann ist jung, Latinus! In seinen Adern fließt heißes Blut.«
»Umso mehr Grund, unserem Mädchen Zeit zum Erwachsenwerden zu geben.«
Amata widersprach nicht, sie widersprach nie, sondern zuckte mit den Schultern.
Ich las ihr Schulterzucken als Zweifel daran, dass ich einem Mann wie Turnus je gewachsen sein würde. Ich fragte mich ja selbst, wie ich das je könnte. Für so einen Mann sollte ich vollbusig und majestätisch wie meine Mutter sein, schrecklich wie sie, schön wie sie. Ich war klein und dünn, sonnengebräunt, ungeschliffen. Ich war ein Mädchen, keine Frau. Ich legte meine Hand auf die Hand meines Vaters auf meiner Schulter und ließ sie dort, während wir gingen. Ich konnte den blauäugigen Turnus nachts im Dunkel meiner Kammer betrachten, wollte mir aber nicht vorstellen, mein Zuhause zu verlassen.
Aeneas’ Rüstung hängt im Eingang unseres Hauses hier in Lavinium, so wie Turnus’ Schwert und Brustplatte bei seinen Besuchen in Laurentum. Ich habe Aeneas mehrmals die Rüstung tragen sehen, Helm, Brustharnisch, Beinzeug, das lange Schwert und den runden Schild, alles aus Bronze: Er leuchtet, so wie das Meer unter der Sonne glänzt und schillert. Seine Rüstung dort hängen zu sehen, zeigt mir, welch ein großer, kräftiger Mann er ist. Er wirkt nicht groß, auch nicht muskulös, weil sein Körper perfekt proportioniert ist, und er bewegt sich behänd und anmutig, stets mit Rücksicht darauf, wer und was um ihn herum ist, anstatt sich vorzudrängen wie so viele große, starke Männer. Und doch kann ich die Rüstung, die er mit Leichtigkeit trägt, kaum anheben. Sie ist ein Geschenk seiner Mutter, die sie, wie er mir erzählte, von einem berühmten Feuermeister hatte anfertigen lassen. Der Mann, der diese Rüstung geschmiedet und gearbeitet hatte, war der Herr aller Schmiede. In der ganzen westlichen Welt gab es kein schöneres Werk als diesen Schild.
Die Oberfläche der sieben Schichten geschweißter Bronze ist mit einem Muster aus Figuren bedeckt, geprägt, feinsäuberlich graviert, in Gold und Silber herausgearbeitet. Hie und da eine leichte Delle, ein leichter Kratzer aus der Schlacht. Ich stehe oft vor diesem Schild und studiere ihn. Mein Lieblingsbild ist, oben links, eine Wölfin, die ihren schlanken Hals nach hinten reckt, um ihre säugenden Welpen zu lecken, aber die Welpen sind Menschenkinder, Jungs, die gierig an ihren Zitzen hängen. Ein anderes, das ich auch mag, ist eine Gans, ganz aus Silber gefertigt, die mit gestrecktem Hals eine Warnung faucht. Hinter ihr klettern Männer über einen Felsvorsprung; ihre Haare sind aus gelocktem Gold, ihre Umhänge silbern gestreift; sie tragen gewundene Halsreife aus Gold.
Nicht weit von der Wölfin sind Figuren, die ich von unseren Festspielen her kenne – Springpriester mit Schilden, geformt wie Achten, und ein Paar Wolfsjungen, das nackt umherläuft und kichernden Frauen Dornenstöcke entgegenschwingt. Hie und da sind ein paar Frauen abgebildet, vor allem aber Männer, endlose Schlachtszenen mit kämpfenden Männern, zerstückelten Männern, ausgeweideten Männern, abgebrochenen Brücken, eingerissenen Mauern, Gemetzel.
Aeneas ist auf keinem der Bilder, und nichts von dem, was der Dichter mir über Belagerung und Fall seiner Stadt oder über seine Irrfahrten, bevor er nach Latium kam, erzählte, ist auf dem Schild zu erkennen. »Sind das Szenen aus Troja?«, frage ich ihn, und er schüttelt den Kopf.
»Ich weiß nicht, was sie zeigen«, erwidert er. »Vielleicht das, was kommt.«
»Dann ist das, was kommt, vor allem Krieg«, sage ich und suche nach Szenen, die keine Schlachten zeigen, suche nach unbehelmten Gesichtern. Ich sehe eine Massenvergewaltigung, Frauen, die schreien und kämpfen, während sie von Kriegern verschleppt werden. Ich sehe große, schöne Schiffe mit Ruderreihen, aber die Schiffe sind alle im Krieg, manche brennen. Feuer und Rauch steigen über dem Wasser auf.
»Es könnte das Reich sein, das die Söhne unserer Söhne einmal erben werden«, sagt er ganz leise. Aeneas spricht immer aus der Stille, selten lange, meist leise. Er ist nie ungnädig, aber er ist still, gebraucht Worte wie sein Schwert, nur wenn er muss.
Das ist also das Rom meines Dichters, die große Stadt in vielen Bildern. Ich schaue mir die Mitte des Schilds, die Seeschlacht, genauer an. Auf dem Heck eines Schiffs steht ein Mann mit gutgeschnittenem, kaltem Gesicht. Von seinem Kopf strahlt Feuer ab, darüber schwebt ein Komet. Das ist wohl der hehre Herrscher.
Während ich weiter schaue, entdecke ich Dinge, die ich nie zuvor gesehen habe. Die Stadt, oder irgendeine große Stadt, liegt in Trümmern, völlig zerstört und ausgebrannt. Ich sehe noch eine zerstörte Stadt und noch eine. Gewaltige Feuer brechen in geraden Reihen aus, eines nach dem anderen, hüllen eine ganze Landschaft in Flammen. Riesige Kriegsmaschinen kriechen übers Land oder tauchen durchs Meer oder schnellen durch die Luft. Die Erde selbst brennt in öligen schwarzen Wolken. Jetzt, am Ende der Welt, steigt über dem Meer eine gewaltige runde Vernichtungswolke auf. Ich weiß, dass es das Ende der Welt ist. Entsetzt sage ich zu Aeneas: »Schau doch, schau!«
Aber er kann nicht sehen, was ich auf dem Schild sehe. Er wird nicht lange genug leben, um es zu sehen. Er muss nach nur drei Jahren sterben und mich zur Witwe machen. Nur ich, die ich den Dichter im Wald von Albunea getroffen habe, kann durch die Bronze im Schild meines Gemahls all die Kriege sehen, in denen er nicht kämpfen wird.
Der Dichter ließ ihn leben, glorreich leben, und so muss er auch sterben. Ich, die der Dichter mit so wenig Leben ausgestattet hat, kann weiterleben. Ich kann die Wolke über dem Meer am Ende der Welt erleben.
Ich breche in Tränen aus, schlinge meine Arme um Aeneas, er hält mich zärtlich, sagt mir, ich solle nicht weinen, Liebste, nicht weinen.
Das Haus des Königs, wo ich lebe, ist ein Quadrat, unterteilt in vier Quadrate; der große Lorbeer steht am Kreuzungspunkt in der Mitte. Im ersten Morgengrauen verlasse ich das Haus und die Stadt, gehe hinaus auf die Felder im Osten.
Der Pagus, wo wir Paganen leben, ist nach den Äckern ausgerichtet, aufgeteilt durch die Feldwege zwischen den Äckern. An der Kreuzung, wo sich vier Äcker treffen, befindet sich der Schrein der Laren, der Geister der Wegkreuzung. Der Schrein hat vier Türen, davor jeweils der Altar eines Bauernackers. Ich stehe draußen auf einem Weg zwischen den Äckern, schaue in den Himmel.
Das Haus des Himmels ist grenzenlos, aber mit meinem Geist gebe ich ihm Grenzen und teile es durch vier. Ich stehe in der Mitte, an der Kreuzung, nach Süden, nach Ardea gewandt. Ich beobachte den leeren Himmel, in den langsam Licht nach oben fließt. Krähen fliegen von links, von den Hügeln im Osten kommend, kreisen über mir, rufen, kehren zurück zum Sonnenaufgang, der die Hügel mit Feuer krönt. Das ist ein gutes Omen, aber die Morgenröte kündet von einem stürmischen Tag.
Ich war zwölf, als ich meinen Vater zum ersten Mal nach Albunea begleitete, dem heiligen Hain am Fuß des Hügels, wo schwefeliges Wasser in einer hochgelegenen Höhle entspringt und die schattige Luft mit rastlosem Tosen und einem Dunst erfüllt, der nach faulen Eiern riecht. Die Geister der Toten sind dort in Hörweite, wenn du sie rufst. In den alten Zeiten kamen Leute aus allen westlichen Landen nach Albunea, um die Geister und Kräfte des Orts zu befragen; heute besuchen viele das Orakel gleichen Namens bei Tibur. Dieses geringere Albunea aber war meiner Familie heilig. Wenn mein Vater beunruhigt war, ging er dorthin. Diesmal sagte er zu mir: »Zieh dein heiliges Gewand an, Tochter, und hilf mir beim Opfern.« Ich hatte ihm oft zu Hause beigestanden, wie es die Aufgabe eines Kindes ist, ihn aber noch nie zur heiligen Quelle begleitet. Ich legte meine rotgesäumte Toga an und nahm einen Beutel gesalzenen Schrots aus der Vorratskammer hinter Vesta. Ein paar Meilen weit folgten wir Pfaden über vertraute Äcker und Weiden, dann waren wir in Gegenden, die ich noch nie gesehen hatte, wilder, mit bewaldeten Hügeln, die auf beiden Seiten näherrückten. Wir kamen an einen Bach und folgten seiner felsigen Schlucht auf der Nordseite; er heiße Prati, sagte mein Vater und erzählte mir von den Flüssen in Latium: unserem Lentulus bei Laurentum, dem Harenosus, dem Prati, dem Stagnulus und dem heiligen Numicus, der hoch oben auf dem Alba entspringt und unsere Grenze zu den Rutulern bildet.
Er trug das Opfertier, ein zweiwöchiges Lamm. Es war April. Im Dickicht knospte und blühte es, und die Eichen an den Hängen trugen ihre langen, zarten, scheuen Blütenkätzchen aus Grün und Bronze. Die Wälder vor uns stiegen höher und höher dem Alba entgegen, und zu unserer Linken hingen bewaldete Felsen wie eine dunkle Wolke. Wir schlüpften unter den Bäumen hinein. Es war dunkel im Wald, und anders als auf den Feldern und Hecken, wo lauter Vogelsang schallte, sangen hier nur wenige Vögel. Ich roch den Gestank der nahen Quelle, konnte aber keine Dämpfe sehen und das Geräusch des Wassers nur schwach hören, ein zischelndes Murmeln wie von einem Kessel, in dem Wasser zum Kochen kommt.