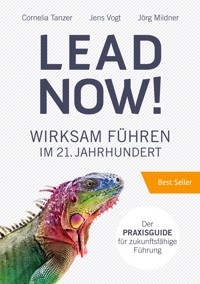
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Schöpfen Sie als Führungskraft oder Organisation mit Ihrer Führungsleistung das volle Potenzial Ihres Teams bzw. Unternehmens aus? Sind Sie Future Ready und für das derzeitige Race for Talents sowie die Herausforderungen der aktuellen und zukünftigen VUKA-Welt gerüstet? Und spüren Sie bereits, dass sich Führung im 21. Jahrhundert verändern muss, damit Teams und Unternehmen weiterhin nachhaltig erfolgreich sind? Lead now! unterstützt Sie dabei ein erweitertes Verständnis davon zu entwickeln, was es bedeutet, eine moderne Führungskraft zu sein, Ihre Sicht auf Ihre eigene Leistung als Führungskraft selbstkritisch zu schärfen, tiefe Einblicke in Ihre persönlichkeitsbedingten Führungspräferenzen und Herausforderungen zu gewinnen sowie zu lernen, wirkungsvolle Verhaltensalternativen zu entwerfen, die Sie als Führungskraft (noch) erfolgreicher machen. Darüber hinaus zeigen detaillierte Praxisbeispiele aus der Arbeit der Autoren mit Leadern aus weltweit führenden Organisationen Wege zur effektiven und zeitgemäßen Entwicklung von Teams und Organisationen auf. Der im 21st Century Leadership Framework dokumentierte Zusammenhang zwischen Systemklima, Führungsstilen und Führungspersönlichkeit liefert einen wegweisenden Blick darauf, wie dieser Dreiklang den Unternehmenserfolg nachhaltig stärken kann. "LEAD NOW! ist ein 'Muss' für alle, die in der Führungsaufgabe mehr sehen, als einen Teil ihrer Jobbeschreibung. Und für Menschen, die Führung als eine singstiftende und bedeutsame Aufgabe erleben - für ihre Organisationen, ihre Mitarbeitenden und nicht zuletzt auch für sich selbst." (PROF. DR. DIRK ZUPANCIC, CEO, FÜHRUNGSCOACH UND PRIVATDOZENT DER UNIVERSITÄT ST. GALLEN). »In diesem Buch habe ich eine der besten Zusammenfassungen anwendbarer Führungs- praktiken gefunden. Es zeigt, wie Führung aussehen sollte, um wirklich etwas zu bewirken. Es ist die perfekte Mischung aus Theorie und Praxis.« MARIO CRISTIANO, LEADERSHIP EXPERTE UND BEGLEITER VON FÜHRUNGSKRÄFTEN »Dieses Buch ist mutig, denn es nennt die Dinge beim Namen. Es bleibt nicht an der theoretischen Oberfläche. Es ist voller Praxisbeispiele, und gleichzeitig tiefgründig und fundiert. Ich würde sagen: Read Now!« BORIS DIEKMANN, AUTOR VON CHIEF ENERGY OFFICER, EXECUTIVE COACH, EXPERTE FÜR FÜHRUNG UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG 2. ÜBERARBEITETE UND AKTUALISIERTE AUFLAGE
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
AUFTAKT
EINFÜHRUNG
Leadership im 21. Jahrhundert: Höchste Zeit für einen Richtungswechsel!
TEIL I
GROUNDWORK: KEY FACTS RUND UM FÜHRUNG UND UNTERNEHMENSERFOLG
KAPITEL 1
Das Führungsvakuum: Risiken und Nebenwirkungen
KAPITEL 2
Führungsmodelle? Gibt’s doch schon!
KAPITEL 3
Exzellente Führung im Fokus: Gedankenfutter für ein neues Mindset
KAPITEL 4
Das Dream-Team: Führung, Kultur und Unternehmenserfolg
TEIL II
FRAMEWORK: DAS FÜHRUNGSMODELL FÜR DAS 21. JAHRHUNDERT
KAPITEL 5
Future Ready Leadership 21st Century
KAPITEL 6
Full Range of Leadership: Auf der ganzen Klaviatur spielen
KAPITEL 7
Das Systemklima: Großwetterlage und individuelle Wohlfühltemperatur zwischen Anspruch und Wirklichkeit
KAPITEL 8
Die individuelle Führungspersönlichkeit: Wer seine Einzigartigkeit (er-)kennt, führt besser
TEIL III
PRACTICAL WORK: UMSETZUNG UND ANWENDUNGS-FELDER
KAPITEL 9
Wie Lernen und Weiterentwicklung gelingen – Von unendlichen Möglichkeiten, blinden Flecken, günstigen Erfahrungen und viel Schwung
KAPITEL 10
Ein echtes Chamäleon: Die Anwendungsfelder des Frameworks
FINALE
Das Ende aller Ausreden
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS
ÜBER DIE AUTOR:INNEN
Richtungswechsel
Effektive Führung im 21. Jahrhundert bedeutet, eine gesunde Unternehmenskultur zu schaffen, in der Menschen in Verbindung sein können – mit sich selbst, miteinander und mit einer Sache, die sie inspiriert und motiviert – die ihnen Leben gibt
Performance erfordert letztendlich Führung, die demütig dem Menschen und der leistenden Gemeinschaft dient
Die Realität ist
Dass Führung sich im Kern vorrangig auf das leistungs- und zielorientierte Managen von ›Human Resources‹ reduziert
Ich glaube einfach nicht
Dass wir das derzeit immer noch weit verbreitete kurzfristig orientierte, transaktionale Verständnis von Führung wahrhaftig verändern können
Dass wir ein neues Bewusstsein dafür schaffen können, dass exzellente Führung der mit Abstand größte Einflussfaktor auf die Unternehmenskultur ist
Dass wir die tiefe Erkenntnis vermitteln können, dass Kultur in Organisationen der stärkste und nachhaltigste Hebel für wirtschaftliche Performance ist
Am Ende ist es so
Dass das gewohnte Verhalten und die vorhandenen Muster unveränderlich in Menschen verankert sind
Ich denke nicht
Dass wir Führungskräften tatsächlich einen neuen Blick auf das Thema Führung ermöglichen können – und wirklich helfen können zu sehen, was sie in dieser Rolle alles zu bewirken in der Lage sind
Dass wir das notwendige Bewusstsein für grundlegend neue Führungsansätze schaffen können
Meine tiefe Überzeugung ist
Dass einfach die maßgebliche Einsicht fehlt, wofür wir wirklich führen
Ich mag es nicht wahrhaben
Alles bleibt wohl so, wie es ist
Vor diesem Hintergrund ist es absolut unpassend zu lamentieren:
Um als Organisation im 21. Jahrhundert nachhaltig erfolgreich zu sein, brauchen wir ein deutlich erweitertes Führungsverständnis und Führungsverhalten!
Für eine zeitgemäß wirksame Führung ist ein verändertes Mind-, Skill- & Toolset – ein echter Richtungswechsel – erforderlich! Lies den Text daher doch bitte noch einmal Satz für Satz von unten nach oben …
Jens Vogt, Oktober 2022
TEIL I
GROUNDWORK – KEY FACTS RUND UM FÜHRUNG UND UNTERNEHMENS-ERFOLG
KAPITEL 1
Das Führungsvakuum: Risiken und Nebenwirkungen
Hilfe, ein Führungsvakuum! – Warum Führung notorisch zu kurz kommt – Das »Peter-Prinzip« lässt grüßen – Pinguin oder Thomas? – Von Organismen und Organisationen – Wie teuer ist das denn? Wie Performanzlücke, hohe Fluktuation und Fehlzeiten den Unternehmenserfolg gefährden
»Leadership is a choice, not a rank.«SIMON SINEK
Es ist fast schon zu simpel, um es zu Papier zu bringen, aber wir tun es trotzdem: In den allermeisten Fällen haben Mitarbeitende, die angestellt tätig sind, eines gemeinsam – sie haben eine Chefin oder einen Chef. Das ist eine Person, die ihnen vorgesetzt ist, die sie anleitet und die ihnen konkrete Arbeitsaufträge sowie Feedback zu ihren Leistungen gibt. Sie werden uns zustimmen: Das ist nur das absolute Basisprogramm an Führung. Aber das ist auch das, was in den meisten Organisationen stattfindet. Nicht mehr, und oft sogar weniger.
Aber Führung ist so viel mehr und kann so viel mehr als nur das: Führungskräfte können ihrem Team nämlich nicht nur Anweisungen geben und Mitarbeitenden die Richtung weisen, in die sie agieren sollen, oder Kontrolle ausüben. Sie können ihr Team auch bewusst in Entscheidungen mit einbeziehen, sie können integrierend wirken, Konflikte antizipieren oder helfen, sie aufzulösen. Sie können ihre Mitarbeitenden entwickeln, sie dabei coachen, und sie können ihr Team inspirieren und es auf eine Vision, auf die Reise hin zum Unternehmenserfolg, »einschwören«. Das wäre dann – gemessen am Standard in Unternehmen heute – schon das Deluxe-Programm.
Sicher hängt es ganz vom jeweiligen Unternehmen und auch von den individuell am Arbeitsprozess beteiligten Personen ab, wie viel an Führung erwartet wird. Aber ob Basisprogramm oder Deluxe-Version, ETWAS wird auf jeden Fall erwartet. Wer eine Führungsrolle einnimmt und dadurch über Autorität verfügt, der muss etwas TUN, so der Konsens.
Was passiert eigentlich, wenn diese Erwartungshaltung nicht bedient wird? (Auf die Gefahr hin, dass wir vorgreifen: Sie wird in der Regel nicht durchgängig bedient, nicht verlässlich und auch nicht zielführend – also nicht mit Blick auf den Unternehmenserfolg.) Was passiert, wenn Beteiligte am eigenen Leib erfahren, dass sie Führung als etwas ganz Selbstverständliches voraussetzen – was in der gelebten Praxis aber nicht stattfindet? Dazu führen wir in Organisationen regelmäßig folgendes Experiment durch, das ein solches Führungsvakuum sofort spürbar werden lässt:
Skandal! Führungslosigkeit führt zu … totaler Irritation!
Ein großes mittelständisches Unternehmen: Stellen Sie sich vor, das Managementteam sitzt zusammen mit zwei Moderator:innen im Rahmen eines Führungsworkshops in einem hellen Konferenzraum. Nach der Begrüßungsrunde und einer ersten kleinen Präsentation starten die Moderator:innen mit dem Experiment. Sie schreiben aufs Flipchart: »Lernt und erfahrt den Unterschied zwischen Autorität und Führung – hier und jetzt.« Daraufhin ziehen sie sich ganz diskret
in eine Ecke zurück – und schweigen. Es dauert nur knapp eine halbe Minute, dann schauen sich alle Teilnehmenden untereinander an. Der eine oder andere fragende Blick wandert dabei zu den Moderator:innen. Als sie nicht reagieren, startet die Diskussion: »Was sollen wir jetzt machen?« – »Die Aufgabe steht doch da!« – »Dann lass uns doch mal anfangen, etwas aufzuschreiben!« – »Ja, aber was?« Die Situation stagniert und dreht sich im Kreis. Weil von den Moderator:innen nichts kommt, richtet sich der Blick ganz intuitiv auf die ranghöchsten Chefs im Raum. Und wenn von denen auch nichts kommt, sehen sich diejenigen von der Führungsebene darunter in der Verantwortung. Jemand fasst sich vielleicht ein Herz, steht auf und sammelt ein paar Punkte am Flipchart. Aber keine(r) macht so richtig mit, alles droht im Sande zu verlaufen. Eigentlich wartet jede(r) darauf, dass jemand sich den »Hut« aufsetzt und die Führung übernimmt: Ein Führungsvakuum ist entstanden; alle fühlen die entstandene Lücke am eigenen Leib.
Die Moderator:innen tun weiterhin nichts. Sie halten den Spannungsbogen, und wenn sie den nur noch eine weitere Viertelstunde lang einwirken lassen würden … dann würde sich die Gruppe bestimmt auflösen und sich aus lauter Frust geschlossen auf die Suche nach der Cafeteria begeben. Nein, natürlich nicht wirklich – aber alle fühlen sich zusehends unbehaglicher, werden auf sich selbst zurückgeworfen und haben Schwierigkeiten, die Situation zu interpretieren.
Wenn die Moderator:innen meinen, dass es genug ist, und die Situation mit den Teilnehmenden auflösen, reflektieren sie alle gemeinsam die Situation auf drei Ebenen:
1. Wie habt Ihr Euch gefühlt?
Je nach Gruppen- und Gemütslage kommt als Feedback: Orientierungslos, ungeduldig, amüsiert oder angespannt. In der Regel überwiegen hier aber negative Emotionen und ein »Was soll das Ganze? Was ist Sinn und Zweck der Übung?«
2. Was habt Ihr getan – oder auch nicht getan?
Hier kommen folgende Antworten: »Wir haben diskutiert, wir haben versucht, die Aufgabe zu interpretieren und wir haben vielleicht ein paar Punkte aufgeschrieben.«
3. Was hättet Ihr gebraucht (damit diese Gefühle nicht aufkommen)?
Einen Handlungsrahmen, ein Ziel, eine Anleitung, Führung, Orientierung, mehr Hintergrund und eine Erklärung: Was soll das hier? – das sind die gängigen Antworten.
Der Bogen zum Thema »Führung« spannt sich hier wie von selbst. Überdeutlich steht im Raum, dass die Moderator:innen im Workshop-Setup von Beginn an eine definierte Rolle innehaben – samt der dazugehörigen Autorität. Blöd war nur: Sie haben diese Autorität (absichtlich) nicht eingesetzt und genutzt. Sie haben vielmehr die Situation ausgesessen, sie sind nicht aktiv geworden – kurz: Sie haben nicht geführt!
Autorität ist eine Rolle, Führung ist eine Aktivität
Das Experiment führt uns ganz praktisch vor Augen, was in Unternehmen leider oft Alltag ist. Führungskräften wird qua Position Autorität verliehen – sie haben also die »Streifen auf der Schulter«. Aber dass sie die Autoritätsrolle, die damit einhergeht, oft gar nicht ausfüllen – und was das für Mitarbeitende bedeutet – ist prekär: Es entsteht ein Vakuum. Genauer gesagt, es entstehen sogar zwei Leerstellen: ein Führungsvakuum und ein Leistungsvakuum, die beide akut den Unternehmenserfolg gefährden. Das hat erst mal nichts mit böser Absicht zu tun. (Also nicht wie bei den Moderator:innen, die sich zu Demonstrationszwecken in die Ecke gesetzt und zugesehen haben, wie die Situation gegen die Wand fährt.) Es gibt im Gegenteil vielschichtige Ursachen dafür, dass in Unternehmen zu wenig geführt wird.
WARUM FÜHRUNG NOTORISCH ZU KURZ KOMMT
In vielen Vier-Augen-Gesprächen hören wir in Coachings von gestressten und ratlosen Führungskräften im Vertrauen immer wieder zwei Fragen:
»Führen?
Wann
und
wie
soll ich das denn (noch) machen?« und
»
Was
ist denn die Ewartung an mich als Führungskraft?«
Diese beiden einfachen Fragen stehen für ein Riesendilemma, das sich grob in den folgenden zwei Aspekten beschreiben lässt:
1. Keine Zeit!
Die erste Frage nimmt Bezug auf den zeitlichen Aspekt (s. Einführung): Mit einer Beförderung in eine Führungsposition wird Führung meist stillschweigend »mit« erwartet. Schließlich muss das Team, müssen die Mitarbeitenden, geführt werden. Selbst, wenn also Führung nicht explizit in der Stellenbeschreibung auftaucht (und das ist meistens so), muss sie trotzdem geleistet werden. Aber was das eigentlich bedeutet, was alles damit verbunden ist, bleibt unausgesprochen. Führung wird als Aktivität gar nicht en detail beschrieben! Und dann gibt es da dummerweise auch immer noch die operativen Aufgaben (die in der Stellenbeschreibung ganz sicher und explizit auftauchen!). Gefühlt oder real ist die Überlastung mit dieser Art von Doppelspitze auf jeden Fall vorprogrammiert. Denn in der Realität gilt folgende Faustregel: Ist das Team größer als acht Mitarbeitende, muss die Führungskraft den überwiegenden Teil ihrer Zeit in Führung investieren. Sind es mehr als 15 Mitarbeitende, dann bliebe der Führungskraft buchstäblich keine Zeit mehr für operatives Geschäft. Der Aufgabenfokus verschiebt sich also je mehr in Richtung Führung, desto mehr Mitarbeitende eine Führungskraft hat. Oder das sollte er zumindest … Da aber der Ergebnisdruck im Unternehmen konstant hoch ist, ist das keine Option. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass Führungsaufgaben sich auf die in HR-Prozessen vorgegebenen Pflichtbausteine beschränken oder sogar ganz hintenrüber fallen. Viele Führungskräfte sind allerdings extrem leistungswillig und versuchen alles, um der Situation Herr zu werden – was für sie meist viele, viele Überstunden bedeutet.
2. Keine Führungskompetenz!
Die zweite Frage nimmt Bezug auf die Methodenkompetenz, denn Führung ist schließlich eine äußerst anspruchsvolle Tätigkeit. Wie führt man als Führungskraft »richtig«, wie m-a-c-h-t man das eigentlich? Ist man vielleicht ein Naturtalent und kann direkt auf die Mitarbeitenden losgelassen werden? Oder kann man Führung lernen? Muss man das vielleicht sogar? Und wenn ja, wie? Die Fragen sind sehr berechtigt, denn das eigene Fach hat man meist von der Pike auf gelernt. Neue Führungskräfte aber starten meist ungelernt in die Führungsrolle, ohne jedes Grundwissen. Denn eine Karriere sieht häufig folgendermaßen aus: Vier oder fünf Jahre Studium – Chemie, Maschinenbau, Betriebswirtschaft oder etwas anderes, Einstieg in eine Position im Unternehmen, Aufstieg in eine Teamleitung – und dann wegen der neuen Führungsposition zwei Tage Leadership als Seminar. Das jedoch ist keine adäquate Vorbereitung. Wie gesagt: Unternehmen lassen ihre IT-Systeme ja auch nicht von Facility Managern warten, die ganz andere Kompetenzen haben. Warum also überlassen sie das Wertvollste, ihre Mitarbeitenden, absoluten Laien? Und – wir sprachen schon davon – die Frage ist auch: Können sie sich das noch leisten? Unter VUKA- oder BANI-Bedingungen und bei schwindender Fehlertoleranz in zunehmend angespannten Märkten?
Beide hier beschriebenen Aspekte zeichnen hauptverantwortlich für das Führungsvakuum, von dem wir sprechen. Natürlich ist das Ganze einerseits ein strukturelles Problem – und andererseits eingebettet in die jeweilige, individuelle Unternehmenskultur. In Gesprächen hören wir häufig, dass sogar hochrangige Führungskräfte sich ihres ganz persönlichen Defizits in Bezug auf Führung durchaus bewusst sind: Sie halten sich im Bereich der Führung von Mitarbeitenden für nicht besonders talentiert. Und sie haben oft auch keine echte Affinität zur Führungsaufgabe. Als sie gefragt wurden, ob sie eine Führungsposition übernehmen möchten, haben sie selbstverständlich trotzdem zugesagt. Denn sie wollen ja in ihrem Job gestalten und wirksam werden. Sie haben die Anerkennung und das Gefühl genossen, dass man ihnen etwas zutraut. Und sie wollen die Karriere samt Status und Annehmlichkeiten. Und diese Karriere gibt es nur ganz selten ohne Führungsverantwortung, denn schließlich bemisst sich der Karrierestatus in Deutschland noch immer zu einem (zu) großen Teil an der Anzahl der Mitarbeitenden, die man als Führungskraft verantwortet.
Zudem könnte es ja sein, dass man nicht noch einmal gefragt wird, wenn man »Nein« sagt. Der Grund für eine Beförderung hat dabei gerade meist nichts mit Führungsqualitäten zu tun. Vielmehr werden Mitarbeitende oft befördert, weil das eine große Projekt ein Erfolg war – oder sie den einen neuen großen Kunden gewinnen konnten. Oder, weil sie einfach die beste Fachkraft im Team sind – was natürlich gar nichts darüber aussagt, wie sie sich in der Führungsrolle machen werden. Oder – und auch das passiert viel häufiger, als man denkt – weil sie nun schon zweimal übergangen wurden und jetzt einfach mal dran sind. Siehe oben: Das schon lange bekannte »Peter-Prinzip« lässt grüßen!
Mit jeder Hierarchieebene, in die Führungskräfte aufsteigen, werden jedoch die Anforderungen an Führung komplexer – und der persönliche Werkzeugkoffer wird schnell zu klein. Führungskräfte geben, wie oben gesagt, teilweise auch sehr offen zu, zu wenig davon zu verstehen, wie man ein Team inspiriert oder emotional mitnimmt – und sie sehen sich sowieso mit den emotionalen Elementen von Mitarbeitendenführung oft schlichtweg überfordert. Dazu kommt noch, dass sich der Führungsjob gerade radikal verändert: Führungskräfte sollen zunehmend dienen, statt Anweisungen zu erteilen, oder Mitarbeitende coachen, statt sie zu kontrollieren. Coachingkompetenz entwickelt sich scheinbar langsam, aber sicher, zu einer zentralen Management- bzw. Führungskompetenz. Wiederum ist die Frage: Wann sollen die Führungskräfte das leisten? Und wie (und wann) können sie die nötigen Kompetenzen dafür erwerben? (1)
Tatsächlich ist es eine recht gängige Praxis, Mitarbeitende so lange in Führungsrollen zu befördern, bis sie schließlich scheitern. Und das passiert eben meist nicht aufgrund der fachlichen Aufgaben, sondern wegen der Führungsaufgaben bzw. der doppelten Herausforderungen der neuen Rolle. Die Vorgesetzten, die eine Beförderung aussprechen, sehen das Problem womöglich überhaupt nicht. Gegebenenfalls ziehen sich ähnliche Verhaltens- und Fähigkeitsmuster durch eine ganze Organisation. Häufig befördern Vorgesetzte Mitarbeitende, die ähnlich ticken wie sie selbst, weil sich das so schön ungefährlich anfühlt. Oder stellen sie als Führungskräfte ein, wie es der bitterböse Flurfunk so schön auf den Punkt bringt: »Pinguine stellen Pinguine ein.«
Hello, my name is Thomas
Oder man könnte auch sagen: »Thomas stellt Thomas ein«. Der so genannte »Thomas-Kreislauf« zeigt, wie in Deutschland im Top-Management rekrutiert wird und wer es auf die Chef:innensessel schafft. Aber wer ist Thomas? Ganz einfach, Thomas ist 1969 geboren, zu 83 Prozent männlich, zu 74 Prozent deutsch, zu 64 Prozent in Westdeutschland ausgebildet, zu 50 Prozent Wirtschaftswissenschaftler und zu 25 Prozent Ingenieur. Thomas ist aber keine reale Person, sondern eine »Schablone«. Eine Schablone, die ausdrückt, wie sehr sich Top-Führungskräfte in Geschlecht, Nationalität, Alter, Herkunft und Ausbildung gleichen. Diese Schablone ist schon seit vielen Jahren aktuell und nach wie vor gültig. »Thomas« war z. B. auch 2020 und 2021 immer noch der häufigste Vorname in den deutschen Börsenvorständen. (2)
Der neue Thomas ist Christian
Eine berechtigte Frage ist natürlich: Was ist denn mit New Work, Transformation, Digitalisierung und neuer Unternehmenswelt? Man könnte doch meinen, dass inzwischen auch dort dringend nach frischem Blut mit Transformationspower gesucht wird? Fakt ist aber, dass der Konformitätstrend sich eher weiter fortsetzt. Zwar heißen die Neu- und Frischlinge an der Spitze der agilen Unternehmenswelt jetzt öfter mal Christian oder Andreas. Aber das durchschnittliche Vorstandsmitglied bleibt: zu 87 Prozent männlich, 1968 geboren, zu 66 Prozent in Westdeutschland ausgebildet, zu 50 Prozent Wirtschaftswissenschaftler und zu 24 Prozent Ingenieur. (3) Das Thema Gleichförmigkeit gleich Konformität gleich Risikovermeidung und Auf-Nummer-sicher-gehen ist also weiterhin hoch aktuell.
Und darum bleibt vielfach alles beim Alten. Nicht nur in besonders etablierten oder eher traditionell geprägten Unternehmen wird die Entwicklung von modernen Leadership Skills und das Etablieren einer echten Führungskultur erstickt von einer Arbeitsmoral, die eine Priorisierung des operativen Geschäfts geradezu glorifiziert. (4)
Management, oder die operativen Aufgaben, haben im Zweifelsfall immer Vorfahrt. Führung, Leadership, läuft unter Nice-to-have und wird sowieso und on top erwartet. Die Führungskraft muss beides zusammen selbstverständlich und in Personalunion leisten. Management ist also aus dieser Perspektive heraus ein valider Business Case – und Leadershipwird dagegen oft genug noch nicht als Wertschöpfung betrachtet.
Das sehen wir definitiv als einen Fehler im System. Mithilfe einer Analogie lässt sich dieser Fehler samt seiner schlechten Auswirkungen anschaulich beschreiben:
Organismus und Organisation
Abwesende, unzureichende, schlechte oder sogar nur mittelmäßige Führung lässt sich mit einem ungesunden Lebensstil vergleichen. Langsam und schleichend, aber mit Sicherheit, erodiert er unsere Gesundheit und schädigt so auf die Dauer das ganze System: Der Blutdruck steigt, erste Pölsterchen zeigen sich an Bauch und Hüften, die Leberwerte laufen aus dem Ruder, wir sind vielleicht ein wenig kurzatmig und fühlen uns immer weniger fit. Das ganze System ist nicht sofort gefährdet, wir leben weiter und »funktionieren«, aber wir könnten uns besser fühlen und deutlich leistungsfähiger sein. Die Ursache ist diffus. Es ist jedenfalls nicht nur das eine Bier am Abend oder das kleine, süße Teilchen am Nachmittag, sondern etwas weitaus Systemischeres. Wir haben einen Verdacht, woran es liegen könnte, aber wir forschen auch nicht genau nach. Wir haben immer Wichtigeres zu tun, als unseren Rhythmus zu hinterfragen und unsere Ernährung auf den Kopf zu stellen. Mittelfristig aber werden die Probleme größer und greifbarer: Wir haben öfter Infekte, kränkeln viel und beim Ausflug mit Freunden werfen wir während einer Zehn-Kilometer-Wanderung das Handtuch. Die negativen Auswirkungen unseres Lebensstils summieren sich und beginnen, unseren Alltag und unser Wohlbefinden zu beeinträchtigen. Erste Auswirkungen werden irreversibel, unser Körper beginnt zu verschleißen.





























