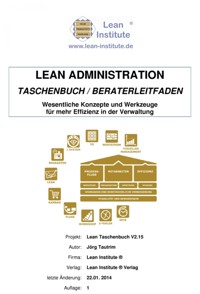
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Lean Management wird inzwischen weltweit in nahezu allen Branchen erfolgreich angewendet und beschränkt sich, wie bereits gesagt, nicht mehr nur auf fertigende Prozesse (Lean Production), sondern bezieht auch andere Geschäftsbereiche ein, wie etwa die Instandhaltung (Lean Maintenance) oder die Geschäftsprozesse (Lean Administration). Lean Administration (manchmal auch als Lean Services bezeichnet) findet Anwendung zum Beispiel bei der Erstellung von Dienstleistungen oder als unterstützende Prozesse zum Beispiel bei der Auftragsabwicklung. Der Methodenkoffer des Lean Administrations / Lean Managements beschreibt nicht nur Begriffe, sondern auch Vorgehensweisen zur Umsetzung von Lean Werkzeugen. Die wichtigsten Lean Werkzeuge werden im folgenden Handbuch näher, d.h. mit Ausgangssituation, Definition und teilweise auch Beispielen näher beschrieben. Beinhaltet sind auch wichtige Kennzahlen, Berechnungen und Berechnungsbeispiele. Messgrößen spielen eine zunehmende Rolle im Rahmen der schlanken Verwaltung. Das Taschenbuch beschreibt die wesentlichen Lean Administration Werkzeuge, d.h. die Verbesserungstechniken, die in der Verwaltung (Vertrieb, Marketing, Qualitätssicherung, Planung, etc.) eingesetzt werden. Das Buch ist geeignet: + für Alle, die sich in die Techniken der Optimierung im Bereich der Verwaltung, Administration auseinandersetzen wollen + Hilfesuchende im Bereich der verbesserten Büroorganisation und schlanker Büroabläufe + für Berater und Workshop-Moderatoren, Coachs, Change Manager, Change Agents + für Trainer zum schnellen Überblick und Nachschlagen der Konzepte + für Unternehmen, öffentliche Arbeitgeber zum Abgleich mit den eigenen Werkzeugen und Optimierungskonzepten + für Produktionsunternehmen, die nach dem Betrieb (Fertigung, Montage) auch die indirekten Bereiche auf Effizienz hin verbessern wollen + für Einsteiger, die sich im "Dschungel" der Lean Begrifflichkeiten schneller orientieren möchten...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Lean Administration Taschenbuch / Beraterleitfaden
Wesentliche Konzepte und Werkzeuge für mehr Effizienz in der Verwaltung
Dr. Jörg Tautrim
Copyright: © 2014 Dr. Jörg Tautrim
Herstellung und Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
ISBN 978-3-8442-8286-3
Imprint
Lean Administration Taschenbuch / Beraterleitfaden
Wesentliche Konzepte und Werkzeuge für mehr Effizienz in der Verwaltung
Dr. Jörg Tautrim
Copyright: © 2014 Dr. Jörg Tautrim
Published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
ISBN 978-3-8442-8285-6
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Zweck des Lean Taschenbuches Administration
Fach-Chinesisch, alter Wein in neuen Schläuchen, Anglizismen…
Nun kommt Lean auch mit Nachdruck in der Verwaltung an; die Begriffe heißen im Wesentlichen Lean Office, Lean Administration oder kurz Lean Admin.
Die Themen „Verwaltung“; „Overhead“; „Wasserkopf“; „Was macht eigentlich die Zentrale den ganzen Tag?“ werden in vielen Unternehmen hitzig diskutiert. Schon der britische Historiker und Publizist Cyril Northcote Parkinson (1909-1993) hat diese Phänomene als „Gesetze“ in seinem Buch „Parkinsons Gesetz und andere Untersuchungen über die Verwaltung“ (englischer Originaltitel: „Parkinson's law, the pursuit of progress“ ) entwickelt und beschrieben.
Folgende Aussage (von Cyril Northcote Parkinson) ist doch ein guter Start.
„Der Niedergang eines Unternehmens beginnt mit der Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes.“
Aber es wird noch besser:
„Die Hauptregel besagt, die bürokratische Arbeit werde so lange ausgeweitet, bis sie die zur Verfügung stehende Zeit ausfülle.“
Zur schnellen Beruhigung - auch in den sog. indirekten Bereichen gibt es wertschöpfende Prozesse. Wertschöpfende Prozesse, für die der Kunde bereit ist zu bezahlen. Diese Ausrichtung am Kundenwert ist eine zentrale Maxime des schlanken Denkens. In den letzten Jahren ist nun das Interesse an Lean Management, das in seiner ursprünglichen Form Anwendung in der Industrie findet, nicht nur bei fertigenden Unternehmen sondern auch in anderen Bereichen der Wirtschaft (hier den indirekten Bereichen, der Verwaltung, in den administrativen Abteilungen) stetig gewachsen.
Immer mehr rückt die Übertragung der Methoden (der Lean Werkzeuge) auf Nicht-Produktionsbereiche in den Fokus, um auch dort Erfolge durch die Anwendung des Lean Ansatzes realisieren zu können. Lean Administration als Ansatz des Lean Managements stellt den strukturierten Ansatz dar, Verwaltungsbereiche nach Lean Kriterien zu gestalten und kontinuierlich zu verbessern.
Zahlreiche Institute, Unternehmensberatungen, Professoren haben Strategien zur Einführung von Lean Administration entwickelt und unterbreiten Beratungsangebote zur Verbesserung der Prozesse in den betroffenen Bereichen. Teilweise sind die Ansätze sehr punktuell:
Abteilungsbezogen: aber keine Gesamtunternehmensstrategie
Werkzeugbezogen:
>> 5S
, „Bleistifte an Ort und Stelle“ oder
ausschließlich prozessbezogen:
>> Prozessoptimierung
Zudem sind viele Lean Admin Konzepte unstrukturiert (es fehlt ein Systemansatz, ein Gesamtverständnis), es fehlt die richtige Definition (1 zu 1 Übertragung von Lean der Produktion auf die Verwaltung) oder over-engineered (wochenlange Analysen ohne Umsetzung).
Hier bedarf es einer zugleich umfassenden Beschreibung der Konzepte und der gezielt einzusetzenden Werkzeuge, Optimierungstechniken. Wie Sie am Inhaltsverzeichnis erkennen und ablesen können, gibt es einen großen Fundus an Möglichkeiten. Nutzen Sie das Lean Taschenbuch als Marktplatz der Möglichkeiten für Ihre Optimierung für sich selbst oder für Ihr Unternehmen. Lassen Sie sich von den Techniken und Konzepten inspirieren.
Im Rahmen unserer Lean Admin Projekte und Lean Workshops („Workshops“ sind umsetzungsstarke Arbeitstreffen einer Gruppe) treten immer wieder Kommunikationsprobleme, Verständnisschwierigkeiten und am Ende ungewollt Fehler auf.
Der Grund: Wir sprechen von unterschiedlichen Dingen, meinen aber das Gleiche. Oder wir sprechen vom Gleichen und nutzen unterschiedliche Begriffe.
Häufig werden auch Management-Begriffe gerne aus dem Englischen übernommen. Die Mitarbeiter der Basis können allerdings mit diesen Begriffen und Schlagwörtern wenig anfangen.
Praxistauglichkeit beginnt mit der einfachen und nutzergerechten Sprache. Die Praxistauglichkeit bestimmen im Umfeld eines umsetzungsorientierten Lean aber der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin in den Abteilungen, die Kollegen / die Kolleginnen, die die Geschäftsprozesse ausführen.
Daher ist es uns ein Anliegen und auch eine Pflicht im Rahmen von „Lean“ eine einheitliche Sprache zu sprechen. Die Sprache soll nicht nur einheitlich sein, sondern auch leicht verständlich und so „deutsch“ wie eben möglich.
Da eine Vielzahl der Begriffe über die amerikanische Management-Schiene zu uns nach Deutschland herüber „schwappt“, lässt es sich nicht vermeiden, zumindest teilweise die englischen Begriffe zu nutzen.
In diesem Zusammenhang macht ein „Taschenbuch“, ein Lean Pocket Guide Administration, zur schnellen Orientierung im Dschungel der Lean Begrifflichkeiten mehr als Sinn. Unsere Berater setzen dieses Handbuch auch als Beraterleitfaden ein. Dies soll die Sprache und die Techniken standardisieren und professionalisieren.
1.1 Die Lean Historie (Quelle Wikipedia) im kurzen Überblick
Entstanden sind die Methoden des Lean Managements Mitte des 20. Jahrhunderts bei dem japanischen Automobilhersteller Toyota, dem es mit diesem Konzept gelungen ist, eine stabile Prozessorganisation zu gestalten, die Grundlage des erreichten hohen Qualitätsniveaus seiner Produkte sind.
Lean Management wird inzwischen weltweit in nahezu allen Branchen erfolgreich angewendet und beschränkt sich, wie bereits gesagt, nicht mehr nur auf fertigende Prozesse (Lean Production), sondern bezieht auch andere Geschäftsbereiche ein, wie etwa die Instandhaltung (Lean Maintenance) oder die Geschäftsprozesse (Lean Administration). Lean Administration findet Anwendung zum Beispiel bei der Erstellung von Dienstleistungen oder als unterstützende Prozesse zum Beispiel bei der Auftragsabwicklung.
Viele namhafte Unternehmen haben Lean Projekte und Produktionssysteme eingerichtet, die das Toyota Production System (>> TPS) zum Vorbild haben.
Nach unserem Kenntnisstand hat nun der frz. Automobilzulieferer Faurecia mit der Übertragung der TPS-Konzepte (Lean Manufacturing) in die Verwaltung begonnen; hier wurden dann bereits 2002 Kanban, Teamtafeln, Kennzahlen, etc. im Büroumfeld in die Anwendung gebracht.
Vergleichbare Konzepte haben z.B. auch die Siemens AG mit Total Cycle Time (dt.: Gesamtdurchlaufzeit) Verbesserungskonzepten begonnen. „Um Motivation und Qualifikation der Belegschaft durch eine größere Beteiligung am gesamten Prozessablauf zu erhöhen, verordnete sich Siemens 1993 ein „Fitnessprogramm“ mit dem Namen „top“ (time optimized process). 1998 wurde es unter Einsatz konkreter Management-Instrumente zu „top+“ erweitert.“ [Quelle Siemens.com/history am 22.05.2013]
Hier steht die Verbesserung der >> Durchlaufzeiten von Prozessen im Mittelpunkt der Überlegung. Dieses Element der Gesamtdurchlaufzeitbetrachtung und der schnellen Prozesse findet sich auch im Rahmen von >> Lean Administration wieder.
1.2 Verbesserung der Verständlichkeit
Der vorhandene Katalog beschreibt kurz und prägnant die wichtigsten Lean Begriffe. Die Zeichenkette „>>“ verweist auf weitere Erläuterungen in anderen Abschnitten/Kapiteln des Taschenbuches. Im Anhang befindet sich zudem ein hilfreiches Abkürzungsverzeichnis.
1.3 Der Werkzeugkoffer des Lean Administration / Lean Management
Der Methodenkoffer des Lean Administrations / Lean Managements beschreibt nicht nur Begriffe, sondern auch Vorgehensweisen zur Umsetzung von Lean Werkzeugen.
Die wichtigsten Lean Werkzeuge werden im folgenden Handbuch näher, d.h. mit Ausgangssituation, Definition und teilweise auch Beispielen näher beschrieben.
Das Taschenbuch beschreibt die wesentlichen Lean Administration Werkzeuge, d.h. die Verbesserungstechniken, die in der Verwaltung (Vertrieb, Marketing, Qualitätssicherung, Planung, etc.) eingesetzt werden.
Teilweise wurden die Begriffe aus dem Lean Production in kurzen Beschreibungen belassen. Dies ist damit begründet, dass einige indirekte Bereiche „produktionsnah“ sind, wie z.B. die Logistik, die Werksinstandhaltung. Diese Bereiche können beide Konzepte, die des Lean Production und des Lean Administration, verwenden.
Ein weiterer Grund für den Mix besteht darin, dass ein „perfektes“ Verständnis für „Lean Administration“ verbessert werden kann, wenn die zugrundeliegenden Konzepte des „Lean Production“ verstanden sind. Dennoch wurde der Inhalt von „Lean Production“ kompakt gehalten. Die weiteren Details zu den Werkzeugen des „Lean Production“ finden sich im Lean Taschenbuch Produktion des Lean Institute.
Es ist geplant ein vergleichbares Taschenbuch auch für Lean Leadership (dt.: das richtige Führen, die richtige Organisation für Lean) aufzubauen.
Nun beginnen wir mit der Beschreibung der einzelnen Begriffe, Werkzeuge und zugrundeliegenden Denkweisen. Mit dem Arbeiten und dem besseren Verstehen der Begriffe ergeben sich ein mehr und mehr schlüssiges Bild der Begriffe und deren Wechselwirkung untereinander.
Der erfahrende Berater wird auf der Basis des richtigen Problemverständnisses die richtige Diagnose stellen und abschließend die richtigen Verbesserungstechniken auswählen
Hieraus leitet sich dann auch ein wachsendes Systemverständnis ab. Denn das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile.
Bitte beachten Sie, dass wir oft die maskuline Form von Personen nutzen (der Berater, der Mitarbeiter, der Geschäftsführer, o.ä.) – dies soll in keinster Weise diskriminieren. Wir haben dies alleine aus Vereinfachungsgründen so gewählt.
Viel Spaß, liebe Leserin, geschätzte Beraterin, lieber Leser, geschätzter Trainer, nun beim Lesen und Stöbern!
1.3.1 3 Mu (Muda, Mura, Muri)
Aus dem Japanischen für die typischen 3 Verlustarten in einer Fabrik; diese können aber auch, Sie werden sicherlich zustimmen, in der Verwaltung auftreten:
Muda
Verschwendung
Mura
Abweichung / Inkonsistenz
Muri
Überlastung
Die 3 Mu stellen die Grundlage für die Verbesserungsphilosophie des Toyota Production Systems (siehe dazu unter >> TPS) dar. Die drei Mu werden als Schwerpunkte des Verschwendungspotenzials bzw. der Verbesserungsmöglichkeiten verstanden. Darunter ist die Verlustart „7 + X Arten der Verschwendung“, Sieben plus X (>> Muda) die Wichtigste; siehe dazu auch „TIM WOOD", Waste und 7+1 Arten der Verschwendung Produktion.
Im Wesentlichen benutzen wir zur Vereinfachung lediglich den Begriff „Verschwendung“ oder „Muda“; dies hat sich im Lean Sprachschatz und bei den Lean Anwendern verfestigt.
Informativ:
Mura bezeichnet eine ungleiche Verteilung der Arbeitslast über den Tag, wenn es beispielsweise bedingt durch ungünstige Prozessverknüpfungen Wartezeiten und dann wieder Zeiten mit hektischer Arbeitstätigkeit gibt.
Der Begriff Muri beschreibt Tätigkeiten, deren Ausführung z.B. durch mangelhafte Ausstattung des Arbeitsplatzes oder falsche Arbeitstechnik erschwert wird. Ein zentrales Ziel des Lean Administration Systems ist es muda, mura und muri zu reduzieren.
Um diese Verschwendung gezielt anzugreifen ist es sinnvoll, alle Prozesse aus Kundensicht zu betrachten und die Anteile von Aktivitäten, die nicht der Erfüllung der Kundenwünsche dienen, konsequent zu verringern. Das schließt alle Wertschöpfungsaktivitäten ein, die entweder extern oder intern (z.B. für andere Abteilungen) erbracht werden.
Die Verschwendung ist im Umfeld von „Lean“ unser allergrößter „Feind“.
Der Begriff soll glasklar aufzeigen, wo es Verbesserungspunkte gibt. Einige Unternehmen scheuen sich den Begriff „Verschwendung“ zu nutzen, da er zu kritisch wirkt. Die Selbstkritik und das Streben nach Perfektion sind aber ein Element, welches das schlanke Denken bei Toyota und anderen sehr erfolgreichen Unternehmen auszeichnet.
Es ist die Entscheidung des Unternehmens, wie dieser zentrale Punkt genannt wird. Eines ist aber klar: Es gibt eine große Liste an Verbesserungspunkten, wenn man in einer Abteilung des Unternehmens die „Verschwendungsbrille“ aufhat und gelernt hat „Verschwendung zu sehen“.
Eine gute Technik, die hier eingesetzt wird, ist der sogenannte Verschwendungsrundgang. Hier wird ein abgegrenzter Bereich bewusst für ca. 10 Minuten beobachtet. Alle Auffälligkeiten werden sorgsam notiert. Mit diesen Punkten haben wir sehr schnell Verbesserungsmöglichkeiten aufgedeckt. Dieser Verschwendungsrundgang wird im Englischen als „Office Waste Walk“ oder „Gemba Walk“ bezeichnet; hierfür gibt es unterstützende Formblätter.
Er hat seinen Ursprung im sog. „Toyota Kreidekreis“; hier müssen Führungskräfte in einem auf dem Boden markierten (gedachten) Kreidekreis stehen und das Produktionsgeschehen für einige Minuten (ca. 10-15 Minuten) aufmerksam beobachten. Diese Übung, die sich in erster Näherung seltsam anhört, ist eine bedeutende Übung zum „Sehen Lernen“ der Verschwendung. Innerhalb weniger Minuten kann sichtbare Verschwendung erkannt werden: gestörte Maschinen, Mitarbeiter haben Probleme mit dem Material, die Logistik fährt fünf Mal mit dem Stapler an einer engen Stelle vorbei, etc..
Ob Verschwendung nun der größte Feind für das Unternehmen oder der größte Freund für den Optimierer ist, sei jedem selbst überlassen. Wichtig ist, dass an Verbesserungen konsequent gearbeitet wird.
Aus der Praxis:
Es ist keine Seltenheit, dass Einkäufer mit Lieferanten bei den neuen Einkaufspreisen bereits Preisreduzierungen in Höhe von jeweils 10% für die nächsten 3 Jahre vertraglich vereinbaren.
Das Eliminieren von Verschwendung, die kontinuierliche Verbesserung mit Lean / KVP liefert einen entscheidenden, eleganten Beitrag für diese Kostensenkung. Wer dies nicht nutzt, hat einen entscheidenden unternehmerischen Nachteil.
1.3.2 4P – Pyramide
Die 4P (Philosophie, Prozesse, Mitarbeiter und Partner, Problemlösung) stellen die zentralen Aspekte dar, die im Rahmen des Toyota Produktionssystems eine entscheidende Rolle spielen.
Dies zeigt klar, dass die Werkzeuge, Verbesserungstechniken in ein Gesamtkonzept, in ein schlankes Denken (>> Lean Thinking) eingeordnet werden müssen. Hierzu gehören auch externe Lieferanten.
Bild: Toyota’s
Tabelle: Kompakte Erläuterung der 4P
1.3.3 5 M - Mensch – Maschine – Material – Methode - Management
Das Prozessmodell des Qualitätsmanagements (auch 5M oder 5M-Prozessmodell) ist ein Prozessmodell bestehend aus der Aufzählung der betrachteten Elemente eines Prozesses. Die fünf Elemente (auch Produktionsfaktoren genannt) werden mit Begriffen abgekürzt, die für die prozessbestimmenden Faktoren stehen.
Das Modell ähnelt dem Arbeitssystem, das in der Arbeitsgestaltung verwendet wird.
der
M
ensch (man)
die
M
ethode (method)
das
M
aterial (material)
die
M
aschine (machine)
die
M
itwelt (milieu)
Der Mensch wird in diesem Zusammenhang sowohl als Arbeitsperson, als auch als soziale Einheit betrachtet. Unter Methode werden Prozessabläufe ebenso verstanden wie die Arbeitstätigkeiten, die im System ausgeführt werden müssen. Das Material steht für das Eingangs- und das Ausgangsmaterial, welches im Arbeitssystem getrennt aufgeführt wird.
Die Maschine steht für alle Technologien, die in dem System eingesetzt werden und die Mitwelt (Umwelt) beschreibt die gesamte wahrgenommene und nicht wahrgenommene Umwelt, die auf den Prozess einwirkt. [Quelle: Wikipedia am 22.05.2013]
Diese 5M oder weitere „M“ finden wir im Umfeld der Problemanalyse und dem >> Ishikawa-Diagramm - Fischgrätendiagramm wieder. 5M öffnet den Blick auf beeinflussende Faktoren des Geschehens.
Aus der Praxis:
Zu oft wird ein Faktor, z.B. bei auftretenden Qualitätsproblemen oder sogar Kundenreklamationen, „der Mitarbeiter war schuld; dieser muss geschult werden!“ selektiv betont.
Dies führt i.d.R. aber nicht weiter. Genau aus diesem Grund besteht 5-M aus mehr als 1 M.
1.3.4 5 S (5 A) - 5 Schlüssel für Ordnung und Systematik
Die Erreichung eines sauberen, ordentlichen und organisierten Arbeitsplatzes wird mit 5S erreicht: Ordnung, Sauberkeit und Systematik! Der zentrale 5S-Leitsatz heißt:
„Alles Notwendige hat seinen Platz und alles ist an seinem Platz, ist sauber und bereit zum Gebrauch - immer."
Im Büroumfeld schließt dies die Arbeitsplätze aber auch die EDV-Strukturen ein. 5S nicht nur auf dem Schreibtisch, in den Schränken sondern auch auf der Festplatte.
5S kommt aus dem Japanischen und bedeutet:
Seiri + Ordnung schaffen; Aussortieren
Seiton + Ordnungsliebe; Platz definieren
Seiso + Sauberkeit; Sauberkeit sicherstellen
Seiketsu + Persönlicher Ordnungssinn; Standards nutzen
Shitsuke + Disziplin; jeden Tag zu jeder Zeit
Auf Deutsch beinhalten die 5S (5S wird dabei manchmal auch 5A genannt):
Sortieren AussortierenSystematisieren AufräumenSäubern Arbeitsplätze sauber haltenStandardisieren Allgemeine Standards erarbeitenSelbstdisziplin, Stabilisieren Alle Punkte einhalten und ständig verbessern
Hinweis: Bei internationalen Unternehmen empfiehlt sich 5S als einheitlicher Begriff (5S im Englischen: Sort, Set, Shine, Standardize, Sustain).
Was ist das praktische, konkrete Problem vor 5S Office?
Fehlende Ordnung, Sauberkeit und Systematik
Hohes Maß an Ineffizienz (Suchen, unnötiges Vorhalten von Ordnern,…)
Keine Prozesssicherheit (Gefahr der Verwechslung; Informationen können offen herumliegen oder dem falschen Adressaten in die Hände fallen)
Zu wenig Platz (oder wir glauben, dass wir zu wenig Platz haben)
Unfallgefahr durch herumliegende Gegenstände / elektrische Kabel / zugestellte Flure
Schema:
Folgendes Schema illustriert den 5S-Prozess mit den einzelnen Schritten. Zudem wird klar, dass 5S Office auch einen hohen Bezug zur IT/EDV hat.
Bild: Der Lean Institute 5S Office Prozess
Definition:
5S / 5A ist ein sehr praktisches Lean-/KVP-Werkzeug. Basisaufgaben jedes Mitarbeiters sind es Ordnung, Sauberkeit in einem organisierten Arbeitsumfeld zu bewahren.
Dies gilt für den eigenen Arbeitsplatz und auch für die Gemeinschaftsbereiche (z.B.: Küchen, Besprechungsräume, Kopierer).
Das 5S-Konzept stellt eine einfache, aber effektive Methode zur Arbeitsplatzorganisation dar und dient der Sicherstellung von Ordnung, Sauberkeit und Systematik am Arbeitsplatz. Es kann bei konsequenter Umsetzung neben einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen, des Teamworks, der schnellen Informationsverfügbarkeit oder der Kundenzufriedenheit auch die Suchzeit, Flächenkosten (s. anfallende Mieten) und die Durchlaufzeiten senken.
Dabei können die 5S in verschiedenen Bereichen, angefangen vom einzelnen Arbeitsplatz über ganze Abteilungen bis hin zu einer umfassenden Anwendung im ganzen Unternehmen, realisiert werden. Gekennzeichnete Stellflächen, übersichtlich gestaltete Ordnerablagen, Informationsstrukturen oder saubere Gemeinschaftsbereiche führen nicht nur zu erhöhter Sicherheit, Informationssicherheit, verbesserter Qualität und einer Steigerung der Produktivität, sondern verbessern auch die gesamte Optik des Büros, nicht zuletzt in den Augen des Kunden.
Es sind Fälle bekannt, bei denen eine Image-CD eines Konstruktionsbüros „durchgefallen“ ist, weil die im Hintergrund gezeigten Schreibtische des Konstruktionsbüros überfüllt, chaotisch und desorganisiert wirkten. Der Interessent, der die CD betrachtete, zeigte sich von der „Qualität“ des Konstruktionsbüros durch die sichtbare Unordnung irritiert. „Die können doch keine Qualität konstruieren, wenn es so bei denen aussieht!“
Ziele:
Reduzierung von Verschwendung
Ordnung, Sauberkeit und Systematik am Arbeitsplatz
Ordnung, Sauberkeit und Systematik in den Dateistrukturen
Reduzierung von Suchzeiten, Wegzeiten, Doppelarbeiten
Ziel ist es, dem Mitarbeiter die Verantwortung für den einwandfreien Zustand seines gesamten Arbeitsplatzes (nicht nur der Arbeitstisch sondern auch die eingesetzte EDV-Struktur) zu übertragen.
Vorgehensweise / Methode:
Die Mitarbeiter werden in 5S Office geschult, ein Bewusstsein aufgebaut und ein Pilotbereich für 5S definiert. Es wird der >> Red-Tag-Bereich (oder: Rote Zone) definiert und Kennzeichnungen in Farbe und Form festgelegt. Diese Farbdefinition regelt die einheitliche Kennzeichnung von Schränken, Stellflächen, Ordnern, Sperrflächen für die gesamte Abteilung. Alles wird einheitlich gekennzeichnet, denn alles hat seinen Platz und alles ist an seinem Platz.
Praktisches Beispiel:
Zum Arbeiten in einem Vertrieb steht ein Marketingmaterial-Schrank zur Verfügung, in dem alle Kataloge, Werbegeschenke „kreuz und quer“ liegen. Tatsächlich werden aber nur ein aktueller Katalog und die passende Produktspezifikation benötigt. Hier kann man zunächst vieles aussortieren… In einem praktischen Fall konnten Hunderte Uhren (Werbegeschenke) in einem Schrank gefunden werden. Der Schrank musste zuvor aufgebrochen werden, da der Schlüssel nicht auffindbar war und dieser Schrank wohl seit Jahren keine Verwendung mehr hatte. Die Uhren zeigten zudem einen Markennamen eines abgelaufenen Produktes, welches nicht mehr Katalogware war.
Tipps und Erfahrungswerte:
Nach der „Aufräumaktion“ soll die Disziplin eingehalten werden.
Ein Bereichsverantwortlicher soll festgelegt werden.
Patenschaften für einzelne Teilbereiche, Schränke sichtbar festlegen.
Der Erfolg wird messbar in den Prozesszeiten.
Was ist der konkrete Nutzen / Wertbeitrag?
Reduzierung der Suchzeiten
Abmelden von genutzter Bürofläche zur Senkung der Mieten
Reduzierung der Wegzeiten
Reduzierung von Stress
Ordnung, Sauberkeit und Systematik
Prozesssicherheit / Informationssicherheit
Mehr Platz (z.B. für neue Arbeitstische)
5S auch im Büro und im Rahmen der Informationssicherheit
Das neue System der Ordnung, Sauberkeit, Systematik zeigt auch im Rahmen der Informationssicherheit seine Vorteile. Ergebnis: Reduzierung der Gefahr, dass sensible Informationen (Rezepturen, Zeichnungen, Kalkulationen und Preise) an den falschen Empfänger geraten.
Immer wieder können bei Firmenbesuchen Kopierer, Faxe, zentrale Drucker gesehen werden, wo Ausdrucke mit Zahlenmaterial, Angebote und/oder Zeichnungen ausliegen.
Nichts wäre fataler, als dass diese Informationen in die falschen Hände geraten. In einer 5S Office Anwendung bei einem großen Konzern wurde der Zusammenhang zwischen 5S Office und Informationssicherheit von Beginn an thematisiert und berücksichtigt.
5S Produktion
5S hat seinen Ursprung in der Fertigung, in der Montage als 5S Produktion; weitere Details hierzu im Taschenbuch >> Lean Taschenbuch Produktion.
Hier wurde der Nutzen zur Reduzierung der Suchzeiten, Verringerung von Stress bereits früh erkannt und methodengestützt umgesetzt.
1.3.5 5 W / 5 mal Warum
Ist eine einfache Methode zur Identifizierung der Ursache eines Problems. Sie kennen diese Technik sicherlich von Kindern, die mit dem „Warum-Fragen“ gar nicht aufhören,…, bis zur „Verzweiflung“ des Antwortsuchenden…
Die Idee besagt, man solle fünfmal nach dem Warum (daher 5 W) fragen. Mit jedem Mal soll eine Problemebene abgedeckt werden, bis man am Ende den eigentlichen Kern trifft. Es gilt die Ursache abzustellen – nicht das sich zeigende Symptom.
Beispiel: 5 Warum: Verlust von Skontogeld
5 mal „Warum?“ fragen ist ein Element der standardisierten Problemlösung (>> PDCA, DMAIC) und hilft der wirklichen Ursache auf die Spur zu kommen.
5 W vermeidet oft teure Schnellschüsse, bei denen das Problem immer wieder auftritt. Lieber einmal richtig analysieren, der Sache auf den Grund gehen als dauernd das gleiche Problem zu bekämpfen.
1.3.6 7+1 Arten der Verschwendung Produktion
Als Verschwendung (jap.: „muda“) bezeichnet man alles außer dem Minimum an Aufwand für Betriebsmittel, Material, Platz und Arbeitszeit, das für die Wertsteigerung eines Produktes unerlässlich ist. Es sind also jene Aktivitäten, die Ressourcen verbrauchen, aber für den Kunden keinen Wert oder Nutzen erzeugen. Der größte „Feind“ der Verschwendung ist unser „Lean Freund“.
Einige Unternehmen übernehmen 1:1 die Toyota Verschwendungsarten auch für das administrative Umfeld. Grundsätzlich ist dies nicht falsch; allerdings stellen wir in der Praxis fest, dass Schnittstellen, unklare Standards, Unordnung als Verschwendungsarten in der Verwaltung eine hohe Bedeutung haben. (Anmerkung: Wichtig ist, dass 1 Standard hierzu existiert…)
Bei Toyota wurden die sieben plus eins Arten der Verschwendung herauskristallisiert, auf die alle KVP-Aktivitäten zurückzuführen sind: Da die Vermeidung von Verschwendung ein grundlegendes Prinzip des Lean Ansatzes ist, zielen nahezu alle eingesetzten Methoden und Werkzeuge (s. Lean Tools) auf eine Steigerung der wertschöpfenden Tätigkeiten und eine Eliminierung der verschwendungsbehafteten, nicht wertschöpfenden Tätigkeiten.
Ziele:
Bestände reduzieren
Bewegungen reduzieren
Kürzere Wartezeiten / Leerzeiten
Keine Überproduktion
Keine Überbearbeitung
Keine Nacharbeit durch Defekte, Prüfungen, Tests
Weniger Transport, weniger Handlings
Qualifiziertere Mitarbeiter
Tabelle: 7+1 Arten der Verschwendung - Produktion
Methode: Von der Verschwendung zur Problemlösung
Nach Erkennen der Verschwendung wird die Verschwendung unter Nutzung der standardisierten Problemlösung (standardisierte Problemlösung gemäß >> PDCA, DMAIC, >> 8 LI Schritte) reduziert oder noch besser ganz eliminiert.
Praktisches Beispiel:
Es wird seit Jahren in der Endkontrolle der Fehler „Druckbild Inkjet falsch“ in einer Qualitätsdokumentation festgehalten. Dieses Datensammelblatt wird in eine Statistik eingepflegt. Diese Statistik, mit einer Kennzahlendarstellung ergänzt, wird seit Jahren in der Fabrik in der Leitung vorgestellt. Gegenmaßnahme ? – Fehlanzeige! Dies ist ein klassisches Beispiel für Verschwendung: Arbeitszeit, EDV-Zeit, Besprechungszeit,…
Bemerkung:
Verschwendung ist nicht die Ursache sondern das nach Außen auftretende Symptom!
Was ist der konkrete Nutzen / Wertbeitrag?
Transparenz der wertschöpfenden und nicht wertschöpfenden Prozesse
Sichtbarmachen von Verschwendung
Mitarbeiter sensibilisieren, dass KVP/Lean sinnvoll ist
Frustabbau bei den Mitarbeitern durch „Probleme kommen jetzt auf den Tisch!“
1.3.7 7+X Arten Verschwendung Administration
Als Verschwendung (jap.: „muda“) bezeichnet man alles außer dem Minimum an Aufwand für Betriebsmittel, Material, Platz und Arbeitszeit, das für die Wertsteigerung eines Produktes unerlässlich ist. Es sind also jene Aktivitäten, die Ressourcen verbrauchen, aber für den Kunden keinen Wert oder Nutzen erzeugen.
Bei Toyota wurden in der Produktion die sieben plus eins Arten der Verschwendung herauskristallisiert, auf die alle KVP-Aktivitäten zurückzuführen sind.
Wir haben als Lean Institute ® auf der Basis unserer Erfahrungen und Zielstellungen folgende Verschwendungsarten für die Verwaltung, die administrativen Bereiche herausgestellt.
Dem aufmerksamen Leser wird in der folgenden Tabelle auffallen, dass „Bestände“ in der Admin als Verschwendung nicht unmittelbar auftaucht. Diese Verschwendungsart wird mit Überproduktion und Warten hinreichend abgedeckt.
Arten der Verschwendung im indirekten Bereichen (Büro, Verwaltung)
Tabelle: 7+3 Arten der Verschwendung - Verwaltung
Diese Verschwendungsarten werden mit dem >> Office Waste Walk und dem Verschwendungsinterview (eine gemäß den Verschwendungsarten strukturierte Fragetechnik, Fragenliste) aufgespürt, dokumentiert und abgestellt.
1.3.8 8 Schritte der standardisierten Problemlösung
Ein exzellentes Hilfsmittel zur standardisierten Problemlösung und Kennzahlenverbesserung sind die 8 Schritte des Lean Institute (8 LI-Schritte).
Hier werden auf einem Flipchart insgesamt 8 Blätter im Querformat angebracht; diese in 2 Spalten à 4 Blätter strukturiert (s. Schema) und z.B. mit offenen Klarsichthüllen befestigt.
Diese Blätter (Schritte des Problemlösungsprozesses) werden nacheinander vom Eigentümer oder Verbesserungsteam vervollständigt.
Wenn mehrere Personen gleichzeitig an verschiedenen Verbesserungsthemen arbeiten, kann die Führungskraft einen schnellen und strukturierten Überblick erhalten.
Im Grunde genommen entspricht dies dem >> PDCA-orientierten Verbesserungsprozess. Das Lean Institute hat mit dieser einfachen Technik beste Erfolge auf der mittleren Führungsebene erreicht.
Tabelle: In 8 Schritten ein relevantes Problem kontinuierlich verbessern
Es gibt hunderte Varianten an standardisierten Problemlösungsmethoden; einige in 4 Schritten (>> PDCA); einige in 5 Schritten (>> DMAIC); einige in 8 (>> 8D Bericht), 9 (s. später der >> A3-Bericht),10 oder 12 Schritten.
Tipp:
Legen Sie Ihren standardisierten Problemlösungsprozess und die Schritte in der Verzahnung mit dem Qualitätsmanagementhandbuch als Standard fest.
1.3.9 80-20-Regel – Pareto-Prinzip
Ein exzellentes Hilfsmittel bei der fokussierten Problemlösung und wirkungsvollen Kennzahlenverbesserung ist die sog. 80-20-Regel.
Hintergrund ist die Erkenntnis, dass oft eine Vielzahl von Faktoren einen Einfluss auf die Problemlösung haben. Die Erfahrung und die Datensammlung zeigt jedoch, dass es (zum Glück) oft einige wenige Faktoren gibt, die einen deutlich größeren Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Kenntnis dieser wenigen aber wirkungsstarken Faktoren hilft uns gezielt und gemäß der >> Aufwand-Nutzen-Matrix mit minimalem Aufwand die größte Wirkung auf eine Ergebnisverbesserung zu erzielen.
Bild: Wenige Einflussfaktoren haben eine größere Wirkung auf die Zielerreichung
Begriff und Historie
Das Paretoprinzip, benannt nach Vilfredo Pareto (1848–1923), auch Pareto-Effekt, 80-zu-20-Regel, einfach 80-20-Regel, besagt, dass z.B. 80 % der Ergebnisse in 20 % der Gesamtzeit eines Projekts erreicht werden. Die verbleibenden 20 % der Ergebnisse benötigen 80 % der Gesamtzeit und verursachen die meiste Arbeit.
Die Pareto-Verteilung beschreibt dann das statistische Phänomen, wenn eine kleine Anzahl von hohen Werten einer Wertemenge mehr zu deren Gesamtwert beiträgt als die hohe Anzahl der kleinen Werte dieser Menge.
Vilfredo Pareto untersuchte die Verteilung von Reichtum und Einkommen in England und fand heraus, dass ca. 20 % der Familien ca. 80 % des Vermögens besitzen. Banken sollten sich also vornehmlich um diese 20 % der Menschen kümmern und ein Großteil ihrer Auftragslage wäre gesichert.
Daraus leitet sich das Pareto-Prinzip oder die 80-20-Regel ab. Es besagt, dass sich viele Aufgaben mit einem Mitteleinsatz (Ressourcenaufwand) von ca. 20 % so erledigen lassen, dass 80 % aller Probleme gelöst werden. [Quelle: in Anlehnung an wikipedia vom 21.01.2014]
Voraussetzung einer datenbasierten Bewertung ist das Sammeln von Daten und die Nutzung von >> ZDF.





























