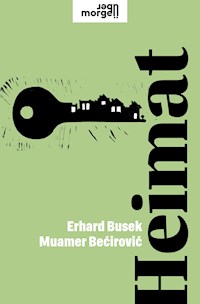Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Erhard Busek ist eine faszinierende Persönlichkeit. Geboren 1941 als Sohn eines Bauingenieurs, geht er schon früh in die Politik - und bringt es weit darin. Unkonventioneller Denker und Intellektueller, der er ist, lässt er sich nie in Parteikorsette zwängen, engagiert sich mit den "bunten Vögeln" für Umweltpolitik, als dies noch nicht Mainstream ist, initiiert Projekte gegen Fremdenfeindlichkeit und für eine moderne Kulturpolitik - die VP-Granden beenden die bundespolitische Karriere Buseks, Wolfgang Schüssel wird Vizekanzler. Doch "homo politicus" bleibt Erhard Busek und ist es bis heute. Die europäische Integration Mittel- und Osteuropas ist ihm seit je ein Anliegen. Schon im Prager Frühling 1968 nimmt er Kontakt mit Dissidenten auf, ist 1980 beim Gründungskongress der Solidarność dabei - und stößt mit seinem Engagement in Österreich lange auf Unverständnis. Erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ändert sich das. Die Erinnerungen Erhard Buseks sind keine chronologisch geordnete Lebensgeschichte: Persönliches wechselt sich mit Überlegungen zur heutigen Kultur-, Bildungs- und Wissenschaftspolitik ab, biografische Stationen führen zu Nachdenklichem über Europa und den Balkan. Auch da lässt sich Erhard Busek nicht einengen: Der konventionelle Rahmen einer Biografie würde zu kurz greifen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erhard Busek
Lebensbilder
www.kremayr-scheriau.at
ISBN 978-3-218-00953-9 Copyright © 2014 by Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co. KG, Wien Alle Rechte vorbehalten Schutzumschlaggestaltung: Sophie Gudenus unter Verwendung eines Fotos von Manca Juvan Typografische Gestaltung: Birgit Mayer, Extraplan Datenkonvertierung E-Book: Nakadake, Wien
Inhalt
Einleitung
Wo ist meine Heimat?
Non vitae, sed scholae discimus – oder umgekehrt?
Religion kommt von „religare“, sich binden
Demokratie und Parlament im Wandel
Wien, Wien nur du allein
Die Zeit am Minoritenplatz
Nichts bleibt gleich in Europa
Abschied aus dem Amt
Entscheidung für Europa
Faszination der Kultur
Europa konkret
Ohne Freunde geht es nicht
Danksagung
Lebenslauf
Publikationen
Namenregister
Einleitung
„Hiersein ist herrlich.“ Rilke, Duineser Elegien
An sich ist es zunächst erfreulich, wenn man von wohlmeinenden Menschen aufgefordert wird, seine Erinnerungen zu schreiben, aber in mir hat sich immer etwas dagegen gesträubt. Zum einen haben mich nur wenige Memoiren österreichischer Politiker überzeugt, weil sie entweder uferlos breit angelegt oder mehr oder weniger das Produkt eines Ghostwriters waren. Dazu kommt, dass man sich an vieles nicht mehr erinnert und auch das eigene Leben für nicht so wichtig nimmt, als dass es wert wäre, aufgezeichnet zu werden. Andererseits hat mich aber eine gewisse Sehnsucht erfasst, angesichts der gegenwärtigen gewaltigen Umbrüche, aber auch der sich verändernden Welt, die ich, zum Ende meines Lebensbogens kommend, erlebe, manches festzuhalten, das mir wichtig ist.
Ich bin 1941 geboren, mitten im Zweiten Weltkrieg, mein Vater war zur Wehrmacht eingezogen worden und mein geliebtes Österreich hat es für die sieben Jahre des tausendjährigen Reiches nicht gegeben. Ich erlebe heute eine junge Generation, der dieser historische Bogen vom Zweiten Weltkrieg über das Wiedererstehen Österreichs hin zur Unabhängigkeit, zur Randlage am Eisernen Vorhang bis hin zur Integration in das im Werden begriffene Europa nichts sagt. So habe ich mich entschlossen, Geschichte in Geschichten zu erzählen, die ein wenig sichtbar machen sollen, wie ich die Entwicklung in der Zeit gesehen habe, was mir begegnet ist und woran ich erinnern möchte.
Was ich hier schreibe, ist äußerst subjektiv und das Ergebnis eines Interviews mit mir selbst. Das gesprochene Wort wird sich daher im Duktus mancher Sätze, in der nicht immer konsequent angewendeten Consecutio temporum und in einigen verwendeten Ausdrücken wiederfinden. Sich zu erinnern bedeutet letztlich, etwas in die Gegenwart zu holen, mit allen Empfindungen.
Natürlich gibt es geschichtliche Ereignisse, die sich entsprechend dokumentieren lassen, aber Fakten und Jahreszahlen allein machen eine Welt nicht vollständig sichtbar. Dazu gehören Geschichten, die erzählt werden, und Anekdoten, die genauso einen Überblick geben und etwas Farbe in das Geschehen bringen. Eine wirkliche Objektivierung gibt es eigentlich nicht. Nicht nur die Art des Berichtes, sondern auch die unterschiedliche Perzeption bringt immer ein subjektives Element hinein.
Sensationen oder Enthüllungen habe ich nicht zu bieten. Ich hatte mir beim Schreiben dieses Berichts vorgenommen, manche Dinge zu erzählen, wie ich sie gesehen und erlebt habe, auch Personen zu beschreiben, wie sie von mir wahrgenommen wurden. Der Leser wird die Systematik vermissen, ich halte sie nicht für notwendig. Auch muss man Erinnerungslücken einkalkulieren, nicht nur als Ergebnis des zunehmenden Alters, sondern wohl auch aufgrund der Tatsache, dass zum Erinnern auch das Vergessen gehört.
Persönlich neige ich dazu, das Vergessen als ein Geschenk zu betrachten, wenn nicht sogar als eine Gnade für die jeweils Betroffenen, wie Berthold Viertel meinte. Um nicht missverstanden zu werden: Erinnerungskultur und der Kampf dem Vergessen sind heute Elemente, die immer wieder als „political correctness“ eingefordert werden. Das halte ich auch für völlig richtig, beide zielen jedoch nicht auf das Vergessen des Einzelnen ab, sondern auf jenes innerhalb unseres Geschichtsbewusstseins. Was ich möchte, ist schlicht das Gefühl vermitteln, dass mir Gott, meine Mitmenschen, die Zeitereignisse, letztlich die Erfahrung, eine Welt geschenkt haben, in der ich gern zu Hause bin und, so lange es geht, auch sein möchte. Man sollte das vorliegende Produkt daher als eine Erzählung über einzelne Ereignisse betrachten, die mich bleibend fasziniert haben, in denen es mir geschenkt war, an Veränderungen teilzunehmen, oft meinen Sehnsüchten und Auffassungen folgend, wobei ich mir nicht einbilde, dabei grandiose Erfolge erzielt zu haben, sondern schon sehr zufrieden war, ein Mitwirkender mit vertretbaren Ergebnissen zu sein.
Je länger ich in der Politik tätig bin – von der kommunalen Ebene bis zur nationalen und europäischen Politik, in der „civil society“ oder in allen möglichen anderen Aufgaben, die ich mit Vergnügen wahrgenommen habe, desto mehr ist mir zu Bewusstsein gekommen, dass das Leben eigentlich ein Fest ist. Zeit- und Lebensabschnitte werden immer von Festen begleitet. Mit Sicherheit haben diese die Aufgabe, unser Erinnerungsvermögen zu stärken, Feste behält man im Gedächtnis, quasi als Video über das Leben. Dadurch entsteht eine höhere Ebene des Seins, die uns davon abhält, nur unseren menschlichen Funktionen nachzukommen. Bei Festen werden wir uns inne, dass unser Leben dieses „bloß Materielle“ zwar zur Grundlage hat, im Feiern jedoch sagen wir bewusst und dankbar Ja zu dieser Bedingtheit unseres Daseins, während uns gleichzeitig bewusst wird, dass unser Leben nicht vollständig aufgeht in diesem bloß Materiellen, sondern dass ein höherer Anspruch an unser Menschsein gestellt ist, und dass wir selbst höhere Ansprüche an uns selbst und an unsere Lebensziele haben.
Ein Fest ist daher etwas zutiefst Menschliches, oder besser gesagt: etwas höchst Menschliches. Tiere feiern keine Feste. Nur Menschen können das, weil nur Menschen lachen können, sich erinnern können, sich ihrer Vergangenheit und Zukunft vergewissern können, sich des Ablaufs der Zeit bewusst sein können. Ein Fest ist etwas Geistiges, eine Kulturgabe des Menschen. Ein Fest ist ein Ja zur Welt, ein Ja zum Leben; es ist eine utopische und dennoch reale Vorwegnahme einer besseren Welt, und gleichzeitig ein dankbares Ja zu unserem Dasein hier und jetzt.
Wo ist meine Heimat?
Bei aller im Leben zunehmenden Erfahrung darüber, wie viele Welten es gibt, in denen man zu Hause ist oder die einen prägen, gibt es doch so etwas Ähnliches wie eine Nabelschnur. Das Wort trifft in erster Linie auf Eltern und Familie zu, gilt aber auch für das Milieu, das einen prägt, wobei auch das einem Zeitenwandel unterworfen ist. Ein Problem meiner Generation, die den Missbrauch des Wortes „Heimat“ erleben musste, ist es, damit auf die richtige Weise umzugehen. In der Welt, in die ich hineingeboren wurde und in der ich erstmals so etwas wie ein Bewusstsein entwickelte, war die Beziehung zur Heimat Österreich sehr stark. Das war auch verständlich, denn die Familie, aus der ich komme, samt allen Ahnen mütterlicher- und väterlicherseits, fühlte sich in Österreich und Wien beheimatet. Als Konsequenz des Missbrauches des Wortes „Heimat“ in der Nazi-Zeit wurde man in der Öffentlichkeit ängstlich, es überhaupt zu verwenden. Man verkennt dabei aber, dass vor dieser schändlichen Umwertung des Begriffes Heimat damit ein ganz normales Gefühl beschrieben wurde. Eine Schwierigkeit mag auch sein, dass es in anderen Sprachen, soweit ich weiß, keine passende Übersetzung gibt. Aber alle, die entweder internationalistisch oder soziologisch denken, auch jene, die so wie ich ganz selbstverständlich sagen, dass sie Europäer sind, haben ein Gefühl der Nähe zu jenem Raum, in dem sie aufgewachsen sind und der sie durch verschiedenste Elemente geprägt hat.
„Das, was man ist, wird man durch Paris.“ (Jean-Jacques Rousseau, Confessions) Das gilt nicht nur für die französische Hauptstadt, sondern für alle unsere Orte. Ich kann mir schon vorstellen, dass im heutigen Zeitalter der Mobilität eine Vielseitigkeit entsteht, wie sie in Diplomatenfamilien üblich ist, wie sie auch bei der Wanderung durch die Wirtschaftswelt von heute entstehen kann oder aber dadurch, dass die politischen Verhältnisse einen zur Emigration gezwungen haben. Für mich muss ich bekennen: Ich bin Österreicher und Wiener – ohne das in irgendeiner Weise abzustufen. Dabei nimmt man vieles mit, was durchaus widersprüchlich ist, aber trotzdem ist es ein Nebeneinander, das jeweils prägend wirkt, aber nicht unbedingt in einen Konflikt münden muss.
Natürlich sind die Ereignisse der Geschichte durch all die Zeiten nicht spurlos an unserer Stadt und unserem Land vorübergegangen. Sie haben tiefe Narben im Antlitz Wiens, Österreichs und in den Seelen ihrer Bewohner hinterlassen. Jeder von uns trägt seine Erfahrungen und die seiner Familie sein Leben lang mit. Jörg Haider hat mir das ins Bewusstsein gerufen, als er meine aus seiner Sicht evidente tschechische Abstammung als Grund dafür nannte, dass ich für die Erweiterung der EU durch unsere Nachbarn eingetreten bin. Offensichtlich hat er damit eine „Ausbürgerung“ aus Österreich und eine Verletzung unserer Interessen durch mich gemeint.
Eine Kindheit und Jugend in Wien
Wie ist es wirklich? Vielen wird es so gehen wie mir: Meine Vorfahren sind von irgendwoher in das Zentrum des alten Reiches gekommen. Die einen, mütterlicherseits, sind schon seit mehr als zwei Jahrhunderten da, sie kamen aus dem bayrischen Raum und versuchten sich als Gewerbetreibende „am Grund“, als bürgerliche Fragner (Zimmermeister), bis sie schließlich im Baufach landeten. Sie waren allesamt gut katholisch. Bei den väterlichen Vorfahren verhielt es sich in vielerlei Hinsicht anders: Erst der Urgroßvater betrat diese Stadt, aus jenem Teil Schlesiens kommend, den Friedrich II. von Preußen Maria Theresia gelassen hatte. Der übertriebenen Neugier der Ahnenforscher des Dritten Reiches verdanke ich das Wissen, dass die Buseks eigentlich nicht so echt böhmisch sind, wie der Name klingt. Sie schrieben sich nämlich früher Buseck und kamen ursprünglich aus Hessen, aus dem Busecktal bei Gießen. Sie sind von dort unter die tolerantere Habsburgerkrone gezogen. Diese Toleranz erzeugte eigenartige Konfessionssitten: Da die Männer der Familie Busek evangelisch waren und die Frauen aus dem katholischen Österreich kamen, wurden alle Söhne nach dem Augsburger Bekenntnis getauft, die Töchter aber folgten dem Glauben der Mutter – ein pragmatisches Toleranzedikt gut österreichischer Prägung. Diese familiäre Erfahrung teile ich mit einem polnischen Politiker – Jerzy Buzek –, dessen Familie auch aus der Stadt kommt, über die meine Ahnen nach Wien gekommen sind: Teschen, heute geteilt in Český Těšín (Tschechische Republik) und Cieszyn (Polen). Er ist evangelisch, seine Schwestern katholisch – den gleichen Traditionen wie meine Familie folgend. Wahrscheinlich sind wir entfernt verwandt. Schreibfehler in Geburtsurkunden sind über Jahrhunderte selbstverständlich.
Erblicher Gleichklang bestand bei beiden Familienzweigen hingegen in beruflichen Fragen. Mein Urgroßonkel war Polier beim Rathausbau, der Urgroßvater baute das „Eisgrübl“-Haus hinter der Peterskirche, der Großvater stockte das Hotel Imperial auf und mein Vater schließlich hat beim Erbauer der Lueger-Kirche, Max Hegele, gelernt. Wenn alle Mitglieder der Familie zusammenkamen, gab es immer eine schreckliche Fachsimpelei über Wandstärken, Grundaushübe, Eisenarmierungen, unverständliche Flächenwidmungen und sinnlose Vorschriften der Bauordnung. Sämtliche Nachkommen der Familie haben sich ebenfalls dem Bauen verschrieben, ich betrachte mich da nicht als Ausnahme, denn schließlich wollte ich mit anderen gemeinsam an Wien weiterbauen. Zu den Baudenkmälern dieser Stadt habe ich daher eine enge Verbindung, nicht nur der Vorfahren wegen, sondern auch aufgrund der beruflichen Erfahrung meines Vaters als Leiter der Bauabteilung beim Fürsten Liechtenstein. Hier habe ich aus nächster Nähe miterlebt, was es heißt, historische Bausubstanz zu erhalten, Kriegseinwirkungen zu beseitigen und alte Mauern zu revitalisieren. Wer heute ein denkmalgeschütztes Haus hat, ist kein stolzer Besitzer und gedankenloser Nutznießer, sondern jemand, der ganz kräftig etwas dafür leisten muss, dass unsere eigene Geschichte in Zeugnissen erhalten bleibt.
Wie schwer das ist, zeigt ein Gang durch die Straßen und Gassen meiner Kindheit im neunten Wiener Gemeindebezirk, durch Liechtenthal – so wurde es früher geschrieben. Das Bild, das es heute bietet, in „aufgelockerter Bauweise“ mit viel zu hohen Gemeindebauten, ist längst nicht mehr jener Grund, der früher Anlass für Lieder und Gedichte war und ein Heimatgefühl vermittelte. Verloren steht die Pfarrkirche da, die ihr Aussehen Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg, dem Erbauer der Gloriette, verdankt, verloren steht auch das alte Pfarrhaus da, das noch einen Hauch jenes Charakters hat, den „Liechtenthal“ bis zum Ende der Fünfzigerjahre zeigte. Es soll damit nicht jenen einstöckigen Häusern das Wort geredet werden, die nicht über die notwendigen sanitären Anlagen verfügten und in denen das Wasser in den Mauern bis zum ersten Stock stand, statt aus der Leitung zu rinnen – Revitalisierung müsste ja keine brutale Neugestaltung sein. Aber die gewachsenen sozialen Strukturen dieses Viertels sind dahin. Die Menschen, die mit mir ihre Kindheit und Jugend dort verbracht haben, sind in andere Stadtgebiete gezogen, kommen aber heute noch öfter zusammen, um sich im alten Gesellenhaus, das inzwischen von der Kolpingfamilie renoviert wurde, an dieses Liechtenthal zu erinnern. Längst steht auch das Haus „Zum blauen Einhorn“ nicht mehr, das Heimito von Doderer liebevoll in seiner „Strudlhofstiege“ beschreibt. Es hat einer Begradigung der Liechtensteinstraße weichen müssen. Offenbar zur Erinnerung ist dort eine Verkehrsampel angebracht worden, die den Verkehr jetzt genauso behindert wie früher das vorgebaute Haus. Neu muss nicht immer besser sein. Aber prägend war das alles für mich.
Ich erinnere mich an meine Kindheit: Schon als Vierjähriger wurde ich darauf trainiert, die Warnsignale aus dem Radio zu erkennen, mit denen anfliegende Bomberverbände angekündigt wurden. Wie Momentaufnahmen stehen Bombentrichter vor mir, abgestürzte Flugzeugteile hinter dem Burgtheater und schließlich der Einmarsch der Roten Armee. Die Sowjets hielten den 9. Bezirk bis August 1945 besetzt und zogen sich dann über die Friedensbrücke in den 20. Bezirk zurück. Wir waren auf der besseren Seite in Wien zu Hause, denn nach den Beschlüssen der Alliierten waren es die amerikanischen GIs, die die Kontrolle übernahmen. Zehn Jahre lang war gerade diese Brücke über den Donaukanal kein Punkt des Friedens. Zuerst waren da die Sperren, dann die USIA-Läden drüben, die Produkte von Firmen aus „deutschem Eigentum“ – jetzt in kommunistischer Hand – zu billigen Preisen marktschreierisch den Bewohnern des 9. Bezirks anboten, die in der amerikanischen Zone lebten. Es war eine eigentümliche Internationalität, in der ich damals zu Hause war. Die Amerikaner trafen mit dem Zug aus Salzburg über die Donauuferbahn am Franz-Josefs-Bahnhof ein – ich glaube, es war der „Mozart-Express“ – und überraschten die Kinder mit Kaugummi und der Tatsache, dass es auch Menschen mit dunkler Hautfarbe unter den Soldaten gab.
Schließlich kamen noch die Schweden dazu, die im Gartenpalais Liechtenstein, das später sehr lange das „Bauzentrum“ gewesen ist, den Sitz ihrer Hilfsaktion „Rädda barnen“ (Rettet das Kind) aufschlugen. Wir können uns im Zeitalter des Überflusses kaum mehr an die damalige Not erinnern. Nur Anekdoten sind mir geblieben. Als im Januar 1946 Militär-LKWs der Schweden einrollten, wollten sie uns und den Mitbewohnern des Hauses übrig gebliebenen Kakao zum Verfüttern an die Schweine geben. Es war selbstverständlich, dass wir uns selbst als Ersatz für die nicht vorhandenen Haustiere verstanden und dass dann allen übel wurde, weil unser Verdauungsapparat den fettreichen Kakao nicht mehr gewöhnt war. Nachkriegszeit und Kriegsfolgen waren prägend für mich, in vielem wurzle ich in diesem Ambiente.
Im Übrigen erinnere ich mich noch, dass die Kindheit meiner Mutter für uns ein Glücksfall war. Sie kam nach den Folgeerscheinungen des Ersten Weltkriegs, nämlich dem Hunger, in einer Aktion als „Wiener Kind“ nach Schweden, genauer gesagt nach Helsingborg, zu einer Familie, bei der sie fast zwei Jahre blieb. Dort wurde sie nicht nur aufgefüttert, sondern ging auch zur Schule und lernte Schwedisch, das sie bis zu ihrem Lebensende leidlich beherrschte. Anlässlich ihres 70. Geburtstags 1975 unternahmen wir eine für damalige Verhältnisse abenteuerliche Reise mit meinem Auto, die uns über Prag (damals erschreckend kommunistisch dominiert), durch Dresden (schrecklich die immer noch sichtbaren Folgen des Bombardements von 1945), über West- und Ostberlin nach Travemünde führte, wo uns ein Fährboot nach „Sverige“ brachte. Da ich auf diesen Strecken auch heute noch unterwegs bin, erinnere ich mich an die Fährnisse, etwa an der tschechoslowakischen Grenze zur DDR. Ein forscher Volksarmist wollte, dass meine Eltern aussteigen, damit er die rückwärtige Sitzbank des Autos entfernen könne. Es regnete aber in Strömen und meine Mutter hatte nicht die Absicht, sich diesem Wetter auszusetzen. Zu meinem Schrecken schrie sie den Uniformierten an, dass sie dazu nicht bereit sei und er sich überhaupt besser benehmen solle, denn sie könnte bereits seine Großmutter sein. Ich rechnete mit einem Aufenthalt in einem DDR-Kotter, aber die Verhaltensweise meiner Mutter hatte Erfolg. Schroff teilte der Volksarmist ihr und meinem Vater mit, dass sie sitzen bleiben und verschwinden sollten. Das war Lebenserfahrung: Mein Vater bemerkte dazu trocken, dass man in einer Diktatur die Akteure unterer Ebene immer am besten anschreit, das seien sie gewöhnt.
Zeitgeschichte habe ich unter anderem von meiner Mutter erfahren, die nicht nur als Dolmetscherin tätig war, sondern in Verhandlungen mit der schwedischen Armee auch die Verteilung einer Unmenge von Kleidungsstücken an die Bewohner des Grätzels erreichte. Sie eröffnete auch einen beachtlichen Handel mit Objekten der Wehrmacht. Es gab eine eigene Preistabelle für Fliegerdolche, Eiserne Kreuze, sonstige Orden und Auszeichnungen und alles, was deren Träger verständlicherweise gegen Lebensmittel eintauschen wollten. Die Währung waren Lebensmittel, was die schwedischen Partner meiner Mutter nicht wirklich verstanden.
Mein Vater wiederum, der als Jugendlicher den Ersten Weltkrieg und dessen Folgen erlebt hatte, erklärte mir, was ein „Umbruch“ wirklich bedeutete. Nicht die politischen Veränderungen an den Spitzen der jeweiligen Staaten waren entscheidend, sondern die massiven Konsequenzen für das Leben der Bürgerinnen und Bürger.
Es waren nicht immer Militärs und Besatzungsmächte oder gar politische Veränderungen, die mehr als problematische Eigenschaften mancher Bürger und Bürgerinnen ans Tageslicht brachten. In der Zeit des Vakuums im Übergang von einer Macht zur anderen kamen auch kriminelle Seiten zum Vorschein. Ein Beispiel: Mein Vater bekam in seiner Eigenschaft als Verwalter der Liechtenstein'schen Güter von den neuen Behörden einen Amtsschein, dank dem er Hausdurchsuchungen durchführen konnte, um Objekte sicherzustellen, die aus dem Palais Liechtenstein, aber auch aus anderen Büros und Haushalten verschwunden waren. In einem der durchsuchten Haushalte fand er meinen Kinderwagen vor. Von der Hausfrau wurde ihm auf seine Frage hin sofort mitgeteilt, dass sie diesen Kinderwagen persönlich von Ing. Busek erhalten habe, der Name war nämlich auf den Boden dieses Fahrzeugs gestempelt. Zur Überraschung besagter Frau teilte mein Vater ihr mit, dass er selber dieser Ing. Busek sei und sich nicht erinnern könne, ihr je dieses Stück übergeben zu haben. Natürlich gab sie es ohne zu zögern zurück.
Die Wiener sind auch mit dieser Zeit fertig geworden und haben sich an den Wiederaufbau gemacht. Kaum erinnert man sich noch an die Lücken in den Häuserzeilen, die inzwischen längst geschlossen sind. Die Stadt wurde in relativ kurzer Zeit renoviert, die Entwicklung ging weiter. Fuhren wir als Zehnjährige noch mit der offenen 39er-Straßenbahn in die Krottenbachstraße zum Realgymnasium, so verkehrte zur Zeit meiner Matura bereits der moderne Großtriebwagen. Heute sind manche Linien verschwunden – wie der F, der in einer abenteuerlichen Kurve von der Währinger Straße an der Votivkirche vorbei in den Ring einbog. Die Eltern erzählten noch vom 15er, der durch die Lazarettgasse fuhr, und von anderen Linien, die längst der Vergangenheit angehören. Herzmanovsky wäre zu ergänzen: Es können nicht nur Eisenbahnzüge hinter Leoben, sondern auch Straßenbahnen in Wien versickern …
Wien ist mir in der Zeit meines Heranwachsens wie eine Landschaft vorgekommen. In der Volksschule haben wir noch die Teile des 9. Bezirks gelernt: Liechtenthal, Thurygrund, Rossau, Althan, Alservorstadt, Himmelpfortgrund und Michelbeuern. Ich fühlte mich als Liechtenthaler, obwohl ich ins „Ausland“, in den Himmelpfortgrund, zur Volksschule ging; ich fühlte mich als „Alsergrundler“, obwohl ich später ins Döblinger Gymnasium fuhr. Es gab da ein Gefühl der näheren Heimat, das in den neuen Siedlungsgebieten vielfach nicht mehr aufkommen kann – wie lieblos werden heute neben alte Ortskerne in der Donaustadt oder im 23. Bezirk Neubauten gestellt! Anlässlich einer Kulturwanderung durch das alte Oberlaa konnte ich erkennen, dass das dort vorhandene Lokalbewusstsein den Neu-Ansiedlern ebenfalls ein Heimatgefühl bringen könnte, wenn es nur gemeinsam aktiviert würde. Mein Großvater war noch so stolz, auf Briefe den Namen seines Wohnhauses, „Erzgebirgerhof“, zu schreiben, obwohl es nur ein hässlicher Häuserzwilling des 19. Jahrhunderts und er ein einfacher Mieter am Inneren Gürtel im 7. Bezirk war. Namen geben wir neuen Häusern auch heute, meistens von Politikern, an die sich bald niemand mehr erinnert – die Gemeinschaft und das Lokalbewusstsein aber müssen wir erst nachliefern.
So bin ich in diese Stadt Stufe um Stufe hineingewachsen, vom Grund in den Bezirk, dann mit Studium und Beruf über die Grenzen hinaus in die Zentren des öffentlichen Lebens der Stadt, später durch meine politische Tätigkeit über die Stadt hinaus, dann wieder in sie hinein. Das alles erwähne ich nicht, um nachzuweisen, dass ich ein Wiener bin. Der echte Wiener weist sich nicht durch Abstammung, Geburtsort und Aufenthaltsdauer aus, auch nicht durch eine bestimmte Färbung der Sprache und schon gar nicht durch einen elitären Stolz auf seine Kultur. Es ist vielmehr das Bewusstsein, hier zu Hause zu sein und mit dem Zuhause auch leben zu wollen. Für mich als Wiener Bürger ist diese Stadt ein Credo geworden, ein Auftrag zu Lebensform und Gestaltung.
Was Heimat bedeutet
Das wirft aber auch die Frage auf, was man als seine Heimat betrachtet. Was sind die Einflüsse, die generell eine Rolle spielen? Ich bin nicht unbedingt ein Anhänger einer radikalen Milieutheorie, es wird eine Mischung verschiedener Elemente sein, die uns alle prägt. Dabei sind positive wie negative Erfahrungen entscheidend. Man bleibt ja nicht derselbe, als der man geboren wurde. Die eigene Entwicklung, jene der Zeit und der Landschaft, in der man zu Hause ist, spielen eine ganz entscheidende Rolle.
Heimat ist zunächst einmal ein Gefühl von Bindung, eine Sehnsucht der Menschen. Heimat – das ist das Sicherheit verbürgende Wissen, sich auszukennen, im buchstäblichen und metaphorischen Sinn vertraut zu sein mit den Sitten und den Lebensstilen, den Symbolen und Verständigungszeichen, zu wissen, dass man mit vielen anderen in einer gemeinsamen Welt lebt, dass man die „Klänge der Heimat“ wiedererkennt und sich an den Nuancen der Sprache orientieren kann. In der Heimat lebt man in vertrauten Räumen, die Identität geben, mit Bauten, die – weil man ihre Bedeutung kennt, die über ihre Funktion hinausgeht – zu einem sprechen, mit geliebten Speisen, die man immer schon gerne gegessen hat. Heimat geben aber vor allem Menschen – Menschen, mit denen wir Gefühle, Erfahrungen, Alltagshandlungen, das Leben teilen. Wenn wir das Gefühl des Gemeinsamen und Vertrauten im Leben verlieren, versteinern und erkalten wir. Die Einsamkeit lässt uns verstummen. Wir brauchen etwas, vieles sogar, das wir teilen können. Wir brauchen es fast so sehr wie die Atemluft. Erst das, was wir mit den anderen teilen, macht Heimat.
Heimat ist ein Gut, ein Wert. Am Schicksal der Flüchtlinge wird klar, dass Heimat nicht nur ein sentimentaler Begriff ist, der angeblich nichts mit Politik zu tun hat, sondern dass Heimat auch etwas Handfestes ist, ein Gut und auch ein Recht. Vielfältige Heimatverluste durch ethnische Säuberungen und regionale Kriege sind im Europa von heute wieder zu einer erschreckenden und beschämenden Wirklichkeit geworden. Die Heimatsuche und die Heimatfindung werden zu einem vielschichtigen friedenspolitischen, ökonomischen und menschlichen Problem. Man muss kein großer Prophet sein, um darauf hinzuweisen, dass infolge der Migrationszüge unserer Zeit die Fragestellung noch vielfältiger und naturgemäß schwieriger wird. Nicht allein politische Ereignisse wie etwa die letzten Balkankriege, der „Arabische Frühling“ und der Hunger in der Welt führen zu verstärkter Migration, sie ist auch ein Ergebnis unserer erhöhten Mobilität und der individuellen Freiheit, sich den Ort auszusuchen, an dem man leben will. Wenn man sich aber dafür entschieden hat, an einem bestimmten Ort leben zu wollen, heißt das noch lange nicht, dass man dort auch „zu Hause“ ist. Aus diesem leidvollen Prozess wird klar: Heimat muss gewährt werden. Heimat geben können aber nur jene, die sie auch für sich selbst suchen und sie dann mit anderen zu teilen vermögen.
Wer um die Unverwechselbarkeit, Einzigartigkeit, Besonderheit der eigenen Heimat weiß, wird nicht nur mehr für sie sorgen, er wird auch die Heimaten der anderen mehr achten und nicht ängstlich, sondern neugierig und höflich auf Fremdes reagieren. Er hat einen Sinn für die „Klänge der Heimat“ anderer Menschen. „Wo Bindung ist, ist Verantwortung“, meinte einmal Karin Brandauer.
Jeder von uns wächst in mehrere Heimaten hinein, die im Bewusstsein später zu einer Heimat verschmelzen. Meine Eltern haben es mir ermöglicht, durch die „Sommerfrische“ – wer kennt das Wort noch – in Tirol eine zweite Heimat in Alpbach zu finden. Heimat ist mehr als der bloße Herkunftsnachweis, Heimat erwirbt man sich. Als Jugendlicher, als Student habe ich diese verschiedenen Landschaften miteinander verbunden und allmählich eine Gesamtansicht von Heimat gewonnen, als emotionale und historische Erfahrung.
So wurden mir die unterschiedlichen Landschaften der Bundesländer ebenso zur Heimat wie das geschichtliche Wachsen der Zweiten Republik, von ihrer Wiedererstehung bis zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Wir übersehen als Zeitgenossen leicht, dass sich Österreich seit dem Staatsvertrag grundlegend geändert hat. Aus dem Land, das nach den großen Kriegen alles daran gesetzt hat, nicht besonders aufzufallen, ist eine Gemeinschaft von Menschen gewachsen, die auf sich stolz sein kann. Ich meine nicht den Wohlstand und die so oft zitierten kulturellen Leistungen, sondern das Bestehen in vielen Herausforderungen. So war Österreich in den Jahren 1956, als sowjetische Truppen den ungarischen Aufstand niederschlugen, und 1968, im Jahr der Invasion des Warschauer Paktes in der Tschechoslowakei, ein couragierter und geforderter Nachbar. Auch gegenüber den Ereignissen im Polen der Achtzigerjahre und unmittelbar betroffen vom Krieg im ehemaligen Jugoslawien ist Österreich von seinem selbstbewussten Kurs des Einsatzes für die Sicherung der Menschenrechte und für die nachbarschaftliche Hilfe nicht abgerückt. So hat sich Österreich in diesem Teil Europas eine Stellung erworben, die für die Stabilität und Sicherheit in dieser Region unverzichtbar geworden war. Mir kommen jedoch Zweifel, ob das heute noch gilt. Unser „Naher Osten“ wird als „Ferne“ verstanden, Nächstenliebe wird zur Fernstenliebe. Österreichs historische Entscheidung für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union war eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen für die Orientierung unseres Landes, verbunden mit der Option, ein guter Anwalt und Dolmetscher der östlichen Nachbarstaaten zu sein. Das alles sind Qualitätsveränderungen unserer Republik, die einstmals 1918 als „Staat, den keiner wollte“ begann.
Bindung wächst also aus dem wichtigen, aber vielfach auch missverstandenen Bedürfnis nach Verwurzelung der menschlichen Seele. Die Philosophin Simone Weil hat das noch vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in dunkler Vorahnung so beschrieben: „Ein menschliches Wesen hat eine Wurzel durch seine wirklich aktive und natürliche Teilhabe an einer Gemeinschaft, die gewisse Schätze der Vergangenheit und gewisse Ahnungen der Zukunft lebendig hält.“
Für meine Generation gibt es natürlich auch Schätze der Erfahrung aus der Geschichte, nicht nur aus der offensichtlichen europäischen Zukunft, die wir haben. Als sich mein Vater aus beruflichen Gründen um den „großen Arier-Nachweis“ bewerben musste, wurde er auf den „Schreibfehler“ aufmerksam gemacht, dass im Namen Busek das „c“, früher Buseck, fehle. Der Beamte machte ihm Vorwürfe, dass der Name nicht richtig geschrieben sei, was aufgrund der Dokumente klar ersichtlich war. Mein Vater, ein Pragmatiker, erklärte dem Vertreter des Regimes, wenn er unbedingt wolle, könne er es ja ändern. Die Antwort war für die Zeit typisch und schmerzlich: „Seien Sie froh, dass Sie kein Jud' sind.“ Damit wurde auch meiner Familie klar, was Abstammung bedeutet. Im Alsergrund, insbesondere in der Rossau, haben viele Juden gelebt. Das hatte eine lange Tradition, in der Seegasse gibt es heute noch einen übriggebliebenen jüdischen Friedhof, der schon von Kaiser Josef II. geschlossen wurde.
Anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 1954 in der Schweiz hat mir mein Vater erklärt, dass man die österreichische Fußballmannschaft daran erkenne, dass sie tschechische Namen habe (Zeman, Ocwirk, Aurednik, Stojaspal etc.), während die tschechische Mannschaft meistens deutsche Namen trage. Bei einem Besuch des tschechischen Ministerpräsidenten Václav Klaus und seines Stellvertreters Josef Lux habe ich mich daran wieder erinnert, denn die österreichischen Repräsentanten vis à vis hießen Vranitzky und Busek. Der damalige Bundeskanzler hat mir diese Bemerkung übelgenommen, denn er fragte nach dem Zusammentreffen, ob ich ihm seine slowakische Abkunft vorhalte. Das fand ich lächerlich, noch dazu angesichts meines Namens und seiner möglichen Interpretationen. Ich habe es daher auch immer lächerlich gefunden, wenn Namen umgeschrieben wurden, denn es macht keinen Unterschied, ob man nun „Petschnigg“ oder „Pecnik“ schreibt. Es geht hier um die Akzeptanz einer geschichtlichen Realität auch im persönlichen Bereich, man kann auch sagen: Namen sind Schall und Rauch. Aus dem FPÖ-Politiker Westenthaler ist durch seine Umbenennung von „Hojač“ auch kein anderer geworden. Wir sind hier auf eine ganz eigentümliche Weise schizophren. Auf Ivica Vastić sind wir stolz, weil er ein ausgezeichneter Fußballer war, während uns der eingewanderte Hilfsarbeiter gleichen Namens auf die Nerven geht. „I haaß Kolarić, du haaßt Kolarić, warum sagen s' zu dir Tschusch“, war vor Jahrzehnten ein sehr wahres Plakat.
Es ist zu hoffen, dass die Entwicklung Europas alle diese Spannungen reduziert. Im Moment werden sie verstärkt, weil wir uns offensichtlich gegen einen notwendigen Prozess wehren. Was soll nationales Denken angesichts der Globalisierung und der Notwendigkeit der Integration? Diese in der Wirtschaft durchzuziehen und kulturell auf sie zu verzichten, ist Unsinn. Europa war kulturell nämlich schon früher eine Wirklichkeit, nicht nur wenn wir an Musik und Literatur denken, sondern etwa auch an die Universitäten, die ein wirkliches Produkt Europas sind. Zu meinem Schmerz begreifen das die Kirchen zu wenig, die einen wesentlichen Beitrag leisten könnten, denn sie sind meistens auch nicht national zu verorten.
Heimat heißt auch Elternhaus
Die Umgebung meiner Kindheit und Jugend war eine glückliche Mischung. Da war einerseits das Gartenpalais Liechtenstein an der Alserbachstraße, ein Bau des Ringstraßenarchitekten Heinrich Ferstel. Das Palais war allerdings in einem verrotteten Zustand, weil der Krieg und die intensive Nutzung nicht nur durch geflohene Aristokraten, sondern auch durch aus den Gütern Liechtensteins in Mähren vertriebene Arbeiter und Angestellte Wunden hinterlassen hat. Die soziale Schichtung der Pfarre Liechtenthal, auf der anderen Seite der Alserbachstraße gelegen, war eine proletarische, im Wesentlichen durch die Eisenbahner des Franz-Josefs-Bahnhofes geprägt. Im sozialen Umfeld der Pfarre gehörte ich quasi zur Oberschicht, ohne mir dessen bewusst zu sein, denn in Wahrheit waren wir eine kleinbürgerliche Familie, offensichtlich von jener Welt beeinflusst, die meine Eltern in ihrer Kindheit und Jugend im Gemeindebezirk Neubau erlebt hatten. Die Ehe meiner Eltern war ein Ergebnis räumlicher Nähe, denn die Bernhardgasse und der Lerchenfelder Gürtel lagen nahe beieinander, wobei die Tatsache, dass mein Vater mit dem Bruder meiner Mutter in dieselbe Schule ging, eine entscheidende Rolle gespielt hat.
So war es eine kleinbürgerliche Welt, der ich zu Hause begegnete und die einen festen Rahmen von Regeln und „Gehört-Sichs“ bot. Meine Mutter war dieser Welt, in der strenge Regeln herrschten, denen schon ihre Eltern und Großeltern folgten, besonders verhaftet. Das spiegelte sich im ethischen und religiösen Verhalten gleichermaßen wider wie im Ablauf des Jahres und sogar in den Lebenszyklen. Da die „schöne Leich“ in Wien immer eine große Rolle gespielt hat, hat es mich nicht verwundert, als mich die Großeltern einmal darauf hinwiesen, wo ihr Sterbegewand zu finden sei. Diese Grundhaltungen müssen auch eine starke Stütze der Monarchie gewesen sein, denn als ich nach dem Tod meines 80-jährigen Großvaters – 1956 – seine Wohnung zu liquidieren half, fanden wir ungeheure Mengen von „Kriegsanleihen“, in die er offensichtlich sein ganzes damaliges Vermögen zugunsten von Kaiser und Vaterland investiert hatte. Er hat aber nie darüber gesprochen. Wir haben auch das Substitut für die goldenen Eheringe der Großeltern mit der Aufschrift „Gold gab ich für Eisen hin“ gefunden. Darüber nicht zu klagen, gehörte zur Disziplin bürgerlicher Verhaltensweisen. Ob meine Großeltern Monarchisten waren, konnte ich nie feststellen, weil auch darüber nicht gesprochen wurde. Sie waren Österreicher, lehnten Hitler und Deutschland massiv ab, wobei offensichtlich die Rivalität zwischen der Habsburgermonarchie und den Hohenzollern zu dieser Haltung geführt hatte.
Es wurde auch nicht über die kleine Republik Österreich geklagt. Als einziges gab es eine Erzählung vom Tag des Attentats auf den Thronfolger in Sarajevo. Die Nachricht erreichte meine Großeltern beim Heurigen. Meine Großmutter ist dem Vernehmen nach mit dem Ausruf „Das ist das Ende!“ in Ohnmacht gefallen. Die aus einfachen ländlichen Verhältnissen stammende Frau aus dem Weinviertel hatte instinktiv begriffen, was später viele politisch, historisch und literarisch so beschrieben haben. Der Großvater dagegen bekundete später immer seine Skepsis zunächst gegenüber Kaiser Karl I., weil er der Meinung war, dass die Tatsache, dass der junge Kaiser das Telefon verwendete und den Eisenbahnfahrplan der Monarchie auswendig konnte, noch keine brauchbare Regierung ergebe. Noch kritischer war er gegenüber der Neugestaltung der Landkarte 1919. Er sagte wiederholt: „Sie erklären uns immer, dass wir in modernen Zeiten leben, nun aber brauche ich alle 150 Kilometer einen Pass!“ Die Entwicklung des Schengen-Europa hätte ihn getröstet … Er hatte Prinzipien. Als kleiner Selbständiger (mit einem Architekturbüro und einer kleinen Baufirma) war er nicht bereit, in die von Hitler auf Österreich ausgedehnte Reichsversicherungsordnung einzuzahlen. Er verkündete des Öfteren, dass er lieber in die Höfe gehe, um dort Zither zu spielen und von Almosen zu leben, als sich vom „Reich“ und vom „Böhmischen Gefreiten“ aushalten zu lassen. Der praktische Sinn meiner Großmutter ersparte ihm das Zitherspielen in den Höfen. Sie zahlte heimlich in die Versicherung ein, das Geld dafür vom kargen Kostgeld abgespart und dabei von meinem Vater unterstützt.
Es gibt zwei Geschichten, die mich hinsichtlich Prinzipien und Selbstdisziplin dieser Generation sehr beeindrucken. Die erste ist die Tatsache, dass meine Großeltern von der bescheidenen Rente und offensichtlich vorher angespartem Geld auch noch einen Hausanteil kauften, von dem niemand etwas wusste. Die Großmutter hat es meinem Vater, ihrem Schwiegersohn, auf dem Sterbebett flüsternd anvertraut. Der Großvater weigerte sich dann jedoch, bei der Erbabwicklung diesen Hausanteil bekannt zu geben, was nach seinem Tod zwangsweise zur Wiederaufnahme des Erbverfahrens führen musste.
Die zweite Geschichte war dramatischer: Mein Onkel Karl, der Bruder meiner Mutter, war in der Zeit der großen Wirtschaftskrise arbeitslos und ging, weniger aus Überzeugung als um eine Beschäftigung zu bekommen, zur Heimwehr, bei der er als Kindergärtner tätig war. Schon an Fotos aus dieser Zeit sieht man, dass er mit diesem Beruf nichts am Hut hatte. Eines aber brachte es ihm: eine Anstellung bei der 1934 mit dem Ständestaat gleichgeschalteten Gemeinde Wien. 1938 wurde ihm von der inzwischen nationalsozialistisch geführten Verwaltung nahegelegt, der Partei beizutreten. Er fürchtete sich aber vor seinem Vater, dem überzeugten Österreicher, so sehr, dass er sich lieber freiwillig zur Wehrmacht meldete, denn dort durfte man nicht Parteimitglied sein. Er hat die ihm durch Erziehung und Familienprinzipien auferlegte Treue zu Österreich bitter bezahlt, denn er hat den gesamten Krieg an allen möglichen Fronten mitgemacht und noch dazu zwei Jahre Kriegsgefangenschaft.
Rückblickend bin ich immer noch erstaunt darüber, dass meine Mutter keine Schwierigkeiten hatte, als sie den Protestanten Ernst Busek ehelichte, allerdings haben die beiden katholisch geheiratet mit der Verpflichtung, die Kinder auch so erziehen zu lassen. Dem verdanke ich die Tatsache, dass ich der erste männliche Katholik in der Busek-Familie überhaupt bin.
Mein Vater wuchs als fünftes von sechs Kindern auf. Seine Mutter starb sehr früh, so dass er von seiner ältesten Schwester erzogen wurde. Das hat aus ihm einen Menschen gemacht, der versuchte, mit den Lebensumständen eher pragmatisch fertigzuwerden. Eines habe ich an dieser Familienseite immer bewundert: Trotz der Nähe des österreichischen Protestantismus zu Hohenzollern, zum Deutschen Reich und der Weimarer Republik, war unter den Familienangehörigen kein einziger Nazi. Mein Vater ist sein Leben lang seiner Kirche treu geblieben, hat ihre Regeln eingehalten, den im Vergleich zu den Katholiken erheblich höheren Kirchenbeitrag der Protestanten entrichtet, während meine Mutter sich darüber aufregte, dass die katholische Kirche von ihr einen Kirchenbeitrag verlangte, obwohl sie als Hausfrau nichts verdiente. Mein Vater hat auch diesen Beitrag bezahlt, ohne darüber ein Wort zu verlieren … Das wirklich Eigentümliche an dieser wechselseitigen Toleranzregelung war jedoch, dass mein Vater jeden Sonntag das katholische „Kirchenblatt“ kaufte, während die Mutter das Abonnement für das evangelische Blatt „Die Saat“ entrichtete. In beiden Familien meiner Eltern hat sich niemand aktiv politisch betätigt. Es ist auch nicht bekannt, dass irgendjemand Parteimitglied war, weder in demokratischen noch in totalitären Zeiten. Lediglich mein Urgroßvater mütterlicherseits war für Lueger, wobei es mehr die Bewunderung für die städtebaulichen Leistungen und die rege Bautätigkeit war als alles andere.
Politik hat aber die Karriere meines Vaters auf eine eigenartige Weise beeinflusst. Nach Absolvierung der Staatsgewerbeschule, heute Höhere Technische Lehranstalt in Wien I., Schellinggasse, arbeitete er im Architekturbüro seines Lehrers Max Hegele und interessanterweise bei einer Baufirma, die für die Sascha-Filmproduktion des Alexander Joseph Graf Kolowrat-Krakowsky tätig war. Er hat auch als Bauleiter für ein kleines Theater gewirkt, das heute im ersten Bezirk vom „Theater der Jugend“ bespielt wird. Ich glaube, es hieß „Die Insel“. Besagter Lehrer, Max Hegele, hat ihn dann offensichtlich nach einer Ausschreibung in die Bauabteilung der Gutsverwaltung des Fürsten Liechtenstein vermittelt, eine berufliche Tätigkeit, die mein Vater immerhin von 1926 bis 1969 ausübte. Gleichbleibend war der Arbeitgeber, wechselnd waren die Verpflichtungen. Waren nach dem Ersten Weltkrieg noch beträchtliche Güter in Österreich und in der Tschechoslowakei zu verwalten, so haben sich im Folgenden die politischen Ereignisse in jeder Hinsicht auch für ihn dramatisch niedergeschlagen. Sein Vorgesetzter war Baurat Cehak, der sich frühzeitig illegal der NSDAP anschloss, ohne es in seinem Berufsbereich bekannt zu geben. Dem lange Zeit regierenden Fürsten Johannes von Liechtenstein folgte sein Bruder Fürst Franz, ehemaliger Botschafter der alten Monarchie in St. Petersburg. Seine große Liebe war eine junge Frau aus einer sehr reichen jüdischen Familie, zwar geadelt, aber nicht als ebenbürtig angesehen. Als besagter Fürst Johannes starb, beerbte ihn infolge des Fehlens direkter Nachkommen Fürst Franz und heiratete seine langjährige Liebe, Fürstin Elsa. Diese schätzte den Vorgesetzten meines Vaters sehr und war entsetzt, als im März 1938 herauskam, dass Cehak ein Nazi war. Es entsprach dem damaligen, heute leider verschwundenen Ehrenkodex, dass besagter Baurat Cehak seinen beruflichen Abschied nahm und sich in gehobenem Alter freiwillig zur Wehrmacht meldete, was er im Krieg mit dem Tod bezahlte. Mein Vater übernahm in jugendlichem Alter die Bauabteilung und damit auch einen großen Wirkungsbereich.
Aus den Erzählungen meiner Eltern kenne ich eine Welt, die offensichtlich noch aus der Monarchie herüberragte. Als meine Eltern heiraten wollten, hatten sie sich dem bereits genannten Fürsten Johannes vorzustellen, wobei mein Vater um die Erlaubnis einzukommen hatte, meine Mutter heiraten zu dürfen. Der alte Fürst soll gütig gewesen sein, alles Gute gewünscht haben, mit der Schlussbemerkung: „Mach er ihr ein schönes Zuhause!“, was so viel hieß, dass eine Dienstwohnung bereitgestellt wurde. Seit 1927 haben meine Eltern in einem Seitentrakt des Liechtenstein-Museums (früher Galerie) im 9. Bezirk gewohnt, ab 1938 dann in dem bereits genannten Gartenpalais.
Das klingt alles ganz wunderbar, nur die Zeiten waren nicht so. Es war Aufgabe meines Vaters, die Liechtenstein'schen Güter durch die Nazizeit und den Krieg und dann durch zehn Jahre sowjetische Besatzung zu behüten. Der Nachfolger von Fürst Franz, Fürst Franz Josef, residierte als erster wirklich in Liechtenstein auf Schloss Vaduz. Die früheren Fürsten waren nicht einmal nach Liechtenstein gefahren. Durch Nazizeit und Krieg bekam dieser Flecken Erde eine besondere Bedeutung, die sich heute in der durchaus beachtlichen Rolle dieses Ministaates dokumentiert. Erst 1948 ist ein Bruder des Fürsten wieder in Wien aufgetaucht. Bis dahin war es Sache meines Vaters, das Vorhandene zu verteidigen bzw. die Schäden, die durch Kriegseinwirkungen und Besatzungen entstanden waren, in Grenzen zu halten. Meinem Vater kam sein Pragmatismus und die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Situationen umzugehen, sehr zugute. Ohne es sich allzu sehr anmerken zu lassen, hat er allerdings unter den Umständen sehr gelitten. Er war stolz, wenn er irgendwo ein Forsthaus bauen konnte, und es hat ihn sehr geschmerzt, dass aus der ehemaligen Galerie ein Warenlager, später das „Bauzentrum“, ja dann das Museum Moderner Kunst Sammlung Ludwig wurde. Er wäre heute sehr glücklich, die ihrer Zweckwidmung zurückgegebene „Galerie“ und das Gartenpalais in der Rossau zu sehen oder gar erst das Stadtpalais in der Bankgasse/Minoritenplatz.
Am 12. März 1945 fielen Flugzeugteile auf den einen Flügel des Burgtheaters und auf eben dieses Palais, haben die Prunkstiege zerstört und weitere Teile des Palais unbrauchbar gemacht, in dessen anderen Teilen mein Vater bis zur Pensionierung sein Büro hatte. Ich erinnere mich an ihn, wie er mich durch die leeren Räume des Gartenpalais in der Rossau führte und er, der Ingenieur und Techniker, durch Gesten Rubensbilder, Caravaggios oder gar die Tapisserien über das Schicksal des römischen Konsuls Publius Decius Mus an den Wänden entstehen ließ. Durch die gegenwärtigen Fürsten habe ich die Möglichkeit erhalten, die architektonischen Wiederherstellungen der Räumlichkeiten besichtigen zu dürfen und unendlich bedauert, dass mein Vater all das nicht mehr sehen konnte.
Für mich hat das die Begegnung mit einer Welt bedeutet, die heute nicht mehr existiert, mir aber Dimensionen der Geschichte eröffnete. Als Kind sollte ich beim 80. Geburtstag der Mutter des damaligen Fürsten Franz Josef, Erzherzogin Elisabeth, eine Halbschwester des Thronfolgers Franz Ferdinand, ein Gedicht aufsagen, bei dem ich zum Schrecken meiner Mutter jämmerlich versagte. Erzherzogin Elisabeth war in Spitzen gehüllt, hatte eine Habsburger-Lippe und eine Kammerdienerin als Erinnerung an andere Zeiten … Diesen Erlebnissen verdanke ich die Vorstellung, dass Österreich in Wirklichkeit ein bisschen größer ist, als es die Landkarte heute zeigt. Meine Vorfahren haben offensichtlich in einem größeren Raum gelebt, sich dort ganz selbstverständlich bewegt und in Wahrheit auch die Unterschiedlichkeiten der Menschen und ihrer Räume verstanden. Ich kann mich an keine abfälligen Bemerkungen über unsere Nachbarvölker erinnern, der schreckliche Katalog von verächtlichen Wörtern, wie sie in Karl Kraus' „Die letzten Tage der Menschheit“ verewigt sind, wurde bei uns nie benutzt. Mir ist damit die Akzeptanz des „Andersseins“ geblieben. Meine Mutter pflegte allerdings einen katholisch geprägten Antisemitismus, der immer in der Feststellung endete, dass man wegen der Verantwortung der Juden am Kreuzestod Christi natürlich keine KZs hätte errichten müssen – das Wort allein ist schon schrecklich genug. Mein Vater hatte eine andere Einstellung, die von der Tatsache geprägt war, dass er als Protestant sein Leben lang einer Minderheit angehört hatte. Beruflich hatte er dabei nie Nachteile. Das katholisch geprägte Fürstenhaus Liechtenstein hatte die weitherzige Einstellung der Monarchie des 19. Jahrhunderts oder vielleicht gar kein Interesse daran. Mein Vater berichtete immer, dass er in der Unterstufe der Realschule Neustiftgasse mit an die 50 Prozent Juden zur Schule gegangen sei, und hat davon immer mit Respekt erzählt. In der Umgangssprache meines Elternhauses waren jüdische Ausdrücke selbstverständlich. Schließlich wurden auch böhmische oder ungarische Ausdrücke als ein farbiges Element der Umgangssprache verwendet. Meine Mutter hatte manchmal eine Frau Wimmer zur Aushilfe im Haushalt, trotz ihres Namens eine waschechte Böhmin, die sie ein Leben lang immer wieder zitierte: „Sie ham's noch Glick g'habt in die Ehe, sie sind's noch g'wachsen.“. Dieses Zitat wurde auch in der Sprachfärbung ein Familiensprichwort.
Erst spät habe ich verstanden, dass mein Vater Protestant war. Er ging jeden Sonntag mit uns zur Kirche, wobei mir erst nach Jahren auffiel, dass er in der Heiligen Messe beim Glaubensbekenntnis, das ja in der Textierung vom Protestanten Melanchthon stammt, an der Stelle, wo die Katholiken erklären, dass sie „an die heilige katholische Kirche“ glauben, immer hustete. Es ist dies der einzige ökumenische Husten, der mir bekannt ist, und ich begriff bald, wie relativ manches ist, denn der Text für Protestanten lautet: „Ich glaube an die heilige christliche Kirche.“ Interessanterweise war es auch mein Vater, der darauf Wert legte, dass ich zunächst in den Seelsorgeunterricht in der Pfarre, später in die Katholische Jungschar und dann in die Katholische Jugend ging. Auch war ich einmal Zeuge eines elterlichen Gesprächs, bei dem darüber geredet wurde, ob ich nicht in eine katholische Privatschule gehen sollte. Meine Mutter war sich der Sache nicht sicher, aber eher dafür. Die Erklärung meines Vaters jedoch war eindeutig: Ich soll in eine staatliche Schule gehen, damit ich fest im Glauben bleibe. Ich bin ihm bis heute dankbar für diese Entscheidung. Meinem Vater ging es darum, dass ich in einer Jugendorganisation bin, er sah für mich Einzelkind meine Sozialisierung in Gefahr. Das Einzige, was ihn etwas beunruhigte, war die Tatsache, dass wir in der Kleidung der Katholischen Jungschar für Kirchenprozessionen, Katholikentage und Fackelzüge weiße Strümpfe trugen. Er war davon alles andere als begeistert, denn es erinnerte ihn an die Zeit der Hitlerjugend bzw. auch an die Tatsache, dass illegale Nazis vor 1938 gerne weiße Strümpfe als politische Aussage nutzten.
Ich verdanke meinem Vater auch eine bessere Kenntnis der Bibel. Hier schlug der Protestant bei ihm durch, in seiner Sprache waren mehr Bibelzitate zu Hause als im katholischen Rest meiner größeren Familie. Irgendwann habe ich begriffen, dass der Religionsvollzug aus der Zeit meiner Großeltern und Eltern stark formal geprägt war. Man wusste, wie man sich zu kleiden und an welchen kirchlichen Festen man wie teilzunehmen hatte. Bei aller grundsätzlich positiven Einstellung zu Religion und Kirchen gab es aber auch eine gesunde Distanz zu bestimmten Ausdrucksformen, für die ich rückblickend sehr dankbar bin.
Eine entscheidende Rolle in Elternhaus und Familie hat das Verhältnis zu Kunst und Kultur gespielt. Mein Großvater war Obmann des Theatervereins „Die Volksbühne“, meine Eltern gehörten einer Abspaltung dieses Laienspielvereins an, nämlich der „Jugendbühne“, wodurch mir der bleibende Wert von Kunst und Kultur als eine Selbstverständlichkeit vermittelt wurde. Auch hier gab es eine Abgrenzung zu Radikalismen aller Art, vor allem wollte man Kunst nicht vordergründig politisch verstehen. Manches war daher in späteren Zeiten, etwa nach 1968, für meine Eltern schwer verständlich, so wie sie auch die Polarisierung des Kulturbereichs in der Zeit vor 1945 abgelehnt hatten. Große Philosophen waren meine Eltern allerdings keine, mag sein, dass die Frage des Überlebens in der Zeit von Wirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit, totalitären Systemen, Weltkriegen und Wiederaufbau dies verhinderte. Die Dinge kritisch zu beurteilen, habe ich jedoch gelernt, weil Eigenverantwortung eine der selbstverständlichen Wertvorstellungen war, die familiär tradiert wurden. Man gab in den Generationen meines Elternhauses zu, manches nicht zu verstehen, ließ gleichzeitig aber auch die Freiheit, sich selbst ein Bild zu machen. Bei Lessings „Nathan der Weise“ habe ich Zeilen gefunden, deren Aufforderungscharakter für mich bleibend ist:
„Ein Mann, wie du, bleibt da
Nicht stehen, wo der Zufall der Geburt
Ihn hingeworfen: oder wenn er bleibt,
Bleibt er aus Einsicht, Gründen, Wahl des Bessern.“
Brief an meinen Vater
Lieber Papa,
mit dir führe ich immer noch Gespräche, nicht nur, wenn ich an deinem und Mutters Grab stehe, sondern auch in manchen Momenten meines Lebens. Oft kommen mir deine knappen Bemerkungen, deine praktischen Weisheiten und deine freundliche Art, Wichtiges auch nachdrücklich zu vermitteln, in den Sinn. Wahrscheinlich wird mir meine Mutter auch jetzt noch etwas gram sein, wenn ich dir auf diese Weise quasi als Erinnerung einen Brief schreibe und nicht ihr. Als ich mit 14 bei einem Schulaufsatz zum Thema: „Ein Mensch, den ich sehr liebe“ zum Unterschied der großen Mehrheit der Klasse nicht die Mutter angesprochen habe, sondern dich, war das schon ein Problem. Der Deutschprofessor hat mir allein schon deswegen ein „Sehr gut“ gegeben, weil ich der Einzige war, der den Vater als Objekt genommen hatte. Aber sie wird es schon richtig verstehen.