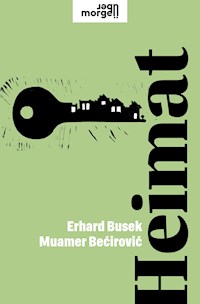Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ihre politische Positionierung könnte unterschiedlicher nicht sein: Der "schwarze" Erhard Busek und die "rote" Trautl Brandstaller kennen einander seit Jugendtagen, lieferten sich immer wieder harte Diskussionen und doch: In ihrer Diagnose zum Zustand der österreichischen Republik sind sie sich einig: Die Lage ist ernst, Erneuerung tut Not. In zehn thematischen Schwerpunkten analysieren sie den Zustand der Republik, machen konkrete Vorschläge für notwendige politische Reformen und formulieren Ausblicke in die Zukunft. Ob Bildungspolitik oder Demokratiereform, interkulturelle Verständigung, Wirtschaftspolitik, Wertedebatte oder die Kommerzialisierung von Medien und Kultur: Sie nehmen pointiert Stellung und scheuen sich nicht, auch unbequeme Meinungen zu vertreten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Trautl Brandstaller / Erhard Busek
Republik im Umbruch
Eine Streitschrift in zehn Kapiteln
www.kremayr-scheriau.at
ISBN 978-3-218-01029-0 Copyright © 2016 by Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co. KG, Wien Alle Rechte vorbehalten Schutzumschlaggestaltung: Sophie Gudenus, Wien unter Verwendung von Fotos von Doris Kucera (links) und Marc Haader (rechts) Typografische Gestaltung und Satz: Michael Karner, Gloggnitz Datenkonvertierung E-Book: Nakadake, Wien
Inhalt
Vorwort: Wege auseinander – Wege zueinander
Kapitel 1: Was bleibt von Österreich?
Erhard Busek
Trautl Brandstaller
Kapitel 2: Demokratie in Österreich
Trautl Brandstaller
Erhard Busek
Kapitel 3: Der »österreichische Weg«:Anfänge, Krisen, Chancen
Trautl Brandstaller
Erhard Busek
Kapitel 4: Bildung, das ewige Streitthema
Trautl Brandstaller
Erhard Busek
Kapitel 5: Kultur und Kulturpolitik:Zwischen Repräsentation, Avantgarde und Event-Kultur
Trautl Brandstaller
Erhard Busek
Kapitel 6: Medien und Medienpolitik:Zwischen Kommerzialisierung und Provinzialisierung
Erhard Busek
Trautl Brandstaller
Kapitel 7: Wertewandel und Wertkonflikte
Erhard Busek
Trautl Brandstaller
Kapitel 8: Österreich und die internationale Politik
Trautl Brandstaller
Erhard Busek
Kapitel 9: Europäisches Sozialmodellversus Globalisierung
Trautl Brandstaller
Erhard Busek
Kapitel 10: Das Ende der klassischen Ideologienund die Visionen vom guten Leben
Trautl Brandstaller
Erhard Busek
Interview: Vor finsteren Zeiten
Danksagung
Wege auseinander – Wege zueinander
Wir kennen uns seit vielen Jahrzehnten. Wir haben ungefähr zur gleichen Zeit unsere Ausbildung erhalten. Was uns aber in Wirklichkeit zusammengeführt hat, waren die Katholische Hochschulgemeinde und die Einflüsse von Priestern wie Monsignore Karl Strobl und Monsignore Otto Mauer, aber auch eine gemeinsame und intensive Auseinandersetzung mit Freunden, die in einem ähnlichen Ambiente lebten. Die vorkonziliare Zeit hat uns sehr beeinflusst, als Sehnsucht nach Veränderung und danach, den Stillstand zu überwinden, der unseres Erachtens gar keiner war, aber das, was damals geschah, ging uns zu langsam und war uns zu wenig.
Später haben uns die Wege auseinander geführt. Die eine, Trautl Brandstaller, engagierte Politikwissenschaftlerin und Journalistin, entwickelte sich unter dem Einfluss der Studentenbewegung eher nach links, der andere, Erhard Busek, wechselte unmittelbar nach dem Studium ins Parlament, in den ÖVP-Klub. Als Journalistin hat man natürlich andere Ausdrucksmöglichkeiten als in der Politik …
Es ist ein interessanter Vorgang, dass wir uns, offensichtlich dem Ende des Lebens näherkommend, wieder annähern. Wir haben nach wie vor unterschiedliche Ansichten, sie sind aber nicht mit Konflikten behaftet, sondern von dem Wunsch getragen, in diesem unseren Land eine gute Entwicklung, eine bessere Politik und eine geistige Qualität mit zu befördern, wobei uns die Liebe zu Österreich und der Wunsch, dass es in Europa mehr leisten möge als bisher, verbindet.
Wir haben beide eine Konfliktfreudigkeit, die sich unterschiedlich dargestellt hat, aber vom gleichen Ziel begleitet war, nämlich durch Auseinandersetzung positive Ergebnisse im Sinne des Humanum zu erreichen.
Was uns beide besonders mobilisiert, ist die Tatsache, dass sich offensichtlich die Entwicklung im Moment dramatisch verschlechtert, nachdem es eine Zeit lang nach dem Zweiten Weltkrieg einen permanenten Aufstieg gab. Eine Verschlechterung, die sich auf allen Ebenen abspielt – auf der österreichischen, der europäischen und der globalen Ebene. Beide waren wir Nutznießer der Tatsache, dass es in jedem Jahr besser geworden ist, mehr Möglichkeiten entstanden sind und sich die Horizonte erweitert haben. Gegenwärtig müssen wir feststellen, dass wir nicht nur in Statistiken, sondern auch in der Grundbefindlichkeit mehr und mehr nach unten rutschen. In dem Buch »Was haben wir falsch gemacht?«, das Erhard Busek herausgegeben hat und an dem auch Trautl Brandstaller mitgewirkt hat, sind wir ebendieser Frage nachgegangen. Die dahinter stehende Unruhe ist uns geblieben und wird mehr und mehr zur Sorge.
Persönlich meinen wir, dass es eine grundsätzliche Auseinandersetzung um Werte, Aufgaben und Strukturen geben sollte. Historisch betrachtet besteht die Konsequenz aus Katastrophen oder drastischen Fehlentwicklungen meist darin, eine Art neuen Anfang setzen zu können. Solche Situationen bieten die Möglichkeit, manches hinter sich zu lassen und neue Akzente zu setzen. Andererseits gibt es auch die Erfahrung der »Torheit der Regierenden«, wie die amerikanische Historikerin Barbara Tuchman in ihrer beklemmenden Analyse historischer Vorgänge feststellte. Die Ignoranz und Handlungsunfähigkeit der Mächtigen hat immer wieder Katastrophen ausgelöst.
Wir sind weit davon entfernt zu behaupten, dass wir eine ähnlich kritische Situation haben, wie das 1918/19 und 1945 der Fall gewesen ist. Offenkundig ist aber, dass wir eine große Chance versäumt haben: Wir haben den Zeitpunkt, das eigene Haus zu renovieren, ungenutzt gelassen, nämlich beim Beitritt zur Europäischen Union 1995. Es macht aber keinen Sinn, dem nachzutrauern. Seit dieser Zeit haben wir uns weltweit andere Zeichen an der Wand eingehandelt, wie etwa den schleichenden Beginn eines Dritten Weltkrieges. Wir denken dabei nicht an die kriegerischen Konflikte, wie wir sie aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts kennen, aber eine bestimmte Art von Kriegführung selbst in etablierten Staaten findet zweifellos statt, die sich nicht nur in akuten Konflikten (Krim/Ukraine, Syrien/Irak, Libanon, Libyen, Mali oder gar im südchinesischen Meer) äußert. Die Flüchtlingskrise, die von diesen im Nahen, Mittleren und Ferneren Osten schwelenden Konflikten ausgelöst wurde, stellt die Konstruktion Europas auf den Prüfstand. Manche warnen schon vor einem Zerfall Europas.
Vermehrt treten Phänomene auf, von denen wir dachten, dass sie längst der Vergangenheit angehören. Der »Neonationalismus«, die rechten Gruppen in fast allen europäischen Ländern, sind nur Vorboten einer solchen möglichen Entwicklung. Es ist offensichtlich nicht gelungen, eine demokratische Entwicklung weiter zu befördern, die einerseits auf Stabilität und Wohlstand, andererseits auf der Fähigkeit zu grundsätzlichen Reformen basiert. Die Demokratie scheint im Wesentlichen einen Teil ihrer Kraft verloren zu haben, autoritäre Figuren gewinnen Zulauf und die klassische Form der partizipatorischen Demokratie ist bedroht.
Es geht nicht darum, Schreckgespenster an die Wand zu malen, sondern um eine Gestaltung der Gesellschaft, sodass sie in der Lage ist, die bestehenden Fragestellungen zu bewältigen. Natürlich kennen wir die Überschriften zu den Problemen – Globalisierung, ökologische Fragen, Arm und Reich, Wanderungsbewegungen und Flüchtlingsprobleme –, aber Entscheidendes zu ihrer Lösung ist nicht geschehen. Vielmehr zeigt sich eine offensichtliche Schwäche der handelnden Personen, mit diesen Fragen fertig zu werden und positive Signale zu setzen. Es wird die Frage nach »Führung« gestellt, wobei dieses Wort für unsere Generation in der historischen Erinnerung einen unangenehmen Beigeschmack hat. Meistens verwendet man dafür stattdessen »Leadership«, weil das weniger gefährlich klingt – das Problem ist jedoch das gleiche!
Thematisch in zehn Kapitel gegliedert, die unabhängig voneinander verfasst wurden, versuchen wir darzustellen, aus welcher Welt wir kommen, welche Möglichkeiten wir haben oder hätten und wo wir mit Recht auch Ängste registrieren müssen. Dabei geht es nicht darum, Weltuntergangsszenarien zu malen, sondern eigentlich nur um eine Aufforderung zum Handeln. Das Interessante ist, dass gegenwärtig viele Schriften dieser Art entstehen. »Empört euch!« von Stéphane Hessel ist nur eines der Beispiele. Im Gegensatz dazu haben wir den Eindruck, dass wir wie Schlafwandler durch die Gegend gehen und der Überzeugung sind, die Konsequenzen der ungelösten Probleme würden uns ohnedies nicht treffen.
Die Zeichen an der Wand – als gäbe es dieses alttestamentarische Menetekel der Warnung – sind relativ leicht zu verstehen. Es bedürfte nur der Energie, daraus im Dialog der politischen Kräfte die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Das griechische Wort Krise kommt von »krino« und bedeutet »beurteilen« und »entscheiden«. Wer hindert uns daran, das zu tun?
Mit dem vorliegenden Buch wollen wir dazu einen Beitrag leisten, wobei wir uns der Lückenhaftigkeit bewusst sind, in der Hoffnung, dass diese Mängel andere dazu führen, noch mehr und neue Einfälle zu entwickeln. Diese Hoffnung hat uns zu dieser Schrift bewogen.
Trautl Brandstaller und Erhard BusekWien im Dezember 2015
Kapitel 1
Was bleibt von Österreich?
ERHARD BUSEK
Eigentlich konnte die Republik bis vor einiger Zeit sehr stolz auf sich sein: Sie ist nach mühevollem Geschehen, nach der Auflösung der alten Monarchie, der Unfähigkeit zu einer Gemeinsamkeit in der Demokratie, nach dem Verlust der Eigenständigkeit und schließlich nach dem Zweiten Weltkrieg nach 1945 sehr stabil geworden. Der Lernvorgang in Richtung Demokratie war getragen von Großer Koalition, Sozialpartnerschaft und letztlich auch von einer inhaltlichen Übereinstimmung, nämlich von der Überzeugung, das kleine Österreich tatsächlich zu wollen. Der Eiserne Vorhang, dessen Ende und der Weg in die Mitte Europas aus einer Randlage heraus, wurde ebenso anständig bewältigt wie die Entscheidung, ein Teil der Europäischen Union zu werden. Eigentlich war das eine hervorragende Ausgangslage, und wir waren zeitweise auch stolz darauf, das benachbarte Deutschland quasi überholt zu haben. Wir Österreicher hatten ja aus verständlichen historischen Gründen seit Jahrhunderten ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Deutschland – einerseits haben wir das Gefühl, anders zu sein, andererseits verbinden uns nicht nur Sprache und Geschichte, sondern auch praktische Lebensumstände, die sich in Wirtschaft, Tourismus und auch in einer gewissen gegenseitigen Aggression niederschlagen.
Was alles schiefläuft in Österreich
Derzeit jedoch werden die Stimmen lauter und die Analysen deutlicher, dass Österreich »absandelt« (Copyright Christoph Leitl). Wir sind in diesem Europa irgendwie marginalisiert, spielen nicht mit und bemühen uns auch gar nicht – im Gegenteil: Wir sind stolz darauf, mit vielem nichts zu tun zu haben. Es ist nach 1989 nicht gelungen, auf europäischer Ebene eine politische Gruppe zu gestalten oder wenigstens aktiv daran teilzunehmen. In der Visegrád-Gruppe (Tschechische Republik, Polen, Slowakei, Ungarn) sind wir nicht repräsentiert – die Formel »Visegrád + 2« (Österreich, Slowenien) hat keine wie immer geartete Bedeutung –, Mitteleuropa gibt es nur im Wetterbericht und die Abgrenzungen zu den übrigen Europäern nehmen zu. Wen von ihnen mögen wir Österreicher eigentlich?
Auch innenpolitisch stellen sich zunehmend mehr Fragen. Gegenwärtig wird die Politik durch die Bundesländer dominiert, die zweifellos zweimal, nach 1918 und 1945, einen wesentlichen Anteil am stabilen Wiedererstehen der Alpenrepublik hatten. Nun aber sind sie dabei, einen wesentlichen Beitrag dazu zu leisten, dass so gut wie nichts weitergeht – aus einem stabilen Element ist eine politische Kulturbremse besonderer Art geworden. Der Föderalismus ist ein »Förderalismus« – es geht nur ums Geld, das man versucht, dem Bund und damit dem österreichischen Steuerzahler abzuknöpfen. Nicht nur der Größenwahn von Kärntens Landeshauptmann Haider, sondern auch der brutale Egoismus bei der Verfolgung von provinziellen Projekten wird hier deutlich. Eine medizinische Fakultät in Linz, die kein Problem der Gesundheitsversorgung löst, ist dafür ebenso ein Beispiel wie eine Reihe von Straßen- und Tunnelprojekten (z. B. Koralm), denen kein Gesamtkonzept zugrundeliegt. Dafür hat man sich lange Zeit gelassen, um die notwendigen Verkehrsverbindungen zu den ehemals »östlichen« Nachbarn herzustellen, wie etwa die Autobahn zwischen Wien und Prag bzw. Wien und Brünn oder die Verbindung von Freistadt nach České Budĕjovice, die entsprechenden Eisenbahnverbindungen nach Tschechien und Polen sowie die Linienführungen nach Ljubljana, Zagreb und Triest. Und dann ist man verwundert, wenn die Fonds der EU nicht bereit sind, innerösterreichische Prestigeprojekte zu finanzieren, weil ihnen auch keine europäische Bedeutung zukommt.
In der europäischen Flüchtlingsproblematik sind wir nicht in der Lage, eine verhältnismäßig bescheidene Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen, wobei die Aufteilungsspiele auf europäischer Ebene ebenso wie bei uns geradezu beschämend sind. Einmal werden Länderschlüssel ausprobiert, dann wieder Bezirksquoten, politische Unentschlossenheit und egoistisches Denken der einzelnen Länder herrschen vor, vermehrt um die Angst vor rechten politischen Gruppen und Bürgerinitiativen, die weit weg von jenem Prinzip sind, das eigentlich einer Demokratie zugrunde liegt: Partnerschaft und Lastenteilung. Dafür trompeten wir bei jeder Gelegenheit unser Engagement für die Menschenrechte in die Welt hinaus, kritisieren andere und verkennen, dass es uns im Verhältnis zu Problemländern des Kontinents eigentlich sehr gut geht und wir mehr Lasten auf uns nehmen könnten. Wenn das so weitergeht, können sich weder Europa noch Österreich darauf berufen, dass die Menschenrechte ein gemeinsames Gut sind.
Auf der anderen Seite steht eine aufgeblähte Verwaltung, wobei es den letzten Bundesregierungen einvernehmlich gelungen ist, schon das Wort Verwaltungsreform zu vermeiden. Die steirische Partnerschaft zwischen SPÖ und ÖVP war eine Zeit lang ein Versuch, der sich allerdings nur in einer Reduktion der Zahl der Gemeinden niedergeschlagen und letztlich auch keine neuen Wege aufgezeigt hat. Der Begriff »Subsidiarität« – ein Bestandteil der katholischen Soziallehre – taucht eigentlich gar nicht mehr auf. Subsidiarität ist nicht nur im Hinblick auf Gebietskörperschaften, sondern auch auf das Verhältnis zwischen kleineren und größeren Gesellschaftsstrukturen zu verstehen. Stattdessen sind eine Unmenge von paritätischen Kommissionen eingeführt worden, sozialpartnerschaftlichen Einrichtungen und ausgelagerten Verwaltungseinheiten, die es dem Bürger verunmöglichen, hier durchzublicken. Es gab zwar einen Verfassungskonvent, der sehr gute Ergebnisse geliefert hat, die aber nie auch nur ansatzweise verwirklicht wurden. Der größte Treppenwitz ist die Existenz des Bundesrates, von dem eigentlich mit Ausnahme der Bundesräte selbst und der Parteioberen, die damit Personalprobleme lösen, niemandem klar ist, wozu es ihn gibt. Österreich hat ja auch kein echtes Zweikammersystem, dieses ist vielmehr eine Arabeske der Verfassung.
Was Österreich in Zukunft braucht
Natürlich gab es auch Bemühungen, ein Bild vom Österreich der Zukunft zu entwerfen. Man hat dazu Aufträge an internationale Experten vergeben, nur kam dabei nichts heraus. Eine Beschreibung der Rolle, die Österreich in Europa und im Globalisierungsprozess spielen kann und soll, ist unterblieben. Nach 1995, dem Beitritt zur EU, hat man sich nicht den Kopf darüber zerbrochen, welchen Part man in diesem Europa spielen will. Manchmal schimmert durch, dass wir uns besonders für den Osten und den Balkan verantwortlich fühlen, allerdings ohne politische Konsequenzen. So war es die Wirtschaft, die Großes geleistet hat, die Politik war immer sehr zurückhaltend – bis auf den Skandal der Hypo Alpe Adria Bank, der uns im Ansehen in dieser Region und überhaupt in Europa deutlich beschädigt hat. In Wahrheit aber verdienen wir auch heute noch durch die wirtschaftliche Präsenz in Ost- und Südosteuropa viel Geld und sichern Arbeitsplätze!
Auf eine gewisse Weise wäre es Zeit, dass Österreich ein neues Selbstverständnis entwickelt. Keine Angst, das Vorhandene soll nicht abgeschafft werden, wir sind auch nicht eine »Versuchsstation für Weltuntergänge«, wie es Karl Kraus in einer weitaus kritischeren Zeit einmal formuliert hat, aber wir sollten endlich versuchen, ein »Laboratorium für die Zukunft« zu werden.
Wir sind betroffen, wenn wir in den verschiedenen Rankings (z. B. im Bereich von Wissenschaft und Forschung oder als wirtschaftlicher Standort) relativ weit hinten liegen. Die Tatsache, dass es so gut wie keine österreichische Wissenschaftseinrichtung geschafft hat, unter die ersten hundert dieser Welt zu kommen, ist schon schmerzlich genug. Die Medizinische Universität Wien ist stolz darauf, ungefähr auf Rang 30 zu liegen, was angesichts der Tradition diverser Wiener Medizinischen Schulen nicht gerade beeindruckend ist. Ein klassisches Beispiel im Bereich Medizin für das, was nicht so funktioniert, wie es sollte, ist Wien: Im Konflikt zwischen der Verantwortung des Bundes für die autonome Medizinuniversität und der Verantwortung der Gemeinde für die Versorgung des Allgemeinen Krankenhauses bleibt die Notwendigkeit auf der Strecke, eine funktionierende Organisationseinheit zu schaffen, die nicht zwischen Kompetenzen zerrissen wird, sondern ein gemeinsames Ziel hat. Es ist nahezu archetypisch, dass wir uns schon in der gemeinsamen Zielformulierung schwertun. Stattdessen kämpft man darum, die jeweiligen Einflusssphären zu sichern, Abonnements für Postenbesetzungen zu haben und letztlich im jeweils kleinen eigenen Raum zu renommieren, was man alles Großartiges geleistet hat. Kontinentale und globale Vergleiche sind eher unangenehm, wie man auch an den Reaktionen auf PISA-Rankings feststellen konnte.
Was soll geschehen?
Es müsste endlich einmal in einem kritischen, durchaus konfliktreichen Prozess festgestellt werden, welchen Beitrag wir bei den anstehenden Fragen in Europa, in der Welt, in der ungeheuren Entwicklung der Globalisierung insgesamt leisten und was wir leisten können. Bei der Bewertung unserer Leistungen berufen wir uns immer wieder auf Nobelpreisträger, die wir schon lange nicht mehr haben. Im Bereich der Forschung können wir zwar einige wenige internationale Zentren (z. B. IST – Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg) vorweisen, aber an diesem Beispiel kann man gleichzeitig sehen, wie umstritten die Akzeptanz in der eigenen Wissenschaftsszene ist. Man will immer nur erreichen, dass das für Projekte aufgebrachte Geld jeweils für die eigenen Interessen verwendet wird. Einige interessante Ansätze gibt es dennoch – etwa das Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Institute for Human Sciences – #8e8e8d), das eigentlich eine polnische Gründung in Wien ist, entstanden aus der Situation rund um 1989, und das eine beachtliche Vernetzung nicht nur in Mittel- und Osteuropa, sondern auch auf dem amerikanischen Kontinent geschaffen hat. Warum nicht auf diesem Sektor weitertun, etwa im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften? Die dafür aufzuwendenden Beträge wären vergleichsweise sehr gering, wenn man an die weiter oben genannten Tunnelprojekte denkt.
All das liegt jedoch nicht allein in der Verantwortlichkeit der Politik, auch das Geistes- und Kulturleben des Landes ist gefordert. Beide müssen eine gemeinsame Strategie entwickeln, um wirksam zu werden. Es muss begriffen werden, dass sich die Voraussetzungen für Österreich gerade in den letzten Jahren in einem ungeheuren Tempo dramatisch geändert haben: Die Fortschritte von Forschung und Technologie, die europäischen Veränderungen, die Interdependenz und die Globalisierung spielen hier ebenso eine Rolle wie die Verantwortlichkeiten auf den verschiedenen politischen Ebenen. Doch wer in der politischen Szene die jeweils Verantwortlichen finden und zur Rechenschaft ziehen will, landet in einem Call-Center mit null Aussicht, fündig zu werden.
Unsere Zeit ist davon gekennzeichnet, dass man sich gerne auf sich selbst zurückzieht. Der Satz »jeder denkt an sich, nur ich denk an mich« ist zum Kennzeichen der Strömungen in der Öffentlichkeit geworden. Gäbe es eine funktionsfähige Ebene der Politik- und der Medienwissenschaften, müsste man einmal untersuchen, was von den Trägern der Öffentlichkeit wirklich an Themen erörtert wird. Provinzialismus ist das Mindeste, das dabei zu entdecken wäre, wobei Provinz nicht als geografischer, sondern als geistiger Zustand gemeint ist. Um aus dieser Sackgasse herauszufinden, müsste man sich überlegen, auf welchen Ebenen welche Probleme angegangen werden müssen. Das hat aber zur Voraussetzung, dass man überhaupt um die Probleme weiß. Vor allem sollte man endlich einmal damit aufhören, die Krise als etwas ausschließlich Negatives zu verstehen, dann müsste man sie nicht verdrängen. Sie ist im Gegenteil eine Chance, die geistigen und kulturellen Kräfte der Menschen dieses Landes zu mobilisieren. Davon kann eine gewisse Faszination ausgehen, Freude daran, Neugierde zu zeigen, Entwürfe für eine Neugestaltung zu planen, die die uns gegebenen Möglichkeiten ausnützt. Wer sich bei öffentlichen Anlässen umsieht, stellt jedoch fest, dass mehrheitlich ein Ausdruck der Griesgrämigkeit in den Gesichtern bestimmend ist. Diese Ausdrucksform ersetzt offensichtlich nicht die Nachdenklichkeit, scheint aber als Beweis einer kritischen Haltung zu gelten. Kritik heißt jedoch Unterscheidung, Mobilisierung zum Besseren und Freude daran, es auch umsetzen zu können. Da taucht dann immer die Ausrede auf, dass wir ein kleines Land sind und eigentlich nichts bewirken können, wenngleich wir uns bei allen Möglichkeiten für größer halten, als wir tatsächlich sind. Wir wären es auch, wenn wir die vorhandenen Ressourcen und Begabungen nutzten und ein Klima schafften, in dem sich Neugierde und Schöpferisches vereinen. Es muss uns Freude dabei begleiten, zu gestalten, unsere immer noch beachteten Fähigkeiten auszunutzen und neue, wenigstens andere Wege zu wagen. Zukunft zu gestalten ist einfach schön!
Ich gestehe, dass ich mir im Hinblick auf die Zukunft der jungen Generation große Sorgen mache, nicht weil »nichts Besseres nachkommt«, wie immer behauptet wird, sondern weil wir einfach nicht die Voraussetzungen geschaffen haben, um eine hoffnungsfrohe Zukunftsentwicklung zu befördern. Man muss sich nur die Personalauslese in den Parteien ansehen, ebenso die Personalauslese in Wirtschaft und ziviler Gesellschaft. Wo sind die unbequemen Querdenker, die gewiss anstrengend sind, aber Korrektive und Innovationen andenken? Man muss die Jungen ermutigen, ihre »exakte Phantasie«, wie Goethe sie nannte, einzusetzen. Aufdecken statt zudecken, das darf man nicht bloß den Journalisten überlassen. Hinsehen statt wegsehen!
Was haben wir falsch gemacht? Wir decken zu, verharmlosen, wurschteln mutlos herum, jeder in seinem Bereich auf seinen Schrebergarten bedacht, gruppenegoistisch, ohne Gedanken an ein größeres Ganzes. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich Österreich gut entwickelt. Vom Rückblick können wir aber nicht leben. Wie aber sieht diese Zukunft aus, wenn wir uns nicht endlich dazu entschließen, mutig und energisch an die wirklich schöne Aufgabe heranzugehen, aus diesem Österreich aus globaler Verantwortung mehr und Besseres zu machen? Dazu müssen aber Entscheidungen getroffen werden. Wir haben keine Zeit zu verlieren!
Kapitel 1
Was bleibt von Österreich?
TRAUTL BRANDSTALLER
Verfolgt man die Tagespolitik in Österreich, könnte man den Eindruck gewinnen, das Land bestehe nur aus seinen Bundesländern, der Bund sei in Auflösung, die Bundesregierung sei nur eine Schattenregierung, de facto werde das Land von den Landeshauptleuten oder der »Landeshauptleute-Konferenz« regiert, einem Gremium, das nirgendwo in der Verfassung aufscheint.
Dieser Eindruck ist nicht nur auf personelle Konstellationen zurückzuführen. Wie immer muss man in die Geschichte zurückgehen, in die Geschichte von Institutionen und Mentalitäten, die »histoire de longue durée«, für die Fernand Braudel in Österreich ein schönes Forschungsfeld, ein Spezialkapitel der Nationsbildung, vorgefunden hätte. Österreich ist bekanntlich eine »verspätete Nation«, eine Nation, die sich erst im Lauf des 20. Jahrhunderts unter schwierigsten Bedingungen entwickelt hat.
Zwischen Föderalismus, Identitätsproblemen und europäischer Verfassung
»Das, was bleibt, ist Österreich«, formulierte zynisch George Clémenceau. Österreich-Ungarn, eine europäische Großmacht, war von 60 Millionen Einwohnern auf sechs Millionen geschrumpft zu einem Kleinstaat. Und diese Republik glaubte von Anfang an nicht an ihre eigene Lebensfähigkeit, sie wollte sich an Deutschland anschließen, was ihr die Siegermächte des Ersten Weltkriegs aber ausdrücklich verboten hatten.
Die Republik, die sich eine bundesstaatliche Verfassung gab, drohte gleich zu Beginn zu zerfallen. Vorarlberg wollte zur Schweiz (manche sehen auch heute noch ihr Heil im Nachbarland, dem sie mental durchaus verwandt sind). Tirol konnte den Verlust von Südtirol nicht verschmerzen und empfand wenig Solidarität mit der Wiener Zentrale, die keine Volksabstimmung durchgesetzt hatte, Salzburg, bis 1803 ein eigenständiges, von Fürst-Erzbischöfen regiertes Land, zwischen 1810 und 1816 zu Bayern gehörig, wäre am liebsten in ein Bündnis mit dem Nachbarn Bayern eingetreten. Und auch die Oberösterreicher empfanden starke Sympathien für die Bayern. In Kärnten beanspruchte das neugegründete Königreich Jugoslawien den südlichen, slowenisch dominierten Teil des Landes, was zu einem blutigen Abwehrkampf führte, der noch für Jahrzehnte die Stellung der slowenischen Minderheit belasten sollte. Im Osten kam es zu einer Volksabstimmung, die den größten Teil Deutsch-Westungarns als neugebildetes Bundesland »Burgenland« zu Österreich brachte. Nur die Steiermark zeigte keine Abspaltungstendenzen. Das Kernland blieb Niederösterreich, das mit der ehemaligen Reichshaupt- und Residenzstadt Wien bis 1922 ein gemeinsames Bundesland bildete.
Der Föderalismus war also realpolitisch eine schwere Geburt. Dem entsprach die noch schwierigere Geburt der Verfassung. Karl Renner, als Staatskanzler und führender Sozialdemokrat, trat für einen zentralistischen Einheitsstaat ein, sein christlich-soziales Gegenüber, Vizekanzler Jodok Fink aus Vorarlberg, plädierte für einen starken Föderalismus und eine schwache Zentralregierung.
Hinter diesen Fronten steckten natürlich die massiven ideologischen Gegensätze zwischen Sozialdemokraten und Christlich-Sozialen. Wien war die »Hochburg der Roten«, die Länder waren mehrheitlich »schwarz«, ursprünglich auch das neu erworbene Burgenland, eine Ausnahme bildete Kärnten. In Kärnten gab es eine vorwiegend protestantische Bevölkerung, die aufgrund ihrer Abneigung gegen das katholische Herrscherhaus der Habsburger schon immer großdeutsch eingestellt war.
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der »Kampf um die österreichische Identität« (Friedrich Heer 1981) in neuer Form. Hitler hatte, wie ein deutscher Sozialdemokrat aus dem Widerstand formulierte, den Österreichern die Liebe zu Deutschland endgültig ausgetrieben. Der Streit um die »österreichische Nation« trennte erneut die politischen Lager. Die Konstruktion des »Österreich-Mythos« nahm ihren Anfang.
Führend waren die Konservativen, Österreichs Beginn wurde bis in die Zeit der Babenberger, ins Jahr 976, zurückverlegt, der »homo austriacus« als besonders edles Exemplar der menschlichen Spezies vorgeführt, eine richtige Österreich-Mythologie entstand.
Die Sozialdemokraten standen dieser Mythenkonstruktion eher skeptisch, wenn nicht aggressiv gegenüber. Man erinnere sich an Friedrich Adlers Zitat von der österreichischen Nation als »widerlicher reaktionärer Utopie«, das lange von den wahren »Linken« in der SPÖ verteidigt und später von Jörg Haider genüsslich zitiert wurde. Auch einer Einbindung der Habsburger in die österreichische Geschichte stand die Sozialdemokratie lange ablehnend gegenüber, was Günther Nenning treffend unter »Habsburg-Kannibalismus« rubrizierte. Zahlreiche Bücher versuchten über die Jahre die Befindlichkeit der »österreichischen Seele« (Erwin Ringel 1984) – von Friedrich Heer im Jahr 1958 mit »Land im Strom der Zeit« bis zu Robert Menasses »Land ohne Eigenschaften« 1992 – zu erkunden.
Jedes Jahrzehnt setzte neue Schwerpunkte in dieser Analyse der nationalen Befindlichkeit: Heer wollte ein österreichisches Langzeitmotiv in der Vermittlung zwischen dem Osten und dem Westen Europas erkennen, Ringel analysierte die tiefsitzenden autoritären Strukturen des Landes, verkörpert in Kaiser Franz Joseph und dessen autoritärem Regierungsstil, und Robert Menasse bezog sich auf den Opfermythos und dessen Verlogenheit.
Es waren vor allem die ersten Jahre der Zweiten Republik, die von diesen ideologischen Kämpfen geprägt, aber schließlich durch ein gemeinsames Bekenntnis zur österreichischen Nation beendet wurden (auch wenn das »dritte Lager«, von VdU bis FPÖ, bis zuletzt eine solche Nation ablehnte und sich als Teil der deutschen Kulturgemeinschaft verstand). Dennoch waren die politischen »Lager«, wie sie damals noch genannt wurden, geeint im Kampf für den Wiederaufbau des Landes und für die Erringung der völkerrechtlichen Souveränität durch den Staatsvertrag.
Der Staatsvertrag und die mit ihm verbundene Neutralität stellten eine tiefe Zäsur in der kollektiven Seelenlage der jungen Nation dar. Die Neutralität entwickelte sich zur neuen Staatsideologie, die auch die lange dominierenden Länderinteressen und föderalen Egoismen überdeckte und überwand. »Zwischen den Blöcken«, »Mittler zwischen Ost und West«, »Friedensstifter« – diese Schlagworte füllten die Sonntagsreden der Politiker, auch wenn sie nur selten von realen politischen Aktionen gedeckt waren. Dass es diese sehr wohl auch gab, soll in einem anderen Kapitel ausführlich behandelt werden.
Hier geht es eher um die Ideologie der Neutralität, die von vielen Bürgern und Bürgerinnen als Aufforderung zur Nichteinmischung und als Ausstieg aus der Geschichte missverstanden wurde.
Die Neutralität wurde zu einem Baugesetz der Republik, zu einer der zentralen Säulen der österreichischen Verfassung, zum Kernstück der österreichischen Identität. Wer immer daran rüttelte, weckte den Unmut der Bevölkerung. Als spätere Bundeskanzler einen Beitritt Österreichs zur NATO in Erwägung zogen bzw. hinter den Kulissen bereits Gespräche führten, stürzten sie in den Umfragen ab. Wolfgang Schüssel ließ die heiße Kartoffel NATO-Beitritt daher schnell wieder fallen.
Das »annus mirabilis« 1989 brachte etliche Säulen der Republik ins Wanken. Die Neutralität schien plötzlich ihren Sinn verloren zu haben. Der gleichzeitige Machtverfall der ehemals großen Parteien und der Aufstieg einer neuen Rechten schwächten den Zusammenhalt der Republik und stärkten die Autonomie der Länder – noch ehe der Beitritt zur Europäischen Union das verfassungsrechtliche Gefüge durcheinanderbrachte.
Hans Kelsen, der von Karl Renner damals berufene Jurist für die Ausarbeitung der neuen Bundesverfassung, sollte einen Kompromiss aus den verschiedenen, von den Parteien vorgelegten Vorschlägen formulieren. So vorbildlich die Grundstruktur dieser Verfassung noch heute ist, sosehr sie durchaus als Vorlage für einen modernen Rechtsstaat (Gewaltenteilung, Stufenbau der Rechtsordnung, Höchstgerichte) gelten kann, sosehr sind viele Kompetenzfragen zwischen Bund und Ländern unbefriedigend gelöst. An vielen dieser Kompromisse leidet die Republik heute. Eklatantestes Beispiel: die seit Jahrzehnten ungelöste Schulfrage, an deren Blockade beide ehemals großen Parteien beteiligt waren und sind.
Viele Politikfelder, die sich seit 1920 neu entwickelt haben – vom Sozialstaat bis zur Umweltfrage, von Forschung und Universitäten bis zu öffentlichen Investitionen, vom Gesundheitssystem bis zur Verkehrsinfrastruktur, von der Gemeindeautonomie bis zur europäischen Integration – erfordern eine Neu- und Umverteilung der Kompetenzen.
Die Realpolitik hat sich bislang bei jeder umstrittenen Frage, die nicht durch die Verfassung gelöst werden konnte, darauf geeinigt, einfache Gesetze in den Verfassungsrang zu heben – was nicht nur zum Missbrauch der Verfassung, sondern auch zu einer so anschwellenden Menge von Verfassungsbestimmungen geführt hat, dass sie heute kaum noch ein Jurist überblicken kann.
Verfassungsrechtler sprechen von einem Verfassungslabyrinth. Und keine Ariadne ist in Sicht, die, mit rotem Faden ausgestattet, aus dem Labyrinth herausfindet.
Eine neue Verfassung braucht das Land
[1]