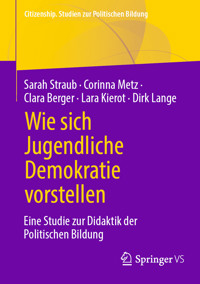15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Demenz hat viele Gesichter – Inspirierende Geschichten aus der Praxis
In ihrem neuen Buch »Lebensmut trotz(t) Demenz« erzählt Sarah Straub inspirierende Lebensgeschichten von Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Mit diesen berührenden Begegnungen möchte sie andere Menschen ermutigen, gestärkt und lebensbejahend mit dem Thema umzugehen. Für die Neurowissenschaftlerin ist ein einfühlsamer und beherzter Umgang mit den Patientinnen und Patienten die Basis dafür, dass deren Lebensqualität bewahrt werden kann. Denn Sarah Straub glaubt an ein gutes Leben mit Demenz, wenn es durch Solidarität, Zusammenhalt und Nächstenliebe getragen wird: »Das Lächeln eines Menschen mit Demenz ist pures, unverfälschtes Leben. Wahrhaftig und echt.«
Immer wieder wechselt die Autorin, die selbst pflegende Angehörige war, bei diesen Begegnungen die Perspektiven und verknüpft die emotionalen Erzählungen mit jeweils fachlich eingeordneten, hilfreichen Informationen. So ist das Buch auch eine Orientierungshilfe, wenn es darum geht, Menschen, die an Demenz erkrankt sind, in dieser herausfordernden Zeit liebevoll zu begleiten und neu zu entdecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
»In den letzten fünfzehn Jahren bin ich ihnen immer wieder begegnet – den Menschen mit Demenz ebenso wie den pflegenden Angehörigen, die mir auf beeindruckende Weise ihren Lebensmut gezeigt haben. Jedes Kapitel dieses Buchs erzählt eine Fallgeschichte, die auch Sie inspirieren, stärken und ermutigen soll.
Dabei geht es nicht darum, ob Sie in einer ähnlichen Lebenssituation ähnliche Entscheidungen getroffen oder genauso resilient reagiert hätten. Vielmehr geht es darum, die Essenz dieser Geschichten zu erfassen, Vertrauen in Ihre eigenen Fähigkeiten zu gewinnen und daran zu wachsen. Ich möchte, dass Sie sich nach der Lektüre dieses Buchs stärker, mutiger und zuversichtlicher fühlen können.«
Dr. Sarah Straub
Dr. Sarah Straub, geboren 1986, ist promovierte Diplom-Psychologin und leitet eine Demenz-Sprechstunde am Universitätsklinikum Ulm. Seit Jahren ist die gefragte Demenz-Expertin Gast in Radio- und TV-Sendungen und klärt zudem mit Fachvorträgen und Konzertlesungen unter anderem auch über ihr Spezialgebiet, die Frontotemporale Demenz, auf. 2021 erschien ihr erstes Buch Wie meine Großmutter ihr Ich verlor bei Kösel.
Neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit gibt die Liedermacherin zahlreiche Konzerte in Deutschland und bringt dabei ihre persönlichen Erlebnisse mit dem Thema Demenz mit menschlicher Wärme und auf unterhaltsame Weise auf die Bühne.
Dr. Sarah Straub
Lebensmut trotz(t) Demenz
Wie wir Menschen mit Demenz einfühlsam und respektvoll begegnen.
Geschichten aus der Praxis
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossean.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2025 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR.)
Umschlaggestaltung: buxdesign I München unter Verwendung einer Illustration von Daniela Hofner und einem Foto von © Hauke Dressler
Redaktion: Sabeth Ohl, Hamburg
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-33158-0V001
www.koesel.de
Inhalt
Vorwort
Lebensmut trotz(t) Demenz
»Es macht mich glücklich, dass ich mich glücklich fühlen kann« – Über einen lebensbejahenden Umgang mit einer Demenzdiagnose
Wissen kompakt: Erkenntnisse für den Alltag mit Demenz
Alle für einen – Wie Teilhabe gelingen kann
Wissen kompakt: Erkenntnisse für den Alltag mit Demenz
Das Glück der kleinen Dinge – Wenn Demenzerkrankungen erblich bedingt sind
Wissen kompakt: Erkenntnisse für den Alltag mit Demenz
»Irgendein Depp mäht irgendwo immer« – Personalisierte Aktivierung von Menschen mit Demenz
Wissen kompakt: Erkenntnisse für den Alltag mit Demenz
Einmal Pflegeheim und zurück – Über eine beeindruckende Suche nach Lebensqualität
Wissen kompakt: Erkenntnisse für den Alltag mit Demenz
Ein zweites Leben – Demenz als Fehldiagnose und wie man sie vermeiden kann
Wissen kompakt: Erkenntnisse für den Alltag mit Demenz
»Die Dementen sind oft aggressiv« – Vom Überwinden negativer Glaubenssätze
Wissen kompakt: Erkenntnisse für den Alltag mit Demenz
Vom Schattenkind zur Leuchtgestalt – Wie Kinder kranker Eltern gesund erwachsen werden können
Wissen kompakt: Erkenntnisse für den Alltag mit Demenz
Das letzte Segel – Über die schwierige Frage nach einem selbstbestimmten Abschied
Expertenmeinung: Was wir hier lernen können
Deine Welt in meiner Welt – Begegnungen auf einer Demenzstation
Wissen kompakt: Erkenntnisse für den Alltag mit Demenz
Zwischen Systemlücken und fehlender Vorsorge – Auf der Suche nach individuellen Lösungen
Wissen kompakt: Erkenntnisse für den Alltag mit Demenz
Epilog I: Hoffnung säen, Mut ernten
Epilog II: Handreichung Demenz
Der erste Verdacht – Jetzt nicht aufgeben!
Demenz hat viele Gesichter
Ärztliche Abklärung
Kurzer Exkurs: Wenn Betroffene eine Untersuchung ablehnen
Erste Schritte nach der Diagnose
Ärztliche Weiterbetreuung und Therapie
Menschen mit Demenz verstehen lernen
Entlastungsmöglichkeiten für Angehörige
Früh betroffen: Demenz vor dem 65. Lebensjahr
Wenn die Pflege zu Hause an Grenzen stößt
Nachwort
Danksagung
Glossar
Weblinks aus dem Buch – Kompakt zusammengestellt
Anmerkungen
Vorwort
Mein Name ist Sarah Straub, und ich lebe zwei Leben – zwei vollkommen gegensätzliche Welten treffen in mir aufeinander. In dem einen bin ich Musikerin: Ich stehe auf der Bühne, komponiere, texte, singe und unterhalte. Alles, was ich dort tue, ist getragen von dem Wunsch, mein Publikum zu berühren und selbst berührt zu werden. In meinem anderen Leben bin ich Neurowissenschaftlerin, Diplom-Psychologin und Demenzexpertin. Hier leite ich eine Demenzsprechstunde an einem Universitätsklinikum und eine Online-Sprechstunde für pflegende Angehörige, bin also aktiv ins medizinische und pflegerische Versorgungssystem eingebunden, begleite Betroffene auf ihrem Weg mit der Erkrankung und unterstütze ihre Angehörigen in dieser herausfordernden Zeit. Dieses zweite Leben war nie geplant – es fand mich, als meine Großmutter an Demenz erkrankte.
Meine Erlebnisse als pflegende Enkelin haben mich und meinen Lebensweg verändert und mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Ja, ich bin Musikerin, Psychologin und Wissenschaftlerin – und doch schreibe ich dieses Buch weder ausschließlich aus der einen noch aus der anderen Perspektive. Ich schreibe es als der Mensch, der ich durch all meine Erfahrungen geworden bin – geprägt von den Begegnungen mit Erkrankten, ihren Familien und Freunden, die mich tief berühren, bereichern und inspirieren.
Ich glaube von ganzem Herzen an ein gutes Leben mit Demenz, basierend auf Solidarität, Zusammenhalt und Nächstenliebe – selbst, wenn mich die Realität meines beruflichen Alltags in diesem Glauben immer wieder herausfordert. Manchmal fühle ich mich in meinen Sprechstunden wie ein Teil eines porösen, von Löchern durchsetzten Auffangnetzes für Menschen, die sich im Seiltanz des Lebens gerade im freien Fall befinden. So viele Familien fühlen sich alleingelassen, wissen überhaupt nicht, wie sie ein Leben mit Demenz organisieren sollen und kämpfen sich mehr schlecht als recht von Tag zu Tag. Und das, obwohl überall in Deutschland Entlastungs- und Unterstützungsangebote etabliert sind. Und auch das öffentliche Bewusstsein zunimmt. Das alles ist einfach nicht genug.
Familien, die einen an Demenz erkrankten Menschen begleiten, stehen vor sehr individuellen Herausforderungen, die ebenso individuelle Lösungen erfordern. Und die lassen sich nicht immer umsetzen. Auch ich stoße manchmal an meine Grenzen, weil ich nicht helfen kann, wie ich gerne helfen würde. Es fällt mir manchmal schwer, in den Feierabend zu gehen und die Geschichten der Familien zu verdrängen. Doch für mich ist es mehr als nur ein Beruf – es ist eine Aufgabe, die ich mit ganzem Herzen erfüllen möchte. Nicht nur aus Mitgefühl. Nicht aus moralischem Pflichtbewusstsein. Nicht, weil es guttut, Gutes zu tun. Ich muss und möchte helfen, um etwas zurückzugeben. Denn ich verdanke meinen Patienten alles. Die Arbeit mit ihnen und ihren Angehörigen ist sinnstiftend und inspirierend. Unsere Begegnungen verleihen mir eine Superkraft: die Fähigkeit, zu erkennen, was im Leben wirklich zählt. Wie schön dieses Leben eigentlich sein kann. Ich habe das Gefühl, dass Menschen mit Demenz ihr Herz auf der Zunge tragen und ihre Gedanken durch ihr Tun offenbaren. Weil sie ihre geistigen Ressourcen verlieren und die Fassaden sozialer Konventionen wegfallen, sind sie authentisch. Wahrhaftig und echt. Ihr Lächeln pur und unverfälscht. Und ich möchte diese Gedanken in die Welt hinaustragen: Wie wert es ist, Menschen mit Demenz bedingungslos zu begegnen und sie in unsere Lebenswelten zu integrieren. Wie sehr unsere Gesellschaft, wir alle, profitieren können, wenn wir Menschen mit (welchen) Beeinträchtigungen (auch immer) auf Augenhöhe begegnen. Wie reich das Leben ist, wenn wir Nächstenliebe walten lassen. Wie viel wir von diesen Menschen und ihren Angehörigen lernen können.
Dies alles ist möglich, wenn wir die Herausforderungen des Lebens mit Demenz anerkennen. Ich verkläre nichts, bagatellisiere nichts und versuche nicht, die Realität schönzufärben. Ich bin eine von Ihnen, weil ich selbst pflegende Angehörige war und die wohl wichtigste aller Perspektiven auf das Thema Demenz am eigenen Leib erfahren habe. Zuerst war es meine Großmutter, dann mein Schwiegervater. Ich weiß genau, was es bedeutet, jemanden zu begleiten und irgendwann loslassen zu müssen. Gleichzeitig bin ich Wissenschaftlerin und beschäftige mich mit dem Stand der Ursachenforschung von Demenzerkrankungen. Zuletzt erlebe ich als Psychologin aus nächster Nähe, welchen Belastungen Menschen durch die Demenz eines Familienmitglieds ausgesetzt sind. Ich verstehe Ihre Situation. Die Belastung pflegender Angehöriger ist real. Gleichzeitig glaube ich fest daran, dass wir es als Gesellschaft schaffen können, Demenz als festen Bestandteil unseres Lebens zu akzeptieren und mutig neue Wege im Umgang damit zu finden. Und das bedeutet für mich vor allem, die Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Erkrankte nicht auf ihre Diagnose zu reduzieren, sondern den Wert ihrer Person zu erkennen, die sie waren und weiterhin sind. Wenn ich in meinem Bekanntenkreis die Frage stelle, vor welchen Krankheiten sie am meisten Angst haben, lautet die Antwort häufig: Demenz. Es herrscht nach wie vor dieses negativ geprägte Bild in der Bevölkerung. Natürlich erst einmal nachvollziehbar, weil viele in ihrem Umfeld schon einmal erleben mussten, wie schwer es war, als nahestehende Menschen erkrankten. An diesem Bild müssen wir rütteln. Denn Mut, sich dem Thema Demenz zu stellen, ist der Schlüssel, um unseren Mitmenschen mit Demenz einfühlsam und respektvoll zu begegnen. Davon bin ich überzeugt.
Lebensmut trotz(t) Demenz
Das Leben mit einer an Demenz erkrankten Person ändert alles. Man kann sich das kaum vorstellen, bevor man sich selbst in einer solchen Situation befindet. Einen lieben Menschen, den man vielleicht sein Leben lang kennt, immer weniger wiederzuerkennen, und sein Verhalten und seine Gefühle immer weniger nachvollziehen zu können – das ist auf ziemlich vielen Ebenen schmerzhaft und erschütternd. Es fühlt sich an, als verliere man Stück für Stück einen Teil von ihm – bei meiner Großmutter empfand ich es gar so, als würde ich auch einen Teil von mir selbst verlieren. Wer fängt uns auf in dieser Trauer, wenn wir als pflegende Angehörige doch gleichzeitig der sichere Hafen sein sollen? Während die Fähigkeiten unserer erkrankten Liebsten mit der Zeit schwinden, müssen wir von einem Moment auf den anderen immer mehr Fähigkeiten erlernen – vom Laien zum Experten – am besten in Lichtgeschwindigkeit. All die Herausforderungen, die eine Demenzerkrankung mit sich bringt, anzunehmen und als Teil unseres Lebens zu begreifen, erfordert Kraft und Mut zum Leben. Dieser Lebensmut kann Demenz als Schreckensszenario trotzen und neue Bedeutungen und Perspektiven eröffnen, die den Fokus auf Lebensqualität, wertvolle Momente und zwischenmenschliche Verbundenheit legen. Was wir brauchen, ist die Zuversicht, auch in schwierigen und unsicheren Lebensphasen weitermachen und Herausforderungen annehmen zu können.
Wie können Sie diesen Lebensmut in sich stärken, damit er Sie in schwierigen Momenten trägt? Wie können Sie ihn ganz neu entdecken? In den letzten fünfzehn Jahren bin ich ihnen immer wieder begegnet – den Menschen mit Demenz ebenso wie den pflegenden Angehörigen, die mir auf beeindruckende Weise ihren Lebensmut gezeigt haben. Mich von ihren Geschichten inspirieren zu lassen, gehört zu den wichtigsten Ankerpunkten meines eigenen inneren Wachstums. Diese Menschen ermöglichen mir, meinen eigenen Lebensmut zu stärken, indem sie mir zu Lehrmeistern werden. Ich blicke immer wieder staunend auf sie und lerne von ihnen. So wie ich den Erkrankten und ihren Angehörigen als Psychologin beistehe, so ermöglichen sie mir im Gegenzug, den Blick auf das eigene Leben zu verändern, den eigenen Horizont zu erweitern und, ja, immer wieder die Liebe als größte Kraftquelle des Lebens bestätigt zu wissen.
Lassen Sie mich Ihnen einige dieser ganz besonderen Geschichten erzählen und fühlen Sie ihnen nach, so wie ich ihnen nachfühlen durfte. Jedes Kapitel dieses Buchs erzählt eine Fallgeschichte, die Sie inspirieren, stärken und ermutigen soll – so wie mich die Begegnungen mit den Protagonist:innen dieser Geschichten inspiriert, gestärkt und ermutigt haben. Dabei geht es nicht darum, ob Sie in einer ähnlichen Lebenssituation wie die Protagonist:innen ähnliche Entscheidungen getroffen oder genauso resilient reagiert hätten. Vielmehr geht es darum, die Essenz dieser Geschichten zu erfassen, Vertrauen in Ihre eigenen Fähigkeiten zu gewinnen und daran zu wachsen. Ich möchte, dass Sie sich nach der Lektüre dieses Buchs stärker, mutiger und zuversichtlicher fühlen können.
Ich wünsche mir, dass Sie Volkmar kennenlernen, einen weitgereisten, hochgebildeten Mann Mitte 70, der Ihnen schildern wird, warum er glücklich ist – und das nicht nur trotz, sondern auch gerade mit seiner Demenzdiagnose. Oder Stefanie, die mehrere Familienmitglieder, teilweise in sehr jungen Jahren, an Demenz verlor und mit dem Wissen lebt, dass es sich in ihrer Familie um eine genetisch bedingte Demenzform handelt, welche mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent auch sie treffen wird. Selten habe ich eine so lebensbejahende und starke junge Frau kennengelernt. Sie hat mir gezeigt, wie man sich trotz schwerer Schicksalsschläge die Fähigkeit bewahren kann, sich an den kleinen und großen Dingen des Lebens zu erfreuen, und wie es möglich ist, sich nicht von Angst oder Verzweiflung lähmen zu lassen, sondern den Blick bewusst auf das Positive zu richten. Ich möchte Ihnen zeigen, wie es möglich ist, Menschen mit Demenz auch in weiter fortgeschrittenen Stadien ihrer Erkrankung zu erreichen – sie dort abzuholen, wo sie sind, und mit ihnen auf eine Weise zu kommunizieren, die Verbindung schafft. Und welch wundervolle, berührende Begegnungen entstehen können, wenn wir ihnen liebevoll und auf Augenhöhe begegnen.
Ich werde Ihnen auch von besonders herausfordernden und schmerzlichen Schicksalen erzählen, die mit unermesslichem Leid verbunden waren. Doch auch hier haben die Beteiligten das Außergewöhnliche geschafft und ihren Lebensmut bewahrt. Sie haben gelernt, unveränderliche Umstände anzunehmen, ohne daran zu zerbrechen oder zu verbittern. Und trotz allem haben sie Wege gefunden, sich handlungsfähig zu fühlen und ihre Situation aktiv zu verbessern. Es sind Geschichten von Stärke, Hoffnung und einem unerschütterlichen Willen, dem Leben auch in der dunkelsten Stunde etwas Positives abzugewinnen.
Zusätzlich biete ich Ihnen in jedem Kapitel eine fachliche Einordnung, damit Sie – ganz nebenbei – Ihr Wissen über Demenzerkrankungen und den Umgang damit erweitern können.
Sollten Sie selbst pflegender Angehöriger oder pflegende Angehörige sein und sich momentan von den enormen Herausforderungen eines Lebens mit Demenz überwältigt fühlen, dann möchte ich Ihnen Mut machen: Es sind oft die ganz kleinen Schritte, die Sie gehen können und die nach und nach Ihre Situation verbessern. Geben Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Gehen Sie einen Schritt nach dem anderen. Einer der ersten ist mit Sicherheit, sich über Demenz und den Umgang damit zu informieren. Jede Veränderung, jedes Symptom, das Sie als Teil der Erkrankung richtig einordnen können, wird Ihnen ein Stück Ihrer Sicherheit zurückgeben, die Angst reduzieren und das Gefühl der Ohnmacht mindern können. Gleichzeitig wird Ihnen ein gutes Verständnis der bestehenden Versorgungsstrukturen Handlungsspielräume eröffnen, die Ihnen ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit vermitteln.
Ein weiterer Schritt kann darin bestehen, sich von den Erfahrungen und der Stärke anderer Betroffener inspirieren zu lassen. Genau dafür halten Sie dieses Buch in Händen. Ich erhoffe mir, dass Sie hier und jetzt die Welt durch meine Augen sehen können. Lassen Sie uns gemeinsam eine Perspektive auf das Thema Demenz entwickeln, die über Bürde, Verlust und Anstrengung hinausgeht. Mein größter Wunsch ist, dass Sie in den folgenden Geschichten lernen können, warum ein einfühlsamer und respektvoller Umgang mit Menschen mit Demenz nicht nur diesen selbst guttut, sondern unser aller Leben bereichert und schöner macht. Lebensmut trotz(t) Demenz!
»Es macht mich glücklich, dass ich mich glücklich fühlen kann« – Über einen lebensbejahenden Umgang mit einer Demenzdiagnose
Ich befinde mich in einer kleinen, schnuckeligen Wohnung bei Frankfurt am Main, und vor mir sitzt ein Mann mit knallbunten Socken an den Füßen. Mitte 70 ist er, aber man merkt ihm sein Alter nicht an. Ich beginne zu grinsen und strecke ihm mit kindlicher Freude meine eigenen Füße entgegen – meine Socken sind gelb, rot, grün, blau kariert. Wir lachen beide über unser Faible für diese wunderbaren Modesünden und vergessen fast, dass wir uns eigentlich gar nicht kennen. Ich fläze auf dem Sofa dieses Mannes, als sei ich schon hundertmal hier gewesen und wundere mich ein bisschen über mich selbst. Wobei – vielleicht auch nicht. Volkmar, so heißt der Mann, ist ein echter »Frauenversteher«, ein Gentleman der alten Schule, und er weiß eben ganz genau, was es braucht, damit man sich wohlfühlt. Beim Betreten seiner Wohnung hätte ich – würde ich es nicht besser wissen – darauf geschworen, dass hier eine Frau wohnt. Jede Ecke zeugt von liebevoll gestalteten Details: Lampen, die die einzelnen Wohnbereiche in ein warmes Licht hüllen, Regale mit Büchern und Souvenirs aus aller Welt, und eine Atmosphäre, die eine ganz persönliche Handschrift trägt. Es ist ungemein gemütlich hier, und Volkmar wirkt sehr zufrieden in seinem kleinen Reich.
Dabei ist dies gar keine gewöhnliche Wohnung. Erst der Blick aus dem Wohnzimmerfenster verrät, dass wir uns nicht in einem klassischen Mehrfamilienhaus befinden, sondern in einer betreuten Wohnanlage des Deutschen Roten Kreuzes. Volkmar lebt mit einer Alzheimer-Demenz und zog vor einiger Zeit hierher. Wenn sein Gesundheitszustand sich verschlechtert, möchte er bestmöglich versorgt sein. Und so fallen mir nach und nach Details auf, die von den Gedächtnisstörungen zeugen: Am Eingang und an den Wänden sind Erinnerungshilfen angebracht – Magnettafeln mit Notizen, Terminhinweisen, To-do-Listen. In regelmäßigen Abständen – an diesem wie an jedem anderen Tag – meldet sich die sprachgesteuerte virtuelle Assistentin »Alexa«, um Volkmar die Tagesstruktur zu erleichtern und ihn an seine Routinen zu erinnern: Sie sagt ihm, wann er seine Medikamente einnehmen muss, wann sein kognitives Training ansteht oder er eine Sporteinheit absolvieren sollte.
Ich habe Volkmar kennengelernt, als er sich im Frühjahr 2024 per Mail bei mir vorstellte, nachdem er ein Konzert meiner letzten Tournee besucht hatte. Er erzählte mir darin, dass er im Beirat »Leben mit Demenz« der Deutschen Alzheimer Gesellschaft tätig sei und in einem Vortrag von meiner Arbeit berichtet habe. Ich fühlte mich sehr geschmeichelt, war aber auch total fasziniert von Volkmars Arbeit in diesem Gremium. Ich hatte davon gehört, dass es diesen Beirat gibt, mich aber nie zuvor bewusst damit auseinandergesetzt. »Leben mit Demenz« besteht aus Personen, die selbst an Demenz erkrankt sind, und wurde ins Leben gerufen, um die Anliegen und Perspektiven der Betroffenen in die Arbeit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft einzubringen. Das hat mich irgendwie beeindruckt, war es doch logisch, Menschen mit Demenz in die Gestaltung von Versorgungsstrukturen und Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Familien einzubeziehen. Selbstverständlich ist es nicht. Man ist eben gewohnt, nicht mit den Betroffenen, sondern für sie zu sprechen und zu entscheiden.
Volkmar und ich blieben in den nächsten Monaten in Kontakt und in mir wuchs der Wunsch, seine Sicht auf ein Leben mit einer Demenzdiagnose zu erfahren. Volkmar steht mitten im Leben, so wirkt es zumindest, wenn man ihn kennenlernt. Dabei weiß ich sehr wohl, dass er mitunter eine Fassade aufrechterhält, er sich selbst auch anders wahrnimmt und seine zunehmenden kognitiven Beeinträchtigungen sein Leben erschweren. Er ist eloquent und reflektiert und ich bin mir sicher, dass Menschen, die ihm begegnen, dazu neigen können, ihn zu überschätzen. Volkmars Demenzerkrankung ist nicht weniger real, nur weil er konstruktiv und lebensbejahend damit umgeht. Aber sie verliert in gewisser Weise ihren Schrecken, wenn man diesen Mann beobachtet, wie er da vor mir sitzt, mit seinen bunten Socken und einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Dem möchte ich auf den Grund gehen. Verstehen, was er vielleicht anders macht als viele andere Erkrankte, denen ich begegne. Volkmar strahlt Zufriedenheit aus. Dabei ist sein Leben nicht immer leicht gewesen, man hätte sich auch vorstellen können, dass ihn eine gewisse Schwermut umgibt. Auch weil er mit einer Diagnose leben muss, für die wir keine Heilung kennen, die ihm nach und nach seine Selbstständigkeit nehmen wird und die zu stoppen nicht möglich ist. Volkmar hat sich entschieden, das Leben mit all seinen Facetten zu lieben und ich glaube, diese Entscheidung traf er in den gut 70 Jahren seines Lebens immer wieder gleich – auch schon als Kind.
Volkmar war auf den Tag genau zwei Jahre alt, als seine Eltern im Sommer 1950 mit seinem fünf Jahre älteren Bruder und ihm aus Thüringen über »die grüne Grenze« in den Westen flüchteten. Bis heute hat er den stechenden Gestank der frischen Tierhäute in der Nase, die auf dem Laster gestapelt waren, dessen Pritsche sie per Anhalter Richtung Frankfurt mitnahm. Für ihren Traum von einem neuen Leben hatte die Familie alles aufgegeben und besaß nun – so stelle ich mir das zumindest vor – nicht mehr als die Kleider, die sie alle am Leib trugen. Bettelarm müssen sie gewesen sein, doch Volkmar bleibt vage, als er mir davon erzählt.
In Frankfurt angekommen, hauste die Familie erst einmal in einem Badezimmer, aus dem sie samstags immer raus mussten – da war Badetag. Danach kamen sie in einem Bunker unter, der mehr einem Kellerverschlag glich, bis sie schließlich eine kleine Zweizimmerwohnung beziehen konnten. Volkmars Vater war schwer alkoholkrank. Er konnte die Familie nie ausreichend ernähren, sodass der kleine Volkmar früh in eine Rolle gedrängt wurde, die viel zu große Verantwortung mit sich brachte. Von der Mutter zu einer Art Vaterersatz gemacht, sah er sich in der Pflicht, für Essen zu sorgen und die Familie über Wasser zu halten. Regelmäßig bettelte Volkmar, mit einer Schüssel in seinen Kinderhänden, in einem Fischgeschäft um etwas Fischsoße – immer hoffend, dass sich ein kleines Stück Fisch darin verirrt haben könnte. Und in einem Restaurant bat er jede Woche um Reste der dort zubereiteten Schlachtplatten. Für seine Familie war er ein König, wenn er es schaffte, etwas Wurst zu beschaffen.
Man könnte nun meinen, dass ein solcher Start ins Leben einem Kind einen ähnlichen Weg vorzeichnet, den seine Eltern gegangen waren: Wirkt sich Armut nicht auch negativ auf die schulischen Leistungen aus, da den Familien die Ressourcen fehlen, um die Kinder zu unterstützen? Tatsächlich belegen wissenschaftliche Untersuchungen, dass Kinder aus solchen Haushalten bis heute geringere Chancen auf eine höhere Bildung haben1 und auch ein erhöhtes Risiko für psychische Probleme.2 Die finanziellen Sorgen der Eltern können sich auf die Kinder übertragen und bei ihnen Ängste und Unsicherheiten auslösen, die sie auch im Erwachsenenalter begleiten. Umso erstaunlicher ist, wie Volkmar schon als junger Mensch mit seiner Lebenssituation umzugehen wusste: Er muss vor Energie und dem unbedingten Wunsch voranzukommen, gestrotzt haben.
Nach der Schule schaffte er die Aufnahmeprüfung für eine Lehre zum Fernmeldemonteur, richtete sich im Schlafzimmer seiner Eltern ein winziges Schreibtischeckchen her und stürzte sich in die Arbeit, paukte für die Ausbildung und holte, ganz nebenbei, im Fernstudium noch sein Abitur nach. Liebenswert und angepasst, so beschreibt Volkmar sein Kindheits-Ich. Dass er sich als junger Mann bei den Pfadfindern engagierte und eine Gruppe fast Gleichaltriger anführte, passt gut zu diesem Bild. Ich stelle ihn mir als einen jungen Menschen voller Träume und Ideale vor, der es vermochte, trotz aller Widrigkeiten ein Vertrauen in die Welt zu entwickeln; der voller Neugierde und Vorfreude in das Abenteuer Leben startete.
Und so begann Volkmar mit 18 Jahren ein Studium an der neu gegründeten Fachhochschule für Sozialarbeit in Frankfurt. Einfach war es anfangs nicht – es fiel ihm schwer, auf andere zuzugehen und sich zu öffnen. Da entpuppte sich sein folgender Zivildienst in Gießen als wichtige Weichenstellung für sein weiteres Leben: Hier lernte er seinen besten Freund fürs Leben kennen und das, wie er mir mit Strahlen in den Augen sagt, »schönste Lebensglück«: seine Frau Gertraude. 44 Jahre sollten sie gemeinsam verbringen, »sie war die tollste Frau der Welt«, sagt Volkmar.
Als sie sich kennenlernten, war er als Zivildienstleistender kaserniert, sie als Krankenschwester in einem Schwesternwohnheim untergebracht. Um in ein Doppelzimmer ziehen zu dürfen, musste man ein Ehepaar sein – also taten sie, was nötig war, und heirateten, frisch verliebt und Knall auf Fall. An einem ersten April versteht sich, so viel Spaß muss sein, war die Aktion doch erst mal nur Mittel zum schönen Liebeszweck. Ich weiß, wie Volkmar das meint, wenn er mir davon erzählt, weil es am Ende überhaupt kein Aprilscherz war: Sie war die Frau seines Lebens und er muss es vom ersten Moment an gewusst haben. Beneidenswert.
Nach dem Studium zum Diplom-Sozialarbeiter studierte Volkmar noch berufsbegleitend an der Uni Frankfurt Diplom-Pädagogik. Später baute er ein Berufsbildungszentrum in Frankfurt auf und leitete es. Er führte Mitarbeiter, die meist doppelt so alt waren wie er und wurde, auch weil er flache Hierarchien einführte, sehr erfolgreich und beliebt. Er stieg weiter auf – bis in die leitende Geschäftsführung eines Konzerns mit 14 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nach der Wende kümmerte er sich um Projekte wie den Aufbau beruflicher Bildungsstrukturen in Thüringen und Polen, sein Job forderte ihn Tag und Nacht, sieben Tage die Woche.
Mit 45 Jahren bekam er die Rechnung: »Burn-out«. Doch was genau dies bedeutete, überspringt Volkmar, als er mir davon erzählt. »Die Power und Motivation, mich selbst aus dem Sumpf zu ziehen, kam schnell zurück«, sagt er, und ich glaube ihm, dass diese Gabe ihm sein Leben lang ein Schlüssel zum Glück (gewesen) sein muss.
Er traf infolge seiner Erschöpfung eine lebensverändernde Entscheidung: Er wollte mit seiner Frau eine Weltreise unternehmen. Er bereitete alles minutiös vor, Manager eben, Volkmar konnte nicht aus seiner Haut. Und sie gaben gemeinsam ihre »bürgerliche Existenz« auf, wie Volkmar sagt, verkauften ihr Haus, übergaben ihr Vermögen an einen Verwalter und ließen die Frage nach einer Rückkehr offen. Sollte es ihnen irgendwo besonders gut gefallen, würden sie einfach bleiben. Diese Freiheit wollten sie leben.
Das Ehepaar begann seine Reise in Singapur und Indonesien und alles fühlte sich nach einem großen Abenteuer an. Sie tauchten tief in fremde Kulturen ein, lebten zum Beispiel auf der Insel Borneo nicht als Touristen, sondern als Freunde der Einheimischen. Sie schliefen auf Teppichen, inmitten von Menschen, die nichts von materiellem Wert besaßen, aber jeden Tag mit einem Lächeln begannen. Drei Jahre lang waren Volkmar und Gertraude unterwegs, von Laos bis Alaska. Jeden Tag neue Eindrücke, jeden Tag unendlich viel Zeit für ihre Liebe.
Dann kam die große Zäsur: Die beiden Weltenbummler erfuhren, dass ihr ganzes Geld weg ist. Sie waren pleite und mussten die Reise abbrechen. Ihr Vermögensverwalter hatte ihr Geld nicht verwaltet, sondern »durchgebracht«, wie Volkmar es formuliert. Sie waren von einem Moment auf den anderen »arm wie Kirchenmäuse«, mussten nach Hause fliegen und konnten zum Glück in Gertraudes Elternhaus im Spessart ziehen. Alles auf Anfang. Volkmar sollte sich von dieser finanziellen Misere nie mehr ganz erholen.
Er zog sich auch dieses Mal wieder aus dem Sumpf. Volkmar entschied sich dafür, beruflich neue Wege zu gehen, und begann, als Journalist zu arbeiten. Das war für ihn kein Kompromiss, sondern eine Neuausrichtung, um seiner eigentlichen Begabung und Leidenschaft zu folgen. Gemeinsam mit seinem besten Freund arbeitete er für eine Fachzeitschrift, die sich mit Komplementärmedizin, also alternativen Heilmethoden, beschäftigte. Volkmar war sich bewusst, dass er in einer Nische tätig sein würde, die weder wirtschaftliche Entlastung noch Erholung bringen würde. Trotzdem: Das Schreiben und die Begegnungen mit Menschen erfüllten ihn zutiefst.
Einige Jahre nach der Weltreise starb Gertraude, Liebe und größtes Glück seines Lebens. »Verschieb nichts aufs Alter« – das sei immer sein Motto gewesen, erzählt Volkmar, und es habe sich als richtig erwiesen. Die gemeinsame Weltreise habe ihm wertvolle Zeit mit seiner geliebten Frau geschenkt, von der er bis heute zehre.
Ich muss schlucken, als er das erzählt. Er hat so viel erlebt und getragen in seinem Leben, dabei haben wir seine Demenzdiagnose noch gar nicht angeschnitten. Ich spüre und sehe ihm an, dass er seinen Frieden hat mit all dem, was das Schicksal ihm abverlangte. Und ich kann nun besser verstehen, warum es ihm gelingt, auch mit seiner Demenzerkrankung lebensbejahend umzugehen. Auch da hat er sich »wieder selbst aus dem Sumpf gezogen«, wie Volkmar sagen würde. Für ihn gibt es keine Alternative. Ein Zufallsbefund vor drei Jahren sei das gewesen, sagt er, als er wegen einer anderen Frage ein MRT vom Kopf habe machen lassen. Obwohl: So ganz zufällig war es doch nicht. Er hatte immer mal wieder kleine Gedächtnislücken bemerkt, aber eine neuropsychologische Untersuchung blieb ohne Befund. Im Bild vom Kopf habe man dann einen Hirnabbau festgestellt, der nicht zu seinem Alter passte. Volkmar stellte sich in der Gedächtnissprechstunde der Uniklinik Mainz vor. Hier wurde aus einem vagen Verdacht Gewissheit. Beginnende Alzheimer Demenz. Es war ein Schock und er stellte sich – wie wahrscheinlich viele Menschen in einer solchen Situation – schon die »finale Phase« der Erkrankung vor. Er hatte erst einmal unendlich viel Angst.
Volkmars Leben war schön gewesen zu der Zeit, auch ohne viel Geld reiste er ab und zu – er habe Kreuzfahrten gemacht, sei viel Fahrrad gefahren. Und jetzt: Demenz? Das war ein besonders tiefer Sumpf, aus dem er sich nun wieder am eigenen Schopf herausziehen wollte.
Volkmar begann, wie er selbst sagt, »zu seinem eigenen wissenschaftlichen Projekt zu werden«, um sich bestmöglich gegen die Krankheit zu wehren. Er las alles, was er über Demenz finden konnte, eignete sich umfangreiches Wissen an und schaffte es so, die Angst vor ihr zu überwinden. Und wenn sie doch einmal an seine Tür klopft – vor allem in den Momenten, in denen er merkt, dass sie fortschreitet – lässt er sie nicht herein. Er gibt der Demenz so wenig Raum wie möglich und ist überzeugt, dass er aktiv gegen sie ankämpfen kann.
Volkmar lebt heute ein ganz anderes Leben als früher, alles ist darauf ausgerichtet, dem Alzheimer ein Schnippchen zu schlagen. Er stellte seine Ernährung auf mediterrane Kost um, integrierte Sport und Hirnleistungstraining in seinen Alltag und suchte sich »massiv soziale Kontakte«, wie er sagt. Er begann, sich ehrenamtlich zu engagieren, und ist inzwischen der offiziell benannte Hospizbetreuer in seiner Wohnanlage. Darüber hinaus verbringt er viel Zeit im ortsansässigen Kulturbahnhof, unterstützt seine Nachbarn oder hält Vorträge über seine Erkrankung. Sein Arzt und seine Psychotherapeutin begleiten ihn dabei als wichtige Stützen. Volkmar zeigt eindrucksvoll, wie man mit Entschlossenheit, Wissen und einem aktiven Lebensstil der Krankheit entgegentreten kann – und wie es möglich ist, trotz einer Alzheimer-Diagnose ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen.
Es berührt mich, wie stark Volkmar wirkt, und gleichzeitig denke ich in diesem Moment an all diejenigen meiner Patienten, denen solch ein Weg verwehrt bleibt. Demenzerkrankungen verlaufen sehr individuell und es ist von ganz unterschiedlichen Faktoren abhängig, wie die Menschen direkt nach der Diagnosestellung damit umgehen können. Ich schaue diesen lebensfrohen Mann in seiner gemütlichen Wohnung an und mir wird bewusst, was für ein Glück er hatte, dass der Krankheitsprozess sehr früh erkannt wurde. So war Volkmar in der Lage, die Situation vollumfassend zu durchblicken, zu werten und Veränderungen in seiner Lebensführung vorzunehmen, die keinerlei Unterstützung von außen bedeuten mussten. Zusätzlich half ihm ein hohes Bildungsniveau, was sich nachweislich positiv auf den Krankheitsverlauf auswirken kann. Die sogenannte Fallhöhe ist in seinem Fall einfach höher. Viele Patienten kommen deutlich später zu uns in die Gedächtnissprechstunde. Zu diesem Zeitpunkt haben sie oft schon erhebliche Schwierigkeiten, ihren Alltag zu bewältigen, und sind nicht mehr ausreichend in der Lage, allein zurechtzukommen. Warum das so ist? Zum Beispiel, weil wir Menschen, die uns nahestehen, anders beobachten, als Außenstehende es tun würden.
Ich muss gar nicht als Psychologin zu Ihnen sprechen, wenn ich das einordne, es ist eigentlich besser, Ihnen von meinen eigenen Erfahrungen als Angehörige von Menschen mit Demenz zu erzählen. Als meine Großmutter sich veränderte, habe ich es lange einfach nicht wahrhaben wollen. Jede kleine Seltsamkeit verbuchte ich unter »normalem Älterwerden«, sprach sie gar nicht darauf an, wollte sie nicht beunruhigen. Und schon gar nicht wollte ich, dass sie sich schämt. Mit ihr ein offenes Gespräch zu führen – allein die Vorstellung bereitete mir unerträgliches Unbehagen. »Demenz« war ein schreckliches Wort, das ein großes Tabu bedeutete. Heute würde ich natürlich alles anders machen, aber woher hätte ich denn damals wissen sollen, was »normal« ist und was nicht?
Die Menschen kommen also häufig recht spät, um mögliche demenzielle Veränderungen abzuklären, und haben dann nicht mehr die Ressourcen, der Erkrankung so selbstbestimmt und aktiv entgegenzutreten wie Volkmar. Sie benötigen bereits Unterstützung durch nahestehende Personen, um Therapien zu organisieren, Arzttermine auszumachen oder soziale Kontakte zu pflegen. Eine gute Ausgangsposition, um die Erkrankung bestmöglich einzudämmen, sieht anders aus.
In all diese Gedanken vertieft, sitze ich immer noch auf Volkmars Sofa, esse inzwischen allerlei Süßkram, den er mir vor die Nase setzt und den ich schmunzelnd irgendwie unter »mediterrane Kost« verbuche. Es ist nicht so, dass es damals nur an mir lag, dass meine Oma nicht zum Arzt gegangen ist. Ich war nicht schuld, auch wenn ich das jahrelang geglaubt habe. Oma hatte wie viele andere Erkrankte eine gute Fassade aufrechterhalten. Sie konnte ihre Defizite super verstecken und ich habe vieles gar nicht richtig bemerken können. Ich fühle mich traurig und esse noch mehr von Volkmars leckeren Süßigkeiten.
Volkmar reißt mich aus meinen Gedanken, als er sagt, er habe das Gefühl, seine Erkrankung schreite voran; er erwähnt es an diesem Tag immer wieder mal, so auch jetzt. Ich sehe ihn in meiner Rolle als Neuropsychologin an und möchte seiner Beobachtung nicht zu viel Bedeutung beimessen – weiß gleichzeitig aber, dass ich sie nicht leichtfertig übergehen darf. Ich wünsche ihm, dass er sich in seinen Sorgen ernst genommen fühlt, ohne dass diese Sorgen seine unglaubliche Stärke und Zuversicht überschatten. Und so stelle ich ihm die vielleicht etwas grenzüberschreitende Frage, wie das Leben mit dieser Erkrankung für ihn sei. Volkmar sieht mich mit seinen freundlichen Augen an und sagt: »Es macht mich glücklich, dass ich mich glücklich fühlen kann. Es fehlt mir an nichts und so bedrohlich die Erkrankung auch sein mag, so hat sie mir auch einen großen Benefit gebracht.« Ich muss in diesem Moment überrascht auf ihn gewirkt haben, denn er erklärt mir sogleich, die Erkrankung habe sein Leben auf den Kopf gestellt und ihm Forderung und Förderung ermöglicht. Er liebe neue Herausforderungen und den Kontakt zu Menschen. Und öffentlich über seine Erkrankung zu sprechen, gebe ihm Kraft. Er sei dankbar für all die wunderbaren Begegnungen, die er nun erleben dürfe. Er erlebe das alles mit viel Demut. Das seien alles Geschenke. Und er klingt sehr zufrieden, als er für sich zusammenfasst: »Würde ich heute abtreten müssen, so sage ich: Ich habe ein tolles Leben gehabt. Ich habe keine Angst vor dem Ende.«
Seine Worte klingen noch wohlig in mir nach, als wir uns verabschieden. Bevor ich gehe, fotografieren wir uns lachend gegenseitig, und Volkmar zeigt mir voller Stolz seine Sammlung bunter Socken. Zum Abschied umarme ich ihn fest. In diesem Moment wird mir klar, dass ich heute nicht nur eine bereichernde Begegnung mit einem faszinierenden Menschen hatte, sondern etwas viel Wertvolleres gewonnen habe: einen Freund.
Wissen kompakt: Erkenntnisse für den Alltag mit Demenz
Wussten Sie, dass Demenz ein Überbegriff ist für ganz unterschiedliche Erkrankungsbilder? Demenz bezeichnet den Verlust der kognitiven Funktionen, also Fähigkeiten wie Denken, Erinnern, Orientieren oder das Verknüpfen von Denkinhalten. Dieser Verlust führt dazu, dass alltägliche Aktivitäten zunehmend nicht mehr eigenständig bewältigt werden können. Die Alzheimer-Demenz ist mit etwa zwei Dritteln der Betroffenen die häufigste und daher auch bekannteste Form der Demenz. Sie entsteht, weil nach und nach Nervenzellen im Gehirn absterben, was zu einem fortschreitenden Verlust der geistigen Fähigkeiten führt. Besonders betroffen sind zu Beginn der Erkrankung Nervenzellen im Hippocampus, der in seiner Form einem Seepferdchen ähnelt und daher nach ihm benannt wurde. Diese Hirnregion ist besonders wichtig für unser Gedächtnis und unsere Fähigkeit, Neues zu lernen. Er ist wie eine Art Speicherzentrale, die darüber entscheidet, welche Erinnerungen ins Langzeitgedächtnis überführt werden. Außerdem unterstützt er uns bei der Navigation und dabei, uns an Orte oder Wege zu erinnern, und spielt eine Rolle bei der Verknüpfung von Gefühlen mit Erinnerungen. Genau deshalb haben Menschen mit Alzheimer-Demenz anfangs auch schon früh (schleichend beginnende und fortschreitende) Gedächtnisstörungen und Orientierungsschwierigkeiten. Die Nervenzellen sterben ab, weil bestimmte Proteine, die innerhalb und außerhalb der Zellen vorkommen, verklumpen und mit der Zeit sowohl die Kommunikation zwischen den Zellen als auch deren Versorgung mit Nährstoffen stören. Warum dies geschieht, ist wissenschaftlich noch nicht vollständig geklärt. Im Verlauf der Erkrankung breitet sich dieses Zellsterben dann wie ein Lauffeuer über immer größere Bereiche des Gehirns aus. Dementsprechend verlieren die Betroffenen immer mehr Fähigkeiten im Alltag.