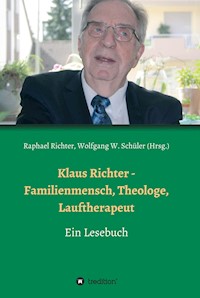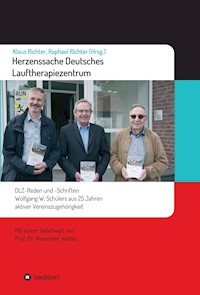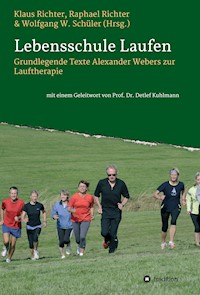
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Herausgeber: Klaus Richter, D.Th. (Univ. of South Africa), Dr. Raphael Richter und Wolfgang W. Schüler M.A. sind langjährige Läufer und Dozenten am Deutschen Lauftherapiezentrum (DLZ). Sie haben umfangreich zu Fragen des gesundheitsorientierten Laufens und der Lauftherapie geforscht und publiziert. Sie verfügen über vielfältige Erfahrungen in der Durchführung von Lauftherapiekursen. Zum Inhalt: Prof. Dr. Alexander Weber ist es gelungen, gesundheitsorientiertes Laufen zu einem systematischen Behandlungsansatz zu entwickeln, der unter dem Begriff "Paderborner Modell der Lauftherapie" bekannt geworden ist. Es ist sein Verdienst, "Laufen als Therapie" lehr- und lernbar gemacht zu haben. Vorliegendes Buch, das aus Anlass seines 80. Geburtstages im Juni 2017 erscheint, zeichnet Webers Weg der Entwicklung über vier Jahrzehnte anhand seiner grundlegenden Schriften nach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Klaus Richter, Raphael Richter, Wolfgang W. Schüler (Hrsg.)
Lebensschule Laufen
Grundlegende Texte Alexander Webers zur Lauftherapie
© 2017 Klaus Richter, Raphael Richter, Wolfgang W. Schüler (Hrsg.)
Umschlag, Illustration: Raphael Richter
Cover-Foto: © Torsten Schubert
Autoren (in alphabetischer Reihenfolge):
Detlef Kuhlmann, Klaus Richter, Raphael Richter, Wolfgang W. Schüler, Alexander Weber
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
978-3-7439-2060-6
(Paperback)
978-3-7439-2061-3
(Hardcover)
978-3-7439-2062-0
(e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Herausgeber unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Vorwort
Prof. Dr. Alexander Weber – Person und Werk im Kontext der Lauftherapie
Grundlegende Texte Alexander Webers zur Lauftherapie
Lauftagebuch. Laufen im Jahresrhythmus – aufgezeichnet vom 25.XII.1974 – 21.XII.1975
„Ich fühle mich unglaublich wohl“ - Warum Läufer laufen. Eine Untersuchung der Motive von Gewohnheits-Läufern
Falschen Göttern nachzulaufen
Laufen – Motive und Wirkungen. Eine repräsentative Untersuchung an Volkslaufteilnehmern
Mehr Lebensfreude durch Laufen
Regelmäßiges Laufen beeinflußt den ganzen Menschen – Veränderungen im seelischen Bereich
Lauftherapie mit Alkoholabhängigen an einer Kurklinik
Laufen verbindet Menschen - Kommunikatives Laufen
Laufen als Behandlungsmethode – eine experimentelle Untersuchung an Alkoholabhängigen in der Klinik
Frauen auf neuen Wegen - Beobachtungen und Erkenntnisse nach einem Jahr Laufpraxis
Lauftherapie für Alkoholabhängige
Anfängerlaufen für Hausfrauen
Thesen zum Thema: „Anfänger und Abbrecher im Ausdauersport“ aus psychologischer Sicht
Laufen als Therapie
Wieviel Laufen ist gesund? - Der heutige Mensch zwischen Bewegungsmangel und Fitness-Sucht
Burnout und Lauftherapie - Diagnose, Symptome, Behandlungsweg, Erfolgsmessung
Das Paderborner Modell der Lauftherapie
Rundbriefe an LT-Kursteilnehmer stärken die Motivation
Psychologische Aspekte des Langstreckenlaufs in der Lauftherapie
Über Alter, Wellness und Fitness
Die andere Wellness
Warum laufen? 5 Fragen an Prof. Dr. Alexander Weber
Gesundheitsförderung durch Lauftherapie - der Weg zum Lauftherapeuten
Körperliches und seelisches Wohlbefinden und Lauftherapie
Das Paderborner Modell der Lauftherapie
Wir Läufer und unsere stummen Signale
Gesundheitsförderung – vorrangige Aufgabe des Deutschen Lauftherapiezentrums e.V. (DLZ)
Exkurs: George Sheehan - Suche nach höherem Sinn
Exkurs: Bewährungsprobe Hermannslauf
Bibliografie - Alexander Weber über Lauftherapie
Über die Herausgeber und den Verfasser des Geleitwortes
Geleitwort
von Detlef Kuhlmann
Prof. Dr. Alexander Weber vollendet am 25. Juni 2017 sein 80. Lebensjahr. Das ist nicht zu fassen! Wirklich schon 80 Jahre? Alexander Weber hat wie kein anderer der modernen Laufbewegung in Deutschland ein Gesicht gegeben – ein bis heute jugendliches Gesicht! Alexander Weber hat die moderne Laufbewegung hierzulande über viele Jahrzehnte mit seinen Ideen und Innovationen geprägt und mit seiner unermüdlichen Schaffenskraft dafür gesorgt, dass die Laufbewegung, die inzwischen auch schon ihr 50. Lebensjahr hinter sich hat, selbst jugendlich frisch geblieben ist. Immer noch und immer mehr Menschen finden zum regelmäßigen Laufen und integrieren diese einfache körperliche Aktivität laufend in ihren Lebensalltag. Alexander Weber ist da mit 80 mittendrin …
Alexander Weber hat die moderne Laufbewegung mit zahlreichen und bis heute nachhaltigen Impulsen angereichert. Mit seinem Engagement ist es gelungen, Tausende bis dahin sportabstinente Menschen zum regelmäßigen Laufen zu bewegen und ihnen damit ein Stück Lebenshilfe zu bieten. Für viele ist daraus längst ein „andauernd-ausdauerndes“ Lebensglück geworden. Alexander Weber läuft dabei stets vorweg und macht für uns quasi den Weg frei, um das Laufen neu zu denken und immer wieder neu zu empfinden. In seinem wissenschaftlichen Ertrag finden wir uns laufend wieder: Laufen als Bereicherung für ein sinnerfülltes Leben, Laufen als fester Anker, der uns aber gleichsam in Bewegung hält, Laufen als Erfahrungskontrast zu unserem ansonsten bewegungsarmen Alltag, Laufen als psychisch-physische Therapie, um wieder stark zu werden bzw. stark zu bleiben, Laufen als freie Zeit des Draußenseins genießen, um hinterher ganz drinnen bei sich anzukommen – ganz egal, welche Begriffe und Bilder man bemüht, um mit wenigen anschaulichen Worten etwas von dem zu beschreiben, was uns das Laufen bedeuten kann und welchen „Mehrwert“ wir darin für uns selbst finden können. Für das alles ist Alexander Weber seit mehreren Jahrzehnten und bis heute ein wichtiger Vordenker und Vorläufer in einer Person, die wissenschaftliche Erkenntnisse für die Laufpraxis verfügbar macht und umgekehrt aus dem (lauftherapeutischen) Praxisfeld neue Forschungsansätze generiert.
Der 80. Geburtstag von Alexander Weber ist daher zu allererst ein willkommener Anlass, um dem Jubilar zu danken – ausdrücklich zu danken für diese seine großartige Lebensleistung in der und für die Laufbewegung. Alexander Weber ist der Begründer der Lauftherapie in Deutschland. Der Laufbewegung hat er damit eine einzigartige Dimension geöffnet und diese fortlaufend etabliert. Eine solche Dimension ist in anderen Sportarten bzw. körperlichen Betätigungsformen in dieser Form nicht vorhanden: Beim so verstandenen Laufen gibt es nur Gewinner, und das sind wir selbst! Der pädagogische Psychologe Alexander Weber versteht es, seine wissenschaftliche Expertise „laufend“ so in das Praxisfeld zu transferieren, dass dadurch immer wieder neue Nachahmerinnen und Nachahmer angesprochen werden und sich inspiriert fühlen. Selbst diejenigen, die schon länger aktiv dabei sind, können daraus immer wieder neue Bindungskräfte für ihre eigenen Laufaktivitäten schöpfen.
Alexander Weber ist dieser Band zum 80. Geburtstag gewidmet. Damit werden Teile seiner „gedruckten“ Lebensleistung ganz bescheiden neu zwischen zwei Buchdeckel gepresst. Der Band enthält (nur) 29 Beiträge unter dem Titel „Lebensschule Laufen“. Der Titel klingt programmatisch, ist pädagogisch gesättigt und zielt doch markant darauf ab, das mit zwei einschlägigen Begriffen auszudrücken, was die Lebensleistung von Alexander Weber prägnant umreißt und so einzigartig macht: Wir können das Laufen als eine Lebensschule begreifen! Der Band mit Aufsätzen des Jubilars legt wichtige textliche Spuren, über die wir selbst weiter zu seinem Lebenswerk vordringen können, indem wir uns seine Expertise immer wieder neu vergegenwärtigen – alles mit dem Ziel, sie noch besser zu verstehen und zukünftig noch intensiver zu nutzen. Als Leserinnen und Leser des Bandes können wir selbst Teil dieser „Lebensschule Laufen“ werden, sofern wir uns nicht schon längst dazugehörig fühlen bzw. dazu bekennen.
Der Band enthält gemäß Untertitel „Grundlegende Texte Alexander Webers zur Lauftherapie“. Diese Auswahl wird den Herausgebern des Bandes angesichts der hohen Anzahl von Publikationen und der Vielfalt der thematischen Zugänge zum Laufen bzw. zur Lauftherapie von Alexander Weber sicher nicht ganz leicht gefallen sein – aber: Klaus Richter, Raphael Richter und Wolfgang W. Schüler verfügen als langjährige Kollegen und befreundete Laufgefährten des Jubilars über exzellente Kenntnisse seines Schaffens und speziell seines weit verbreiteten Schrifttums. Wir dürfen daher sicher sein, dass es sich allemal um „typische“ Beiträge von Alexander Weber als Autor handelt.
Der Band „Lebensschule Laufen“ ist einfach, weil chronologisch gegliedert: Er beginnt mit einem Auszug aus dem (bisher unveröffentlichten) Lauftagebuch von Alexander Weber aus dem Jahre 1975. Es folgen 14 Beiträge aus den 1980er Jahren, sodann vier aus den 1990er Jahren, bevor es in das laufende Jahrtausend geht: Sieben Aufsätze sind zwischen 2000 und 2009 verfasst worden. Der Band schließt mit Veröffentlichungen aus dem Jahre 2013 und 2017. Zur weiteren bibliometrischen Vermessung dieses für den Band ausgewählten Schrifttums von Alexander Weber noch soviel: Es handelt sich sowohl um publizierte Zeitschriftenaufsätze als auch um Artikel aus Sammelbänden. Die Länge der Texte variiert von (mindestens) zwei Seiten bis (höchstens) 40 Seiten. Der Umfang der meisten Beiträge liegt jedoch (lesefreundlich portioniert) zwischen zehn und 20 Seiten. Die Lesefreundlichkeit des Bandes zeichnet sich aber auch noch dadurch aus, dass man die Aufsätze im Buch gerade nicht von vorn bis hinten streng der Reihe nach wie die Kapitel bei einem Roman lesen muss, sondern im Grunde überall mit der Lektüre einsteigen und sich beispielsweise dabei von Überschriften leiten lassen kann, um am Ende doch irgendwann alle 29 Beiträge mit Gewinn studiert zu haben. Sodann können wir uns selbst (wieder) gestärkt auf neue Streckenabschnitte unserer persönlichen „Lebensschule Laufen“ begeben. Der Jubilar Alexander Weber ist als unser Mentor immer dabei!
Ein Geleitwort hat nicht zwangsläufig die Aufgabe, alle Beiträge des Bandes im Einzelnen vorzustellen und anzumoderieren. Ich will daher stellvertretend wenigstens drei Texte etwas näher betrachten, weil ich dort Passagen gefunden habe, die mich persönlich jetzt in besonderer Weise berührt haben bzw. nachdenklich gestimmt haben. Gleich im ersten Text bin ich fündig geworden. Man muss sich nur einmal vor Augen führen: Da kommt ein Alexander Weber auf die Idee, von Dezember 1974 bis Dezember 1975 ein Lauftagebuch zu führen. Da schreibt dieser Alexander Weber damals ganz allein für sich am 6. April 1975 einen Eintrag, den wir nun im Buch nachlesen dürfen und der sich etwa so zusammenfassen lässt: Alexander entschließt sich um 17.35 Uhr in Dornumersiel zu einem Deichlauf und fühlt sich nach gewisser Zeit in eine Grundstimmung versetzt, die er als äußerst angenehm empfindet. Wenig später taucht im Tagebucheintrag (erstmals?!) der Begriff „Lauftherapie“ auf. Alexander Weber schwebt vor, dass es auf längere Sicht gelingen könnte, Menschen, die unter depressiven Stimmungen leiden, mit Laufen in mäßigem Tempo von ihrem Leiden zu befreien oder dieses zumindest zeitweilig zu lindern. Alexander nimmt sich vor, darüber in Zukunft vertiefter zu arbeiten … vorerst beendet er seinen Lauf nach 1:20 Std., bemerkt noch, dass er sehr locker gelaufen sei und nur einen Bruchteil von dem gerade niedergeschrieben habe, über das er während des Laufens nachgedacht hat. War das die heimliche Geburtsstunde des Deutschen Lauftherapiezentrums, das er erst später im März 1988 gründen sollte und dessen 1. Vorsitzender er bis heute ist?
Zum zweiten Text: Dass Laufen Menschen verbindet, gilt als trivial. Wenn Alexander Weber aber einen Beitrag unter der Überschrift „Laufen verbindet – Kommunikatives Laufen“ verfasst, dann dürfen wir durchaus tief schürfende Überlegungen, wenn nicht sogar eine programmatische Skizze darin erwarten, wie ein solches kommunikatives Laufen ausgestattet ist. Ich habe den Text aus dem Jahre 1986 jetzt wiederentdeckt. Zwei Aspekte möchte ich knapp herausgreifen, ganz abgesehen davon, dass in diesem Aufsatz (vermutlich erstmals) das Konzept des „Lauf-Encounters“ präsentiert wird, dessen Erfinder Alexander Weber mit seinen mehrtägigen Lauf-Workshops seit mehreren Jahrzehnten im Sommer an der Nordsee ist. Das kommunikative Laufen wird von Alexander Weber als „Körperarbeit in Form des langsamen Dauerlaufes mit hilfreichen Gesprächen“ definiert. Diese Gespräche können immer dann entstehen, wenn mehrere Personen zusammen laufen. Sie können aber auch als ein stilles Gespräch mit sich selbst vorkommen, wenn jemand ganz alleine läuft und in intensiver Selbstwahrnehmung seinem inneren Dialog folgt.
Meine Hypothese im Anschluss an diesen schönen Aufsatz von Alexander Weber lautet nun vorläufig und daher noch vorsichtig als Frage formuliert: Müssen wir das „kommunikative Laufen“ im Zeitalter sozialer Medien nicht längst erweitern und noch von einer ganz anderen Seite betrachten? Diese Entwicklung lässt sich durchaus kritisch bilanzieren und ebenfalls als Frage so präzisieren: Wie steht es denn eigentlich um diejenigen, die ihre sportlichen Aktivitäten – und zwar nicht nur, aber ausgerechnet auch die des Laufens – simultan oder sofort hinterher über ihre sozialen Medien in alle Welt posten und dazu noch auf Befragen angeben, dass sie eigentlich gar nicht so sehr wegen dieser ihrer „Eigen-Leistung“ (nach Lenk) körperlich aktiv seien, sondern nur deswegen, um diese ihre Leistung danach medial zu kommunizieren. Mit dem von Alexander Weber ursprünglich attestierten kommunikativen Laufen hat dies nicht mehr viel zu tun. Wenn wir es dennoch als ein kommunikatives Laufen bezeichnen, dann müssen wir auf jeden Fall hier eine Form von Instrumentalisierung des Laufens konstatieren.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Natürlich ist es und soll es weiterhin angezeigt sein, über seinen Sport und sein Laufen zu kommunizieren. Soziale Unterstützung tut uns allen dabei immer gut. Aber sie darf nicht der alleinige Grund zur Bewegung, zum Sport und erst recht nicht zum Laufen sein: Wer dabei nur an andere denkt, denen er damit gefallen möchte, um sich möglicherweise dann immerzu „liken“ zu lassen, der ist eben noch nicht bei sich selbst angekommen. Es gilt zuerst, das Laufen als Selbstwert zu erleben und für sich mehrwertig zu genießen. Darin liegt meiner Ansicht nach auch das pädagogische Fundament, wenn wir Menschen zum Laufen bewegen wollen. Welchen Stellenwert dabei die jetzt von mir sog. „aktive soziale Vergewisserung im virtuellen Resonanzraum“ haben sollte, darüber wird erst später zu entscheiden sein. Zuvor müssen wir das Phänomen als solches noch viel genauer inspizieren. Erst recht ist hier die Stimme von Alexander Weber als der Protagonist des „kommunikativen Laufens“ gefragt und gefordert …
Zum Schluss noch etwas persönliches und damit zum dritten Beitrag, zu dem ich hier im Geleitwort etwas notieren möchte: Ich durfte Alexander Anfang der 1980er Jahre sogar zweimal kennen lernen, zuerst als Autor und kurz danach den Läufer Alexander Weber. Und das ging ungefähr so: Als Mitarbeiter von Prof. Dr. Dietrich Kurz an der Abteilung Sportwissenschaft der Universität Bielefeld erhielt ich die Aufgabe, einen Text mit der Überschrift „Laufen – Motive und Wirkungen. Eine repräsentative Untersuchung an Volkslaufteilnehmern“ auf formale Stimmigkeit zu prüfen. Dazu musste ich den Beitrag allerdings selbst ganz und gründlich lesen. Dieser Text, der jetzt auch im Band enthalten ist, war von Alexander Weber zur Veröffentlichung in der Zeitschrift „Sportwissenschaft“ eingereicht worden, für die mein Chef damals redaktionell verantwortlich zeichnete. Abgesehen davon, dass es an dem Beitrag von Alexander Weber (so meine Erinnerung bis heute) formal gar nichts zu verbessern gab, hat mich seine Lektüre so angeregt, dass ich sofort danach selbst erstmal eine Runde laufen gegangen bin. Der Text ist meines Wissens die erste wegweisende empirische Studie ihrer Art mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Volksläufen in Deutschland gewesen und bis heute geblieben. Allerdings hat sich die Volkslaufszene seitdem stark verändert – die „Motive und Wirkungen“ der Läuferinnen und Läufer etwa auch?
Die zweite, persönliche Begegnung mit Alexander Weber als Läufer folgte wenig später: im Ziel beim Hermannslauf auf der Promenade vor der Sparrenburg in Bielefeld. Für das gemeinsame Laufen war Alexander damals viel zu schnell für mich. Deswegen kam es dann nur im Ziel bei heißem Tee zu einer kleinen Plauderei zusammen mit meinem damaligen Chef Dietrich Kurz, ebenfalls ein langjährig erfahrener Hermannsläufer. Diese verschwitze Begegnung ist inzwischen mehr als 30 Jahre her. Seitdem sind wir uns hin und wieder mal begegnet, haben sogar mehrfach (hand-) schriftlich korrespondiert. Wir haben uns seitdem nie ganz aus den Augen verloren. Ich durfte ihn als Leser seiner Beiträge und gelegentlich als Rezensenten seiner Laufbücher ein wenig begleiten. Nur gemeinsam gelaufen sind wir noch nie! Das holen wir, lieber Alex, jetzt bald nach – das ist mein Geschenk für Dich zum 80. Geburtstag: eine Einladung zu 80 gemeinsamen Minuten auf einer meiner Hausstrecken im Teutoburger Wald rund um Bielefeld – aber mit Start und Ziel an Deiner ersten akademischen Wirkungsstätte bis 1974 an der damaligen Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe in Bielefeld in der Lampingstraße neben der Rudolf-Oetker-Halle nahe der Alm, dem Dir bekannten Fußballstadion von Arminia Bielefeld. Ist das gebongt? Bis dahin, lieber Alexander: Herzliche Gratulation zum 80. Geburtstag und alles Gute für viele weitere Jahre in der Laufbewegung!
Prof. Dr. Detlef Kuhlmann, Institut für Sportwissenschaft, Leibniz Universität Hannover
Vorwort
Anlass für dieses Buchprojekt ist die Vollendung des 80. Lebensjahres von Prof. Dr. Alexander Weber am 25. Juni 2017. Es handelt sich um eine Festschrift besonderer Art, in der vor allem der Geehrte selbst zu Wort kommt.
Der Psychologe Alexander Weber hat im Laufe seiner Hochschultätigkeit zu verschiedenen Themenbereichen gearbeitet. Schwerpunkte seines Forschens, Lehrens und Publizierens sowie seines praktischen Wirkens in der Umsetzung bildeten und bilden das Lehrer- und Schülerverhalten, die Kleingruppenpädagogik und Angewandte Gruppendynamik, ferner das Stress- und Gesundheitserleben des Menschen – dieses insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeiten der (Selbst-) Erziehung und Therapie durch Laufen, eine besondere Form der Bewegungstherapie. Auf allen Gebieten hat Weber zahlreiche Beiträge in Büchern und Fachzeitschriften vorgelegt, jedoch mit der Lauftherapie offensichtlich sein persönlichstes Thema gefunden.
Weber war nicht daran interessiert, nur für „wissenschaftliche Schubladen“ zu arbeiten; stets suchte er Wege, seine Einsichten und Erkenntnisse einer größeren Öffentlichkeit zu vermitteln. Es überrascht deshalb nicht, dass er gemeinhin als „Laufprofessor“ bezeichnet und geschätzt wird. Zugespitzt könnte man sagen: Ohne ihn gäbe es keine Lauftherapie im heutigen Verständnis.
Alexander Weber ist es gelungen, gesundheitsorientiertes Laufen zu einem systematischen Behandlungsansatz zu entwickeln, der unter dem Begriff „Paderborner Modell der Lauftherapie“ bekannt geworden ist. Es ist sein Verdienst, „Laufen als Therapie“ lehr- und lernbar gemacht zu haben. An dem von ihm 1988 gegründeten Deutschen Lauftherapiezentrum (DLZ) wurden bis heute mehr als 700 Personen als Laufgruppenleiter/innen, Laufpädagogen/innen und Lauftherapeuten/innen ausgebildet. Viele von ihnen sind im Gesundheitsbereich in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Luxemburg tätig.
Um Webers Weg zum Laufen als Therapie nachzuzeichnen, haben wir aus seinem umfangreichen Bestand an Publikationen solche ausgewählt, die beispielhaft den Erkenntnisfortschritt und Entwicklungsgang dokumentieren. Als Ordnungsmerkmal dient deren zeitliche Abfolge aus über vier Jahrzehnten. Einzelne Themenbereiche werden durch mehrere Publikationen dokumentiert. Bei teilweise inhaltlicher Gleichheit findet das Spezifische im Hinblick auf die jeweilige Leserschaft seinen besonderen Ausdruck. Ergänzend wurden zwei bisher nicht veröffentliche Beiträge mit aufgenommen.
Hiermit wird erstmals ein Kompendium der Weberschen Publikationen vorgelegt, die als Einzelbeiträge sonst zum Teil nur schwer zugänglich sind. Allen, die sich umfänglicher über „Laufen als Therapie“ informieren wollen, möge dieses Buch als grundlegende Quelle dienen. Für an der Forschung und Praxis der Lauftherapie Interessierte sollte es Pflichtlektüre sein.
Unser besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Detlef Kuhlmann für sein erwärmendes Geleitwort. Allen Rechte-Inhabern danken wir für die freundliche Bereitschaft, unser Vorhaben durch weitgehend kostenfreie Abdruckgenehmigungen zu unterstützen. Unseren Lesern/innen wünschen wir Freude und Erkenntnisgewinn an der Lektüre. Alexander Weber gratulieren wir zu seinem besonderen Geburtstag und wünschen ihm Gesundheit und Schaffenskraft für seine vielfältigen Aktivitäten.
Klaus Richter
Raphael Richter
Wolfgang
W. Schüler
(Menden)
(Münster)
(Wiesbaden)
Prof. Dr. Alexander Weber – Person und Werk im Kontext der Lauftherapie
von Wolfgang W. Schüler und Klaus Richter
Vom Laufen im Selbstversuch gelangte Alexander Weber zur Laufforschung, von der Laufforschung zur lauftherapeutischen Praxis und deren Vermittlung. Kein anderer im deutschsprachigen Raum hat das Feld der Lauftherapie so initial, umfassend und systematisch bearbeitet wie er. Was ihm anfangs Idee war, ist heute allgemein anerkannte und verbreitete Praxis im Dienst der Gesundheit.
Weber fand Ende der 1960er Jahre zum regelmäßigen Laufen – seiner Gesundheit zuliebe. Im Kontext dieser Erfahrungen erfand er 1975 den Begriff „Lauftherapie“, wie in seinem damaligen – bisher unveröffentlichten – Lauftagebuch nachzulesen ist. Das Laufen hat ihn geprägt, er wiederum prägte das Laufen. Wer die Folgejahre bzw. –jahrzehnte Revue passieren lässt, der erkennt eine erstaunliche Konsequenz des Tuns und Geradlinigkeit der Entwicklung.
Durch Laufen können Prozesse der Selbsttherapie in Gang gesetzt werden. Zu dieser Annahme kam der inzwischen als Professor an die Universität/Gesamthochschule Paderborn Berufene auch durch Berichte anderer Personen. In den von ihm zwischen 1975 und 1980 durchgeführten Wochenendseminaren zur „Psychologie des Laufens“ ging er diesen und weiteren Spuren nach. Aus den Seminaren entwickelte er die Idee und Konzeption des „Lauf-Encounter“, einer Selbsterfahrungsgruppe für Läufer/innen – ein Angebot, das er bis heute vorhält.
Das Anliegen, die Erfahrungen einzelner Läufern/innen an einer großen Personenzahl zu überprüfen führten ihn und Mitarbeiter/innen 1979/1980 zur Durchführung einer Befragung von Volkslaufteilnehmern/innen. Diese zeigte: Die große Mehrheit der Untersuchten zieht aus dem Laufen u. a. einen nicht zu unterschätzenden gesundheitlichen Gewinn.
Der Gedanke drängte sich ihm auf: Wenn Laufen als Möglichkeit der Selbsttherapie wirksam werden konnte, sollte es auch als professionelle Methode zur Behandlung körperlicher und seelischer Beeinträchtigungen nutzbar sein. Ermutigt durch erste, optimistisch stimmende Untersuchungen in den USA und in Kanada führte er – leitend – ein Forschungsprojekt an einer Suchtklinik durch. Als Ergebnis zeigte sich, dass Alkoholabhängige, die laufen, im Vergleich zu denen, die „nur“ herkömmlich behandelt werden, bedeutsam mehr profitieren.
Das dafür entwickelte Laufprogramm und Untersuchungsinventar wurden dann auch bei anderen Zielgruppen eingesetzt: bei Hausfrauen, berufstätigen Frauen, berufstätigen Männern, Psychosomatiker-Gruppen. In den Ergebnissen fand Alexander Weber weitgehende Übereinstimmung: Die Läufer/innen fühlten sich nach der Laufbehandlung vitaler, leistungsfähiger, im Ganzen gesünder; sie waren weniger häufig krank und in besserer seelischer Verfassung.
Mit Gleichgesinnten gründete Weber ein eigenes Institut, das „Zentrum für Lauftherapie (ZfL)“ – alsbald in „Deutsches Lauftherapiezentrum (DLZ)“ umbenannt. Als Aufgaben wurden vereinbart, die prophylaktischen und therapeutischen Möglichkeiten des Laufens praktisch zu erproben (regionale Durchführung von Lauftherapiekursen), systematisch zu sichten (wissenschaftliche Begleitung der Kurse) und in geeigneter Weise an Patienten und Angehörige der verschiedenen Heil- und Sozialberufe zu vermitteln (Ausbildung von Kursleitern/innen). Interviews, Vorträge, Seminare / Workshops, Fachpublikationen und die Herausgabe der institutseigenen „DLZ-Rundschau“ rundeten das öffentliche Auf- und Eintreten für die Sache ab.
Als Vorsitzender und Leiter der Aus- und Weiterbildung gab Weber im April 1991 den Startschuss für die Ausbildung von Lauftherapeuten/innen. Grundlage dafür bildeten die von ihm und Mitarbeitern/innen erarbeiteten Ausbildungsrichtlinien. Ein interdisziplinär einberufenes Dozententeam führte in die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden ein mit dem Ziel, die Kursanten zu verantwortlichem lauftherapeutischem Handeln zu befähigen.
Als wissenschaftlicher Leiter des Bad Lippspringer Symposiums „Gesundheitsförderung durch Lauftherapie“ führte Weber 1997 durch ein viertägiges Kongressprogramm, welches die Erträge seiner bzw. der DLZ-Arbeit sowie die engen Verbindungen und Vernetzungen mit Bereichen, die sich ergänzen und gegenseitig in der Wirksamkeit unterstützen, deutlich machte und praxisnah darstellte. Die einzelnen Beiträge finden sich in dem von ihm herausgegebenen 350 Seiten starken Kongressband „Hilf dir selbst: Laufe!“ (Paderborn 1999).
Mit dem Forschungsprojekt „Systemische Lauftherapie in drei Stufen“ erweiterte er 2005 das bisherige Lauftherapieprogramm um Bereiche, die eine Verhaltensänderung in Richtung einer (ganzheitlichen) Veränderung des Lebensstils erleichtern. Neu im Ausbildungsprogramm fand sich die Fortbildung zum/zur „Laufgruppenleiter/in“, die erfolgreich durchgeführt wurde und sich in den Folgejahren etablieren sollte.
2007 formulierten Weber und die Herausgeber einen Entwurf zur Ausbildung von „Laufpädagogen/innen“, welche in das neue Konzept eines 3stufigen Ausbildungssystems (Laufgruppenleiter/innen, Laufpädagogen/innen und Lauftherapeuten/innen) einging. Ein Jahr später wurde beides umgesetzt.
In noch frischer Erinnerung ist die zweitägige Fachtagung „Lauftherapie in Lebenswelten“, die im Oktober 2016 in der neuen Hochschule für Gesundheit in Bochum zusammen mit der Krankenkasse VIACTIV durchgeführt wurde. Es ging darum, „Chancen und neue Wege für die Gesundheitsförderung“ vorzustellen und zu diskutieren.
Im Übrigen gelten die Worte Schillers: „In dem Heute wandelt schon das Morgen“. So wirft das Jahr 2018 bereits seine Schatten voraus. In ihm wird Alexander Weber auf 30 Jahre Deutsches Lauftherapiezentrum, er selbst auf 50 Jahre Läuferleben zurückblicken können. Wer ihn kennt, weiß um seine kreative Unruhe und dass das letzte Wort über die Entwicklungen am DLZ noch lange nicht gesprochen ist. Und ist er erst einmal von einer Idee überzeugt, dann treibt er sie zügig, aber ohne übertriebene Aufgeregtheit voran, nicht ohne vorher in Einzelgesprächen „Bundesgenossen“ zu suchen. Wer ihn in solchen Gesprächen erlebt, wird das Gefühl nicht los, dass die Lauftherapie ihre eigentliche Geschichte noch vor sich hat.
Grundlegende Texte Alexander Webers zur Lauftherapie
zusammengestellt von Klaus Richter und Raphael Richter
Auf zwei Sachverhalte machen wir aufmerksam:
In den nachfolgenden Texten haben wir die zeitlich jeweils gültigen Rechtschreibregeln beibehalten.
An das Ende der Beiträge haben wir als Exkurs zwei Texte angefügt, die nicht im direkten Zusammenhang mit der Weberschen Lauftherapie stehen.
Alexander Weber schrieb 2002 über den US-amerikanischen Arzt und Laufphilosophen George Sheehan, der für ihn vorbildhaft die Sinnfragen des Laufens beantwortet hatte.
Im anderen Exkurs stellt sich Weber als Läufer bei einem seiner Lieblingsläufe vor, dem „Hermannslauf“.
Lauftagebuch. Laufen im Jahresrhythmus – aufgezeichnet vom 25.XII.1974 – 21.XII.1975
von Alexander Weber (1975)
Unveröffentlichtes Manuskript, S. 67-71
6.IV.1975 Dornumersiel
16 km, 17.35 - 18.55 Uhr
(Deichlauf, Dornumersiel - Bensersiel)
5 Grad Celsius
Kurz entschlossen streife ich am späten Sonntagnachmittag meinen Trainingsanzug über, weil morgen aus familiären Gründen nicht die Möglichkeit des Laufens gegeben sein wird.
Der mit dem anlaufenden Wasser langsam stärker werdende Nordwestwind ist beim Beginn des Laufens, während der Aufwärmphase, am unangenehmsten, weil die Beinmuskulatur noch nicht locker ist und sich der Kreislauf erst allmählich auf eine höhere Belastung einstellt. Aber es dauert nicht lange, bis ich mich angepaßt habe und den kühlen Seewind nicht mehr als störend empfinde. Meine Laufgeschwindigkeit dosiere ich wieder ganz bewußt, und zwar so, daß ich ruhig ein- und ausatmen kann und jederzeit das Gefühl habe, deutlich unter meinem derzeitigen läuferischen Vermögen zu bleiben. Bei solcher Art von Dauerlauf bin ich wirklich entspannt. Ich fühle mich nach einer gewissen Zeit des Laufens fast immer in eine Grundstimmung versetzt, die ich als äußerst angenehm empfinde. Das mag nicht nur allein auf die Tatsache des andauernden, gelösten Laufens zurückzuführen sein. Da spielen sicher noch andere Variablen eine Rolle, wie beispielsweise das Naturerleben, das Gefühl der Weite u.a.
Doch das Laufen an sich, in dem hier gemeinten Sinne, ist primär der wesentliche Faktor, der diese von mir so angenehm empfundene seelische Gestimmtheit positiv beeinflußt. Aus vielen Gesprächen mit Bekannten, die ebenfalls regelmäßig den Dauerlauf betreiben, weiß ich, daß sie Ähnliches in dieser Richtung erleben. Leider ist bisher auf diesem speziellen Gebiet noch kaum wissenschaftlich mit Hilfe objektiver und experimenteller Methoden gearbeitet worden. Ich stelle mir gut vor, daß bei den vielen Menschen, die heutzutage in irgend einer Form unter depressiven Verstimmungen leiden, ein großer Teil davon mit einer Art „Lauftherapie“ - diese wiederum in Verbindung mit anderen geeigneten therapeutischen Verfahren - auf längere Sicht erfolgreich behandelt werden könnte. Wenn ich nicht schon so häufig diese auffällige und eindeutige Stimmungsveränderung in konstant einseitiger Richtung, und zwar stets zur verbesserten, gehobeneren, angenehmeren Grundstimmung im Vergleich zu vorher, während und nach meinen vielen Läufen in den letzten sechs Jahren an mir selbst erlebt hätte, ich würde dieses zentrale und wichtige Thema nicht immer wieder aufgreifen. Sollte es sich als richtig erweisen, daß auch andere Menschen außer mir und den wenigen, die ich kenne und die mir berichtet haben, allein durch langes, ausdauerndes Laufen in mäßigem Tempo in ihrer psychischen Verfassung eine deutlich empfundene, positive Veränderung erfahren, dann sollte das eigentlich Konsequenzen haben, die zur Zeit noch gar nicht abzuschätzen sind. Über diesen Themenkomplex werde ich vermutlich noch in Zukunft vertieft nachdenken und eine Reihe von Gesprächen führen. Mit vielen verschiedenen, kompetenten Leuten sollte ich sprechen, freilich nicht mit jenen, die ihr Ziel allein darin sehen, den Absatz von Psychopharmaka, wie z.B. auch der sogenannten Happy-Pills oder Glückspillen, zu steigern. Als ich vor nunmehr gut vier Jahren an mir selbst eine Art Existenzkrise erlebte, die ich heute auf ein vorangegangenes, strapaziöses Arbeiten ohne Rücksicht auf den zur Verfügung stehenden Kräftehaushalt zurückführe, da hätte ich sicherlich nicht so schnell und komplikationslos aus eigener Kraft aus ihr herausgefunden, wenn ich nicht schon damals das Mittel des Dauerlaufs quasi als Eigentherapie eingesetzt hätte. In dieser Zeit ist mir eigentlich erst so recht bewußt geworden, was für mich das regelmäßige Dauerlaufen außer der Freude an der körperlichen Bewegung und den damit verbundenen Annehmlichkeiten, die jeder kennt, der Freizeitsport in der einen oder anderen Form praktiziert, auch noch oder darüberhinaus vermitteln kann. So ist es vielleicht zu verstehen, daß das Laufen in meinem Leben einen relativ hohen Stellenwert eingenommen hat. Früher, bis zu meinem 32. Lebensjahr etwa, habe ich es mir nicht nehmen lassen und darin auch ein besonderes Vergnügen gesehen, regelmäßig den Stammtisch im Wirtshaus aufzusuchen. Da wurde dann mit guten Bekannten vermeintlich Wichtiges geredet, reichlich gegessen und oftmals auch beträchtlich alkoholischen Getränken zugesprochen. Ich will jetzt dieser Facette des Lebens in gar keiner Weise Abbruch tun, indem ich dieser Art von Entspannung keinen Wert beimesse. Wenn mir genügend Zeit zur Verfügung stünde, würde ich heute wahrscheinlich auch noch Gefallen an solchen gesellschaftlichen Zusammenkünften finden. Nur habe ich diese Zeit zusätzlich nicht, und neben Familie und beruflicher Tätigkeit, die mir, was ich sehr begrüße, eine relativ große Freiheit des zeitlichen Disponierens gewährt, bleibt mir als Ausgleich und Möglichkeit des Kräftesammelns in der Hauptsache nur der Laufsport. Das sage ich ganz und gar ohne einen Unterton des Bedauerns, weil ich gut auf andere Formen der Freizeitbeschäftigung verzichten kann solange mir die Chance gegeben bleibt, den Dauerlauf durchzuführen, und sei es nur einmal wöchentlich, wie zu bestimmten Zeiten verstärkten beruflichen Einsatzes. Hinzu kommt, daß ich ein ausgesprochener Abend- und Nachtmensch bin, was bedeutet, daß ich in den Abend- und Nachtstunden am produktivsten arbeite. Tagsüber schaffe ich gewöhnlich nur Routinearbeiten-, Ideen produzieren und schöpferisch arbeiten, das gelingt meistens nur in den letzten Stunden des Tages.
Meinen Lauf heute beende ich nach einer Stunde und zwanzig Minuten, ca. 16 km bin ich sehr locker gelaufen. So zeigt es mir wenigstens mein Gefühl. Während des Laufes habe ich über viele Dinge nachdenken können. Einiges davon, einen Bruchteil, habe ich gerade niedergeschrieben. Mein Pulsschlag unmittelbar nach Laufende beträgt 116 p.m., ein Zeichen von nicht allzu großer Belastung an diesem Sonntagabend, über den jetzt die Dämmerung mit Macht hereingebrochen ist.
„Ich fühle mich unglaublich wohl“ - Warum Läufer laufen. Eine Untersuchung der Motive von Gewohnheits-Läufern
von Alexander Weber (1981)
aus: PSYCHOLOGIE HEUTE, 8. Jg., H. 8, S. 38-41
Die Zahl der Freizeit-Läufer in der Bundesrepublik wächst ständig. Drei Millionen, so wird geschätzt, traben, joggen, laufen. Dazu gehören Gelegenheitsund Gesundheitssportler ebenso wie „Überzeugungstäter“, für die das Laufen ein fester Bestandteil ihres Lebensstils geworden ist. Viele der Läufer nehmen an den sogenannten Volksläufen teil - 1980 haben nach meinen Schätzungen eine halbe Million bei diesen Lauf-Veranstaltungen mit Wettbewerbscharakter mitgemacht. Bei dieser Gruppe regelmäßig laufender Menschen haben wir eine Untersuchung durchgeführt, um etwas über ihre Motivstruktur zu erfahren.
Wir wissen viel über die körperlichen Effekte des Dauerlaufens, aber noch zu wenig über die psychische Seite. Zwar ist inzwischen gesichert, daß regelmäßiges und ausreichend intensives Laufen Stimmungen und Gefühle beeinflussen kann. Deshalb ist auch kaum anzunehmen, daß jemand längere Zeit und intensiv läuft, „nur“ um fit zu bleiben oder sein Körpergewicht zu kontrollieren. Wenn das so wäre, dann hätten all die Kolumnisten, Satireschreiber und Kritiker recht, die im Laufen den Kampf „um die körperliche Bestform für den Konkurrenzkampf im Alltag“ sehen (Ludwig Harig im Zeit-Magazin). Die Läufer würden dann der Trimm-Dich-Ideologie aufsitzen und sich der „heiligen Verpflichtung“ zur Fitneß unterwerfen. Daß dem nicht so ist, zeigen die Resultate unserer Untersuchung.
Wir haben bei Volkslauf-Veranstaltungen in den letzten beiden Jahren 900 Fragebögen verteilt unter den Teilnehmern und um Rücksendung im beigefügten Freiumschlag gebeten. Die Auswahl der Befragten war zufällig. In etwa 40 Minuten konnte man den siebenseitigen Fragebogen ausfüllen. 559 Läufer schickten uns ihre ausgefüllten Bögen zurück, davon 443 Männer und 116 Frauen. Das entspricht ziemlich genau der Geschlechterverteilung bei den Volksläufen. Das Durchschnittsalter der Läufer lag bei 38 Jahren, die wöchentliche Lauf-Zeit betrug über sechs Stunden. Dabei legten die Männer im Schnitt 37 Kilometer zurück, die Frauen 26,5. 94 Prozent aller Befragten sahen im Laufen einen festen Bestandteil ihrer Freizeitgestaltung.
Hier noch einige Daten, die unsere Stichprobe charakterisieren: Aus Körpergröße und Gewicht konnten wir das „Normalgewicht“‘ der Läufer errechnen (Körpergröße in cm minus 100). Für die Männer lag das bei 76 kg, für die Frauen bei 64,2 kg. Die tatsächlichen mittleren Werte lagen mit 71,5 kg (Männer) und 57,3 kg (Frauen) beträchtlich unter dem Norm-Gewicht.
Nach dem Mikrozensus von 1978 sind 34 Prozent der Bevölkerung im Alter über 10 Jahre Raucher, in unserer Stichprobe nur 4,7 Prozent. Mit zunehmender Laufpraxis nimmt die Häufigkeit des Rauchens noch mehr ab; viele Läufer erklärten, daß ihnen das Laufen beim Abgewöhnen des Rauchens geholfen habe.
Jeder Sozialwissenschaftler, der sich aus wissenschaftlich begründeter Neugier mit Läufern beschäftigt, wird - wie ich - die angenehme Erfahrung machen, daß er es mit Probanden zu tun hat, die gern bereit sind, über sich, ihre Lauferfahrungen und -erlebnisse zu berichten. Läufer betreiben im allgemeinen ihr Hobby mit großer Hingabe, ja Leidenschaft. Dies mag zu einem gut Teil erklären, warum sie, häufig mit geradezu missionarischem Eifer, auf Fragen im Zusammenhang mit Laufen so bereitwillig Auskunft geben. Und sie wollen wissen, was andere Menschen - Nicht-Läufer, aber auch Wissenschaftler, oder Ärzte - vom Laufen halten, wie sie es einschätzen und beurteilen.
Die über 40000 Einzeldaten unseres Fragebogens haben wir in beschreibenden Statistiken und mit Hilfe der sogenannten Faktorenanalyse und der mehrfaktoriellen Varianzanalyse verarbeitet. Dabei schälten sich sieben Faktoren heraus, die relativ stabil für alle Gruppen waren und die Einblick in die Motiv-Struktur der Läufer erlauben. Schon die Durchsicht der einzelnen Fragebögen war aufschlußreich - die meisten sind sehr stark individuell geprägt, sind voll von Anmerkungen und originellen Kommentaren. Ein Leitmotiv durchzieht alle Äußerungen: Wenn ich mit einem Begriff ausdrücken müßte, was regelmäßiges Laufen bewirkt, dann wäre das Veränderung. Schon nach wenigen Jahren des Laufens verändern sich viele Lebensbereiche. Der Läufer verändert sein Bewußtsein, er bekommt eine andere Körpergestalt, ändert Eß- und Trinkgewohnheiten, und vor allem verändert sich sein Lebensgefühl.
Freilich - die Entwicklung dieser Veränderungen verläuft unterschiedlich in bezug auf Zeit und Tiefe, aber sie findet in jedem Fall statt. Die tiefgreifenden Veränderungen werden von den Läufern fast immer wahrgenommen, nicht selten auch geradezu erwartet. Laufen führt anscheinend zwangsläufig zu neuem Erleben und zu einer anderen Lebensweise. Und es gibt nach meinen Eindrücken nur wenige Läufer, die davon nichts an sich selber bemerken. „Für mich bedeutet Laufen“, schreibt ein 43jähriger lapidar, „Physio- und Psychotherapie“. Dieser Satz kann stellvertretend für fast alle Läufer stehen.
Die nachfolgend aufgeführten Faktoren bilden jenes Motivbündel, das Menschen zum Laufen veranlaßt und immer wieder neu inspiriert:
- Seelisches Gleichgewicht
- Vitalisierung
- Selbstgefühl
- Äußere Erscheinung
- Gesundheit/Fitneß
- Geselligkeit
- Ausgleich zum Berufsalltag
Diese Faktoren sind weitgehend unabhängig voneinander, ich will sie nachfolgend nach meinem Verständnis kurz beschreiben.
Seelisches Gleichgewicht: Dieser Faktor bildet ein starkes Motiv fürs Laufen und ist vergleichsweise weitaus dominanter als etwa das Motiv „Fitneß“. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gewinnt mit zunehmender Laufpraxis und -intensität dieses Motiv noch an Stärke. Für den geübten Läufer gibt es kein besseres Entspannungsmittel als eben Laufen. Seine Erwartungen findet er durch die Ergebnisse seiner Laufaktivitäten ja auch stets erneut bestätigt. Weil Laufen seelisch so hervorragend entspannt, stellt sich nach jedem Lauf ein Wohlgefühl ein, das sehr bewußt wahrgenommen und hoch eingeschätzt wird. „Ich fühle“, berichtet ein Läufer, „Entspannung im Kopf, Müdigkeit in den Beinen“. Ein anderer: „Einer meist nur leichten körperlichen Erschöpfung steht ein seelisches Hochgefühl gegenüber. Ich fühle mich unglaublich wohl.“ Laufen bringt Traurigkeitsgefühle zum Verschwinden, läßt Ärger und Wut abklingen, macht den Kopf frei, befreit von Zwängen. „Meine Gedanken schweifen ungehindert durch Laufen ab.“ „Ich träume oft beim Lauf.“ Ein 37jähriger formuliert: „Ich bin gelöst, entkrampft, der Welt entrückt, den Realitäten entflogen.“ Eine 46jährige drückt sich so aus: „Seelische Verkrampfungen lösen sich im Schweiße auf.“ In anderer Wendung lautet die Umschreibung so: „Das Laufen befreit mich von innerem Druck und gibt mir ein freieres Gefühl.“ - Daß Laufen ein wirksames Mittel gegen reaktive Depressionen ist, wurde wiederholt in experimentellen Studien nachgewiesen. In unserer Untersuchung berichtet eine 56 Jahre alte Läuferin, „durch den plötzlichen Tod meines Mannes bin ich auf das Laufen gestoßen“, und durch Laufen habe sie ihr seelisches Gleichgewicht wiederherstellen können.
Vitalisierung: Beim Laufen werden Körperfunktionen zu erhöhter Leistung angeregt, aktiviert, der Stoffwechsel beschleunigt. Das bleibt nicht ohne Einfluß auf Gefühle und Verhalten. Laufen hält das Leben in Gang, treibt es an. Laufen macht lebendiger und erhöht das Energiepotential. Und weil Laufen mit Mühe und körperlicher Anstrengung verbunden ist, wird es vermutlich als lustvoll erlebt. Die durch Laufen erzeugten Körpergefühle lassen „häufig nichts als Freude“ empfinden, wie ein Läufer sich ausdrückt. Eine 46jährige Läuferin „fühlt sich insgesamt aktiver“. Andere berichten von „verfeinerter Sinneswahrnehmung“, von Intensivierung der „Geschmacks- und Geruchssinne“, auch von „Konzentrationssteigerung bei geistiger Arbeit“ und von „Glücksgefühlen“. Ein 43jähriger Akademiker, der seit zehn Jahren läuft und wöchentlich 60 km absolviert, schreibt: „Mein Lebensgefühl ist stärker geworden. Ich staune immer, wie alt ich schon bin!“ Die allgemeine Vitalisierung durch regelmäßiges und ausreichend langes Laufen wird besonders deutlich von Menschen erlebt, die die Lebensmitte erreicht oder bereits überschritten haben. Ein 48jähriger: „Ich erlebe intensives Pulsieren des Blutes, ein sich weit öffnendes körperliches Gefühl, das ich als angenehm empfinde.“ - Laufen steigert Lebensfreude und -lust, macht den Menschen energievoller und erhöht die Genußfähigkeit. Die sexuelle Aktivität ist von der generellen Vitalisierung konsequentermaßen nicht ausgeschlossen. Insbesondere Läuferinnen und Läufer, die das 4. Lebensjahrzehnt überschritten haben, wissen ihr (gesteigertes) sexuelles Potential gut und realistisch einzuschätzen. Wie sie mit ihren neu gewonnenen sexuellen Energien umgehen, hängt wesentlich von den jeweiligen, individuell verschiedenen Wertvorstellungen ab. Mehr als ein Drittel unserer Befragten berichtet von bedeutsam gestiegener sexueller Aktivität, nur knapp zwei Prozent sind der Ansicht, daß Laufen das sexuelle Energieniveau eher gesenkt habe.
Selbstgefühl: Laufen verbessert das Selbstgefühl. Jeder, der läuft, bekommt die eigene Leistungsfähigkeit leicht nachweisbar attestiert. Das trifft gerade auch auf die Anfänger zu, denn die Fortschritte sind zu Beginn, im ersten und zweiten Jahr des Laufens, besonders eindrucksvoll. Diese Erkenntnis ist nicht neu und durch eine Reihe empirischer Studien wissenschaftlich belegt. Bereits einfache sportliche Aktivitäten, wie ein täglicher Lauf von nur zehn Minuten, sind „nachweislich förderlich für die seelische und körperliche Funktionsfähigkeit, so zum Beispiel für die Zunahme der Selbstachtung“ (so Reinhard Tausch in seinem Vortrag auf dem Weltkongreß der Psychologie 1980).
Daß Laufen generell das Selbstwertgefühl steigert, zeigt aufgrund unseres Materials nicht nur die entsprechende Dimension in der Faktorenanalyse (sehr hohe Ladungen auf den korrespondierenden Variablen), sondern auch die Auswertung frei geäußerter Meinungen. Beispiele: „Nach jedem Lauf (habe ich) das Gefühl etwas geleistet zu haben“ (Mann, 40 J.); „Ich bin stolz, daß ich etwas geschafft oder geleistet habe, vielleicht ein Glücksgefühl“ (Mann, 51 J.); „Das Laufen befreit mich von innerem Druck und gibt mir ein freieres Gefühl - eine Bestätigung mir selbst gegenüber“ (Student, 23 J.).
Die entscheidenden Wirkungen
gehen von der
Veränderung der Lebensgewohnheiten aus,
nicht vom Laufen selbst
Äußere Erscheinung: Sich viel bewegen, sich richtig und maßvoll ernähren das sind zwei wichtige Dinge, die dazu beitragen, den Menschen „jung“ zu halten und „gut“ aussehen zu lassen. Für viele würde allein das Motiv „äußere Erscheinung“ stark genug sein, um die Freizeitbeschäftigung Laufen aufrechtzuerhalten.
Übergewichtige Menschen, die sich entschlossen haben, Läufer zu werden, werden nicht allein dadurch schon zu normalgewichtigen oder sehr schlanken Menschen. Sie müssen auch ihre Lebensweise im Essen und Trinken ändern. Das Laufen hat hierbei eine nur unterstützende Funktion. Wirksamer für Gewichtsregulierung und äußeres Erscheinungsbild sind die indirekten Wirkungen des Laufens: das Bewußtsein, jedes Kilogramm zuviel behindert den Bewegungsablauf; die „natürliche Freßbremse“, die mit Laufen einhergeht; die Stimulierung durch kleine Erfolge im körperlichen Selbstformungsprozeß und so weiter. Man muß Kurz zustimmen, der sagt: „Die relativ bedeutenderen Wirkungen gehen also von der allgemeineren Veränderung der Lebensgewohnheiten und des Körpergefühls aus - nicht vom Laufen selbst“. - Wir befragten unsere Probanden auch nach Veränderungen im Hinblick auf das Körpergewicht seit Aufnahme der regelmäßigen Laufaktivität. Bei der überwiegenden Mehrheit der Läufer/innen ist festzustellen: die teilweise recht drastische Gewichtsreduktion erfolgt in den ersten beiden Jahren nach Aufnahme des regelmäßigen Laufens. Sobald der Laufanfänger in der Lage ist, ein wirklich anstrengendes und kalorienverzehrendes Laufprogramm durchzuhalten, speckt er/ sie ab. Eine Auswahl wörtlicher Aussagen zum Faktor „äußere Erscheinung“: „Gewichtsreduzierung ohne Probleme“ (Mann, 37 J.); „Sehr bedacht auf Körpergewicht, ausgewogene Ernährung“ (Mann, 33 J.); „Ich bemühe mich, weniger zu essen“ (Frau, 39 J.); „Nach und nach ‚verkörpert‘ sich der Körper, z.B. kein dickes Gesicht, kein dicker Bauch, kein Hüftspeck“ (Mann, 41 J.); „Esse und trinke bewußter“ (Mann, 40 J.); „Schönere Haut, bessere Figur“ (Frau, 26 J.); „Aussehen besser, Teint, Figur und Ausdruck“ (Frau, 47 J.).
Gesundheit/Fitneß: „Gehen Sie noch mehr auf Krankheitsbilder ein“, schreibt ein 49jähriger Werkzeugmechaniker, der seit sieben Jahren regelmäßig läuft und etwa 50km wöchentlich absolviert. „Sie werden sich wundern, wie viele von den Leuten, die heute laufen, vorher gesundheitlich angeknackst waren.“ Dieser Mann liegt mit seiner Einschätzung grundsätzlich richtig. Unser Material enthält dutzendweise Hinweise auf seine Vermutung. Der geübte, fortgeschrittene Läufer bezieht zwar die primären Antriebe zum Laufen nicht aus Überlegungen und Einsichten im Zusammenhang mit der Erhaltung oder Wiedererlangung von Gesundheit und Fitneß. Dennoch spielen gesundheitliche und konditionelle Aspekte eine bedeutende Rolle bei der Frage nach dem Wozu des Laufens. Läufer/innen sind aufgeschlossen, sensibel für Vorgänge im eigenen Körper. Sie achten im allgemeinen auf das, was in ihrem Körper geschieht. Sie hören in sich hinein, erkennen frühzeitig negative Signale und reagieren entsprechend darauf. Ein sehr wichtiges therapeutisches Mittel, um die volle Gesundheit und die wünschenswerte Fitneß zu erhalten oder wieder zu erreichen, stellt für sie das Laufen dar. Dieses Mittel - wenn erst einmal richtig erprobt - verordnen sie sich selbst und dosieren es in freier Eigenverantwortung. Die dabei erzielten Erfolge werden nicht ohne Stolz vorgetragen. - Beispiele: „Alle meine Herz- und Kreislaufwerte sind verbessert. Ruhepuls stark herabgesetzt“ (Mann, 51 J.); „Selbst Kopfschmerzen können zum Abklingen gebracht werden“ (Mann, 28 J.); „Laufen war wichtiger Beitrag zur Rekonvaleszenz“ (Mann, 43 J.); „Ich komme mit weniger Schlaf aus und bin allgemein leistungsfähiger“ (Mann, 31 J.); „Beginnende Arthritis ist verschwunden“ (Frau, 42 J.); „Ich litt lange Jahre an Bluthochdruck - jetzt wieder normal“ (Mann, 38 J.).
Weil Läufer großen Wert auf die volle körperliche Funktionsfähigkeit legen, sind sie im Umgang mit Alkohol eher zurückhaltend. Wer vor Aufnahme des regelmäßigen Laufens Raucher war, wird den Nikotinkonsum früher oder später ganz einstellen. Die Drogen Alkohol und Nikotin können durch ausreichend intensives Laufen anscheinend leicht kompensiert werden.
Geselligkeit: Dem Faktor „Geselligkeit“ kommt beim Laufen eine Bedeutung zu, wie wir sie zunächst nicht vermuteten. „Laufen ist eine sehr individuelle sportliche Angelegenheit - soziale Kontakte sucht man anderswo!“ Das muß nun zumindest bezweifelt werden. In der Faktorenanalyse hat die entsprechende Variable „Ich betreibe das Dauerlaufen, weil ich die Geselligkeit mit andern habe“ eine relativ hohe Ladung (.63). Auf die Frage „Laufen Sie lieber allein oder mit Partnern?“, antworteten 37 Prozent der Probanden mit „lieber allein“, 52 Prozent mit „lieber mit Partnern“, der Rest machte keine Angaben. Daraus darf man schließen, daß beim Laufen Begegnungen durchaus gesucht werden. Die Freizeitaktivität Laufen kann dazu beitragen, Freundschaften zu schließen, den Hunger nach mitmenschlichen Kontakten zu befriedigen. Ein 40jähriger berichtet: „Laufen bedeutet für mich eine nicht mehr wegzudenkende Freizeitgestaltung, die ... mich mit anderen Menschen zusammenführt. Bei nervlichen und seelischen Problemen laufe ich allerdings lieber allein.“ Eine 46jährige: „Durch Laufen habe ich noch mehr aktive Freunde gewonnen.“
Ausgleich zum Berufsalltag: Die entsprechende Frage lautet im Fragebogen: „Ich betreibe das Dauerlaufen, weil ich diesen Ausgleich zum beruflichen Alltag brauche.“ Das Handlungsmotiv „Ausgleich“ ist unmittelbar einleuchtend. Läufer nehmen - was läge näher? - vom beruflichen Streß auf ihre Weise Abstand. Etwaige Spannungen werden über die Muskulatur, über erhöhten Stoffwechsel und Sauerstoffaustausch abreagiert. Laufen entkrampft, wirkt entlastend und häufig auch wie eine gute Beruhigungspille. So schreibt ein 45jähriger: „Laufen beruhigt die Nerven und dient mir als Ausgleich für den täglichen Streß.“ Ein 49jähriger: „Laufen ist für mich Entspannung und Erholung vom täglichen Berufsstreß.“
Laufen ist für die meisten Läufer
nicht Erholungstechnik,
sondern ein Weg zu Gipfel-Erfahrungen
und Selbstfindung
Für eine scheinbar so einfache Tätigkeit wie das Laufen gibt es offenbar eine ganze Reihe von klar voneinander abgrenzbaren Gründen. Die Befunde unserer Untersuchung zeigen dies. Mit Laufen sind unterschiedliche Ziele und Erwartungen verknüpft. Auf keinen Fall ist es zulässig, alle Läufer - was Ziele und Gründe ihres (Lauf-)Handelns betrifft - über einen Kamm zu scheren. Es gibt sicherlich den Läufer, für den das Laufen lediglich eine „Erholungstechnik“ bedeutet. Gefühle der Freude, des Glücks, der inneren Freiheit, der Naturverbundenheit - all dies liegt nicht im Erlebnisspektrum dieses Läufers. In unserem Datenmaterial entdecken wir ihn kaum. Die von uns untersuchte Gruppe der regelmäßig und relativ intensiv laufenden Personen sucht und findet in der Freizeitaktivität Laufen zwar unterschiedlich akzentuierte, stets jedoch vielfältige Befriedigungen. Was einzelne während ihrer Laufanstrengungen und danach erleben, läßt sich nicht in wenigen Sätzen ausdrücken. Auf jeden Fall ist das Erlebnis Laufen facettenreich. Für die einen ist Laufen „Gelegenheit zur Meditation und Versinken in Gedanken“ (Wissenschaftler, 39 J.), für andere „eine Selbsterfahrung des nur Möglichen“ (Akademiker, 30 J.), oder für wiederum andere schlicht „Freude an der Bewegung“ (Angestellter, 52 J.). Mir scheint, jeder macht die „Gipfel-Erfahrungen“ während des Laufens, die im Bereich seiner Erlebensmöglichkeiten liegen und wofür er disponiert ist. Wir entdeckten auch die potentiell Laufsüchtigen. Dazu könnten jene Läufer zählen, die von sich behaupten: „Wenn ich nicht mehr täglich laufen kann, bin ich krank“ (Mann, 38 J.); „Wenn ich einmal nicht gelaufen habe, habe ich abends im Bett ein unwohles Gefühl“ (Mann, 44 J.); „Laufen ist schlechthin Lebensnotwendigkeit“ (Mann, 70 J.).
Für die große Mehrheit der untersuchten Läufer jedoch gilt, daß sie sich ziemlich bewußt einem Selbsterziehungsprozeß durch Laufen unterworfen hat, aus dem sie einen nicht gering zu schätzenden persönlichen Gewinn für sinnerfülltes Leben zieht.
Literatur
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ERNÄHRUNG E.V.: Ernährungsbericht 1980. Frankfurt 1980.
FIXX, J.: Das komplette Buch vom Laufen (dt. Übers. von „The Complete Book of Running“, 1977). Frankfurt/M. 1979.
GABLER, H.: Motivation zu Ausdauerleistungen im Sport (Ergebnisse einer Untersuchung an Langstreckenläufern). In: Württembergischer Landessportbund e. V. (Hrsg.), 2. Sportmedizinisches Seminar „Ausdauer“, 1978, S. 28-31.
GLOVER, B.; SHEPHERD, J.: Jogging (Laufen als neue Bewegungstherapie). München 1979.
GREIST, J. H.; KLEIN, M. H; EISCHENS, R. R.; FARIS, J. W.: Running as a treatment for non-psychotic depression. In: BEHAVIORAL MEDICINE, June 1978, S. 19-24.
GREIST, J. H.; KLEIN, M. H.; EISCHENS, R. R.; FARIS, J. T.: Running Out of Depression. In: THE PHYSICIAN AND SPORTMEDICINE, December 1978, S. 49-56.
HARIG, L.: Die Fitneß. In: Zeitmagazin, 52, S. 34, 1980.
ISMAIL, A. H.; TRACHTMAN, L. E.: ... mal wieder. In: psychologie heute. Mai 1975, S. 26-31.
KELEMAN, S.: Dein Körper formt dein Selbst. München 1980.
KURZ, D.: Leben Langläufer wirklich länger? (Informationen und Überlegungen zum Zusammenhang zwischen Sport und Gesundheit.) Unveröffentlichtes Vortragsmanuskript anläßlich des 10jährigen Jubiläums der Universität Bielefeld. 1980.
MORGAN, W. P.: Die Zweisamkeit des Langstreckenläufers. In: psychologie heute, H. 7, 1978, S. 60-66.
STEFFNY, M.: Lebens-Lauf (Laufen als neue Erfahrung mit Körper und Psyche). Köln 1979.
TAUSCH, R.: Empirische Prüfung der Theorie förderlicher Beziehungen und Prozesse in personenzentrierten Gruppenpsychotherapien. Unveröff. Vortragsmskr. vom 22. Intern. Kongreß f. Psychol., Leipzig, DDR, 1980.
Falschen Göttern nachzulaufen
von Alexander Weber (1982)
aus: VOLKSSPORT, 3. Jg., H. 1, S. 22-25
In meinen vorangegangenen Beiträgen in VolksSport habe ich unter dem Thema „Mehr Lebensfreude durch Laufen“ etliches Material zusammengetragen, das die positiven Auswirkungen des Laufens unschwer erkennen läßt (siehe Heft 5 und 6/81). Ich habe dargelegt, was Menschen erwarten können bzw. erleben, wenn sie regelmäßig und genügend intensiv, d.h. in vernünftiger, individuell abgestimmter Dosierung laufen.
In diesem Beitrag möchte ich versuchen, an einigen Punkten aufzuzeigen, wann Laufen von richtigen und wann es von falschen Zielen geleitet wird.
Wir wissen jetzt ziemlich zuverlässig, daß regelmäßiges und genügend intensives Laufen (d.h.: mindestens drei Laufeinheiten wöchentlich von mindestens 45 Minuten Länge) beim heutigen Menschen eine Reihe von realen Bedürfnissen zu befriedigen vermag, etwa: Bedürfnisse nach Ausgleich zum Berufsalltag, nach vermehrter Spannkraft, nach Begegnung mit der Natur, nach intensiverem Kontakt mit sich selbst usw. Ich verweise dabei auf meine bereits oben erwähnten Beiträge.
Ein wichtiges Bedürfnis (Motiv) für Laufen stelle ich hier heraus, weil ich an ihm richtige und falsche Zielperspektiven des Laufens beispielhaft erläutern kann. Es ist das allen Menschen innewohnende Bedürfnis nach Bewegung. Meine erste These lautet:
Das starke Bedürfnis sehr vieler Menschen unserer Zeit nach m e h r Bewegung hat sich ein natürliches Ventil geschaffen. Dieses Ventil ist: Langsamer Dauerlauf. Menschen jeden Alters, die regelmäßig den langsamen Dauerlauf zum Zweck des seelischen und körperlichen Wohlbefindens um seiner selbst willen betreiben, tun das Richtige. Sie handeln selbstbestimmt, sorgen für Körper und Seele in freier Entscheidung. Das Sorgen für sich selbst, indem man läuft, ist ein richtiges Ziel.
Im folgenden möchte ich diese These erläutern. Es gibt kaum eine Bewegungsart, die in Intensität und zugleich Unkompliziertheit die Aktivität Laufen übertrifft. Zudem ist Laufen eine frühe und jedem geläufige Erfahrung. Sobald das kleine Kind auf die Beine kommt, bemüht es sich um Fortbewegung im Laufschritt. Beobachtungen an frei spielenden Kindern zeigen uns, daß bei ihnen das Laufen mehr und anderes ist als ein bloßes Sich-Fortbewegen in eine bestimmte Richtung auf ein bestimmtes Ziel hin. Im freien Umherlaufen drücken Kinder Gefühle und Erlebnisse aus. Und meistens sind es Gefühle der Lust, der Freude und des Überschwangs. Sie verschaffen sich die Bewegung, die sie brauchen.
Mit zunehmendem Alter geht das Bedürfnis nach Bewegung zwar zurück, aber es versiegt keineswegs. Und auch der erwachsene Mensch braucht ausreichende Bewegung. Nur: Menschen unserer Zeit haben verlernt, auf dieses elementare Bedürfnis zu reagieren, ja, häufig wird nicht einmal das Signal registriert. Das hat auch entscheidend etwas mit der Umwelt zu tun, die sich Menschen selbst geschaffen haben.
Tagsüber ist der berufstätige Mensch fest an seinen Arbeitsplätzen gebunden. Er ist eingesperrt in Büros, in Fabrikhallen, in geschlossenen Räumen. Außerhalb der Berufstätigkeit lebt er in engen parzellierten Wohnungen; die überwiegende Zahl der Bevölkerung wohnt dicht gedrängt in den Wohnblocks unserer Großstädte. Dichtestreß, Kreislaufschäden, Nervosität, Schlafstörungen, Depressionen, Beeinträchtigungen des Affekt- und Sexuallebens, Fettleibigkeit — um sehr auffällige Symptome zu nennen — sind Folgen unserer modernen Lebensweise.
Einige dieser Symptome können gemildert oder ganz zum Verschwinden gebracht werden, wenn man dem Bewegungsmangel begegnet. Die „Erfindung“, die sich in den späten 60er und frühen 70er Jahren so vehement durchgesetzt hat, ist das Laufen. Laufen wurde plötzlich als die Möglichkeit angesehen, um den Ausgleich für den chronischen Bewegungsmangel zu schaffen. Das bis dahin meist nur latent vorhandene, nicht ausgesprochene und nur vorbewußte, gleichwohl starke Bedürfnis sehr vieler Menschen nach mehr Bewegung hatte ein Vehikel bekommen. Dieses Vehikel war und ist in immer noch ungebremster Vorwärtsentwicklung das Laufen — zu allererst: der langsame Dauerlauf. Gerade diese Art des Sich-Bewegens bringt erwünschte, gesundheitlich wohltuende Effekte hervor. Immer mehr Menschen haben das für sich erkannt. Und folglich beobachtet man immer mehr Menschen jeden Alters in Trainingsanzügen auf Park- und Waldwegen, auf Straßen und Laufbahnen.
Ich habe gegen diese Entwicklung nichts einzuwenden. Das langsame und entspannte Dauerlaufen mit dem Ziel des Für-sich-selber-Sorgens halte ich für gut und richtig. Es stillt den Hunger nach Bewegung. Es führt aus der Enge geschlossener Räume. Es befriedigt gesundheitliche Bedürfnisse. Es gibt dem Körper, was ihm gut bekommt — etwa: indem wir ihn fordern, prüfen, Belastungen aussetzen. Wir geben ihm die Möglichkeit zur Regenerierung relativ schnell entladener Energien, setzen ihn Wind und Wetter aus, lassen ihn immer wieder schwitzen und gelegentlich vor Kälte zittern. Kurz: dadurch, daß wir uns durch Laufen mit dem eigenen Körper auf diese besondere Art und Weise auseinandersetzen, verschaffen wir ihm jene ursprünglichen Befriedigungen und Bewährungsmöglichkeiten, die dumpf an frühere, jahrhundertealte menschliche Daseinsweisen erinnern. Bloße Nostalgie? Ich glaube nicht. Wohl aber noch anderes: Läufer verschaffen sich jene urtümlichen Lusterlebnisse, die — vertraut man den wirklichen Kennern und Könnern — bei weitem das übersteigen, was Fernseher und Flaschenbier, Tabak- oder Kegelabend und was da ähnliches mehr ist, an Genüßlichem zu bieten vermögen.
In eine für mich zweifelhafte, zumindest mehrdeutige Zielrichtung gerät das Laufen, wenn es unter ein Motto wie dieses bekannte gestellt wird: „Ein Schlauer trimmt die Ausdauer!“ Die Aufklärungsarbeit auf diesem Sektor hat der Deutsche Sportbund im Verein mit Krankenkassen, Geldinstitutionen, Gesundheitsbehörden gründlich und umfassend geleistet. Plakatwerbungen, Trimm-Aktionen in vielen Städten des Landes, ständige Informationen durch die Massenmedien, hier vor allen Dingen auch Broschüren, Hefte, Schriften gratis und in millionenfachen Auflagen — dies alles zusammen erzeugt Wirkung. Dem beinah natürlichen Bedürfnis des zivilisierten „Steh- und Sitzmenschen“ unserer Tage nach einem Mehr an Bewegung wird dadurch kräftig nachgeholfen.
Wozu und warum soll hier ein „Schlauer“ die Ausdauer trimmen? Die lapidare Antwort liegt nahe: damit er möglichst immer fit und bei guter Gesundheit allzeit gerüstet und in bester Kondition für den Konkurrenzkampf im Berufsalltag ist — auf diese Weise also für das „Wohl“ der Gesellschaft sorgt. Was aber dieses „Wohl“ der Gesellschaft beinhaltet, ist nicht oder nur vage und wenig eindeutig definiert. Jedenfalls bieten da die genannten Broschüren nur unzureichende Information und Begründung.
Was ist das auch für ein Wert „Wohl der Gesellschaft“? Ich belasse es bei diesen Andeutungen, das Thema ist — frei nach Fontane — ein weites Feld.
Meine zweite These formuliere ich so:
Das Bedürfnis nach mehr Bewegung findet durch Laufen eine starke Befriedigung. Viele Menschen, bei denen regelmäßiges Laufen zu einer festen Gewohnheit geworden ist, reizt es, an Laufwettbewerben teilzunehmen und sich an Konkurrenten zu messen. Dies kann zu falschen Zielen des Freizeit-Läufers führen. Zumal dann, wenn Wettbewerbs-Eifer von außen zusätzlich stimuliert wird und Laufen dadurch eine falsche Sinnrichtung erfährt. Dieses Muster außengeleiteter Bestimmung vom Laufen liefert die konsum- und konkurrenzorientierte Massengesellschaft.
Geübte Läufer verschaffen sich ihre besonderen Erlebnisse und Grenzerfahrungen im Rahmen dessen, was für sie gerade noch möglich ist. Anders gewendet: Läufer wählen so oft und so intensiv ihr Wettkampferlebnis, wie sie glauben, daß dies angemessen und richtig sei. Aber wählen sie wirklich frei? Stellen sich nicht auch schon bei den Freizeit-Läufern die Zwänge ein, die wir allenthalben im sonstigen Leben beklagen? Leistungsdruck, Ellenbogen-Verhalten und Konkurrenzkampf im beruflichen Alltagsleben — die Menschen sind davon geprägt. Ist es da verwunderlich, wenn die Übertragung aufs Laufen quasi wie von selbst vollzogen wird?
Zugestanden: Kampfesfreude, Wetteifer, das Bedürfnis, den anderen zu übertrumpfen, sind kräftige Impulse im Menschen, die sich mit seiner Triebnatur erklären lassen. Und weil Menschen in der hochkomplizierten, modernen Leistungsgesellschaft schnelle „Erfolge“ nicht mehr augenfällig — zumal unmittelbar und erlebt — haben können, bieten die vielfältigen und häufigen Wettkampf-Gelegenheiten des Laufens Ersatz, Kompensation, Möglichkeiten der Abreaktion, gleichzeitig aber auch für Überreaktion. Der falsche Ehrgeiz wird häufig genug und beklagenswerterweise von außen angestachelt. —
Kampfesfreude und Wetteifer können gesunde Impulse geben, doch oft entarten sie. Der Läufer tritt an nach Maßstäben, die er sich nicht selber setzte und denen er sich doch ausgeliefert fühlt.
Die Entwicklung des Volkslaufs — ganz gewiß diese nicht allein und auch nicht an erster Stelle — ist hier nicht ganz schuldlos.
Wenn man sich kritisch über Idee, Organisation und Wirklichkeit des Volkslaufs äußert, heißt das ja noch nicht, daß man für seine Abschaffung plädiert. Wer läuft sollte prinzipiell die Möglichkeit haben, sich an Wettkämpfen zu beteiligen. Volksläufe in den 60ern und zu Beginn der 70er Jahre verdienten ihren Namen noch zu recht. Heute sind sie zumeist, von Ausnahmen abgesehen, Wettkämpfe für Spezialisten, für fortgeschrittene Läufer zumal. Die Leistungen der Läufer — und ganz besonders der Altersklassen-Läufer — sind in der Spitze und Breite gleichermaßen bedeutsam von Jahr zu Jahr gestiegen. Und mit ihnen konsequenterweise, als ihre Voraussetzung, die Anzahl der absolvierten Trainingskilometer. Der durchschnittliche 45jährige Altersklassen-Läufer, der den 10-km-Volkslauf unter 40 Minuten absolviert, läuft im Monat deutlich mehr als 200 Trainingskilometer. Man kann sich leicht vorstellen, wieviel von seiner freien Zeit er für Training aufbringen muß. Jedenfalls weit mehr, als unter gesundheitlichen (körperlichen und seelischen) Gesichtspunkten erforderlich, vielleicht sogar wünschenswert und effektiv ist.
Laufanfänger, auch die weniger Trainierenden und die weniger Talentierten, finden kaum noch bei Volkslauf-Veranstaltungen den richtigen Maßstab zur Einschätzung ihrer persönlichen Leistung. Man wird gut daran tun, sich um die große Masse dieser Läufer mehr zu kümmern. Man sollte ihnen neue, möglicherweise ganz andere Ziele anbieten. Oder man sollte — wenn nun mal die Entwicklung ist, wie sie ist — mehr differenzieren, mehr an die Selbstdisziplin appellieren, falsche Idole abbauen; ferner über Prämien, Preise, Anstecknadeln, Auszeichnungen, Stempel(un)wesen kritisch und gründlich nachdenken. Denn auf diesem Sektor des Laufens haben sich bereits m.E. falsche Gewohnheiten genug entwickelt, die dann — es kann nicht anders sein — zu falschen Wahrnehmungen und Lernerfahrungen führen.
Hier fördert man, ohne sich darüber im klaren zu sein, eine Bewußtseinsbildung beim wettkampfsuchenden Freizeit-Läufer, die zu den falschen Bedürfnissen führt. Volkslauf-Veranstalter sollen nicht die falschen Ziele unterstützen. Wenn mir gewisse Auswüchse mißfallen, so tadle ich nicht den einzelnen Läufer, der laufsüchtig geworden ist. Auch nicht denjenigen, dessen soziales und/oder politisches Engagement wegen exzessiver Lauferei auf den Nullpunkt sinkt, dessen Engagement allein und ausschließlich Laufen ist — welch eine Verengung von Bewußtsein und Leben! — Nein, kritik- und reformbedürftig sind gewisse Ziele, Erwartungen und Umstände, mit denen sich so manch Laufbesessener identifiziert und an deren Konstruktion — teilweise wenigstens — ja doch Sportbünde und -organisationen, Trimm-Trab-Bewegung und Krankenkassenwerbung, ärztliche Missionare und andere Propheten entscheidende Anteile hatten und noch haben.
Es stimmt nachdenklich, wenn Volkslauf-Veranstalter durchweg nach Quantitäten schielen, sich aber kaum Gedanken darüber machen, wie die Qualität des Volkslaufes verändert werden könnte. Symptomatisch ist etwa: in Versammlungen diskutieren Volkslauf-Veranstalter über Organisationsfragen der Volkslauf-Wettbewerbe, über Möglichkeiten der Erhöhung von Teilnehmerzahlen usw. Außerhalb der Diskussion bleiben Fragen nach dem Sinn, den Zielen und Werten solcher Wettkämpfe für Freizeit-Läufer. Warum muß z.B. der Verein ausgezeichnet werden, der die meisten Teilnehmer beim Volkslauf stellt? Oder: Wer profitiert eigentlich davon, wenn Frau X oder Herr Y an einem Volkslauf auf Hawaii oder in Athen teilnehmen? Und wie soll man das einschätzen, wenn — nicht nur in Ausnahmefällen — 50jährige berichten, sie hätten während eines Jahres an 35 Volksläufen oder acht Marathonläufen teilgenommen?
Muß man denn nach Quantitäten schielen, wo doch Qualitäten viel mehr von Bedeutung sind? Eigene Standpunkte zu überprüfen, kann hier von Nutzen sein.
Eine richtige Perspektive dagegen ist: Laufen soll Freiräume schaffen, nicht noch neue und zusätzliche Zwänge. Der Freizeit-Läufer beispielsweise sollte in der Lage sein, daß er selbst seine Ziele erkennen, formulieren und in freier, unabhängiger Entscheidung verwirklichen kann.
Dazu ist er dann imstande, wenn er Laufen als das betrachtet, was es ist: als eine Freizeit-Aktivität, die das Leben bereichert und Freude bereitet. Und nicht zuletzt soll Laufen eine Basis schaffen für körperliches und seelisches Wohlbefinden.
Laufen – Motive und Wirkungen. Eine repräsentative Untersuchung an Volkslaufteilnehmern
von Alexander Weber (1982)
aus: SPORTWISSENSCHAFT, 12. Jg., H. 2, S. 174-184
1 Problemstellung
Seit Beginn der 70er Jahre wirbt der Deutsche Sportbund verstärkt mit Trimm-Aktionen. Durch auflagenstarke Broschüren und andere Massenmedien erreicht die Aufforderung „Trimm Dich durch Sport“ fast alle Bundesbürger. Gesundheit und Fitneß, so wird suggeriert, können vor allem durch sportliche Betätigung erhalten und gefördert werden1. Dem Ausdauertraining wird ein besonders hoher Gesundheitswert zugeschrieben. So verwundert es nicht, wenn der „Trimm-Trab“ ständig mehr Anhänger findet. „Trimmtraben“ — Synonyme sind „ Jogging“ und „Trablaufen“ — gilt als das Mittel, um die Ausdauer zu trainieren und mithin zu verbessern.
Von den ca. drei bis vier Millionen Freizeit-Läufern in der Bundesrepublik betreibt etwa eine Million das Dauerlaufen regelmäßig und — relativ gesehen — intensiv. Das ist nach eigenen Erhebungen eine eher konservative Schätzung. Diesen Gewohnheitsläufern gilt hier unsere Aufmerksamkeit. Weniger beachtet werden jene Jogger, die nur gelegentlich einmal oder in unregelmäßigen Abständen einen kurzen Dauerlauf absolvieren. Der wesentliche Grund ist: nur an ihnen, den Gewohnheitsläufern, lassen sich einigermaßen zuverlässig und valide Motive und Wirkungen des Laufens beobachten und feststellen. Was veranlaßt eigentlich Menschen verschiedener Altersgruppen, mit verschiedenen Berufen und aus allen Sozialschichten zum regelmäßigen Laufen? Wie kommt es, daß so viele, wenn sie die Anfangsschwierigkeiten überwunden haben, diese Gewohnheit beibehalten? Ob Arbeiter, Student, Angestellter, Arzt oder Hausfrau — sie alle investieren einen großen Teil ihrer freien Zeit fürs Laufen. Was erhalten sie als Gegenleistung? Was erwarten sie vom Laufen, und welche Wirkungen erfahren sie an Körper und Seele? Welche Hoffnungen werden erfüllt, welche nicht? — Um Auskünfte auf solche Fragen zu erhalten, wendeten wir uns vorwiegend an Teilnehmer von Volkslauf-Veranstaltungen. Diese Gruppe — so unsere Vermutung — zählt zu den Gewohnheitsläufern. Und sie beabsichtigten wir zu befragen.
Obwohl diese Gruppe der regelmäßig und intensiv laufenden Personen eine quantitativ große Gruppe darstellt und obwohl sie einen Sport betreibt, der schweißtreibende, harte „Arbeit“ verlangt, hat die Wissenschaft sie (bisher) wenig beachtet. Es gibt inzwischen umfangreiche Literatur über Laufen, Jogging, Trimm-Trab. Aber diese Literatur kann sich kaum auf wissenschaftlich gesichertes Wissen stützen, wenn es beispielsweise darum geht, die psychischen Wirkungen des Laufens aus objektivierter, verallgemeinerter Erkenntnis darzustellen. So begnügt man sich (notgedrungen) mit kasuistischen Aussagen.
Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist dies unbefriedigend, zumal das Thema Laufen mancherorts als ideologisch überfrachtet gilt — und teilweise wohl auch ist2. Ich stimme J. Fixx zu; er schreibt: „Wenn man die physiologischen und die psychologischen Aspekte nicht gleichermaßen berücksichtigt, kann man dem Laufen eben nicht gerecht werden“ (1979, 20). Nur fehlen uns vergleichsweise für die psychologischen Aspekte weitgehend noch die wissenschaftlich fundierten Daten.
Eigene Voruntersuchungen und Hinweise aus vereinzelt vorliegender Literatur zu unserer Fragestellung (z. B. GABLER 1978, BRACKHANE u.a. 1981) legen die folgende allgemeine Hypothese nahe: Regelmäßig und genügend intensiv laufende Personen3 betreiben ihren Sport nicht primär aus gesundheitlichen Gründen und um der Fitneß willen. Laufen dient auch nicht primär dem Zweck, „die körperliche Bestform für den Konkurrenzkampf im Alltag“ zu erlangen (HARIG 1980). Dagegen vermittelt regelmäßiges und genügend intensives Laufen Lustgefühle an sich, bewirkt emotionale Ausgeglichenheit, steigert die Lebensfreude und ist eine stetige Quelle für seelisches und körperliches Wohlbefinden. Diese allgemeine Hypothese war anhand einer großen Stichprobe zu überprüfen. Sollte regelmäßiges und intensives Laufen seelische Befindlichkeiten signifikant beeinflussen und verändern, dann müßte das auf der Grundlage unserer Untersuchung nachweisbar sein.
2 Untersuchungsmethode und Datenbearbeitung
Untersuchungsinstrument war ein sieben Seiten langer Fragebogen mit mehr als 50 Items. Es bedurfte eines Zeitaufwands von durchschnittlich 40 Minuten, um ihn auszufüllen. Die Form der Fragebogen-Aufgaben variierte: geschlossene und offene Fragen, Mehrfachauswahl-Antworten, Schätzskalen, Erlebnisaussagen in freier Form. Der Fragebogen wurde an ca. 900 Läufer verteilt. Meine Mitarbeiter4 und ich besuchten in den Jahren 1979 und 1980 eine ganze Reihe größerer Volkslauf-Veranstaltungen in West- und Norddeutschland, um dort die Fragebogen nach dem Zufallsprinzip zu verteilen. Wir sprachen einzelne Läuferinnen und Läufer an, erklärten kurz unsere Absicht, wiesen dabei auf die Anonymität der Erhebung hin und baten um Rücksendung des ausgefüllten Fragebogens im beigefügten Freiumschlag. Der Rücklauf5