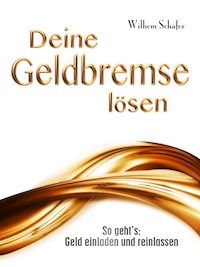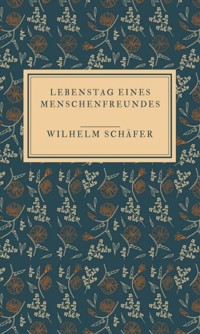
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die Menschenseele in Heinrich Pestalozzi erwacht, liegt sie in einer Stube am Hirschengraben, wo sich jenseits der alten Stadtmauer bis zu den neuen Bastionen am Zürichberg hinauf die Landhäuser der Reichen sonnen. Sie selber spürt nicht viel von dieser Sonne, sie haust mit Kleinbürgersleuten im Gedränge hoher Steingebäude, die nur finstere Gäßchen zwischen sich lassen und mit dunklen Treppen in beengte Wohnungen führen. Außer der Mutter und einer Magd, die Babeli gerufen wird, sind noch drei Geschwister in der Stube, ein Knabe Johann Baptista und zwei Mädchen, von denen das kleinste in der Wiege liegt. Das wird eines Tages von schwarzen Männern fort getragen, über die dunkle Treppe hinunter in die Stadt, die draußen mit beschneiten Dächern wartet. Im Sommer aber ist es wieder da, schläft in der Wiege und heißt Bärbel, wie es vorher auch geheißen hat. Doch weint die Mutter immer noch, und der Vater, der sonst mit großen Schritten durch die Stube gegangen ist, liegt in der Kammer nebenan, nicht anders als das Bärbel in der Wiege; seine haarigen Hände ruhen auf dem Leintuch, und die Augen forschen an der Zimmerdecke.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilhelm Schäfer
Lebenstag eines Menschenfreundes
Morgen
1.
Als die Menschenseele in Heinrich Pestalozzi erwacht, liegt sie in einer Stube am Hirschengraben, wo sich jenseits der alten Stadtmauer bis zu den neuen Bastionen am Zürichberg hinauf die Landhäuser der Reichen sonnen. Sie selber spürt nicht viel von dieser Sonne, sie haust mit Kleinbürgersleuten im Gedränge hoher Steingebäude, die nur finstere Gäßchen zwischen sich lassen und mit dunklen Treppen in beengte Wohnungen führen. Außer der Mutter und einer Magd, die Babeli gerufen wird, sind noch drei Geschwister in der Stube, ein Knabe Johann Baptista und zwei Mädchen, von denen das kleinste in der Wiege liegt. Das wird eines Tages von schwarzen Männern fort getragen, über die dunkle Treppe hinunter in die Stadt, die draußen mit beschneiten Dächern wartet. Im Sommer aber ist es wieder da, schläft in der Wiege und heißt Bärbel, wie es vorher auch geheißen hat. Doch weint die Mutter immer noch, und der Vater, der sonst mit großen Schritten durch die Stube gegangen ist, liegt in der Kammer nebenan, nicht anders als das Bärbel in der Wiege; seine haarigen Hände ruhen auf dem Leintuch, und die Augen forschen an der Zimmerdecke.
Eines Tages muß das Babeli hinein zu ihm — allein und lange, während die Dachtraufe vor dem Fenster einen langen Strahl zerstäuben läßt; als es wieder herauskommt, fällt es der Mutter um den Hals und weint. Die hat, das Bärbel säugend, auf der Ofenbank gesessen; nun tut sie das Kind schnell von der Brust und läuft in die Kammer. Nachher muß Heinrich Pestalozzi mit den Geschwistern auch hinein; der Vater bemerkt sie schon nicht mehr, seine Augen aber forschen noch immer an der Zimmerdecke, nur die eine Hand ist von der Bettdecke abgerutscht, und die Mutter hängt daran, als ob sie ihn festhalten wolle.
Am andern Tag ist er in einen Sarg getan, die Hände sind auf der Brust gefaltet, und die Lider haben wie zwei Deckel aus Wachs die forschenden Augen zugemacht. Heinrich Pestalozzi und sein Bruder bekommen die Sonntagskleider an und müssen — als fremde Männer in schwarzen Röcken und Hüten kommen, den Vater zu holen — mit hinunter über die dunkle Treppe und hinter ihnen her durch die Gassen nach dem Großmünster gehen, wo gesungen und gebetet wird, bevor sie den Sarg auf den Kirchhof bringen und bei Wind und Regen in ein frisch gegrabenes Loch versenken. Seitdem Heinrich Pestalozzi die hohen Münsterhallen mit dem Donnerschall der Orgel gesehen hat, weiß er, wo die Schwester Bärbel so lange gewesen ist; der Vater aber kommt nicht wieder, bis er ihn fast vergißt und nur noch manchmal gleich ihm mit langen Schritten die Stube messen will.
Als wieder Winter wird, nimmt ihn das Babeli eines Abends schnell bei der Hand, einen Arzt zu suchen; sie finden den ersten nicht und müssen den zweiten erst aus einem Wirtshaus holen, wo viele Männer bei der Lampe in einer qualmigen Stube sitzen. Der läuft gleich mit, doch geht er bald wieder kopfschüttelnd fort von dem Bettchen der Schwester Dorothea, und andern Morgens sagt die Mutter, es sei gestorben an der Bräune. Die schwarzen Männer kommen zum drittenmal, aber diesmal tragen sie das Dorli fort, mit dem er jeden Tag gespielt hat. Seitdem ist ihm das Großmünster ein furchtbares Geheimnis, und so oft er die Glocken läuten hört, läuft er zur Stubentür, den Riegel vorzuschieben. Manchmal aber kommen doch Menschen über die Treppe herein, die mit der weinenden Mutter sprechen und denen er die Hand geben muß; er tut es gehorsam, doch immer in der Furcht, daß sie ihn mitnehmen könnten in das Großmünster. Auch wenn die Mutter oder das Babeli ihn selber an der Hand hinunter führen, ist er nicht froh, bis er endlich durch die Haustür hinein schlüpfen kann und oben die Heimeligkeit der Stube wiederfindet. Und nur dadurch, daß seine seltenen Ausgänge meist den gleichen Verlauf nehmen, durch die steilen Gassen und über Treppen zum Markt hinunter, wo die Limmat unter den Holzbrücken hindurch ihr reißendes Wasser drängt, oder Sonntags bis an den gleißenden See hinaus, wo die Schiffe und Schwäne schwimmen und die Wolken auf den fernen Bergen Rast machen, die den blauen Himmel mit ihrem weißen Zackenrand begrenzen: bahnt sich seine furchtsame Seele allmählich Straßen in die fremde Unermeßlichkeit, darin die Türme des Großmünsters drohend stehen. Sonst aber bleibt die Stube die einzige Sicherheit seiner Welt.
2.
Einmal macht Heinrich Pestalozzi auch eine Reise an den See mit seiner Mutter; mittags nach dem Markt fahren sie hinaus, unaufhörlich am Seeufer hin durch Dörfer mit weißen Kirchen, durch Weinberge und Matten, wo die Bauern lustige Haufen Heu zusammen bringen, bis nach Richterswil, wo der Onkel Johannes wohnt. Es ist dort ein großes Haus mit einem prächtigen Garten und vielen fremden Menschen, die seiner schwarzen Mutter um den Hals fallen und denen er die Hand geben muß. Auch einen Knaben gibt es, älter als er und wie ein Soldat mit einem stolzen Federbusch gekleidet; der führt ihn auf den großen Speicher, wo Korn in Haufen liegt, durch die Ställe mit unheimlich behörnten Kühen und stampfenden Pferden in die Weinberge hinauf zu einer Bank, die unter einer Linde einen Ausblick auf den See gibt bis tief in die blauen Bergschlüfte hinein, und danach an das weiche Ufer hinunter, wo das Ried mit hohen Halmen aus dem Wasser wächst und seine Büschel im Wind verneigt. Da haben Jünglinge gerade ein Schiff los gemacht, und weil der eine ein Bruder des Knaben mit dem Federhut ist, sollen sie mit einsteigen. Die Mutter aber kommt gelaufen, todblaß, und trägt ihn auf den Armen, obwohl er sich dessen schämt und schreiend wehrt, durch den Garten zurück ins Haus.
Sie bleiben zwei Tage dort, bis sie am dritten Morgen noch in der Dunkelheit abfahren auf dem selben Bauernwagen und in der Morgenfrühe zurück kommen in die Stadt und in die Stube, wo der dicke Kachelofen mit der kühlen Steinbank auf sie wartet und das Babeli mit den Geschwistern ist. Er denkt später nicht gern an diese Reise; es ist ihm alles fremd geblieben, als ob er nur geträumt hätte.
3.
Lieber hat Heinrich Pestalozzi die Ausflüge nach Höngg, wo der Großvater als Pfarrer amtet. Sie brauchen keinen Bauernwagen dahinaus, sie gehen durch die Niederdorfporte auf die Schaffhauser Straße und dann am Käferberg sacht hinauf durch Weinberge bis an den Hügelrand, wo nach einer Stunde das Dörfchen mit der sauberen Kirche und dem Pfarrhaus erscheint. Unten zieht die Limmat ihren Silberstreifen durch das breite Tal, und hinten zeigt der Albisrücken die steile Schmalseite; wo seine Kante gegen den See verläuft, steht vor der Heiligkeit der Berge und gegen das blanke Wasser die Stadt Zürich mit ihren Mauern und Türmen dunkel wie ein Haufe reisigen Kriegsvolks da.
Jedesmal, wenn er mit seinem Bruder Johann Baptista angekommen ist und sie sich in dem unteren mit spitzen Feldsteinen gepflasterten Flur von dem Staub des Marsches gereinigt haben, dürfen sie zu dem alten Herrn in die Studierstube hinauf. Sie liegt ganz oben und ist in der Ecke des Pfarrhauses so eingebaut, daß durch die breiten Fenster von Süden und Osten die Helligkeit der weiten Landschaft hinein sieht und den würdigen Greis mit Heiterkeit umspielt. Er steht nicht auf, wenn die Buben zu ihm herein kommen, auch dürfen sie nicht anders als einzeln gerufen zu ihm an den Tisch treten. Jedes muß sein Sprüchlein sagen, wie sie die Mutter verlassen haben und wie lange sie unterwegs gewesen sind; und niemals fällt es ihnen bei, hier oben die Ehrwürdigkeit durch eine Zärtlichkeit zu verletzen. Erst unten, wenn er mit am Tisch sitzt, wo die Großmutter mit den gütigen Zwickelfalten ihres alten Gesichtes das Gespräch führt, wird er der Großvater, der sie aus den Schoß nimmt und Scherze mit ihnen treibt. Aber wenn sich allmählich aus dem Donnergott des Großmünsters das Bild Gottes als eines himmlischen Vaters in Heinrich Pestalozzi umbildet, sind es die Züge des Großvaters in der Studierstube, die dem Bild ihr Wesen geben.
Stärker wird dieser Eindruck, als er am Gottesdienst teilnehmen darf. Das Pfarrhaus ist an die Kirche so angebaut, daß es mit dem Totenacker seitlich vom Dorf und am äußersten Rand des Hügels eine Art Gutshof vorstellt, der wie ein solcher auch durch einen Torweg zugänglich ist. Durch den sieht Heinrich Pestalozzi Sonntags die Kirchgänger kommen, sauber gekleidet in ihrer bäuerlichen Tracht. Die Glocken klingen heller, und auch die Orgel hat nicht den brausenden Schall wie im Großmünster. Wenn sie anfängt zu spielen, ist es nicht anders, als ob sich die dunkleren Stimmen der Männer mit denen der stauen und Kinder mischten, und wenn das Lied dann wirklich einsetzt, wird alles zum Gesang der Gemeinde.
Weil er die Stimme und das Wesen des Großvaters kennt, bleiben ihm auch die Worte seiner Predigt nicht gar so fremd, so wenig er im einzelnen davon versteht. Es ist fast der himmlische Vater selber, der zu seinen Kindern in dem feierlichen Ton der Studierstube spricht, aber der gütige Klang in seiner Stimme bleibt; und weil er niemals poltert, niemals aus den Rand der Kanzel schlägt wie die Prediger in der Stadt, bekommt die Predigt nichts von ihrem gottfremden Haß. So trägt Heinrich Pestalozzi jedesmal einen warmen Glanz von der Empore mit hinunter; und weil er die Kirchgänger nachher nicht gleich den Zürchern in die dunklen Schlüfte der Gassen verschwinden sondern langsamen Schrittes sich rund herum in die Gehöfte zerstreuen sieht, zweifelt er nicht daran, daß sie überall etwas von dem Glanz hinbringen. Um so stolzer ist ihm zumut, daß er selber danach im Pfarrhaus bleiben und mit dem Träger dieser feierlichen Macht zu Tisch sitzen darf — wo der Pfarrer freilich am Sonntag außer dem Gebet niemals ein Wort spricht, wie er auch an diesem Vormittag das Frühbrot in seiner Studierstube nimmt und sich vor dem Gottesdienst niemandem zeigt. Erst wenn er seine Mittagsruhe gehalten hat, sehen ihn seine Enkel als Großvater wieder, der gern fröhlich ist und sie manchmal noch bis vor das Tor der Stadt zurück begleitet; hinein geht er seit dem Tode seines einzigen Sohnes nicht mehr gern.
So bewirkt der Großvater in Höngg durch die weise Trennung amtlicher Würde von seiner gütigen Menschlichkeit, daß sich für die Kindheit Heinrich Pestalozzis das Grauen von den kirchlichen Dingen hebt.
4.
Auch außerhalb des Pfarrhauses findet Heinrich Pestalozzi im ländlichen Leben zu Höngg vertrautere Wege aus der engen Stube als in der finsteren Stadt. Wo jeder den andern kennt und die Großmutter wohl weiß, mit welchen Kindern sie den Enkel spielen läßt, ergibt sich leichter ein Kamerad. Der angenehmste heißt Ernst Luginbühl und wird ihm bald ein sehnsüchtig erwarteter Führer in die hügeligen Gebiete bis an den Wald am Käferberg hinauf oder gar in die steinichten Limmatwiesen hinunter, wo Samstags die Schiffe der geputzten Zürcher eilfertig mit der Strömung nach Baden treiben und Sonntags von dem Landvolk an Stricken mühsam stromauf gezogen werden. Er trägt keinen stolzen Federhut wie der Vetter in Richterswil, er läuft barhaupt und barfuß wie die andern Landbuben auch und hat prallrote Backen mit wasserhellen Augen; aber er weiß, wo man am sichersten einen Specht bei seiner Klopfarbeit belauscht oder wo ein Ameisenberg ist. Sein Vater arbeitet als Baumwollenweber, der erste und einzige in Höngg; einmal geht Heinrich Pestalozzi mit hinein und sieht den bärtigen Mann gebückt in dem Gestänge sitzen. Er hat nichts Ähnliches von menschlicher Arbeit gesehen; Küfer, Schmiede, Bäcker und Schreiner und erst recht die Bauern: alle schaffen mit den Händen und bleiben für sich selber frei; dieser Weber aber sitzt im Gestänge seiner Arbeit als ein Teil von ihr, wie die Spinne ans Netz gebunden. Er bleibt eine Stunde lang mit den Knaben dasitzen und hört dem unablässigen Geklapper zu, das aus dünnen Fäden Stoff macht. Als er nachher beim Abendessen ausgefragt wird, wo er gewesen ist, und anfängt, von dem Baumwollenweber zu erzählen, will der Großvater stirnrunzelnd nichts mehr hören von dem Unglück dieser städtischen Neuerung — es ist das einzige, was Heinrich Pestalozzi von seinem Unwillen versteht.
Einmal ist er eine ganze Woche lang in Höngg geblieben und kommt sich selber schon wie ein Landkind vor, als ihn die Mutter wieder holt. Auch diesmal geht der Großvater mit, aber nur bis Wipkingen, von wo er sich geärgert gegen den Berg zurückwendet. Er ist böse auf das geputzte Stadtvolk in den Schiffen, das sich am Sonntag von den Dorfleuten heimziehen läßt, ihre schwere Arbeit mit übermütigem Geschrei begleitend, und Heinrich Pestalozzi hört wieder, wie er von dem städtischen Unglück zu der Mutter spricht. Es geht schon gegen die Dämmerung, und so wendet sich der alte Mann von ihnen fort in einen dunkelroten Abendhimmel hinein, der den Häusern glühende Augen macht. Heinrich Pestalozzi weiß nicht warum, aber die Traurigkeit überkommt ihn so, daß er herzbrechend hinter dem Großvater her weint; es dauert lange, bis die erschrockene Mutter heraus bekommt, daß es die dunkle Stadt ist, vor der er sich fürchtet, und daß er alle Tage mit ihr und den Geschwistern und dem Babeli auf dem Land wohnen möchte. Da gesteht sie ihm, daß die Verwandten in Richterswil ihr das schon damals bei dem Besuch vorgeschlagen hätten, daß sie es aber nicht möchte der Stadtschulen wegen. In Richterswil möchte ich auch nicht, sagt er fast trotzig, lieber in Höngg! und weiß nicht, warum nun seine Mutter herzbrechender weint als er vorher; sodaß sie beide mit einer verlorenen Traurigkeit durch die Niederdorfporte in Zürich eingehen.
5.
Nach diesem Abend verlangt Heinrich Pestalozzi sehnsüchtig in die Schule. Seitdem die Schwester Dorothea gestorben ist und der Johann Baptista, um ein Jahr älter als er, täglich sechs Stunden zu den Schulmeistern am Neumarkt geht und nachher bei den Schularbeiten sitzt, ist er tagsüber allein mit dem Bärbel, das immer noch in der Wiege liegt und ihm kein Gespiele sein kann. Für die deutsche Schule scheint es der Mutter noch zu früh, so bringt ihn das Babeli eines Morgens in die Hausschule.
Es wird aber kein schönes Erlebnis für ihn: als sie in den schmalen Raum eintreten, der eigentlich nur einen breiteren Gang vorstellt, ist der alte Lehrer gerade dabei, einen Buben zu walken; es sieht aus, als ob er ihm die Haare in Büscheln ausreißen wolle; zugleich vollführen die beiden ein weinerliches Geschrei, über das die andern Kinder, Buben und Mädchen durcheinander, schadenfroh lachen. Erst als das Babeli den Zornigen anruft, hört er auf. Hinten ist noch eine Bank frei, dahinein wird Heinrich Pestalozzi mit seinen Sachen gesetzt; das Babeli droht ihm noch einmal mit dem Finger und überläßt ihn den Kindern, von denen er nicht eines kennt, und dem weißköpfigen Schulmeister, der — als er den Namenszettel gelesen hat — die Magd für die Frau Pestalozzi selber hält und ihr mit vielen Komplimenten an die Tür nachläuft. Der Lärm, der durch die Neugier gestockt hat, hebt wieder an: die Kinder haben neben den Büchern ihre Eßwaren, und was sie sonst mit sich führen, auf den Pulten ausgebreitet; ein jedes liest laut oder schreibt für sich wie zuhause: der Lehrer ist nur eine Art Unhold, der eines nach dem andern vornimmt und die andern schwatzen und balgen läßt. So hört das Geklatsch seiner Prügel und sein Geschrei ebensowenig auf wie der Lärm der Kinder, die meist garnicht hinsehen, wenn sich sein Zorn beim nächsten Opfer neu entzündet. Auch Heinrich Pestalozzi kommt endlich an die Reihe, als er eine Stunde lang verängstigt dagesessen hat; er wundert sich fast, als es diesmal ohne Prügel abgeht, malt danach Buchstaben, wie er es von seinem Bruder gelernt hat, und ist noch fleißig dabei, als die andern mit eiligem Geklapper ihre Sachen zusammen raffen.
Auf der Gasse wartet das Babeli; und wenn ihm das schon diesmal Spott einträgt, so wird ein paar Tage später ein wahres Schicksal daraus: es macht sich gerade so, daß ein Platzregen losgeht, das handfeste Babeli will ihn unter die Schürze nehmen; und rafft ihn kurzerhand — da er sich vor den andern schämt — als Bündel unter den Arm, um mit ihm heim zu rennen, so sehr er schreit und strampelt; sogleich verfolgt von einem Rudel der Kinder, die sich nun alle aus dem Regen nichts mehr machen und die Tropfen in ihre Gesichter klatschen lassen.
Seitdem haben sie ihren Schabernack mit ihm, wo sie nur können. Seine Vorfahren vom Vater her sind Italiener gewesen, davon hat er die schwarzen Haare und die dunklen Augen behalten, und von den Blattern ein Gesicht voll Narben: so sieht er eher einem Savoyardenknaben ähnlich als einem Stadtzürcher und ist für sie ein fremder Vogel. Obwohl er nichts lieber gemocht hätte als mit ihnen spielen, macht ihn die Erfahrung scheu, sodaß er nun erst recht ein einsames Stubenkind wird.
6.
Später in der deutschen Schule tritt Heinrich Pestalozzi statt mit dem Babeli mit seinem Bruder Johann Baptista auf; der ist beweglicher als er und hat auch schon Bekanntschaften; dadurch kommt er mit den Knaben anfangs besser zurecht, um so leidvoller wird die Schule selber für ihn. Obwohl die Lehrer nicht solche Zornickel sind wie in der Hausschule, bleibt auch ihr Unterricht eine fortgesetzte Streitigkeit mit dem einzelnen Schüler, wobei sie die Schwächen eines jeden mit geübter Schulmeistergrausamkeit zu finden wissen. Heinrich Pestalozzi, dem es niemals völlig gerät, sich selber und seine Bücher in Ordnung zu halten, der bald ungekämmt in die Schule kommt, bald seine Schreibsachen oder Hefte vergessen hat, der aus den Spaziergängen seiner Gedanken aufgeschreckt die törichtsten Dinge zu sagen vermag und dem die richtigen Antworten meist erst auf dem Nachhauseweg einfallen, ist ihnen bald nur eine Gelegenheit, die herkömmlichen Schulwitze anzubringen. Daß er im ganzen eifriger als die meisten ist und sich leicht geschickter anstellt als es zu ihren Späßen paßt, stört sie nicht in ihren Hänseleien.
Und weil die Lehrer es so halten, widerstehen auch die Mitschüler der Verlockung nicht, ihren Witz an diesem Neuling zu üben, der nichts von ihren Spielen kennt und sich gutgläubig zum Narren halten läßt. Ihm steht diese Gutgläubigkeit gleichsam schon im Gesicht geschrieben, und seine linkischen Hände scheinen nur geschaffen, für ihr Gelächter fehl zu greifen. So weiß ihn eines Tages einer mit Äpfeln begehrlich zu machen, die er im Sack hat: er würde ihm den schönsten schenken, wenn er ihm damit auf sechs Schritte in den Rücken werfen dürfe. Mehr um der Tapferkeit als um des Apfels willen geht Heinrich Pestalozzi auf den Handel ein; der Knabe aber trifft ihn so hart zwischen den Schultern, daß er wie von einem Büchsenschuß hingestreckt wird, und — als er sich mit einer Übelkeit kämpfend an dem nassen Steintrog unter dem steinernen Brunnenmann aufrichtet — nur noch sehen kann, wie ein Flinker unter dem Hallo der andern den Apfel aufhebt und davon rennt.
Heinrich Pestalozzi fühlt damals schon, daß es die Absperrung seiner häuslichen Erziehung ist, die ihn so fremd und linkisch unter den andern Knaben macht; er ginge trotz solcher Späße gern nach der Schule zu ihren Spielen auf die Gasse, aber das Babeli, das immer mehr wie ein handfester Weibel die Stubenwelt der Witwe Pestalozzi regiert, duldet dergleichen schon aus Sparsamkeit nicht: Warum wollt ihr unnützerweise Kleider und Schuhe verderben? Seht eure Mutter, wie sie wochen- und monatelang an keinen Ort hingeht und jeden Kreuzer spart, euch zu erziehen! Und um dem Grund praktische Kraft zu geben, nimmt sie den Buben nach der Schule sogleich die Schuhe weg.
Heinrich Pestalozzi vermag nicht wie sein Bruder Johann Baptista den gutgemeinten Zwang mit allerlei Listen zu umgehen; er hat unterdessen durch die Mutter erfahren, was damals am Sterbebett des Vaters geschehen ist: da hat die Magd dem todkranken Wundarzt um ihrer Christenheit willen versprochen, die Frau nicht zu verlassen, weil seine Kinder sonst womöglich in fremde und harte Hände kämen! Das Babeli in seiner Einfalt, damals dreißigjährig, hat es dem Sterbenden in die Hand gesagt, an ihrem Platz zu bleiben, bis sie stürbe; auch hat sie tapfer Wort gehalten, als sie den Antrag eines ehrlichen Stadtbürgers ausschlagen mußte, und ist dem bedrängten Haushalt ohne Lohn durch alle Schwierigkeiten treu geblieben. Seitdem Heinrich Pestalozzi das weiß, kann er das faltige Sorgengesicht der guten Magd nicht anders als ehrfürchtig ansehen; und wenn der Großvater in Höngg dem Bild des himmlischen Vaters für seine Vorstellung die Züge herleiten muß, so vermag er die biblische Erzählung von Christus und den Schwestern in Bethanien nicht zu hören, ohne daß ihm seine Mutter zur still vertrauenden Maria und das Babeli zur schaffenden Martha wird. Soviel innige Gläubigkeit er aber damit auf die zarte Gestalt der Mutter legt, die — als Susanna Hotze in Richterswil bei den wohlhabenden Brüdern aufgewachsen — ihre bescheidene Lage niemals als Armut fühlt und auch den Kindern das Gefühl ihres guten Standes erhält; so wenig vermag er aus dem Evangelium eine Verachtung für die treue Magd zu ziehen, deren Stunden nichts als schaffende Sorgen kennen; ja, so oft er die abweisenden Worte Jesu liest, drängt ihn sein Gefühl, für die schaffende Martha aufzustehen.
7.
Heinrich Pestalozzi ist acht Jahre alt, als ihm eine Veränderung der äußeren Lebensumstände die Gedanken der Armut dennoch aufdrängen will. Seine Mutter, die immer noch die alte Wohnung gehalten hat, sieht sich genötigt durch die wachsenden Ausgaben für die Kinder, den Haushalt in der kleinen Stadt jenseits der Limmat bescheidener einzumieten. So lustig die Knaben mit dem Bärbel, das nun schon aus der Kammer in die Stube laufen kann, den äußeren Aufwand des Umzugs finden: so schmerzlich ist der Augenblick, als sie hinter dem Wagen mit ihrem Hausrat her — das Babeli trägt die Schwester auf dem Rücken, und die Mutter führt die Brüder an der Hand — am steinernen Rathaus hinübergehen auf die breite Bretterbrücke und in die kleine Stadt. Die ist freilich um den hohen Lindenhof herum gebaut, von dem die Schriften sagen, daß er schon in römischen Zeiten befestigt und der eigentliche Ursprung der Stadt gewesen wäre; aber darum lassen sie doch das Großmünster mit dem Haus Zwinglis drüben, von wo der Zürcher Glaubensheld für seinen Gott in den Krieg und Tod gezogen ist. Überdies will ein Mißgeschick, daß am Hotel zum Schwert gerade ein fremder Herr mit drei Rossen vorfahren will und bei der Wendung in die Deichsel ihres Gefährtes gerät. Der Ruck ist heftig und bricht dem Tisch, der hinten mit abgesperrten Beinen aufgebunden ist, eins davon ab, das schief herunterhängt. Gleich gibt es zwischen den Fuhrleuten ein Geschimpfe, und weil der ihrige zu Fuß geht, der andere aber in einer stolzen Uniform auf dem Bock sitzt, auch der Wirt zum Schwert gleich seinem vornehmen Gast zu Hilfe kommt, bleibt der mit den drei Rossen Sieger, indessen sie mit ihrer Habe, verbellt von Hunden, demütig um die Ecke ziehen.
Es ist kein großer Schaden; sie müssen den Tisch nachher in eine Wandecke stellen, damit er ihnen beim Abendbrot nicht umfällt; doch liegt die Stimmung des verschimpften Auszuges aus der großen Stadt so jämmerlich auf ihnen, daß sie miteinander in eine Heulerei geraten. Die neue Wohnung ist sichtlich beengter als die alte; außer der Küche mit einem Alkoven für das Babeli und der gemeinsamen Kammer für die andern hat sie nur einen Raum, der fortab Besuch- und Wohnstube in einem sein muß: es ist die Lebensluft verschämter Armut, in die sie nun eingezogen sind. Mehr als die Mutter hat das praktische Babeli auf den Umzug gedrängt.
Die Mutter will auch da noch die geborene Hotzin bleiben; und wenn in der Folge eine Bekanntschaft aus den besseren Zeiten, da der Wundarzt Pestalozzi noch auf die Jagd oder fischen ging, oder gar einer aus der vornehmen Verwandtschaft vom See den Weg in die kleine Stadt findet, wird die Stube jedesmal mit allem Staat aufgemacht, den sie aus ihrer Mitgift gerettet hat. Auch hält die einsam verhärmte Frau ängstlich darauf, was sie als Stadtbürgerin an Ehrengaben zu leisten ihrem Stande schuldig ist; und ob sie manchmal dem letzten Gulden mit Ehrenfestigkeit zu Leibe geht, und ob das Babeli danach die Kreuzer zusammenkratzen und auf dem Markt das Billigste erfeilschen muß: nach außen soll alles den Anschein eines unabhängigen Bürgerhaushalts behaupten.
8.
Für Heinrich Pestalozzi wird der Abstieg in die Armut dadurch gemildert, daß er gleich am andern Tag nach Höngg hinauskommt. Er ist mit der deutschen Schule zu Ende, und bevor er in die Lateinschule am Fraumünster eintritt, will der Großvater seinen Kenntnissen noch etwas nachhelfen. Er holt ihn diesmal selber ab; die Übersiedelung hat ihn besorgt gemacht, doch findet er alles recht und gegen Abend ist eine Kalesche da, sie miteinander hinauszufahren. Vor der Stadt darf Heinrich Pestalozzi auch einmal kutschieren; er zupft aber unablässig an den Zügeln, als ob es an ihm läge, daß die vier Beine sich bewegten, sodaß der Gaul am Ende wild wird und sie in einem unfreiwilligen Galopp nach Wipkingen bringt. Der Großvater liebt solche Vorfälle nicht; als er ihm kurzerhand die Zügel abgenommen und das Pferd zur Ruhe gebracht hat, sagt er strafend, das würde einem Knaben vom Land nicht begegnen; es wäre ein rechtes Stadtbubenstück. Er bleibt aber nicht unfreund mit ihm, und als er vor der Wegsteile gegen Höngg aussteigt und das Pferd am Zügel führt, nimmt er ihn gütig an der Hand, als ob trotzdem noch etwas Rechtes aus ihm werden könne.
Der Großvater hat den armen Kindern der Gemeinde erlaubt, hinter der Kirche zu spielen, wo neben dem Kirchhof ein sonniger Rasenplatz auf neue Gräber wartet. Obwohl manche von den Kindern nur mit Hudeln bekleidet sind, tadelt er es nicht, wenn seine Enkel an ihren Spielen teilnehmen. So ist Heinrich Pestalozzi eines Tages mit ihnen dabei, das Wasser aus einer Pfütze neben der Kirche in einer Rinne bergab zu leiten, wo es gerade den schönsten Wasserfall macht, als auf einmal einige der Kinder, dann alle auseinander laufen und sich unter der alten Steinbank, hinter Gräbern oder wo sie sonst einen Schlupfwinkel finden, verstecken: ohne ihr sonstiges Geschrei und sichtbar in Angst, nicht anders, als ob Hühner einen Habicht in der Luft gespürt hätten. Er hält alles zunächst für eins von ihren Spielen, aber so still es aus dem Kirchhof ist, so laut wird es auf der Landstraße: die Gestrengen Herren in Zürich haben allmonatlich eine Betteljagd verordnet, und nun kommen die Landreiter von ihrer Pirsch mit einer verlumpten Schar, Alten und Kindern, in einem langen Strick wie eine Schafherde eingehürdet.
Heinrich Pestalozzi besinnt sich nicht, er läuft nach vorn um die Kirche an den Torweg, und obwohl die Holzflügel schwer mit Eisen beschlagen sind, bringt er sie mit allen Kräften doch in die Riegel. Die Landreiter sind unterdessen schon durch das Dorf geritten, sie hätten sich auch schwerlich durch das Tor abhalten lassen; doch als er eben dabei ist, den Verschüchterten anzusagen, das Tor wäre zu und kein Landreiter könne herein, kommt der Großvater um die Kirche herum neugierig nach. Er hat das eilige Geschäft seines Enkels bemerkt, tut aber nicht weiter dergleichen, nur wie er ihn nachher an der Hand mit ins Pfarrhaus genommen hat und der Knabe in dem dämmrigen Hausflur schon denkt, er werde ihn strafen: hebt er ihn auf den Arm, als ob er ihm sagen wolle, bist ein tapferer Bub! Und als sie miteinander oben in dem Studierzimmer sind, wo er nun lernen soll, wendet er sich zu ihm hin, wie wenn er ein Großer wäre: Ich wüßte den Herren in Zürich andere Mittel als Landreiter und Betteljagden, der Armut auf dem Lande abzuhelfen!
9.
Als Heinrich Pestalozzi diesmal von Höngg zurück kommt, trägt er einen Schatz bei sich, mit dem er sich stolz und vieler Dinge mächtig fühlt. Um ihm den ungewissen Weg in die lateinische Wissenschaft vertrauter zu machen, hat ihn der Großvater das Vaterunser lateinisch gelehrt. Auf dem ganzen Weg nach Zürich hinunter, den er diesmal tapfer allein geht, sagt er die fremden Worte vor sich hin, ängstlich, daß ihm eins davon entfallen könnte. Es ist aber nicht die Schule, der zuliebe er sorgsam mit ihnen ist; dahinter steht das Bild des Großvaters als Lebensziel auf: auch einmal so in einem Dorf Seelsorger zu werden — womöglich in Höngg selber — den Armenkindern ein väterlicher Freund; das scheint ihm alle kommenden Mühsale der Schule wert zu sein.
Er wird auch im Fraumünster kein Schüler, wie ihn die Schulmeister brauchen können. Zu sehr gewöhnt in seiner behüteten Stubenwelt, die Dinge von sich aus zu erleben und eigene Wege in das Geheimnis der Augenwelt zu suchen, sieht er sich bei ihnen vor ein unaufhörliches Vielerlei von leeren Worten gestellt. Bloß auswendig Gelerntes herzuplappern, wie es die meisten tun, vermag er nicht; und selbst, wenn er etwas verstanden hat, wird es ihm schwer, Worte daraus zu machen, weil er sich damit leicht wie ein Komödiant vorkommt. Damit er etwas sagen kann, darf es nicht schon ausgedacht sein, es muß ihm aus den Gedanken selber, nicht aus dem Gedächtnis kommen: weil aber die Fragen der Lehrer selten in seine Gedanken treffen, findet er trotz bestem Willen und innerer Lebendigkeit wenig Gelegenheit, sich als guten Schüler zu zeigen; ja, weil er gerade dann, wenn ihn eine Sache des Unterrichts wirklich beschäftigt, leicht für Minuten und länger von dem unwiderstehlichen Fluß seiner Gedanken fortgetragen werden kann, stellt er nur selten den gelehrigen Schüler dar — der er doch ist —, sondern er wird gerade dann gescholten, wenn er vielleicht mehr als ein anderer bei der Sache ist. Am selben Tag kann er in einem Fach der beste und gleich darauf doch wieder der schlechteste sein; so kommt er bei allem Eifer auch in der Lateinschule bald wieder in ein feindseliges Verhältnis zu den Lehrern, das mit zornigen Strafen über seine Zerstreutheit anfängt und mit der Verspottung seiner absonderlichen Art ausgeht, ihn nach wie vor dem Gelächter der Klasse bloßstellend.
Obwohl das Babeli ihn stets ordentlich herausputzt, steht er doch in der Kleidung gegen die gepflegten Herrenbuben zurück, und was er von der mühsamen Ordnung heimbringt, ist manchmal übel genug. Auch hält das Babeli immer noch strenge Hauszucht, sodaß er auch jetzt nicht zu den Spielen der andern auf die Gasse darf und für die lateinischen Mitschüler der gleiche fremde Vogel bleibt, der er auf der deutschen Schule war. Als der erste Sommer zu Ende geht, hat er bei ihnen schon den Spottnamen, der ihm von da ab durch die ganze Schule bleibt: Heiri Wunderli von Torliken.
10.
Trotzdem hört Heinrich Pestalozzi allmählich auf, der unfreiwillige Spaßvogel seiner Mitschüler zu sein; er lernt sich zu wehren, und kommt durch einen Vorfall sogar in den Ruf einer besonderen Tollkühnheit:
Er ist ein Jahr lang Lateinschüler gewesen, als sein zeitweiliger Spielfreund Ernst Luginbühl aus Höngg in die untere Klasse eintritt. Dessen Vater ist herkömmlich ein verarmter Stadtbürger, der sich in sein dörfliches Anwesen hinein geheiratet hat, aber bis in seine Baumwollenweberei ein unruhiger Kopf bleibt, weshalb ihn auch der Großvater nicht gern in seiner Dorfgemeinde sieht. Ihm selber ist es mit allen möglichen Anschlägen fehl gegangen, darum will er seinem Buben eine bessere Bildung mitgeben und bringt ihn — der einen klaren Kopf hat und gern lernt — in die Lateinschule, wo er, älter als die andern, in die untere Klasse aufgenommen wird. Er hat noch immer seine roten Backen und die wasserhellen Augen, aber er trägt Schuhe an den Füßen und ist auch sonst für die städtische Schule zurecht gemacht, in einer ländlichen Art, die den Stadtkindern von selber zum Gespött wird. Heinrich Pestalozzi weiß längst, wie die Bürgersöhne den Knaben vom Land die Schule verleiden, als ob sie Eindringlinge in ihre Vorrechte wären; ihn selber lassen sie deutlich genug merken, daß seine Mutter nur eine Landbürgerin ist; nun aber trifft es seinen Freund, der in dieser fremden, feindseligen Welt mit den Bauernaugen um Mitleid zu flehen scheint. Jeden Morgen kommt er den mühsamen Weg von Höngg herunter, manchmal, wenn es geregnet hat, naß bis auf die Haut; und mittags, wenn die andern heimgehen, fertigt er seinen Hunger im Klassenraum mit einem Stück Brot ab. Er gerät in ein hartes und verstocktes Dasein, und wenn ihn Heinrich Pestalozzi anspricht, ist es fast, als ob er etwas von seinem Haß gegen die hochmütigen und grausamen Bürgersöhne auf ihn übertrüge, sodaß es hier in der Stadt keine rechte Fortsetzung der ländlichen Freundschaft geben will.
Eines Mittags kommt Heinrich Pestalozzi zufällig als der Letzte aus der Klasse und hört unter dem Gang im Hof ein Hetzgeschrei. Einige größere Knaben haben den mißliebigen Weberssohn in eine Ecke gedrängt und hauen auf ihm, der sich kratzend und beißend wehrt, mit Linealen herum; einer muß ihn am Kopf getroffen haben, denn aus dem weißblonden Haar laufen ein paar Zickzacklinien von Blut herunter. Heinrich Pestalozzi weiß nichts von dem Anlaß des Streites, er sieht nur das Blut, und wie sie ihren Übermut und Hohn an dem Knaben auslassen; darüber faßt ihn augenblicklich der zornige Eifer so, daß er blindlings aus der offenen Halle über die Steinbrüstung hinunter klettert. Es ist eine kleine Stockwerkshöhe, und er könnte sich leicht zu Tode stürzen, als er für einen Augenblick selber erschrocken an der Steinbrüstung hängt. Er purzelt aber einem, der sich gerade bückt, auf die Schultern, daß der bäuchlings hinfällt und ihn wie einen Igel abkugeln läßt, ist gleich von Zorn besessen wieder auf und springt auf die andern ein, die im ersten Schrecken auseinander rennen. Auch der von seinem Sprung Betroffene will fort, kann aber nicht auf und kriecht auf Händen und Füßen eilig davon. Darüber erheben die andern, die schadenfroh der Prügelei zugesehen haben, ein solches Hohngeschrei, daß ein Lehrer dazukommt, ehe die Überfallenen ihrem kuriosen Angreifer heimzahlen können. Es gibt nun zwar ein strenges Verhör, bei dem Heinrich Pestalozzi, weil er trotzig schweigt, als der allein Schuldige übrigbleibt und auch in Strafe genommen wird: aber mit seinem tollkühnen Sprung ist er doch Sieger geblieben, und die Schande einer feigen Flucht vor dem schmächtigen Heiri Wunderli von Torliken bleibt auf den andern sitzen. Das Babeli, als es durch den Johann Baptista davon hört, will ihn strafen, weil die Hosen zerrissen sind; aber die Mutter wehrt ihr und streichelt ihn.
11.
Im Dezember des gleichen Jahres sind die Schüler in der Klasse von Heinrich Pestalozzi gerade aufgestanden, ein Weihnachtslied zu üben, als es einen Erdstoß gibt, wie wenn Pferde einen Wagen anzögen, auf dem sie ständen. Sie hören in derselben Sekunde auf zu singen und halten sich an den Bänken fest; dann ist der Lehrer der erste, bei dem sich die Erstarrung auf die Gefahr besinnt. Mit langen Beinen springt er zur Tür, die Geige und den Bogen noch in den Händen; aber ehe er dort ist, drängen sich ihm schon die nächsten Knaben vor. Draußen quillt die Schreckensflucht aus den andern Räumen ebenso zur Treppe; und ist es zuerst totenstill gewesen, so erhebt sich nun das Geschrei; erst derer, die hinfallen und getreten werden, dann der andern, die davon angesteckt die letzte Besinnung verlieren. Es gibt keinen Einzelnen mehr, nur noch eine Herde, dahinein die Todesfurcht gefahren ist; und die am ehesten Kaltblütigkeit bewahren sollten, die schulmeisterlichen Hirten gehen mit langen Beinen über die Köpfe und abwehrenden Hände der Knaben hinweg.
Auch Heinrich Pestalozzi ist wie die andern von der Besessenheit gepackt worden und hat Arme und Beine gebraucht, sich in dem Strudel oben zu halten; aber darum haben seine Augen doch das unwürdige Beispiel der Lehrer aufgefaßt; und als er unten auf dem Hofe steht, wo rundherum die Stücke von Dachziegeln in dem schwärzlichen Schnee liegen und die Nachzügler kommen, die von den andern überrannt wurden und teilweise bluten — einer liegt leichenblaß seitwärts allein, weil er aus dem Fenster gesprungen ist und den Fuß gebrochen hat — muß er weinen vor Zorn. Die meisten drängen auf die Gasse hinaus, wo die Bürger unterdessen aus den Werkstätten gelaufen sind und in den Himmel starren, der unbewegt über dem Erdbeben steht. Die zurück bleiben, möchten zum Teil gern ihre Bücher und Hüte herunterholen, aber keiner wagt sich hinein; obwohl nach der ersten Erschütterung, die gleich einem langen Gerolle von unterirdischen Wagen gewesen ist, nichts mehr geschieht und die leeren Gebäude gleichsam verwundert auf die ängstliche Menschheit herunter sehen. Der Widerspruch zwischen dieser lächerlichen Flucht und dem alten Heldentum, davon sie täglich durch die selben Lehrer hörten, macht, daß ihm sein Knabenherz trotzig aufspringt, sich selber und den andern ein Beispiel von Tapferkeit zu geben. Während einige Bürger in den Schulhof gekommen sind und den Jungen mit dem zerbrochenen Fuß aufheben, geht er in das verlassene Schulhaus zurück: obwohl es unheimlich ist auf der leeren Treppe und oben im Gang, wo alle Türen offen stehen, kommt er bis an die Klasse und holt seine Sachen heraus; auch einigen andern bringt er mit, was er rasch greifen kann; und nachher zwingt er seine Furcht, daß er die Treppe nicht hinunter springt, Schritt für Schritt die Stufen nimmt und triumphierend zu den Wenigen hinaus tritt, die da noch warten.
Als er danach heim kommt in die Stube, ist der Johann Baptista schon längst dabei, dem Bärbel das Abenteuer zu erzählen, indessen das Babeli verzweifelt durchs Fenster sieht und ihn scheltend empfängt, daß er so spät käme; nun wäre die Mutter aus Angst um ihn schon auf die Gasse gelaufen! Er könnte ihr anders antworten; doch wirft er nur die Sachen verächtlich auf einen Stuhl und springt hinunter, den Schrecken der Mutter abzukürzen. Er findet sie auch gleich, wie sie mit blassem Gesicht zurück kommt und ihn erblickend nichts anderes vermag, als ihn hastig am Arm zu nehmen, wie wenn sie ihn jetzt noch retten müßte.
Bei den Genossen aber gilt der Heiri Wunderli seit diesem Erdbebentag als einer, der sich aus Großmannssucht für etwas Besseres hält, und ihrem Spott ist fortab deutlich der Haß beigemischt, der für das Ungewöhnliche das sicherste Erbteil unter den Menschen ist.
12.
Mit zwölf Jahren kommt Heinrich Pestalozzi wieder hinüber in die große Stadt, wo seine Mutter im Haus zum Roten Gatter an der Münstergasse eine billige Wohnung gefunden hat. Er tritt nun in die Lateinschule am Großmünster über und verliert dadurch seinen ländlichen Freund aus Höngg ganz aus den Augen. Um so betroffener wird er, als er beim Großvater in die Ferien einrückt und dort erfährt, dem Baumwollenweber sei es zu teuer geworden mit der Schule, auch habe der Ernst Luginbühl selber die Plage mit den Stadtsöhnen nicht mehr gemocht. Er benutzt den ersten Ausgang, ihn zu besuchen; schon draußen vor dem kleinen, windschiefen Haus hört er den Webstuhl klappern, aber als er zögernd hinein kommt, sitzt statt des bärtigen Baumwollenwebers der Sohn im Gestänge. Es ist so laut in der Stube, daß der ihn nicht gleich bemerkt; als er sich nachher umsieht, dauert der Streifblick nicht länger als eine Sekunde, dann starrt er wieder in seinen Webstuhl.
Heinrich Pestalozzi denkt, daß es die Arbeit so erfordere, und wartet geduldig eine Pause ab; als sich nach einer Viertelstunde immer noch nichts ändert an dem gleichförmigen Takt, ruft er ihn an, erst leise, dann mehrmals lauter: der andere aber zieht nur trotzig die Schultern ein. Da merkt er, daß ihn der Ernst Luginbühl nicht mehr ansehen will, und in einer tief rinnenden Traurigkeit verläßt er die Stube. Draußen sieht er gerade noch, wie die mattrote Sonnenscheibe in dem Wolkengerinnsel am Horizont versinkt; was ein warmer Glanz mit lustig langen Schatten war, als er herauf kam, ist nun eine rote Glut, die sich brandig in den Himmel einfrißt. Nur am Ütliberg läuft noch eine feurige Kante hinauf, und unten starrt das Kriegslager von Zürich vor dem See, als ob es dunkel auf eine bläßliche Glasscheibe gemalt wäre. Er fühlt mit seinen zwölf Jahren, daß alles, was bisher in seinem Herzen gewesen ist, Zorn und Empörung, Mitleid und Freude: mit den Stunden kam und verrann, wie dort das Sonnenlicht verrinnt und morgen wiederkommt; aber, was da am Webstuhl angeschlossen ist, kam nicht mehr los aus seiner Unabwendbarkeit.
Heinrich Pestalozzi vermag nicht ins Pfarrhaus zurückzugehen; bis zur Dunkelheit sitzt er am Rain und versucht, aus dem Knäuel dieser Gedanken heraus zu kommen. Das einzige, was er gewinnt, ist ein Gefühl, dass bis zur Stunde alles eitel und selbstsüchtig in ihm war: nur, weil er die reichen Verwandten am See und hier den Großvater im wohlbestallten Pfarrhaus hat, durch kein anderes Vorrecht, ist er vor dem gleichen Schicksal behütet. Je tiefer er sich da hinein denkt, um so mehr schämt er sich vor dem Knaben und um so glühender wird sein Wunsch, ihm wenigstens ein Pfand der Liebe aus seinem Herzen hinzulegen, da er ihm sonst nicht helfen kann. Und als er das Pfand gefunden hat — es darf nur das Liebste sein, was er besitzt — hindert Heinrich Pestalozzi nichts mehr, sein Herz zu erfüllen:
Vor der Tür des Pfarrhauses, aus dem ein Licht der Wohlhabenheit in den Abend leuchtet, zieht er die Schuhe aus und schleicht auf Strümpfen in die Kammer. Der Ranzen ist noch nicht ausgepackt, und seine Hände wühlen im Dunkeln nach dem silberbeschlagenen Testament, das seine Mutter von ihrem Vater zur Konfirmation erhalten und ihm kürzlich am Grab des eigenen Vaters in die Hand gegeben hat. Er fühlt das Unrecht, das er damit tut: es gehört ihm selber garnicht, es ist ein Vorrecht vor den Geschwistern, es zu haben. Aber gerade das bestimmt ihn, es herzugeben; denn nur darum ist er wie alle übermütigen Stadtbürgersöhne in Zürich gegen den Weberknaben im Vorteil, weil sie in den Reichtum solcher Familienstücke hineingewachsen sind! Und daß es ein Liebespfand von seiner Mutter ist, darauf hat Christus selber zu Maria gesagt: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen?
Als er zitternd und mit einem schmerzenden Knie, weil er im Eifer gefallen ist — auch die Schuhe wieder anzuziehen, hat er vergessen — zu dem Knaben in die Stube kommt, ist von dem Lichtspan an der Wand ein trübes Licht darin, das die Schatten des Webstuhls wie Ratten in dem halbhellen Raum hin und her laufen läßt. Diesmal hört der Ernst Luginbühl gleich auf zu weben, so sehr scheint er erschrocken, wie einer aus der Dunkelheit mit bittend hingestreckten Armen in sein Licht kommt. Vor den heißen Augen weiß Heinrich Pestalozzi keins von den Worten zu sagen, mit denen er her gelaufen ist; weil die Hände des Knaben am Webstuhl hängen bleiben, legt er ihm das Testament mit dem blinkenden Silber darauf. Wohl eine Minute lang ist es still um die Atemzüge der beiden Knaben, wie wenn dieses Liebespfand sie wirklich vereinen könnte; dann reißt der Webersohn die Hände fort, als ob ihn mit dem kalten Metall des Buches ein widerliches Tier berührt hätte. Klappernd fliegt es gegen das Holz und fällt seitwärts auf den Lehmboden; doch darf es auch da nicht liegen, der Dämon in dem Knaben fährt auf und spuckt danach; und als Heinrich Pestalozzi schützend seine Hände über sein Heiligtum breiten will, tritt er mit beiden Füßen darauf, bis es in den Lehm eingestampft ist. Erst dann bricht er schluchzend aus und läuft durch die offene Tür in die Nacht.
Heinrich Pestalozzi meint, die Mutter laut mit sich weinen zu hören, als seine zitternden Finger das Buch aus dem Boden graben; mit einem Grauen, darin das Großmünster aus seiner ersten Jugend über ihm einstürzt, geht er aus der Stube. Am Zürichberg wird unheimlich das Signal der Mondscheibe aufgezogen; so rot ist sie, als hätte sie dem Abendrot das Blut ausgetrunken. Und wenn Heinrich Pestalozzi auch erst nach Jahren die Verzweiflung verstehen soll, die ihm sein Liebespfand bespien und zertreten hat, eine Ahnung trägt er schon an diesem Abend ins Pfarrhaus hinunter: alles andere, nur nicht das gedruckte Evangelium hätte er dem Knaben auf die Hände legen dürfen, der sich von einer auf dieses Evangelium gegründeten Welteinrichtung verraten fühlt.
13.
Seitdem geschieht es Heinrich Pestalozzi häufig, daß er unversehens an den Webstuhl in Höngg denken muß; er meint dann, das unaufhörliche Geklapper zu hören, und kann, wenn er sich auf die Schulgegenwart besinnt, staunend in eine neue Anschauung der Wirklichkeit versinken: die sonst nur als der Kreis seiner Sinne um ihn gewesen ist oder in seiner Erinnerung ein Bilderbuchdasein geführt hat, je nachdem er zufällig an etwas dachte, wächst sich zur Weite ihrer unabhängigen und ungeheuren Existenz aus. Es wird ein leidenschaftliches Spiel seiner Einbildung, sich vorzustellen, was alles in der gleichen Stunde geschieht, da er mit seinen Büchern dasitzt: wie der Großvater in Höngg den Pfarrhut in seiner Studierstube aufsetzt und hüstelnd — er geht nun schon an die siebzig — die Treppe hinuntersteigt, die Kranken der Gemeinde zu besuchen; wie die Großmutter unterdessen mit ihren runzeligen Händen im Garten schafft, manchmal ein Viertelstündchen mit einer Nachbarin plaudernd; wie rund herum in den Weinbergen und Feldern die Bauern sich nach ihrer Arbeit bücken; wie auf der Straße die Kaufmannswagen, mit runden Tüchern überspannt, ihren Trott dahingehen, oft überholt von den Staubwolken eiliger Reisenden; wie bald ein Sonnenstrahl, bald ein Wolkenschatten hinläuft über das breite Limmattal, über die reisige Stadt Zürich und die Großmünstertürme — daneben er selber im Schulhaus sitzt und dies alles denkt — über den langen See hin bis Richterswil und weiter hinauf gegen den blaudunklen Wall der Berge, die sich nicht so leicht überrennen lassen, über ungezählte fleißige Menschen hin, welche, die fröhlich singen, und andere, die um einer Not willen verzweifelt sind. In der Weite und unausdenkbaren Vielgestaltigkeit dieses Lebens fühlt er sich und seine Pfarrpläne kaum anders als den Vetter am See, der mit seinem Federhut den Soldaten spielt. Die Welt ist nicht mehr so, daß einer mit seiner Knabeneinfalt hineingehen und ihre Dinge umgestalten kann, die Dinge selber sind es, die mit ihrem unübersehbaren Zustand den Einzelnen festhalten und nötigen. Wie die Unheimlichkeit des Großmünsters drohend gegen die Stubenwelt seiner frühen Knabenjahre aufgestanden ist, so kommt jetzt der Lebenskreis der Dinge; nur, daß er diesmal die wirklichen Zusammenhänge fühlt und demütig die Überhebung seiner Knabenpläne einsieht.
Dazu kommt etwas Zufälliges, das freilich mit dieser Art, die Dinge zu empfinden, zusammenhängt, ihn völlig verzagt zu machen: Weil er im Examen der Erste gewesen ist, trifft es ihn, daß er das Gebet vor der Klasse sprechen muß. So feierlich für ihn die Worte des Vaterunsers sind, da er sie selber zum erstenmal öffentlich sagen soll, überfällt der komische Zwiespalt zwischen seiner in tausend Täglichkeiten verbrauchten Knabenstimme und dem feierlichen Aufwand, den er damit treiben soll, sein verscheuchtes Selbstgefühl derartig, daß er einem unwillkürlichen Zwang zu lachen nicht widerstehen kann und dadurch zu einer ernstlichen Vermahnung kommt. Auch in der Folge verliert sich dieses Hindernis nicht; so oft er in der Schule oder gar in der Kirche etwas öffentlich aufzusagen hat, ist das stete Gefühl dabei, vor den anderen Knaben lächerlich dazustehen, und er braucht dann nur seinen Blick mit einem andern zu kreuzen, um auch schon auszuplatzen. Es ist ihm sicher, daß er niemals als Pfarrer seine Stimme in der Kirche wird erheben können, ohne diesen Zwang zum Lachen. Die erste Erkenntnis der Weltzusammenhänge hat ihm die Unschuld seines Knabendaseins unsicher gemacht, und ängstlich fragt er, ob sie ihm jemals wiederkommt?
14.
Als Heinrich Pestalozzi mit dem fünfzehnten Jahr aus der Lateinschule übertritt in das sogenannte Collegium Humanitatis, das auch beim Chorherrngebäude des Großmünsters liegt, ist von seinen Knabenplänen nichts geblieben als die Verzagtheit, überhaupt einen Platz mit seinem Dasein in der Wirklichkeit zu finden. Da hilft ihm zum erstenmal seine Vaterstadt; indem er anfängt, die Dinge zu beobachten, wie sie außer dem Kreis seiner Sinne ihre eigenen wechselvollen Zustände haben, sieht er sich unerwartet vor ihre Vergangenheit gestellt. Diese Bastionen und Stadttürme, Kirchen und Brücken: das alles ist nicht immer so gewesen, wie es nun für seine Augen dasteht. Es ist die Erbschaft der Jahrhunderte — wie die öffentlichen Einrichtungen der Zünfte, der Lehrschulen und Gottesdienste auch — von Menschenhänden in den ewigen Kreislauf der Natur gestellt und von Menschen in der unaufhörlich ablaufenden Frist ihrer irdischen Gegenwart verändert. Noch bevor er Schüler vom alten Bodmer wird, der seit Jahrzehnten in Zürich helvetische Geschichte lehrt, verfällt er mit Eifer auf die Geschichte der stolzen Heimatstadt. Gerade weil sie ihm mit ihren finsteren Gassen nie so heimelig geworden ist wie das Land, und weil sein Gefühl sich so schwer zurechtfindet mit den Einrichtungen, die überall Ehrfurcht fordern und ihn bedrücken: sucht er hitzig nach der Herkunft aller dieser Dinge und Sitten, als ob es ihm so gelingen müßte, sein eigenes Gefühl aus der drohenden Ungewißheit in eine sichere Übereinstimmung mit der Heimat zu bringen.
So liest Heinrich Pestalozzi, der zwischen den Bürgersöhnen immer noch ein schmächtiges Gewächs und der Heiri Wunderli von Torliken ist, die mehr als tausendjährige Geschichte seiner Stadt: wie schon zu römischen Zeiten der Lindenhof ein befestigtes Kastell war und in den Märtyrern der thebäischen Legion, Felix und Regula, seine christlichen Schutzheiligen gewann; wie Karl der Große ihm seine geistlichen Stifte, das Großmünster und das Fraumünster, gab und eine Reichsvogtei das römische Kastell auf dem Lindenhof ablöste; wie es lange vor dem Eintritt in die Eidgenossenschaft reichsfrei und ein mächtiges Stadtwesen war, bis es durch Zwingli der Vorort der reformierten Christenheit wurde. Er liest von den berühmten Bürgermeistern der Stadt: von Bruns, dem ränkevollen Aufrührer der Innungen, der die Regierungen der Zünfte gegen die Geschlechter begründete und in der Züricher Mordnacht die von Rapperswil eingebrochenen Adeligen grausam unterwarf; von dem riesenhaften Stüssi, der um das Toggenburger Erbe den Krieg mit den Eidgenossen aufnahm und vor dem Stadttor an der Sihlbrücke fiel; von Hans Waldmann, dem Helden zu Murten, unter dessen Hand Zürich zum Vorort der ganzen Eidgenossenschaft wurde, bis er, von seinem eigenen Glanz verblendet, seinen Gegner, den Volkshelden Frischhans Theiling, hinrichten ließ und bei der Empörung der Seebauern selber den stolzen Hals aufs Schafott legen mußte. Er liest, wie sich die Bürgermeister um Geld an mächtige Fürsten verkauften, wie Zürich um seines Vorteiles willen mehrmals die Eidgenossen an die Österreicher verriet, und wie durch den Bundesvertrag mit Frankreich das Reislaufen der Eidgenossen ein bezahltes Handwerk wurde. Aber dann kommt Zwingli, der gegen diese wie andere Unsitten in Zürich ein Regiment schweizerischer Mannhaftigkeit aufrichtet und, obwohl er selber bei Kappel kläglich umkommt, Zürich zur evangelischen Glaubensburg macht. Aus dem ränkevollen Spiel der Jahrhunderte wächst ihm die Gestalt dieses Glaubenshelden zu einer Größe heraus, daneben die Figuren der Bürgermeister in den schwankenden Schatten böser Leidenschaften versinken.
Alle diese Dinge liest Heinrich Pestalozzi, wie ein anderer Zürcher Knabe die Geschichte seiner Vaterstadt auch gelesen hätte; aber unvermutet kommt eine Begebenheit, die seine eigene Herkunft angeht und danach lange den heimlichen Schlüssel seiner vaterländischen Gefühle abgibt: Zwingli ist seit vierundzwanzig Jahren tot, und überall haben die Evangelischen mit der katholischen Gegenreformation zu kämpfen; da ziehen an einem Mittag des Jahres 1555 einhundertsiebzehn Flüchtlinge in Zürich ein, ziemlich die ganze reformierte Gemeinde aus Locarno, die mit ihrem Pfarrer Beccaria über den schneebedeckten Bernardino und den Splügen, durch Lawinengefahr und die Frühjahrsschrecknisse der Via mala gewandert ist und in dem Nachfolger Zwinglis, dem Münsterpfarrer und eigentlichen Regenten von Zürich, Heinrich Bullinger, einen mannhaften Beschützer findet. Heinrich Pestalozzi weiß vom Großvater, daß seine Familie ursprünglich italienisch und um des Glaubens willen eingewandert ist: nun erkennt er die Umstände und wie tief er — mütterlicherseits sogar ein direkter Abkömmling jener Flüchtlinge — der Stadt Zürich verpflichtet ist. Zum andernmal wächst das Großmünster mächtig auf vor einem Gefühl, aber es ist kein Grauen mehr; er sieht die beiden Türme als reisige Wächter seines Glaubens die Stadt behüten, und wenn nun Sonntags die mächtigen Glocken darin läuten, ist es der Schlachtgesang Zwinglis und seiner Getreuen, die für das Evangelium hinaus reiten in den Tod.
15.
Seitdem sich Heinrich Pestalozzi selber als einen Schützling dieser mächtigen Stadt erkannte, mag er einsam durch ihre Straßen gehen und sich allein von solchem Gang beglückt fühlen: Es braucht nur ein Hufschmied zu hämmern, und schon hört er Schwertschlag auf stählerne Panzer, und wenn er Sonntags mit der Gemeinde in den hohen Münsterhallen singt, beim Donnerschall der Orgel, wenn er den Prediger das Buch vom Altar nehmen sieht, wie es Zwingli an derselben Stelle genommen hat, mischt sich mit dem ehrfürchtigen Grauen der Stolz und Dank seiner von unbändigen Erinnerungen erfüllten Seele. Er weiß nun, was es bedeutet, daß der steinerne Karl außen hoch am Münsterturm das Schwert flach auf den Knien hält und warum auf den Brunnen die reisigen Männer stehen. Als er einmal mit in die Zwölfbotenkapelle unter dem Großmünster hinunter darf, läuft er nachher wohl eine Stunde lang weinend vor Glück an der Limmat hin.
Es ist, als ob er nun die Stadt erst sehe, in der er aufgewachsen ist; und wenn er durch eine der alten Porten hinaus geht, die noch immer wehrhaft dastehen, obwohl draußen die wohlgerüsteten neuen Bastionen sind, kann es ihm ängstlich werden, die schützende Grenze zu überschreiten. Der schwarze Pfahlwall im See am Grendel, der mit der Dunkelheit die Schifffahrt absperrt, der Wellenbergturm mitten in der Strömung, das mit mächtigen Quadern ins Wasser vorgebaute Rathaus, die stattlichen Zunfthäuser und der breitbedachte Rüden am Stücklimärt, wo immer noch die Constafel, die Geschlechter, tagen, das Haus zum Königstuhl mit seinem derb vorgebauten Erker, darin der Bürgermeister Stüssi gewohnt hat, oder das Haus zum Loch, mit seltsamen Sagen dem großen Kaiser Karl verknüpft: jeder Stein der Stadt wird mit dem Bewußtsein der Geschichte lebendig, die daran gebaut hat.
Auch empfindet er nun, daß es etwas anderes ist, ob der Antistes von Zürich durch die Straßen geht, oder ob sein Großvater von Höngg zu einer Besorgung herein kommt; und als er erst einmal in der Wasserkirche gewesen ist, wo die alte Bibliothek der Stadt in zwei Galerien eingebaut steht und mit den alten Ölbildern an den Wänden gleichsam das Uhrwerk ihrer geistigen Geschichte darstellt, wird der stille Saal für ihn ein Raum mancher heimlichen Feier. Von hier aus beginnt er mit Stolz nach den Männern zu sehen, die zum Ruhm und Vorbild der Bürgerschaft leben, und wenn er nun den greisen Bodmer daherkommen sieht, fühlt er: es ist mehr als ein Professor der helvetischen Geschichte, es ist der Geist dieser tapferen Geschichte selber, der unter seinen buschigen Augenbrauen in die Gegenwart blitzt.
16.
In dieser Zeit fängt Heinrich Pestalozzi auch an, Kameraden zu bekommen; er ist den Wunderlichkeiten des alten Babeli entwachsen, und so sehr die Gute schilt, wenn seine Kleider bei einer unnützen Kletterei an der Stadtmauer oder sonst Schaden genommen haben: er ist zu lange in ihrer Stubenhaft gewesen, um nicht mit Ausgelassenheit die Freiheit solcher Streifereien zu genießen. Sogar reiten lernt er, als wieder einmal der Vetter Weber aus Leipzig für einige Zeit in Zürich auf Geschäften ist und ihm eins von seinen Rossen leiht. Es geht ihm immer noch wie damals bei dem Großvater in der Kalesche, er kann nicht mit dem Gaul übereinkommen, hält sich an den Zügeln fest, als ob es Rettungsseile wären, und macht das arme Tier einmal am Hottinger Pörtchen so wild, daß es auf der Holzbrücke anfängt, Männchen zu machen, und ihn beinahe über das Geländer in den Stadtgraben hinunter wirft. Schon läuft der Torwächter erschrocken hinzu, und die Spaziergänger flüchten sich; irgendwie aber bleibt er doch noch im Sattel hängen, das Pferd zieht es vor, den Stall zu suchen, und er widerstrebt ihm nicht, obwohl er dabei seine Mütze verliert und nicht gerade eine Reiterfigur macht.
Schlimmer geht es ihm jenes Mal, als er an einem Sonntagnachmittag mit einigen Kameraden in einem Weidling nach Wollishofen hinausgerudert ist und nachher wieder heim will. Sie sind nach Knabenart laut gewesen, haben Schweizerlieder gesungen und in dem schwanken Schiff ihre Katzbalgereien gehabt, als ob ihnen garnichts Schlimmes begegnen könnte. Beim Einsteigen aber, als sie noch mitten im Gelächter sind, kommt er mit dem einen Fuß nicht vom Landungssteg los, während er den anderen schon auf den Rand gesetzt hat. Durch den Ruck weicht das Schiff unter ihm fort, bis seine Beine zu kurz für die Spannung sind und er kopfüber in den See kippt. Er kann nicht schwimmen; das Wasser ist ihm immer unvertraut gewesen, und nur dadurch, daß die andern ihm schnell das Ruder hinhalten, als er mit zappelnden Armen hoch kommt, ertrinkt er nicht. Sie schleppen ihn daran wie einen gefangenen Fisch gegen das Ufer zurück, wo sie ihn diesmal mit größerer Vorsicht ins Boot holen wollen. Er mag aber nicht mehr, verschlägt sich unter den Scherzen der andern seitwärts an eine durch Büsche geschützte Uferstelle und trocknet da seine Kleider in der Sonne. Das dauert einige Stunden, während die andern wieder ihre Tollheiten in dem Kahn machen und ihn schließlich, seine Feigheit verhöhnend, im Stich lassen. Daß seine Kleider naß geworden sind, macht ihm nichts aus bei der Sonne; auch ist er so rasch wieder oben gewesen, daß er gleich mit den andern dazu gelacht hat: nun er aber allein so am Wasser sitzt, das auf eine gierige Art ans Ufer schwappt, fängt das Erlebnis an, ihn schwermütig zu machen. Er hat, als er untersank, für einen Augenblick die Augen der Mutter dicht vor den seinen gesehen, und den Großvater dahinter, wie er ihm die Hand auf die Schultern legte: nun hört er das übermütige Geschrei der Knaben vom See und kann nicht begreifen, daß er selber dabei war. Es wäre nichts als ein unnützer Knabe gewesen, den das Wasser an ihm verschluckt hätte; weil aber nichts so heftig in seiner Seele aufbegehrt als der Ehrgeiz, sich selber wert zu halten und es den großen Männern seiner Stadt einmal gleich zu tun, werden für Heinrich Pestalozzi die beiden Nachmittagsstunden, während er am See bei Wollishofen in der Sonne sitzt, zu einem Selbstgericht, wo ein beschämter Jüngling die Kleider halbtrocken wieder anzieht, die sich der Knabe naß vom Leib gerissen hat.
Stärker als damals in Höngg vor der Tür des Ernst Luginbühl ist das Gefühl eines eitlen und selbstgefälligen Daseins in ihm. Mit all seinem Selbstbewußtsein, mit seinen Vergangenheitsträumen und spintisierten Taten ist er doch nur ein Schüler, nach dem niemand fragt, als die, denen er mit seinen Großsprechereien zuleide ist. Seine Auflehnung gegen die Ungerechtigkeit der Lehrer, wenn der Kantor betrunken in die Singstunde kommt oder der Provisor Weber — der selbe, der sich einmal eine Laus vom Kopfe nahm und ihm auf dem Papier zerknickte — dem Ludwig Hirzel vom Schneeberg ein paar Fehler übersieht, weil dessen Eltern ihm eine Metzgeten ins Haus geschickt haben; sein ganzes Weltverbesserertum setzt er nun gegen die Unfähigkeit, mit sechzehn Jahren sich selber und seine Kleider in Ordnung zu halten oder einen Heller zu haben, den er seiner Mutter nicht abgebettelt hat, als ob die ganze Schöpfung nur da wäre, einem Schulknaben nach seinen Einfällen und Sinnen gefällig zu sein.