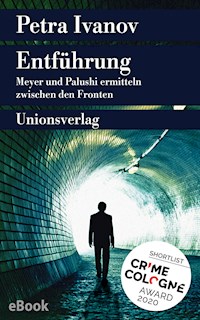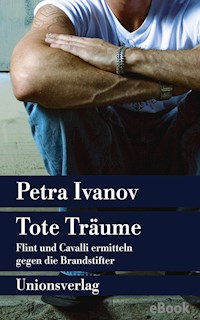12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bei der Bergung eines Schiffsmotors vom Grund des Zürichsees stößt ein Polizeitaucher auf die Leiche eines Mannes. Dessen Glieder wurden mit Hanteln beschwert, was einen Unfall ausschließt. Da der Tote in der Schweiz nicht vermisst wird, schalten Staatsanwältin Regina Flint und Kriminalpolizist Bruno Cavalli Interpol ein. Bald wird klar: Die Beschreibung passt auf einen argentinischen Journalisten, der vor sechs Monaten spurlos verschwunden ist. Doch was führte Ramón Penasso nach Zürich? Und woran arbeitete er vor seinem Tod? Weil die Untersuchung nicht vorankommt, fliegt Regina Flint nach Buenos Aires. In Zürich überschreitet Bruno Cavalli auf der Jagd nach dem Täter die Grenzen des gesetzlich Erlaubten. Denn er hat nichts mehr zu verlieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über dieses Buch
Vom Grund des Zürichsees wird eine Leiche geborgen, deren Glieder mit Hanteln beschwert wurden, was einen Unfall ausschließt. Der Tote ist ein argentinischer Journalist, der vor sechs Monaten spurlos verschwunden ist. Doch was führte Ramón Penasso nach Zürich? Und woran arbeitete er vor seinem Tod?
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Petra Ivanov verbrachte ihre Kindheit in New York. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz absolvierte sie die Dolmetscherschule und arbeitete als Übersetzerin, Sprachlehrerin sowie Journalistin. Ihr Werk umfasst Kriminalromane, Thriller, Liebesromane, Jugendbücher, Kurzgeschichten und Kolumnen.
Zur Webseite von Petra Ivanov.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Petra Ivanov
Leere Gräber
Flint und Cavalli ermitteln in Argentinien
Kriminalroman
Ein Fall für Flint und Cavalli (6)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Die Erstausgabe erschien 2012 im Appenzeller Verlag, Schwellbrunn.
© by Petra Ivanov 2012
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: ovokuro
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30961-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 26.06.2024, 10:52h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
LEERE GRÄBER
Montevideo, UruguayTeil 1 — September1 – Es war ein kurzer Sommer gewesen. Der nasse …2 – Regina Flint schaute auf die Uhr. Noch zehn …3 – Der Tote lag in einem offenen Leichensack in …4 – Cavalli hasste es, seine Tochter in die Krippe …5 – Sie stand am Grab. Obwohl sie wusste …6 – Vera Haas legte den Telefonhörer auf. Im Kanton …7 – DNA und Röntgenbilder stimmen überein«, sagte Uwe Hahn …8 – Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als der …9 – Regina betrat das Kripo-Gebäude gleichzeitig mit Uwe Hahn …10 – Leistungen entfalten bei Leistungsempfängern bestimmte Wirkungen. Sowohl für …Teil 2 — Dezember1 – Schnee bedeckte das Zürcher Unterland. Regina versuchte …2 – Sie hatte immer gern getanzt, schon als kleines …3 – Gonzalo Campos war in jeder Hinsicht durchschnittlich …4 – Der Mond schien zwischen den kahlen Ästen hindurch …5 – Regina unterdrückte ein Husten. Die Abgase erschwerten ihr …6 – Das Tigre Delta bestand aus unzähligen Wasserwegen …7 – Als Erstes zog sie die Schuhe aus …8 – Der Duft von warmen Äpfeln schlug Cavalli entgegen …9 – Die Aussicht vom Cabildo, wo früher der Senat …10 – Als Elena Alvarez de Campos das Büro des …11 – Heinz Gurtner wohnte zusammen mit seiner Frau Helen …Teil 3 — Februar1 – Der Winter hatte die Schweiz fest im Griff …2 – »Sallo«, sagte Cavalli, »heißt ein Fitnessstudio in Zürich-Altstetten …3 – Regina klemmte sich die Akten unter den Arm …4 – Cavalli rollte seinen Schlafsack zusammen und legte ihn …5 – Cavalli drückte auf die Klingel. Alois Ehm kam …6 – Thomas Lauterburg war nicht anzusehen, dass er mehrere …7 – Roswitha Wirz kniff die Augen zusammen. Haas hielt …8 – Es fiel Cavalli schwer, der blonden Frau …9 – Alois Ehm, Susanna Ehm, Thomas Lauterburg, Gabriela Lauterburg« …10 – Ich will die Unterlagen sehen«, sagte Regina11 – Alois Ehm hat gestern Mittag seine Koffer gepackt …12 – Paz betrachtete die Anzeigetafel der S-Bahn. Diesmal wusste …13 – Lily zeichnete mit dem Finger eine rosarote Blume …GlossarWorterklärungenAbkürzungenMehr über dieses Buch
Über Petra Ivanov
Petra Ivanov: »Meine Figuren sind lebendig. Wenn ich nicht schreibe, verliere ich den Kontakt zu ihnen.«
Petra Ivanov: »Mein Weltbild hat sich zum Besseren verändert, seit ich Krimis schreibe.«
Mitra Devi: Ein ganz und gar subjektives Porträt von Petra Ivanov
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Petra Ivanov
Zum Thema Schweiz
Zum Thema Zürich
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Argentinien
Für Karin und Regula
»Es bleiben Türen offen, die man besser schließen sollte.«
Ruth-Gaby Vermot-Mangold, ehemaliges Mitglied des Nationalrates und der Parlamentarischen Versammlung des Europarates
Montevideo, Uruguay
Der Wind pfiff durch die Gassen der verlassenen Altstadt. Er erfasste ein Blatt der Tageszeitung »El País« und wirbelte es durch die Luft. Wie ein Geist schwebte es über der Plaza de la Constitución, bevor es zu Boden segelte. Dort wand es sich zwischen einer PET-Flasche und den Resten einer Kartonschachtel. Als ein weiterer Windstoß vom Río de la Plata her über die Halbinsel fegte, wurde das Blatt erneut in die Höhe gehoben. Diesmal endete sein Flug, als es auf Widerstand stieß.
Ramón Penasso bemerkte das Zeitungsblatt nicht, das ihm am Schienbein klebte. Konzentriert glitt sein Blick über die bröckelnden Fassaden. Kaum waren die Läden geschlossen, glich das Quartier einer Geisterstadt. Einzig zwei Touristen standen mit Kameras vor der Iglesia Matriz, um den verblichenen Charme der Kirche einzufangen. Als das Klappern von Pferdehufen erklang, drehten sie die Köpfe. Ein Kartonsammler bog auf seinem Wagen um die Ecke, das dunkle Gesicht ausdruckslos.
Ramón umklammerte die Plastiktasche, die er bei sich trug, fester. Er hatte absichtlich den Weg durch die menschenleeren Gassen gewählt. Wenn ihm jemand folgte, würde er es hier rascher bemerken als im Zentrum, wo bis weit nach Mitternacht Betrieb herrschte. Doch bis jetzt war ihm niemand aufgefallen. Trotzdem drehte er eine weitere Runde durch die Altstadt, die sich vom Hafen bis zum Festungstor erstreckte.
Gitter schützten die Geschäfte vor Einbrüchen. Die meisten Fensterläden waren geschlossen, obwohl die heiße Nachmittagssonne längst verschwunden war. In den windstillen Ecken roch es nach Urin. Außer dem Kartonsammler und den Touristen waren nur einige Jugendliche unterwegs. Vielleicht habe ich mir die Gefahr eingebildet, dachte Ramón. Er versuchte, sich zu erinnern, wann er das erste Mal das Gefühl gehabt hatte, beobachtet zu werden.
Vor drei Monaten hatte er mit der Fähre von Buenos Aires nach Montevideo übergesetzt. In seiner Nähe war eine Frau gesessen, die immer wieder verstohlen in seine Richtung geblickt hatte. Er hatte ihre Neugier der Tatsache zugeschrieben, dass sein Gesicht in Argentinien bekannt war. Vielleicht hatte ihr Interesse aber nicht ihm als Privatperson gegolten. Möglicherweise hatte sie den Auftrag gehabt, ihn zu beschatten. Oder aber er hatte ihr bloß gefallen. Ramón hätte sich nicht als attraktiv bezeichnet, dazu war sein Kinn zu wenig markant, seine Nase zu lang. Einige Kilogramm weniger hätten auch nicht geschadet, doch sein Äußeres war ihm nie wichtig gewesen. Trotzdem stellte er immer wieder fest, dass Frauen sich von ihm angezogen fühlten. Gut möglich, dass die Unbekannte nichts über ihn gewusst, sondern lediglich versucht hatte, Kontakt zu ihm zu knüpfen.
Die Männer in Punta del Este hingegen hatten mit Sicherheit andere Absichten gehabt. Drei Wochen nach seiner ersten Schifffahrt war Ramón erneut nach Uruguay gereist, diesmal im Auto. Als er ein Café im noblen Badeort Punta del Este verlassen hatte, waren ihm zwei muskulöse Gestalten mit Sonnenbrille aufgefallen. Wenig später hatte er die beiden in der Nähe seines alten Peugeots entdeckt. Mit Schlägertypen kannte sich Ramón aus. Er war in La Boca aufgewachsen, einem Hafenquartier, das vielen italienischen Immigranten einst ein Zuhause geboten hatte. Früh hatte er gelernt, die Fäuste einzusetzen, wenn er seinen Besitz verteidigen oder sich Achtung verschaffen wollte.
Zu Hause hatte Ramón die Männer wieder vergessen. Bis er eines Abends spät in seine Wohnung zurückgekehrt war und das aufgebrochene Schloss an seiner Tür entdeckt hatte. Obwohl Einbrüche keine Seltenheit waren, hatte er nie besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Er besaß wenig, das sich zu stehlen lohnte. Seinen Laptop nahm er meistens mit, wenn er aus dem Haus ging; der Fernseher war so alt, dass sich kaum ein Dieb die Mühe machen würde, ihn abzuschleppen. Seine Großmutter schimpfte, weil er mit sechsunddreißig Jahren immer noch wie ein Student lebte. Sie wollte ihn glücklich verheiratet sehen, bevor sie starb. Ramón fühlte sich noch nicht bereit dazu. Er zweifelte, ob er es je wäre.
Er war bei der Plaza Independencia angekommen, die den Anfang des modernen Zentrums von Montevideo bildete. Eine mehrspurige Straße führte um den Platz herum, vielen Omnibussen diente er als Endhaltestelle. Ramón schritt auf eine Bronzestatue des Volkshelden José Gervasion Artigas zu und legte den Kopf in den Nacken. Über ihm erschienen die ersten Sterne am klaren Himmel.
Der Einbrecher hatte seine Wohnung in ein Trümmerfeld verwandelt. Mitgenommen hatte er jedoch nur einen silbernen Bilderrahmen, einen Reserveakku sowie eine billige Uhr. Ramón hatte sich des Eindrucks nicht erwehren können, der Dieb versuche, ein Interesse an Wertsachen vorzutäuschen. In Wirklichkeit hatte er nach etwas Anderem gesucht.
»Seit wann bist du romantisch veranlagt?«, riss ihn eine Frauenstimme aus den Gedanken.
»Elena!« Ramón breitete die Arme aus. »Du bist schon da! Wie schön, dich zu sehen!« Er war selbst überrascht über das Ausmaß seiner Freude. Er hatte zusammen mit Elena Alvarez studiert, fast vier Jahre lang hatten sie nur Augen füreinander gehabt. Nach dem Studium hatten sich ihre Wege jedoch getrennt. Elena hatte sich nach einer Familie gesehnt, für Ramón hatte das Leben gerade erst begonnen. Ihre unterschiedlichen Erwartungen hatten einen Keil zwischen sie getrieben. Ein Kollege Ramóns hatte die Gunst der Stunde genutzt, um Elena Avancen zu machen. Drei Monate später war sie mit Gonzalo verlobt gewesen.
Ramón betrachtete seine ehemalige Freundin. Sie hatte ihr dichtes Haar zu einem Knoten zusammengebunden, doch einzelne Löckchen umrahmten ihr weiches Gesicht. Die vollen Lippen waren rot geschminkt, die Augenbrauen sorgfältig gezupft. Die helle Bluse, die sie trug, ließ sie eleganter erscheinen als zu Studentenzeiten, doch sie strahlte immer noch dieselbe unbändige Energie aus. Er dachte an die hitzigen Diskussionen, die sie geführt hatten, und an die leidenschaftlichen Nächte, die ihren Auseinandersetzungen jeweils gefolgt waren. Unweigerlich begann sein Herz, schneller zu schlagen.
Elena ignorierte seine ausgebreiteten Arme und küsste ihn kurz auf die Wange, wie es unter Bekannten üblich war.
»Gonzo«, stellte Ramón fest.
Elena zuckte die Schultern. »Er hat sich nicht verändert. Wenn er wüsste, dass du in Montevideo bist, würde er mich nicht aus den Augen lassen.«
Ramón schnaubte.
Elenas Augen funkelten. »Hör auf, Ramón! Gonzo war da, als ich ihn brauchte! Er ist ein großzügiger Mann, und er hat mir zwei wunderbare Kinder geschenkt. Es geht ihnen übrigens gut, danke der Nachfrage.«
Nur Elenas Körperhaltung verriet, wie sehr sie immer noch verletzt war, weil Ramón ihr seinen Beruf vorgezogen hatte. Bereits als Studentin hatte sie die Schultern leicht nach vorne gezogen, wenn sie sich zu schützen versuchte – eine Haltung, die nicht zu ihrer stolzen Erscheinung passte. Als Ramón sie betrachtete, fragte er sich, ob er einen Fehler begangen hatte. Wie hätte sein Leben ausgesehen, wenn er nicht den Drang verspürt hätte, sich zu engagieren? Wenn er, statt Missstände bekämpfen zu wollen, sich um seine eigenen Angelegenheiten gekümmert, eine Familie gegründet hätte? Ein müßiger Gedanke, denn in die Welt, mit der er täglich konfrontiert war, wollte er keine Kinder setzen.
»Du hast recht.« Ramóns Stimme war forsch und zärtlich zugleich. »Es steht mir nicht zu, dein Leben zu kritisieren. Wie geht es Gonzo? Arbeitet er immer noch bei der Bank?«
Elena seufzte. »Was führt dich nach Montevideo, Ramón?« Sie schlug einen leichteren Tonfall an. »Was ist so wichtig, dass sich ein Porteño dazu herablässt, uns einen Besuch abzustatten?«
Ramón begriff, dass sie die Rivalität zwischen den Bewohnern von Buenos Aires und Montevideo ansprach, um das Gespräch in unverfängliche Bahnen zu lenken. Er beschloss mitzuspielen.
»Nostalgie«, meinte er, mit einer ausladenden Geste auf die Umgebung deutend. »Ich wollte mir in Erinnerung rufen, wie Buenos Aires vor zwanzig Jahren ausgesehen hat.«
Elena schnalzte. Sie führte ihn in eine Seitenstraße, wo sie ein Bistro betraten, dessen Bänke mit verblichenem rotem Samt bezogen waren. Ramón setzte sich so, dass er die Tür im Blickfeld hatte. Inzwischen war er fast sicher, dass ihm niemand nach Montevideo gefolgt war, trotzdem ließ seine Aufmerksamkeit nicht nach. Dass er Elena in die Geschichte hineinzog, bereitete ihm Unbehagen. Doch er hatte keine andere Möglichkeit gesehen. Sie war die einzige Person, die nichts mit seinem heutigen Leben zu tun hatte und der er hundertprozentig vertraute.
Nachdem sie bestellt hatten, lehnte sich Elena zurück. »Erzähl«, befahl sie. »Ich sehe doch, dass dich etwas beschäftigt.«
Ramón legte die Plastiktasche auf den Tisch. »Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Da drin befindet sich ein Paket. Wenn du innert dreißig Tagen nichts von mir hörst, schicke es ab.«
Elena kniff die Augen zusammen. »Was ist es diesmal? Wem willst du an den Kragen?«
»Je weniger du weißt, desto besser. Vertrau mir. Und erzähl niemandem davon. Bring das Paket einfach zur Post.«
»Wenn du in Gefahr bist, musst du …«
Ramón legte ihr den Zeigefinger auf die Lippen. »Es ist besser, wir reden nicht darüber.«
Elena schob seine Hand weg. »Ramón!«
Er lehnte sich zurück. »Wahrscheinlich bilde ich mir alles nur ein. Ich war schon immer übervorsichtig.«
»Tonto! Du lebst, als seist du unsterblich! Wenn du dich vor jemandem fürchtest, hast du einen guten Grund dafür.«
Der Kellner trat mit einer Flasche Rotwein an den Tisch. Aus den Lautsprechern erklangen sanfte Tangoklänge. Auch wenn Ramón ab und zu herablassende Bemerkungen über Montevideo fallen ließ, so schätzte er doch die Gemütlichkeit, die hier herrschte. Zwar bevorzugte er das pulsierende Leben in Buenos Aires, doch er verstand, dass sich Elena in der kleineren Stadt wohlfühlte.
Er hob sein Glas und prostete ihr zu. »Und nun erzähl mir von deinen Kindern.«
Elena blickte ihn lange schweigend an. Schließlich nahm sie die Tasche und hängte sie neben ihre Handtasche. Sie berichtete von ihrem achtjährigen Sohn und der fünfjährigen Tochter. Obwohl sie offensichtlich stolz auf ihre Kinder war, nahm Ramón einen melancholischen Unterton in ihrer Stimme wahr. Er vermutete, dass Elenas Gedanken während des Erzählens abschweiften. Fragte sie sich ebenfalls, wie ihr Leben aussähe, wenn sie andere Entscheidungen getroffen hätte? Wie er war sie in der Studentenbewegung aktiv gewesen. Gemeinsam hatten sie an politischen Debatten teilgenommen, hatten Protestaktionen mitorganisiert und waren Seite an Seite in Demonstrationszügen marschiert. Doch Elena war keine politische Kämpferin. Die Angst um ihre Sicherheit und ihre Zukunft hatte sie stets begleitet. Vermutlich hatte sie deshalb das Leben, das Gonzalo ihr bot, so bereitwillig angenommen.
»Und du?«, holte sie ihn in die Gegenwart zurück.
»Ich?«
Elena schenkte Wein nach. »Gibt es jemanden in deinem Leben?«
Ramón zuckte die Schultern. »Nichts Ernstes.«
»Wie lange willst du so weitermachen?«
»Solange es nötig ist«, antwortete er scharf. »Glaub mir, wenn es uns nicht gelingt, die Regierung …«
Elena hob die Hand. »Keine Politik! Nicht heute. Wie geht es deiner Großmutter? Bäckt sie ihre Empanadas immer noch selbst?«
»Keine Politik? Elena, das Leben ist Politik! Es ist wichtig, über unsere Identität, unsere Wertvorstellungen und das System zu diskutieren! Wir dürfen die Augen nicht vor der Realität verschließen. Wir müssen sie mitgestalten! Die Demokratie, in der wir leben, existiert nur auf dem Papier, auch wenn uns die Kirchner vom Gegenteil zu überzeugen versucht. Das Volk hat nichts zu sagen! Das müssen wir ändern. Du siehst doch, wozu es sonst führt. Der Neoliberalismus hat uns nichts als Elend gebracht.« Er beugte sich vor. »Wir müssen aufhören, fremde Modelle zu übernehmen, und lernen, selbst zu denken. Es gibt kein Leben ohne Politik, begreifst du das nicht?«
»Leben?«, fiel ihm Elena ins Wort. »Nennst du das, was du führst, Leben?« Sie nahm das Paket und knallte es auf den Tisch. »Weißt du, wie ich es nenne? Ein Versteckspiel! Du weißt nie, wem du trauen kannst, schaust bei jedem Schritt über die Schulter! Und wozu das Ganze? Was nützen deine Enthüllungen? Verändern sie etwas? Politiker sind wie Unkraut. Kaum ist einer weg, kommt der nächste nach.«
»Lieber jäte ich Unkraut«, gab Ramón zurück, »als dass ich mir den Kopf darüber zerbreche, ob die Servietten zum Tischset passen! Aber das ist bequem, nicht wahr? Ein einfaches Problem, schnell gelöst. Und gefallen dir die Servietten nicht mehr, kaufst du dir einfach neue. Mit dem Geld, das dein Gonzo als Fondsmanager verdient. Überlegst du dir gar nicht mehr, woher es stammt? Wem er es gestohlen hat? Was für eine Frage! Natürlich nicht. Vermutlich gehst du nicht einmal selber einkaufen. Erledigt das ein Hausmädchen für dich?«
Elena versetzte ihm eine Ohrfeige. Eine Weile saßen sie schweigend da, jedes mit seiner Wut beschäftigt. Genau so war es damals gewesen, als sie sich nicht über geplante Aktionen einig geworden waren oder eine Situation unterschiedlich eingeschätzt hatten. Ihre Auseinandersetzungen hatten ihnen geholfen, die Dinge so zu sehen, wie sie waren. Als Elena einen Schluck Wein nahm, realisierte Ramón, dass sie heute keine Klarheit mehr suchte. Sie hatte sich ihre Welt so zurechtgelegt, wie sie sie am besten ertrug. Die Wahrheit hatte darin keinen Platz. Er holte sein Portemonnaie hervor.
»Wie wirst du dich mit mir in Verbindung setzen?«, brach Elena das Schweigen.
Ramón verstand die Frage nicht.
Elena deutete auf das Paket. »Du hast gesagt, falls ich innert dreißig Tagen nichts von dir höre, soll ich es abschicken. Wohin gehst du?«
Ramón zögerte.
»So viel kannst du mir wohl noch verraten!«
»Nach Europa.« Er senkte die Stimme. »In die Schweiz. Aber niemand darf davon erfahren! Ich rufe dich in den nächsten vier Wochen an.«
»In die Schweiz?« Elena hielt inne. In sanftem Tonfall fuhr sie fort. »Es hat mit deiner Schwester zu tun, nicht wahr? Gar nicht mit deiner Arbeit.«
Beim Gedanken an seine Schwester fühlte sich Ramón von einem Moment auf den anderen kraftlos. Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. Er hätte keinen Wein trinken sollen. In den letzten Tagen hatte er nur wenige Stunden geschlafen. Der Alkohol machte seine Glieder noch schwerer, als sie ohnehin schon waren.
»Es tut mir leid«, seufzte Elena. »Ich weiß, wie wichtig es dir ist, sie zu finden. Bist du weitergekommen?«
Ramón schüttelte den Kopf.
Mit einer ungewöhnlich zärtlichen Geste strich sie ihm über die Hand. »Vielleicht ist es Zeit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Du hast getan, was du konntest.«
Ramón richtete den Blick aus dem Fenster. »Wie hast du es formuliert? Kaum ist ein Übel weg, wächst das nächste nach?« Er schloss die Augen. »Es ist nicht vorbei, Elena. Es wird nie vorbei sein.«
Teil 1
September
1
Es war ein kurzer Sommer gewesen. Der nasse, kalte Juni hatte in den Zürchern den Hunger nach Sonne und Wärme geweckt, doch weder der trübe Juli noch der durchzogene August hatten ihn stillen können. Nun tummelten sich die Menschen am See, obschon sich der September bereits dem Ende zuneigte. An den Wochenenden sah die Wasseroberfläche aus, als habe jemand ein Daunenkissen darüber ausgeschüttelt. Segelboote, Jachten, Pedalos und Ruderboote schaukelten auf und ab, Kursschiffe bahnten sich vorsichtig einen Weg von Anlegestelle zu Anlegestelle. Am Ufer planschten Badende; Schwäne buhlten um die Gunst der Spaziergänger, die ihnen Brotreste zuwarfen.
Den Morgen hatte Daniel Frey damit verbracht, die Rettungsstationen zu überprüfen. Er konnte sich nicht daran erinnern, wie viele Rettungsringe er während seiner fünfeinhalb Jahre bei der Wasserschutzpolizei bereits ersetzt hatte. Jugendliche machten sich einen Spaß daraus, sie ins Wasser zu werfen, Touristen nahmen sie als Souvenir mit. Sogar sein siebenjähriger Sohn wollte einen haben. Ben behauptete, er würde damit seine Kameraden beeindrucken. Im Moment gab es für ihn nichts Wichtigeres, als dazuzugehören. Dass der Junge vermutlich immer ein Außenseiter bleiben würde, schmerzte Frey. Wegen seiner Sehbehinderung konnte Ben nicht mit Gleichaltrigen mithalten. Trotz der starken Brillenkorrektur würde er nie scharf sehen können. Das schränkte ihn in seiner Reaktionsfähigkeit ein und nagte an seinem Selbstvertrauen.
Gedankenverloren starrte Frey auf die spiegelglatte Oberfläche des Sees. An Land liebte er den Herbst. Die reine Luft und die Weite ließen ihn zur Ruhe kommen. Von seiner Wohnung in Benglen aus erschienen ihm die Berge zum Greifen nah. Mit dem Wasser verhielt es sich genau umgekehrt: Den Sommer über wuchsen Algen und Plankton, sodass die Sichtweite im Oktober am geringsten war. Erst im November, wenn die Seetemperatur merklich sank, starben die Pflanzen langsam ab.
Trotzdem freute er sich auf den Tauchgang. Schon während der Polizeischule war es für Frey klar gewesen, dass er sich nach dem obligatorischen Streifendienst bei der Wasserschutzpolizei bewerben würde. Dies, obwohl er wusste, dass er häufiger mit dem Tod konfrontiert sein würde als an Land. Frey musste nicht nur Leichen aus Gewässern bergen, sondern auch ausrücken, wenn der Tod in der Badewanne eintrat, da nur die Wasserschutzpolizei über die Geräte verfügte, die nötig waren, um einen Körper aus dem Wasser zu ziehen. Seine Freunde hatten gespottet, er bevorzuge den Dienst auf dem See wegen der knapp bekleideten Frauen. Doch es war der Einsatz unter Wasser, der Frey faszinierte. Mit fünfzehn Jahren hatte er das Tauchen entdeckt, seitdem war kaum eine Woche vergangen, in der er nicht mindestens einmal die Flossen montiert hatte. Dass er sein Hobby zum Beruf hatte machen können, erfüllte ihn mit Dankbarkeit. Der einzige Wermutstropfen war, dass er sich langsam Gedanken über seine Zukunft machen musste. Wenn er eine Kaderausbildung ins Auge fassen wollte, befand er sich am falschen Ort. Da den Polizisten bei der Wasserschutzpolizei nur eine geringe Anzahl Chefposten offenstanden, musste er einen Wechsel in Betracht ziehen. Daran wollte er im Moment aber nicht denken. Lieber konzentrierte er sich auf die bevorstehende Aufgabe.
Am vergangenen Abend hatte ein Segelboot den Außenbordmotor verloren. Vermutlich waren einige Schrauben an der Halterung locker gewesen. Da das Schiff mit einem GPS-Gerät ausgerüstet war, konnte der Besitzer genau angeben, wo der Motor untergegangen war. Frey hatte schon zahlreiche Gegenstände geborgen, von Schlüsseln über Handys bis zu einer wertvollen Perlenkette. Den Motor zu finden, dürfte nicht schwer sein.
Sein Kollege riss ihn aus den Gedanken. »Diesmal gilt es ernst«, meinte Gilles Buchmann, auf den Flachdachbau am Ufer hinter ihnen deutend.
»Mit dem Neubau?«, fragte Frey, während er seine Tauchausrüstung kontrollierte.
»Der Stadtrat hat den Kredit bewilligt.«
Frey lachte. »Das glaube ich erst, wenn die neue Wache steht!« Weil das Gebäude der Wasserschutzpolizei aus allen Nähten platzte, war seit Jahren ein Neubau geplant. Bereits 1996 war eine erste Sitzung abgehalten worden. Vierzehn Jahre später lag noch immer kein Projekt vor. Zu viele Interessen waren aufgrund der exklusiven Lage am See im Spiel. Immer wieder hatte Frey vernommen, nun sei das letzte Hindernis aus dem Weg geräumt – und jedes Mal war eine weitere Hürde aufgetaucht. Er warf Buchmann die Tauchmaske zu. Da an diesem Mittwochnachmittag viel Betrieb herrschte, waren sie nur zu zweit unterwegs.
»Was läuft im Rennen um Steffi?«, wechselte Frey das Thema. »An welcher Stelle liegst du zurzeit?«
»Ziemlich weit hinten.«
»Lad sie mal zu einem Tauchgang ein«, meinte Frey. »Führ ihr deinen Knackarsch vor.«
Buchmann tippte ihm mit der Flosse an den Hinterkopf. Die langbeinige Detektivin war nicht nur bei ihnen Gesprächsthema. Seit sie sich von ihrem Freund getrennt hatte, einem Kollegen vom Sicherheitsdienst, buhlte eine Reihe möglicher Nachfolger um ihre Gunst. Grinsend setzte sich Frey auf den Rand des Tauchschiffs. Obwohl er glücklich verheiratet war, stimmte er gerne ins Getratsche mit ein, wenn auch nur, um Buchmann aufzuziehen.
Frey kontrollierte Tarierhilfe, Bleigurt, Luftversorgung und Verschlüsse. Als Buchmann ebenfalls bereit war, signalisierte Frey ihm »Okay«. Nacheinander ließen sie sich in die Tiefe sinken. Die Algenschicht war etwa fünf Meter dick. Jedes Mal, wenn Frey durch das dichte Grün tauchte, dachte er an seinen Sohn. Die eigene Hand erkannte Frey um diese Jahreszeit nur, wenn er sie sich direkt vors Gesicht hielt. Ganz ähnlich sah Bens Welt aus. Sie bestand aus Schatten und vagen Umrissen. Das Wasser klarte nach und nach wieder auf. Bens Welt würde nie deutlicher werden. Die Ärzte meinten, sein Sehvermögen könne sich durch das Wachstum sogar noch verschlechtern.
Weil die Algen das Sonnenlicht blockierten, war es schon wenige Meter unter der Wasseroberfläche dunkel. Dank des starken Strahls der Lampe hatte Frey keine Probleme, sich zu orientieren. Seit über fünfzehn Jahren tauchte er im Zürichsee. Er hätte auch ohne Licht genau sagen können, wie es entlang der beiden Ufer aussah. Buchmann und er befanden sich in der Nähe des Tauchzentrums Tiefenbrunnen. An dieser Seeseite fiel der Grund stärker ab als am linken Ufer. In neun Metern Tiefe befanden sich zwei versenkte Steinlöwen, nicht weit davon entfernt eine Trinkwasserleitung und ein gesunkenes Boot. Beide Ziele wurden häufig von Tauchern angepeilt.
Der Außenbordmotor hatte sich zwischen dem Zürichhorn und der Saffainsel gelöst, rund hundert Meter vom Ufer entfernt. An dieser Stelle war der See gut dreißig Meter tief. Trotz des warmen Herbstes war das Wasser schon deutlich kühler. Frey störte es nicht. Er tauchte sogar im Winter, nicht nur beruflich, sondern auch in der Freizeit. Im Februar war das Wasser in der Regel so klar, dass er an einigen Stellen ohne Lampe bis zum Grund sehen konnte. Ganz besonders genoss Frey aber die Stille, denn während der kalten Jahreszeit fuhr kaum jemand mit dem Motorboot auf den See hinaus. Frey war süchtig nach der verborgenen Unterwasserwelt; sie erschien ihm bei jedem Tauchgang wie die Vorstufe eines Traums. Wenn ihn eine melancholische Stimmung erfasste, glaubte er sogar, sich in einem Reich zwischen dem Leben und dem Tod zu befinden.
Buchmann gab ihm ein Handzeichen. Als Freys Blick dem ausgestreckten Zeigefinger seines Kollegen folgte, breitete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. Vor ihnen schwamm ein fünfundvierzig Zentimeter langer Seesaibling. Der Bauch des Fisches schimmerte rot, ein Zeichen, dass es ein Milchner war. Während der Laichzeit verfärbte sich das Männchen sowohl am Bauch als auch an den bauchseitigen Flossen. Darüber erkannte Frey einen weißen Streifen, der sich den Afterflossen entlangzog. Frey schätzte, dass es sich um ein jüngeres Tier handelte, ältere Seesaiblinge waren gedrungener. Erst einmal hatte er im Zürichsee einen ähnlichen Fisch gesehen. Seesaiblinge waren äußerst selten. Die Wasserqualität war zu schlecht, der Sauerstoff zu knapp. Frey nahm sich vor, Ben von seinem Erlebnis zu berichten.
Am letzten Sonntag war er mit seinem Sohn am Greifensee fischen gegangen. Obschon sich Frey nie für den Sport hatte begeistern können, hatte er sofort zugestimmt, als Ben ihn um Begleitung gebeten hatte. Seit Monaten versuchte er, Bens Interesse für ein Hobby zu wecken. Wenn sein Sohn eine besondere Fähigkeit hätte, oder wenn er über ein Gebiet besser Bescheid wüsste als seine Kameraden, so glaubte Frey, würde das sein Selbstvertrauen stärken. Doch egal, was er vorschlug, Ben lehnte es ab. Weder wollte er Kurse besuchen noch ein Instrument spielen lernen, von sportlichen Aktivitäten ganz zu schweigen. Vor gut zwei Wochen hatte Ben jedoch plötzlich verkündet, er wolle fischen. Zuerst hatte Frey nicht verstanden, was Ben daran reizte. Als er dann sah, wie er sich an einen geschützten Ort stellte, weit weg von anderen Menschen, und sich ganz auf die Angelrute in seinen Händen konzentrierte, wurde ihm schlagartig klar: Ben spürte die kleinste Regung an der Leine. Obwohl er nicht sehen konnte, wie sich andere Fischer verhielten, machte er instinktiv alles richtig. So war es kein Wunder, dass er bald eine Trüsche an der Angel hatte. Als Frey das Strahlen auf Bens Gesicht sah, wusste er, Fisch würde in Zukunft zu ihren Grundnahrungsmitteln gehören.
Der Tauchcomputer zeigte an, dass sie eine Tiefe von fünfundzwanzig Metern erreicht hatten. Der Motor musste direkt unter ihnen liegen. Frey blies seine Maske aus und richtete die Lampe nach unten. Eine dunkle Masse hob sich vom grauen Schlick ab. Er deutete auf die Stelle. Buchmann nickte. Während Frey auf den Motor zuschwamm, nahm er aus dem Augenwinkel einen weiteren Gegenstand wahr. Als er später danach gefragt wurde, konnte er nicht erklären, was genau seine Aufmerksamkeit erregt hatte. Außerhalb des Lichtkegels war der Grund des Sees stockdunkel. Trotzdem wusste Frey, dass dort etwas lag. Möglicherweise dank der zahlreichen Stunden, die er damit verbracht hatte, den See von Abfall zu säubern. Intuitiv erkannte er, dass dieser Gegenstand nicht dorthin gehörte. Frey bewegte die Hand hin und her, das Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmte. Buchmann folgte seiner Aufforderung, die Stelle zu besichtigen.
Sie näherten sich mit ruhigem Flossenschlag, um den Schlick nicht aufzuwirbeln. Als Zwanzigjähriger hatte Frey einmal den Fehler begangen, vor Aufregung schneller zu schwimmen, weil er am Boden des Greifensees etwas Glänzendes entdeckt hatte. Er hatte gehofft, dass es sich um ein Schmuckstück oder eine Münze handelte. Er hatte das Objekt nie gefunden. Später hatte ihm sein Tauchlehrer erklärt, am Boden des Greifensees sei der Schlick dreißig Meter tief. Einmal aufgewirbelt, dauere es Stunden, bis das Wasser wieder klar werde. Seitdem war Frey vorsichtiger.
Der Gegenstand nahm Konturen an. Zuerst erkannte Frey die Hanteln. Es waren vier. Frey hatte ähnliche zu Hause. Krafträume mochte er nicht, lieber bewegte er sich draußen. Doch ein-, zweimal pro Woche stemmte er Gewichte, um seinen Rücken zu trainieren. Als Kind hatte er sich eine Rückenverletzung zugezogen, die zum Glück glimpflich ausgegangen war. Um Probleme im Alter zu vermeiden, sorgte er dafür, dass seine Rückenmuskulatur kräftig blieb.
Diese Hanteln hatten einen anderen Zweck erfüllt. Sie waren an den Armen und Beinen eines Mannes befestigt. Obwohl Frey das Bild in sich aufnahm, war es ihm im ersten Moment nicht möglich, die Information zu verarbeiten. Fast teilnahmslos registrierte er die langen, dunklen Haare des Toten, die gespenstisch im Wasser schwebten. Sie vollführten einen seltsamen Tanz, als wären sie lebendig. Dort, wo die Augen des Mannes gewesen waren, befanden sich zwei Höhlen. Aus einer krabbelte ein Krebs, als der Lichtstrahl der Unterwasserlampe ihn traf.
Das Hemd des Toten war zerrissen, die Jeans waren jedoch fast intakt, genauso wie große Teile seiner Haut. In dieser Tiefe wurde das Wasser nie wärmer als vier Grad. Deshalb entwickelten sich keine Fäulnisgase. Statt sich zu zersetzen, wurde der Organismus langsam von Krebsen und Fischen aufgefressen. Frey betrachtete die dünne Sedimentschicht, die den Toten bedeckte. Entweder lag der Mann schon seit einigen Monaten hier, oder der Aufprall des Motors hatte den Schlick aufgewirbelt und die Leiche damit bedeckt.
Er spürte eine Hand an seiner Schulter und drehte den Kopf. Buchmann kreuzte die Arme. Er wollte den Tauchgang abbrechen. Frey kam wieder zu sich. Routine setzte ein. Es war nicht die erste Leiche, die er am Grund des Zürichsees entdeckte. Bevor sie auftauchten, musste die Stelle markiert werden. Das entsprechende Material hatten sie nicht bei sich, doch das Reel, das Frey auf jeden Tauchgang mitnahm, würde vorerst genügen. Er holte es hervor und zeigte auf den Schiffsmotor. Gemeinsam befestigten sie das dünne Tau an der Schraube. Anschließend ließ Frey das Reel los. Augenblicklich schwamm es nach oben. Bevor er das Zeichen für den Aufstieg gab, ließ er seinen Lichtstrahl noch einmal über den Toten gleiten.
Der Mann war kräftig gewesen. Frey vermutete, dass er sich absichtlich das Leben genommen hatte oder bereits tot gewesen war, als man ihn ins Wasser geworfen hatte. Wenn er sich gewehrt hätte, wäre es schwierig gewesen, Hanteln an Armen und Beinen zu befestigen. Die Schuhe des Toten waren mit Miesmuscheln bedeckt, darunter glaubte Frey, braunes Leder zu erkennen. Ohne näher heranzuschwimmen, suchte er mit den Augen die unmittelbare Umgebung ab. Sein Blick fiel auf ein Handy, das rund zwei Meter vom Opfer entfernt lag. Daneben entdeckte Frey einige Münzen. Bevor die Gegenstände geborgen wurden, musste die Fundstelle dokumentiert werden. Erst dann würde Frey mit Buchmann den Seeboden nach weiteren Spuren absuchen. Möglicherweise würden die Fundstücke – oder ihre Lage – Aufschluss darüber geben, was sich zugetragen hatte.
Erneut gab ihm Buchmann ein Zeichen. Sie mussten rauf, um die Zentrale der Wasserschutzpolizei zu alarmieren. Diese würde die Einsatzzentrale informieren. Dann nähmen die Dinge ihren gewohnten Lauf: Der Brandtouroffizier der Stadt, ein Rechtsmediziner, ein Staatsanwalt sowie Kriminaltechniker des Forensischen Instituts würden aufgeboten. Sollte sich herausstellen, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelte, würde der Fall dem Kanton übergeben. Weitere Offiziere und Sachbearbeiter des Dienstes Kapitalverbrechen kämen hinzu.
Inzwischen würden Frey und Buchmann den Fundort dokumentieren. Damit sich die Forensiker ein Bild der Situation unter Wasser machen konnten, mussten sowohl Leiche als auch Umgebung fotografiert und gefilmt werden. Anschließend würden sie alle Fundgegenstände markieren. Dazu benutzten sie Bleigewichte mit Schnur und Styroporteilen. Genau wie an Land würde jeder Gegenstand und jede Spur mit einer Nummer versehen. Langsam würde an der Wasseroberfläche ein Abbild der Lage in 30 Metern Tiefe entstehen. Frey verstand sich dabei als verlängerter Arm des Forensikers, der keine Möglichkeit hatte, den Fundort mit eigenen Augen zu besichtigen.
Am heikelsten war die Bergung des Toten selbst. Nachdem alle Fundgegenstände in Plastikbehältern abtransportiert worden wären, müsste die Leiche – wenn möglich, unter Wasser – in einen Leichensack verpackt werden. Frey hatte einmal eine Frau geborgen, die sich bereits in einem fortgeschrittenen Verwesungszustand befunden hatte. Die Haut hatte sich schon bei der bloßen Berührung vom Körper gelöst. Ähnliche Probleme dürften ihnen bei diesem Fall erspart bleiben.
Frey gab Buchmann das Zeichen für den Aufstieg. Als er sich von der Leiche abwandte, streifte seine Lampe einen kaum wahrnehmbaren roten Punkt. Er zögerte. Wenn ein Gegenstand unter dem Schlick lag, so würde er ihn beim nächsten Tauchgang vermutlich nicht mehr auf Anhieb finden. Im schlimmsten Fall gar nicht mehr. Frey verfluchte die Tatsache, dass er kein Markierungsmaterial auf sich trug. Fragend blickte er zu Buchmann. Dieser zuckte die Schultern. Offenbar war er auch nicht sicher, wie sie vorgehen sollten. Er wies auf seine Uhr. Kurz entschlossen griff Frey nach dem Gegenstand. Zeigefinger und Daumen umschlossen etwas Hartes, an der Unterseite befand sich eine leichte Erhebung, kaum größer als die Spitze einer Stecknadel. Ohne Bens Sehbehinderung hätte Frey sie nicht bemerkt. Doch in den letzten Jahren hatte er es sich angewöhnt, Sachen mit den Fingern zu betrachten, genau wie sein Sohn.
Vorsichtig zog Frey am Gegenstand. Es war ein roter Kugelschreiber. Er legte ihn genau an die Stelle, an der er begraben gewesen war. Anschließend streckte er den Daumen in die Höhe. Buchmann gab ihm das Okay-Zeichen. Gemeinsam machten sie sich an den Aufstieg. Normalerweise überkam Frey ein Gefühl von Schwere, wenn er sich der Oberfläche näherte. Er verließ die Unterwasserwelt nur ungern. Er fühlte sich darin geborgen, obwohl sein Körper nicht für das Leben im Wasser geschaffen war. Nicht mehr, sagte sich Frey. Die ersten neun Monate hatte er im Fruchtwasser verbracht. Manchmal fragte er sich, ob sich ein Säugling bei der Geburt ähnlich fühlte wie er sich beim Aufstieg.
Heute konnte Frey die Wasseroberfläche nicht schnell genug erreichen. Er musste sich zwingen, die maximale Geschwindigkeit einzuhalten. Eine Hand über dem Kopf, die andere am Luftablassventil, ließ er sich langsam nach oben treiben.
Die Sonne schien immer noch wie im Hochsommer. Ein leichter Wind hatte eingesetzt und Segler aufs Wasser gelockt. An Bord der vorbeifahrenden »Panta Rhei« winkten einige Passagiere. Als Frey ins Einsatzschiff kletterte, fragte er sich, ob sie die Welt erahnten, die sich unter ihnen verbarg. Er nahm die Maske vom Kopf und griff nach dem Funkgerät.
»Limmat 214 an Limmat 210«, meldete er sich.
»Hier Limmat 10«, kam postwendend die Antwort. »Was gibt’s?«
Vielleicht war es ganz schön, nur die sonnige Seite des Lebens zu sehen.
2
Regina Flint schaute auf die Uhr. Noch zehn Minuten bis zur Urteilsverkündung. Sie strich sich eine helle Haarsträhne aus dem Gesicht. Der Wind, der über dem Zürichsee aufgekommen war, blähte ihre Bluse auf. Regina verlagerte ihre Tasche von einer Schulter auf die andere und knöpfte ihren Blazer zu. Es war Zeit, in den Gerichtssaal zurückzukehren. Als Staatsanwältin war sie es gewohnt, auf Urteilssprüche zu warten. Seit fünfzehn Jahren vertrat sie die Anklage vor Gericht. Diesmal stand sie jedoch nicht vor der Schranke, sondern saß im Zuschauerbereich.
Dennoch war das Interesse der anwesenden Medienschaffenden auf sie gerichtet: Regina hatte maßgeblich dazu beigetragen, dass der ehemalige Oberstaatsanwalt Karl Hofer in einem erstinstanzlichen Verfahren wegen qualifizierter Freiheitsberaubung und falscher Anschuldigung zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Der außerkantonale Staatsanwalt, der die Untersuchung geführt hatte, hatte Hofer zudem wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit einer Minderjährigen angeklagt, doch die Beweise hatten nicht für eine Verurteilung gereicht. Trotzdem hatte Hofer das Urteil ans Obergericht weitergezogen. Nie würde er gestehen, eine kriminelle Handlung begangen zu haben. Dies, obwohl er die Dienste junger Zwangsprostituierter in Anspruch genommen und einem Drogendealer, der ihn deswegen erpresste, Heroin in die Wohnung geschmuggelt hatte.
Für Regina stand viel auf dem Spiel. Nicht in beruflicher Hinsicht, denn ihre Anschuldigungen hatten keine Auswirkungen auf ihre Position bei der Staatsanwaltschaft IV, die auf Gewaltdelikte spezialisiert war. Doch einen Vorgesetzten zu beschuldigen, war immer eine heikle Angelegenheit. Von einigen Kollegen wurde sie hinter vorgehaltener Hand als Nestbeschmutzerin beschimpft. Andere bewunderten ihren Mut. Sollte Hofer nun vom Obergericht freigesprochen werden, so käme dies einer persönlichen Niederlage gleich. Noch schlimmer war für Regina aber die Vorstellung, dass der Oberstaatsanwalt für das Leid, das er den jungen Frauen angetan hatte, nicht bestraft würde.
Als Regina auf die spiegelnde Fassade des provisorischen Obergerichts zuschritt, fragte sie sich, ob sie es wieder täte. Hätte sie vor drei Jahren geahnt, was auf sie zukäme, hätte sie vielleicht weggeschaut, anstatt eine Privatdetektivin auf den Oberstaatsanwalt anzusetzen. Nein, korrigierte sie sich in Gedanken, Unrecht würde sie immer bekämpfen. Es war der Grund, weshalb sie Staatsanwältin geworden war, auch wenn sie inzwischen hatte einsehen müssen, dass die Grenzen zwischen Recht und Unrecht nicht klar gezogen waren.
Der Portier am Eingang des Obergerichts winkte sie durch, ohne ihren Ausweis zu verlangen. Die Zürcher Justiz war wie ein Dorf – jeder kannte jeden. Ihr Lebenspartner Bruno Cavalli bezeichnete sie als »Jassverein«. Beim Gedanken an Cavalli hob sich Reginas Laune. Um den Abschluss des Berufungsverfahrens zu feiern, hatte er sie zu einem Konzert in der Tonhalle eingeladen. Egal, wie das Urteil ausfiel, Schumanns Humoreske und Beethovens Appassionata brächten sie auf andere Gedanken. Seit Tagen freute sie sich auf das Rezital. Es kam nicht oft vor, dass sie mit Cavalli ausging. Schon vor der Geburt ihrer Tochter hatten sie wenig zusammen unternommen. Seit Lily auf der Welt war, verbrachten sie ihre spärliche Freizeit fast ausschließlich mit ihr. Regina hatte ihr Arbeitspensum zwar auf 80 Prozent reduziert, weniger Fälle betreute sie deswegen aber nicht. Es kam häufig vor, dass sie, nachdem Lily eingeschlafen war, bis spät in die Nacht Akten studierte. Als Chef des Dienstes Kapitalverbrechen der Kantonspolizei war es Cavalli gar nicht möglich, Teilzeit zu arbeiten. An drei Tagen pro Woche besuchte Lily eine Kinderkrippe, mittwochs wurde sie von Reginas Mutter betreut. Heute Abend würde sie zum ersten Mal bei Marlene Flint übernachten.
Die Vorstellung bereitete Regina Unbehagen. Sie war ihrer Mutter nie besonders nahegestanden. Soweit sie zurückdenken konnte, hatte Marlene sie kritisiert. Von der Kleider- bis zur Berufswahl, immer hatte sie etwas an Reginas Entscheidungen auszusetzen gehabt. Die heftigste Reaktion hatte Reginas Beziehung zu Cavalli ausgelöst. Noch heute vermied es Marlene, ihm in die Augen zu schauen. Regina vermutete, dass er sie verunsicherte. Cavalli war der einzige Mensch in Marlenes Umfeld, der gegen ihre Angriffe immun war. Auf ihre giftigen Bemerkungen reagierte er lediglich mit einem sarkastischen Grinsen.
Lilys Geburt hatte Reginas Beziehung zu ihrer Mutter verändert. Zum ersten Mal hatte Regina etwas richtig gemacht. Statt Vorwürfe bekam sie nun Ratschläge zu hören. Zur Geburt schenkte Marlene ihr einen Ordner, in dem sie Informationen über Kindererziehung, Ernährung, Körperpflege und Krankheiten zusammengetragen hatte. Sie hatte sogar Rezepte, Adressen von Kinderärzten und Unterlagen von Schulen mit Frühförderungsprogrammen beigelegt. Obwohl Regina damit wenig anfangen konnte, erkannte sie, dass ihre Mutter ihr die Hand entgegenstreckte. Regina hatte sie ergriffen. Seither war Marlene ein fixer Bestandteil ihres Familienlebens. Ohne sie hätte Regina es nicht geschafft, ein halbes Jahr nach der Geburt die Arbeit wieder aufzunehmen. Zwar deckten sich ihre Vorstellungen von Kindererziehung bei Weitem nicht mit jenen ihrer Mutter, doch Marlene vergötterte ihre Enkelin. Das musste genügen.
Die Tür zum Gerichtssaal stand offen. Die meisten Zuschauer hatten bereits Platz genommen. Die Sonne schien durch die braun getönten Fenster und tauchte den Raum in gedämpftes Licht. Am See hatte sich Regina in der Wärme fast gefühlt, als habe sie Ferien. Nun kehrte sie schlagartig wieder in ihre nüchterne Arbeitswelt zurück. Sie ging auf die hinterste Stuhlreihe zu, wo sie neben einigen Studenten Platz nahm. Sie versuchte, einen Blick auf Karl Hofer zu erhaschen, doch ein Journalist verdeckte ihr die Sicht. Kaum hatte der Gerichtsweibel die Tür geschlossen, vibrierte Reginas Pikett-Handy.
Sie schloss kurz die Augen. Seit dem Vortag hatte sie Brandtour. Der Pikettdienst war erstaunlich ruhig verlaufen. Nicht ein einziges Mal hatte sie ausrücken müssen. Sie dachte ans Konzert. Machte ihr das Schicksal in letzter Minute einen Strich durch die Rechnung? Sie hatte gewusst, dass sie ein Risiko einging. Doch die meisten Gewaltdelikte wurden an Wochenenden verübt, wenn Partygänger zu viel Alkohol oder Drogen konsumierten und sich nicht mehr unter Kontrolle hatten.
Während der Gerichtspräsident die Anwesenden begrüßte, schlich Regina aus dem Saal. Als sie erfuhr, dass eine Wasserleiche geborgen worden war, setzte sie sich in einen der ledernen Besuchersessel. Weil die Polizei von einem Tötungsdelikt ausging, war die STA IV aufgeboten worden. Regina legte auf. Ihre Anwesenheit war nicht unbedingt erforderlich. Sie könnte den Bericht der Rechtsmedizin abwarten und den Fall erst dann übernehmen, wenn ein Suizid definitiv ausgeschlossen worden war. Da es sich beim Fundort der Leiche zudem kaum um den Tatort handelte, gäbe es vermutlich nicht viel zu sehen. Vermutlich. Und wenn doch? Ein Foto, sogar ein Video, sagte nie gleich viel aus wie die Wirklichkeit. Wie war der Tote beschwert worden? Was trug er? In welchem Zustand war die Leiche? Sogar die Mimik der erfahrenen Seepolizisten zu beobachten, konnte aufschlussreich sein. Obwohl Regina weiterhin nach einem Ausweg suchte, wusste sie bereits, dass sie an den Mythenquai fahren würde. Sie konnte sich keine Fehler erlauben. Nicht jetzt, wo so viele Augen auf sie gerichtet waren.
Der Portier warf ihr einen fragenden Blick zu, als sie das Gerichtsgebäude verließ. Regina sah ihn nicht. Sie hatte bereits Cavallis Nummer gewählt. Als Dienstchef betreute er nur die wichtigen Fälle selbst, doch er rückte bei einem Tötungsdelikt oft aus, um sich ein Bild der Lage zu machen.
»Hat das Obergericht das Urteil bestätigt?«, fragte er zur Begrüßung.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Regina. »Ich bin unterwegs zur Wasserschutzpolizei. Ich nehme an, du bist über den Leichenfund informiert worden. Wer hat bei euch Pikett?«
»Es ist noch nicht sicher, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt«, wich Cavalli aus.
Regina seufzte. »Ich muss hinfahren. Das verstehst du doch, oder?«
Cavalli zögerte nicht. »An deiner Stelle würde ich es auch tun.«
Genau deshalb waren sie noch ein Paar, trotz ihrer verschiedenen Persönlichkeiten und ihrer unterschiedlichen Vorstellungen von einer Beziehung. Während Regina Sicherheit suchte und ihre Energie aus Stabilität schöpfte, verspürte Cavalli den Drang nach Freiheit und mied Verbindlichkeit, was oft zu Auseinandersetzungen führte. Doch wenn es um ihre Arbeit ging, deckten sich ihre Auffassungen. Sie gingen mit einer Gründlichkeit vor, die häufig Überstunden mit sich brachte. Ihr Beruf erforderte ihren vollen Einsatz, und beide waren bereit, diesen zu leisten. Nur die Motivation, die ihrem Engagement zugrunde lag, war nicht die gleiche. Während Cavallis Fokus auf die Täter gerichtet war, sah Regina die Opfer vor sich, wenn sie eine Untersuchung führte. Sie war der Meinung, sie schulde es ihnen, ihr Bestes zu geben. Daran hatte auch die Geburt ihrer Tochter nichts geändert, obwohl es Regina oft schwerfiel, allen Ansprüchen gerecht zu werden.
»Welcher Sachbearbeiter hat Pikett?«, wiederholte Regina.
»Bis später.«
Cavalli legte auf. Einen Moment lang blieb er reglos sitzen. Auf seinem Schreibtisch stapelten sich Berge von Papier. Da er wegen einer Weiterbildung nächste Woche drei Tage abwesend sein würde, musste er vor dem Wochenende noch die wichtigsten Büroarbeiten erledigen. Er hatte fast den ganzen Tag an Sitzungen verbracht. Die Einführung der eidgenössischen Strafprozessordnung gab viel zu diskutieren. Im Moment sorgten vor allem die neuen Bestimmungen über verdeckte Ermittlungen für Unmut. Ab 1. Januar wäre es der Polizei nicht mehr erlaubt, im Vorfeld einer Straftat verdeckt zu ermitteln. Davon waren auch Fahndungen im Internet betroffen. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern von Polizei und Justiz, hatte die Möglichkeit geprüft, mit einem kantonalen Gesetz Abhilfe zu schaffen. Sie war zum Schluss gekommen, die Lösung müsse auf Bundesebene gefunden werden. Daraufhin hatten beide Zürcher Polizeikorps beschlossen, die seit Jahren praktizierte verdeckte Fahndung im Internet einzustellen. Die sogenannten Chatroom-Ermittlungen hatten es ermöglicht, Kontakt zu pädophilen Tatverdächtigen aufzunehmen und sie später zu überführen. Statt präventiv zu ermitteln, konnte die Polizei nun erst eingreifen, wenn ein Delikt begangen worden war.
Resigniert schob Cavalli die Unterlagen beiseite. Er hatte sein Jurastudium abgebrochen, um Polizist zu werden. Denn während Juristen Stunden damit verbrachten, über den Unterschied zwischen einer einfachen verdeckten Fahndung und einer aufwendigen verdeckten Ermittlung zu diskutieren, heftete sich Cavalli lieber an die Fersen der Täter. Statt sich den Kopf über juristische Details zu zerbrechen, wollte er seinen Verstand und seine Intuition einsetzen, um den Schuldigen zu finden. Es war die Arbeit an der Front, die ihn als Aspiranten überzeugt hatte, den richtigen Beruf gewählt zu haben.
Seither waren zwanzig Jahre vergangen. Mehr als zehn hatte er beim Kapitalverbrechen verbracht. Weiterbildungen hatten ihm Einblick in die Arbeit des FBI und des Bundeskriminalamts in Wiesbaden gegeben. Er hatte tragische Familiengeschichten und spektakuläre Tötungsdelikte erlebt. Einige Fälle hatte er in wenigen Tagen aufgeklärt, andere Ermittlungen hatten sich über Monate, manche sogar über Jahre hingezogen. Zwei Fälle waren bis heute ungeklärt. Immer hatte er mit Hingabe gearbeitet. Meist war er der Erste gewesen, der morgens den fünften Stock des Kripogebäudes betreten hatte. Oft auch der Letzte, der sich nach einem langen Tag auf den Nachhauseweg gemacht hatte. Er hatte die Freude an der Arbeit stets als selbstverständlich betrachtet.
Bis zu seiner Beförderung. Als er vor zwei Jahren die Stelle als Dienstchef angetreten hatte, hatte er gewusst, worauf er sich einließ. Neben den schwierigen Fällen, die er weiterhin selbst leitete, nahm Cavalli nun auch Führungsaufgaben wahr. Der Anteil administrativer Arbeit hatte sich verdoppelt, genauso die Anzahl Sitzungen. Da er bei Tötungsdelikten oft ausrückte, hatte er faktisch immer Pikettdienst, Abwesenheiten ausgenommen. Doch es war nicht die hohe Belastung, die ihm zu schaffen machte. Es war die mangelnde Akzeptanz seitens seiner zwanzig Untergebenen. Ob sie ihn als Menschen mochten, war ihm egal. Freundschaften waren ihm nie wichtig gewesen. Da er als Dienstchef aber für die Fallaufsicht und die Leitung taktischer Besprechungen zuständig war, wurde von ihm erwartet, dass er über die laufenden Ermittlungen seiner Sachbearbeiter Bescheid wusste. Nur so war es Cavalli möglich, die Informationen am wöchentlich stattfindenden Kripo-Rapport seinen Kollegen der gleichen Stufe und seinen Vorgesetzten mitzuteilen und mögliche Zusammenhänge zu anderen Fällen zu erkennen. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, war er auf die Unterstützung seiner Mitarbeitenden angewiesen. Und genau die fehlte ihm.
Eine Schussverletzung vor einigen Jahren hatte ihm physisch und psychisch mehr zugesetzt, als er sich hatte eingestehen wollen. Dass er kurz darauf drei Wochen in einem georgischen Gefängnis festgehalten worden war, hatte die Heilung zusätzlich verzögert. Lange hatte er unter heftigen Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und chronischer Müdigkeit gelitten. Schlimmer waren die psychischen Folgen gewesen. Erstmals in seinem Leben hatten ihn Selbstzweifel gequält. Er hatte sich weder auf seinen Verstand noch auf seine Intuition verlassen können. Er hatte begonnen, seine Entscheidungen zu hinterfragen, und hatte nicht mehr auf sein Urteilsvermögen vertraut.
Ausgerechnet während dieser Zeit war er mit dem schwierigsten Fall seiner Karriere konfrontiert worden. Ein Frauenmörder, von den Medien »Metzger« genannt, hatte sie alle zum Narren gehalten. Trotz intensiver Ermittlungen war es der Polizei monatelang nicht gelungen, ihm auf die Spur zu kommen. Vieles hatte darauf hingewiesen, dass er aus Polizeikreisen stammte. Mehrere Sachbearbeiter waren unter Verdacht geraten, schließlich hatte Cavalli seinen Fokus auf den Rechtsmediziner Uwe Hahn gerichtet. Ein großer Fehler, wie sich im Nachhinein herausgestellt hatte. Dieser Irrtum hatte die einzige Sachbearbeiterin beim Kapitalverbrechen, Jasmin Meyer, fast das Leben gekostet.
Seither hatte sich das Klima im Team verändert. Vorbei die Zeiten, in denen die Sachbearbeiter nach dem Morgenrapport gemeinsam in der Kantine Kaffee tranken. Cavallis Verdächtigungen hatten Misstrauen gesät und das Zusammengehörigkeitsgefühl unwiderruflich zerstört. Objektiv betrachtet, hatte er keinen Fehler begangen. Alles hatte darauf hingedeutet, dass Uwe Hahn schuldig war. Genau das hatte der »Metzger« beabsichtigt. Und Cavalli war darauf hereingefallen. Dass er trotzdem befördert worden war, hatte Unmut ausgelöst. Die Position des Dienstchefs war begehrt, obwohl sie hohe Anforderungen an die Belastbarkeit stellte. Es wurde erwartet, dass die Aufgabe von einem Sachbearbeiter wahrgenommen wurde, der einen tadellosen Leistungsnachweis vorweisen konnte.
Das Klingeln des Telefons riss Cavalli aus seinen Gedanken. Das Display zeigte die Nummer des Personalverantwortlichen an. Cavalli stand auf und verließ das Büro. Er hätte gestern zwei Mitarbeiterbeurteilungen abliefern sollen, war aber noch nicht dazu gekommen, sie mit seinen Untergebenen zu besprechen. In Tat und Wahrheit hatte er die Gespräche hinausgeschoben. Viel lieber hatte er sich in die Fallarbeit vertieft. Bevor er sich nun um die Qualifikationen kümmern konnte, musste er sich ein Bild von der Wasserleiche machen. Vermutlich handelte es sich um einen Sachbearbeiterfall, der Cavallis Anwesenheit nicht unbedingt erforderte. Doch genau wie Regina konnte er es sich nicht leisten fernzubleiben.
Gion Barduff, der Sachbearbeiter, der heute Pikettdienst 1 hatte, war am Mittag mit Fieber nach Hause gegangen. Normalerweise hätte er den neuen Fall übernommen. Die zwanzig Mitarbeitenden des Kapitalverbrechens waren in Gruppen eingeteilt, immer vier hatten gleichzeitig Pikett, in unterschiedlicher Priorität. Pikett 1 fasste die großen Fälle. War der Kollege ausgelastet, so folgte die Nummer zwei, anschließend die drei und die vier. Ein Blick auf die Personaleinsatzplanung bestätigte Cavallis Vermutung, dass Heinz Gurtner fürs Pikett 2 eingeteilt war. Regina würde sich nicht freuen. Sie kam schlecht mit seiner ungehobelten Art zurecht. Im Flur überlegte Cavalli, ob er den Fall einem anderen Sachbearbeiter zuteilen könnte. Irgendeine Ausrede fiele ihm schon ein. Doch die meisten Kollegen waren bereits gegangen. Stefan Mullis, der vor einem Jahr vom Kriminaldienst zum Kapitalverbrechen gewechselt hatte, saß zwar noch am Arbeitsplatz, aber er war mit einer Messerstecherei beschäftigt, die ihn noch einige Zeit voll beanspruchen würde. Neun Personen waren in die Auseinandersetzung involviert gewesen, jeder erzählte eine andere Version der Geschehnisse. Aus dem Büro von Tobias Fahrni klangen ebenfalls Geräusche. Mit ihm verstand sich Regina besonders gut. Sie mochte seine Feinfühligkeit und seine seltsame Denkweise. Es war schwer nachzuvollziehen, was sich in Fahrnis Kopf abspielte. Cavalli wusste nur, dass er mit einer überdurchschnittlichen Intelligenz gesegnet war und die Gabe besaß, Menschen und Situationen zu betrachten, ohne sie zu werten. Das machte ihn zu einem wertvollen Ermittler. Der »Metzger« hatte Fahrni fast dazu gebracht, seinen Beruf an den Nagel zu hängen. Schließlich hatte die Tatsache, dass Fahrni als Polizist Straftaten nicht nur aufklären, sondern auch verhindern konnte, ihn überzeugt zu bleiben. Es war Fahrnis Beharrlichkeit und seinem Fleiß zu verdanken gewesen, dass der »Metzger« schließlich gefasst worden war. Und dass Jasmin Meyer überlebt hatte.
Als Cavalli das Büro betrat, fiel sein Blick wie immer auf den Schreibtisch, an dem Jasmin Meyer früher gearbeitet hatte. Seither saßen Stagiaires an ihrem Platz. In Gedanken fluchte Cavalli. Er hatte gehofft, Vera Haas sei schon gegangen. Seit Montag wartete die vierunddreißigjährige Regionalpolizistin darauf, dass er sich um sie kümmerte. Cavalli hatte genug von den ewig wechselnden Praktikanten, die davon träumten, eine der begehrten Stellen beim Kapitalverbrechen zu ergattern. Vielleicht hoffte er insgeheim immer noch, dass Jasmin Meyer zurückkehrte. Doch ihre Kündigung lag über zwei Jahre zurück. Nicht ein einziges Mal hatte sie ihre Kollegen seither besucht. Cavalli hatte gehört, sie habe sich als private Ermittlerin selbstständig gemacht.
Er setzte sich auf Fahrnis Schreibtisch. Der Sachbearbeiter schaute nicht vom Bildschirm auf. Mit seinem runden Gesicht und den roten Wangen sah er immer noch aus wie Mitte zwanzig. Nur der wachsende Bauchansatz verriet, dass die Zeit auch an ihm nicht spurlos vorbeigegangen war. Nächstes Jahr würde er seinen vierzigsten Geburtstag feiern.
Als sich Cavalli vorbeugte, erkannte er auf dem Bildschirm das Logo von Fahrnis privatem E-Mail-Account. »Stör ich?«, fragte er.
Fahrni nickte, ohne den ironischen Tonfall wahrzunehmen. »Ich brauche noch zwei Minuten«, antwortete er abwesend.
Jeden anderen Sachbearbeiter hätte Cavalli zurechtgewiesen. Doch Fahrnis Verhalten beruhte nicht auf Respektlosigkeit. Er tickte einfach anders. In Ruhe schrieb er seine E-Mail zu Ende. Erst nachdem er sie abgeschickt hatte, richtete er die himmelblauen Augen auf seinen Vorgesetzten.
»Paz kann nicht oft ins Internet«, erklärte er.
Cavalli wusste nicht, wer Paz war. »Wie kommst du mit dem Tötungsdelikt in Oerlikon voran?«, fragte er. »Hast du Kapazität für einen neuen Fall?«
»Ich warte noch auf einen Bericht der Ballistiker«, antwortete Fahrni. »Vor meinen Ferien sollte ich die Befragungen aber abschließen können.«
Vage erinnerte sich Cavalli, einen Ferienantrag in seinem Pendenzenfach gesehen zu haben. Er stand auf. Wenn Fahrni bald abwesend wäre, war es sinnlos, ihm einen neuen Fall zuzuteilen. Der Auftakt einer Ermittlung brachte viel Arbeit mit sich, auch wenn es sich um einen einfachen Fall handelte. Regina würde sich mit Gurtner arrangieren müssen.
Im Gang nahm Cavalli den Geruch von Zigarettenrauch wahr. Der Einzige, der trotz Verbot in seinem Büro rauchte, war Juri Pilecki. Ein Blick bestätigte, dass die Bürotür geschlossen war. Cavalli trat ein. Pilecki saß am offenen Fenster und scherzte. Heinz Gurtner hatte seinen Computer bereits heruntergefahren und griff grinsend nach seiner Jacke. Als Pilecki Cavalli erblickte, erstarb sein Lachen. Auch Gurtner setzte eine neutrale Miene auf. Cavalli spürte förmlich, wie die beiden sich für die Begegnung mit ihm wappneten. Von allen Mitarbeitern waren Pilecki und Gurtner diejenigen, die ihm die größten Vorwürfe wegen seiner Fehler machten. Gurtner, weil er als gelernter Metzger selber unter Verdacht gestanden war. Pilecki, weil er der Meinung war, Cavallis unsensibles Verhalten habe zum Herz-Kreislauf-Kollaps geführt, den der Rechtsmediziner Uwe Hahn in der Untersuchungshaft erlitten hatte. Dass Cavalli den ehemaligen Stadtpolizisten trotzdem zu seinem Stellvertreter ernannt hatte, als er befördert worden war, lag einzig daran, dass er der Meinung war, nur Pilecki verfüge über die erforderlichen Fähigkeiten. Cavalli hatte geglaubt, die Zeit würde die Wunden heilen, doch er hatte sich getäuscht. Pileckis Abneigung ihm gegenüber schien sogar noch zu wachsen. Dies, obwohl sich Cavalli bemühte, sachlich zu bleiben und nicht auf die Provokationen seines Stellvertreters zu reagieren.
»Wir haben eine Wasserleiche am Mythenquai«, kam Cavalli direkt zur Sache. »Barduff ist krank.«
Gurtner fluchte.
Cavalli wandte sich an Pilecki. »Was meinten die Brändler zum Boot in Wollishofen?«
»Der Brand passt nicht in die Serie. Könnte ein Trittbrettfahrer sein, der ein Tötungsdelikt vertuschen will.«
Seit fast einem Jahr waren die Brandermittler mit einer Serie von Brandstiftungen beschäftigt. Vor zwei Wochen war erstmals jemand bei einem der Bootsbrände ums Leben gekommen. Weil es sich dabei möglicherweise um den Versuch handelte, ein Tötungsdelikt zu vertuschen, arbeitete Pilecki mit den Kollegen vom Brand zusammen. Wenn sie es tatsächlich mit einem Trittbrettfahrer zu tun hatten, musste Pilecki der Sache sofort nachgehen. Cavalli ärgerte sich, dass Pilecki ihm die Information nicht von sich aus mitgeteilt hatte.
»Warst du vor Ort?«, fragte er schroff.
»Natürlich. Ich weiß, wie ich meine Arbeit erledigen muss.«
»Zu deiner Arbeit gehört es auch, mich auf dem Laufenden zu halten. Ich habe noch keinen Bericht gesehen.«
»Ich habe auch noch keinen geschrieben.« Ohne die Augen von Cavalli abzuwenden, zündete sich Pilecki eine weitere Zigarette an.
»Dann hol es sofort nach.« Cavalli wandte sich an Gurtner, der seinen massigen Arm in den Ärmel seiner Jacke zwängte. »Willst du mit mir fahren?«
»Ich habe einen dringenden Termin«, brummte Gurtner.
Cavalli glaubte, sich verhört zu haben. »Du hast Pikett.«
Pilecki warf die Zigarette weg und schloss das Fenster mit einer unnötig heftigen Bewegung. »Ich übernehme den Fall.«
»Gurtner wird gehen«, wiederholte Cavalli. »Du bist ausgelastet.«
Pilecki verengte die Augen zu Schlitzen. Cavalli betrachtete ihn. Sie waren einmal so etwas wie Freunde gewesen. Nicht besonders enge, doch ab und zu waren sie nach der Arbeit zusammen etwas trinken gegangen. Das war weit mehr, als Cavalli mit anderen Mitarbeitern unternommen hatte. Er verspürte Bedauern, verdrängte das Gefühl aber gleich wieder. Dafür war kein Platz.
»Ich kann nicht«, beharrte Gurtner.
Cavalli bemühte sich um einen sachlichen Tonfall. »Es gibt nichts zu diskutieren. Du wirst zum Mythenquai fahren.«
Gurtner ignorierte ihn und machte einen Schritt auf die Tür zu. Cavalli erstarrte. Noch nie hatte ein Untergebener einen Befehl einfach ignoriert. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Gurtner sich aus Trotz weigerte, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Obwohl er engstirnig war, erledigte er seine Aufgaben stets gewissenhaft. Oder hatte ihn Pilecki angestachelt? Genügte ihm der passive Widerstand nicht mehr? Was auch immer hinter Gurtners Weigerung steckte, Cavalli durfte sie nicht durchgehen lassen, sonst hatte er bald gar nichts mehr zu sagen.
Pilecki hob schlichtend die Hand. »Darf ich einen Vorschlag machen? Haas ist hier, um etwas zu lernen. Bis jetzt hatte sie wenig Gelegenheit dazu. Sie würde viel dafür geben, ausrücken zu dürfen. Und sie bewundert dich«, teilte er Cavalli mit einer Grimasse mit. »Wie wäre es, wenn du ihr eine Einführung in die Arbeit vor Ort geben würdest? Eine Wasserleiche ist keine große Sache. Am Montag wird Gurtner dann übernehmen.«
Erleichtert, dass Pilecki nicht die Ursache für Gurtners Verhalten war, nutzte Cavalli den Ausweg, den sein Stellvertreter ihm bot. Mit einem kurzen Nicken verließ er den Raum. Ganz wohl war ihm dabei nicht. Er musste die Situation im Team in den Griff bekommen, sonst würde am Schluss die Fallarbeit darunter leiden. Zu lange hatte er längst fällige Gespräche hinausgeschoben. Jetzt aber wartete eine Wasserleiche auf ihn. Die Vorstellung, dem Kripo-Gebäude zu entfliehen, erfüllte ihn mit Erleichterung. Wie viel einfacher war doch der Umgang mit Toten.
Mit leichten Schritten ging er in sein Büro, legte den Papierstapel zurück in sein Pendenzenfach und holte seine Sachen. Anschließend suchte er Haas auf.
»Wir fahren zum Mythenquai«, verkündete er. »Mach dich bereit.«
»Jetzt?«, fragte sie erstaunt.
»Hast du ein Problem damit?«
Sie sprang auf. »Ich komme.«
3
Der Tote lag in einem offenen Leichensack in der Garage der Wasserschutzpolizei. Als Vera Haas den Raum betrat, schluckte sie. Nie würde sie vergessen, wie sie in Ohnmacht gefallen war, als sie bei der Regionalpolizei erstmals einen Suizid bearbeitet hatte. Der Tote hatte tagelang unentdeckt in seiner Wohnung gelegen. Die Haut hatte sich bereits grün verfärbt und vom Körper zu lösen begonnen. Wenn sie Cavalli richtig verstanden hatte, war die Wasserleiche in einem besseren Zustand. Auf der Fahrt zum Mythenquai hatte er ihr erklärt, was sie erwartete. Obwohl sie sich bemüht hatte, die Informationen aufzunehmen, war es ihr nicht gelungen. Cavallis Anwesenheit blockierte sie.