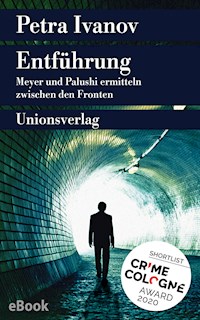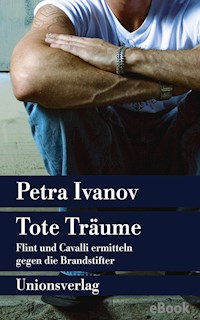12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Entwicklungshelferin Isabelle Jenny verschwindet spurlos. Und der Buchhalter der Organisation »Teamwork«, für die sie tätig ist, wird tot zu Hause aufgefunden. Selbstmord? Staatsanwältin Regina Flint nutzt ihre Ferien im Südkaukasus, um nach ihrer ehemaligen Schulfreundin zu suchen, doch sie stößt auf eine Mauer des Schweigens. Warum verkehrt Isabelle in Kreisen, die sie früher gemieden hat: mit Auslandschweizern, der georgischen Oberschicht, Gewerkschaftsleuten? Der Aufenthalt wird für Regina Flint und den rekonvaleszenten Kriminalpolizisten zum Albtraum, als die georgische Polizei sie in Untersuchungshaft nimmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über dieses Buch
Staatsanwältin Regina Flint und Kriminalpolizist Bruno Cavalli nutzen die Ferien, um nach ihrer ehemaligen Schulfreundin zu suchen. Diese arbeitete in Georgien als Entwicklungshelferin und verschwand von einem Tag auf den anderen. Einer ihrer Kollegen stirbt kurz darauf. Selbstmord? Flint und Cavalli stoßen auf eine Mauer des Schweigens.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Petra Ivanov verbrachte ihre Kindheit in New York. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz absolvierte sie die Dolmetscherschule und arbeitete als Übersetzerin, Sprachlehrerin sowie Journalistin. Ihr Werk umfasst Kriminalromane, Thriller, Liebesromane, Jugendbücher, Kurzgeschichten und Kolumnen.
Zur Webseite von Petra Ivanov.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Petra Ivanov
Stille Lügen
Flint und Cavalli ermitteln in Georgien
Kriminalroman
Ein Fall für Flint und Cavalli (4)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Die Erstausgabe erschien 2008 im Appenzeller Verlag, Schwellbrunn.
Die Autorin dankt der Außerrhodischen Kulturstiftung und der Stadt Dübendorf für die Werkbeiträge.
© by Petra Ivanov 2008
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Izabela Habur
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-30637-0
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 26.06.2024, 04:58h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
STILLE LÜGEN
1 – Als die Sonne hinter den Gipfeln des Südkaukasus …2 – Obwohl aus einigen Büros Licht drang, wirkte der …3 – Von Arburg hatte sich wie versprochen gemeldet …4 – Die Bürotür sprang auf, und Heinz Gurtner schob …5 – Als Dschaba Iosseliani Georgien zusammen mit verschiedenen Warlords …6 – Der Donnerstag war Fahrni heilig. Christina hatte immer …7 – Der Niva schaukelte wie ein Kind, das von …8 – Die mächtigen Bäume auf dem Friedhof Sihlfeld filterten …9 – Tamaz Glonti wusste nicht, worauf er noch wartete …10 – Die Bettdecke lag über Fahrnis Gesicht. Sie nahm …11 – Der Raum nahm im schwachen Morgenlicht langsam Gestalt …12 – Fahrni griff nach einem Kugelschreiber und begann …13 – Das Warten zermürbte. Zu Beginn hatte Regina versucht …14 – Warum hat der Botschafter es noch nicht geschafft …15 – Regina lernte schnell. Schon nach wenigen Tagen begriff …16 – Kevin Sutter füllte die Gießkanne mit Wasser und …17 – Regina schob einen zähen Brocken Fleisch in den …18 – Meyer knallte einen Ordner auf Thalmanns Schreibtisch. »Vom …19 – Schlotternd kam Cavalli zu sich. Die nassen Kleider …20 – Regina erkannte den Säntis unter ihnen, doch von …21 – Cavalli stand vor der Tafel in der Kripoleitstelle …22 – Eastern Investments gehörte zu den sechzehn Spendern …23 – Regina verließ das Bezirksgericht mit gemischten Gefühlen …24 – Narek Davityan pfiff einen armenischen Schlager, während er …25 – Der Airbus aus Dubai weckte Regina um halb …26 – Die Kripoleitstelle füllte sich nur langsam. Mathias Hug …27 – Regina erkundigte sich am Samstagmorgen als erstes nach …28 – Die Kripoleitstelle war fast leer. Mullis hatte einen …WorterklärungenAbkürzungenMehr über dieses Buch
Über Petra Ivanov
Petra Ivanov: »Meine Figuren sind lebendig. Wenn ich nicht schreibe, verliere ich den Kontakt zu ihnen.«
Petra Ivanov: »Mein Weltbild hat sich zum Besseren verändert, seit ich Krimis schreibe.«
Mitra Devi: Ein ganz und gar subjektives Porträt von Petra Ivanov
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Petra Ivanov
Zum Thema Schweiz
Zum Thema Georgien
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Asien
Für Sabine
»Kein Mensch kann etwas verändern, wenn er nur ans Überleben denkt. Zuerst muss man ihm auf die Beine helfen.«
Entwicklungshelfer in Georgien,
April 2005
1
Als die Sonne hinter den Gipfeln des Südkaukasus unterging, breiteten sich die Schatten wie Totenflecken über der Schlucht aus. Obwohl das Gebirge die Stadt Bordschomi vor extremen Temperaturen schützte, fröstelte Frank Bolay. Das Hotel Zar Franco lag oberhalb der Stadt, umgeben von Orientfichten und Rhododendren. Von seinem Platz auf der Terrasse aus sah Bolay auf die Parkanlage entlang des Flusses Mtkwari, wo sich die Heilquellen mit ihrem natürlichen Mineralwasser befanden. Diesen Quellen verdankte Bordschomi seine Berühmtheit und Frank Bolay seinen Reichtum. Westeuropäer, und immer öfter auch Russen, die den Ort zu Badekuren aufsuchten, schätzten die gehobene Atmosphäre des Zar Franco und waren bereit, für den Luxus zu zahlen. Sie glaubten an die Heilkraft des Mineralwassers, das Bolay den Hotelgästen in Halbliterflaschen anbot.
Frank Bolay selbst trank Evian. Jetzt füllte er sein Glas nach und sah sich nach der Bedienung um. Tanja Begiaschwili schnitt hinter der Bar Zitronen. Als sie in seine Richtung blickte, tippte Bolay mit dem Zeigefinger auf die Evianflasche, als Hinweis darauf, dass sie leer war. Tanja Begiaschwili bemerkte die Geste nicht. Eine dunkle Haarsträhne hatte sich aus dem engen Knoten gelöst, den sie vorschriftsgemäß trug. Sie leckte sich den Saft vom Finger und griff nach der nächsten Zitrone.
Bolay packte seine leere Evianflasche, durchquerte die Hotelbar und stellte die Flasche auf Tanja Begiaschwilis Schneidebrett. Die junge Frau sah überrascht auf. Bolay wusste, dass er mit seiner Größe von 1,72 Metern und seinem schmächtigen Körperbau niemanden beeindruckte. Umso stärker achtete er darauf, dass seine Hemden tadellos gebügelt waren und seine Anzüge perfekt saßen.
Er befahl Tanja Begiaschwili, mit ihm zu kommen. Sie legte ihr Messer auf die Ablage und ließ sich in die Küche führen. Dort bedeutete ihr Bolay, ihm in die Vorratskammer zu folgen. Die junge Frau schüttelte den Kopf. Sie wollte sich nicht allein in einen Raum mit ihm begeben. Bolay packte sie am Arm und schob sie vor sich durch die Tür. Der armenische Hilfskoch wandte sich ab und widmete sich seinen Kräutern.
Bolay schloss die Tür. »Wie oft habe ich Sie auf die Hygienevorschriften aufmerksam gemacht?«
Tanja Begiaschwili starrte auf ihre Füße.
»Antworten Sie!«
»Oft«, flüsterte Tanja Begiaschwili.
Bolay nickte. »Kommen Sie nach Ihrer Schicht zu mir ins Büro. Ich werde Ihren Austritt vorbereiten.«
Tanja Begiaschwilis dunkle Augen füllten sich mit Tränen. Bolay spürte, wie ihm das Blut durch den Körper schoss. Tanja Begiaschwili war am schönsten, wenn sie weinte. Georgische Frauen, sinnierte er, waren dafür geboren zu weinen. Er fuhr Tanja Begiaschwili mit dem Daumen über die nasse Wange und legte seine Hand auf ihren Nacken. Ihre Unterlippe zitterte, und sie versuchte kaum merklich zurückzuweichen.
Mit der anderen Hand strich Bolay über ihren Arm. Als er bei ihren Fingerspitzen ankam, hörte er, wie sie den Atem anhielt. Er ließ sich Zeit, um den Moment voll auszukosten. Er erinnerte sich daran, wie ihm im vergangenen Herbst eine Rothirschkuh am Eingang des Bordschomi Kharagauli Nationalparks vors Auto gesprungen war. Das Tier hatte ins Licht seiner Scheinwerfer gestarrt, bockstill bis auf seinen Schwanz, der zuckte, als wolle er ohne Körper fliehen. Das Bellen der Hirschkuh beim Aufprall hatte die Nacht zum Leben erweckt.
»Irgendwo muss noch Salz sein, verdammt!« Die Stimme des Kochs erfüllte die Vorratskammer. »Ich habe selber …« Matthieu Junod verstummte, als er seinen Chef sah. Über sein Gesicht huschte ein Ausdruck von Ekel, den er zu verbergen versuchte.
Bolay wischte eine weitere Träne von Tanja Begiaschwilis Wange und wandte sich an Junod. »Frau Begiaschwili geht es heute nicht besonders gut.« Dann drehte er sich wieder zu Tanja Begiaschwili. »Kommen Sie nach der Arbeit bei mir im Büro vorbei. Ich werde sehen, was ich tun kann.«
Als das Taxi vor der Schweizer Botschaft hielt, trat Pierre-Richard von Arburg einen Schritt vom Fenster zurück. Er griff sich an den Krawattenknoten, ließ seine Hand aber wieder fallen, ohne ihn zu lockern. Unten auf der Straße stiegen die Fahrgäste aus. Die Wache vor dem Tor zeigte zum Eingang. Kurz darauf klingelte das Telefon. Bevor von Arburg sein Büro verließ, sprühte er sich Mundspray auf die Zunge.
Von Arburg deutete eine Verbeugung an und hieß die Besucher in Tiflis willkommen. Er hatte sich Regina Flint kräftiger vorgestellt. Laut den Erkundigungen, die er über sie eingezogen hatte, war sie eine unbeugsame Staatsanwältin, standhaft, ehrlich und geradlinig. Die Gestalt, die vor ihm stand, erschien ihm zu zerbrechlich, um Gewaltdelikte zu verfolgen.
Regina Flint erwiderte seinen Händedruck. »Danke, dass Sie sich für uns Zeit nehmen.«
»Selbstverständlich«, lächelte von Arburg. Er wandte sich an den Polizisten, der Regina Flint begleitete, und bat ihn, Platz zu nehmen. Auch Bruno Cavalli sah weniger bedrohlich aus, als von Arburg aufgrund seines Rufes vermutet hatte. Seine matten Augen starrten an von Arburg vorbei, als er sich auf den Stuhl fallen ließ.
»Kann ich Ihnen etwas anbieten? Kaffee? Orangensaft?«, fragte von Arburg.
»Wasser bitte«, antwortete Regina Flint.
»Herr Cavalli?«
»Kaffee.«
Nachdem von Arburg die Bestellung weitergeleitet hatte, nahm er am Kopf des Besprechungstisches Platz und fragte nach ihrem Hotel. Regina beschrieb den Neubau, bis die Getränke gebracht wurden.
»Herr von Arburg, ich habe Ihnen am Telefon angedeutet, weshalb wir hier sind.«
Pierre-Richard von Arburg bemerkte die Veränderung in Regina Flints Stimme. Sie wurde sachlich. Zwischen ihren Augenbrauen bildete sich eine kleine Falte. Als sie sich nach vorn beugte, griff von Arburg automatisch zum Mundspray in seiner Tasche. Er zwang sich, seine Hand wieder auf den Tisch zu legen. »Ich erinnere mich. Sie suchen eine vermisste Person.«
»Isabelle Jenny. Sie arbeitet für das Hilfswerk Teamwork. Kennen Sie die Organisation?«
Von Arburg nickte. »Ein kleines Schweizer Hilfswerk, das hauptsächlich in Osteuropa tätig ist.«
»Ausschließlich. Es wurde 1989 von Schweizer Slawistikstudenten gegründet, die sich für den Frieden in Osteuropa einsetzen wollten. Die Friedensarbeit ging immer mehr in Entwicklungszusammenarbeit über. Seit fünf Jahren ist Teamwork hauptsächlich im Südkaukasus tätig. Isabelle Jenny hat das Programm in Georgien aufgebaut.«
Von Arburg nahm einen Schluck Kaffee. »Eine noble Aufgabe.«
»Isabelle Jenny flog am 28. April von Zürich nach Tiflis, seither hat niemand sie gesehen.«
»Darf ich fragen, warum Sie sich als Zürcher Staatsanwältin mit diesem Fall beschäftigen? In der Regel werden Vermisstmeldungen über die Sektion für konsularischen Schutz des EDA an uns weitergeleitet.«
»Wir sind privat hier. Es gibt bis jetzt keinen Hinweis darauf, dass Isabelle Jenny etwas zugestoßen ist. Doch ihre Mutter ist besorgt. Angeblich telefoniert Isabelle jeden Sonntagabend nach Hause. Der 28. April war ein Donnerstag. Sie hat sich weder am 1. Mai noch gestern gemeldet.«
»Dann hat die Mutter der vermissten Frau Sie also privat engagiert? Zusammen mit Herrn Cavalli?« Von Arburg blickte zum Polizisten, der aufsah, als er seinen Namen hörte.
»Isabelle Jenny ist eine alte Schulkollegin von mir«, erklärte Regina Flint. »Als ihre Mutter von unseren Ferienplänen erfuhr, bat sie mich, Isabelle aufzusuchen.«
Von Arburg wandte sich an Bruno Cavalli. »Ist etwas außergewöhnlich an Isabelle Jennys Verschwinden?«
»Möglicherweise.«
»Haben Sie schon mit den georgischen Behörden Kontakt aufgenommen?«
»Nein, noch nicht«, erwiderte Regina Flint. »Sind sie kooperativ?«
»Die Zusammenarbeit ist manchmal schwierig«, antwortete von Arburg. »Aber ich werde schauen, was ich für Sie tun kann. Wie lange sind Sie in Tiflis?«
»Noch zwei Tage. Anschließend fahren wir nach Batumi ans Meer.«
»Ein wunderschöner Ferienort.« Von Arburg stand auf und nahm die Visitenkarte, die Regina Flint ihm reichte. Er versprach, sich so bald als möglich zu melden. Dann begleitete er sie zum Ausgang. Als er die Tür hinter ihnen zustieß, holte er seinen Mundspray hervor.
Im Hotel legte sich Cavalli hin. Sobald er die Augen schloss, befand er sich in Gedanken wieder im Taxi. Der Lada war im Zickzackkurs durch Tiflis gerast, um Schlaglöchern und Autofahrern auszuweichen. Regina hatte ihn vor der Reise gewarnt, doch er hatte nicht auf sie gehört. Zu verlockend war die Vorstellung gewesen, der Untätigkeit zu entfliehen. Wochenlang hatte er nichts anderes getan, als zu schlafen und zu spazieren. Sein Arzt hatte ihn nach der Schussverletzung drei Monate krankgeschrieben. Als Reginas Freundin Leonor wegen eines Krankheitsfalls in der Familie ihre Reise absagte, ergriff Cavalli die Gelegenheit und begleitete Regina an Leonors Stelle nach Georgien. Seine Kräfte ließen jedoch schneller nach, als er sich eingestehen wollte.
Cavalli presste den rechten Arm gegen seine Brust und rutschte zur Bettkante. Das Hämmern in seinem Kopf setzte wieder ein. Neben dem Bett waren Medikamente aufgereiht, doch er würde die Schmerzmittel nicht schlucken. Die Angst, dass ihm sein Körper noch fremder würde, war zu groß. 41 Jahre bei bester Gesundheit und dann, auf einen Schlag, war alles vorbei. Würde er seine Ferien in Zukunft im Sanatorium statt im Kaukasus verbringen? Die Vorstellung gab ihm die Kraft, sich aufzusetzen und die Füße auf den Boden zu stellen.
Wieder hämmerte es, diesmal nicht in seinem Kopf, sondern draußen.
»Cava? Ist alles in Ordnung?« Reginas Stimme.
Cavalli öffnete die Augen. Er saß immer noch auf der Bettkante, aber inzwischen war es dunkel. Seine Zunge klebte am Gaumen, als er zu antworten versuchte.
»Cava? Mach auf!«
»Bin gleich so weit.«
»Brauchst du Hilfe?«
Cavalli zwang sich aufzustehen. Seine operierte Lunge füllte sich mit Luft und drückte auf die gebrochenen Rippen. Er ignorierte Regina und konzentrierte sich auf die vier Meter bis zum Badezimmer.
Regina berichtete, dass sie mit Lili Tsagareschwili telefoniert habe. Sie würde sie am nächsten Tag um neun Uhr vor dem Hotel abholen. Als Cavalli nicht reagierte, erklärte Regina, dass Lili Tsagareschwili die engste Mitarbeiterin von Isabelle sei. Sie leite das Büro von Teamwork in Georgien. Cavalli rührte mit dem Löffel in der Linsensuppe.
»Hat sich Isabelle immer noch nicht gemeldet?«, fragte er.
»Nein. Langsam kommt mir die Geschichte seltsam vor. Auch Lili Tsagareschwili hat gesagt, das sehe Isabelle nicht ähnlich. Dass sie über Ostern wegfahre, habe sie erwartet. Isabelle landete am 28. April in Tiflis, der 29. April war bereits Karfreitag. Georgien feiert nach dem orthodoxen Kalender.«
»Ich weiß«, sagte Cavalli. »Die Kugel hat mich nicht am Kopf getroffen.«
Regina betrachtete ihn. Sie wusste genug über posttraumatische Belastungsstörungen, um zu erkennen, dass Cavalli akute Reaktionen zeigte. Obwohl ihm »Cop Shock« ein Begriff war, bestritt er, darunter zu leiden. Aber sein Gefühl, unverletzbar zu sein, war erschüttert worden, und damit auch ein Teil seines Selbstbildes. Hilfe anzunehmen bedeutete für ihn Schwäche und Kontrollverlust, das würde er nie zulassen. Deshalb ging sie nicht auf seine Bemerkung ein und erzählte, dass Isabelle laut Lili Tsagareschwili eine begeisterte Wanderin sei.
»Es wird nicht einfach sein, sie im Kaukasus zu finden«, stellte Cavalli fest.
»Ich habe ihrer Mutter nur versprochen, mich zu erkundigen. Lili Tsagareschwili zeigt mir morgen Isabelles Arbeitsplatz und ihre Wohnung. Ich glaube zwar nicht, dass es uns weiterhilft, aber damit habe ich mein Versprechen eingelöst. Der Rest ist Sache der georgischen Polizei.«
»Die Botschaft hat die Zusammenarbeit nicht gerade gelobt.«
Regina schob Cavalli ihre Suppe weg. »Dass Herr von Arburg sich negativ über die Polizei geäußert hat, hat mich erstaunt. Ich dachte, Saakaschwilis Reformen greifen. Er hat 15 000 Polizisten entlassen.«
»Ich frage mich, was aus ihnen geworden ist.«
»Vielleicht kann uns Lili Tsagareschwili mehr darüber erzählen. Ich möchte auch Genaueres über die Justizreform erfahren. Ich werde aus der Presse nicht schlau. Manchmal glaube ich, dass Saakaschwili und seine Nationalen wirklich etwas verändern wollen. Wenn ich dann aber lese, dass …« Regina lehnte sich vor. »Cava? Bist du noch da?«
»Was?« Cavalli sah sie an. »Siehst du eine Verbindung zu Isabelle? Denkst du, sie war politisch aktiv?«
»Nein. Ich rede einfach vor mich hin.« Regina musterte Cavallis Augenringe. »Ich bin müde«, log sie. »Gehen wir zu Bett?«
Cavalli lächelte. »Wir?«
»Ja, du in deines und ich in meines.«
Er war doch noch der Alte.
2
Obwohl aus einigen Büros Licht drang, wirkte der fünfte Stock des Kripo-Gebäudes leer. Seit Cavalli krankgeschrieben war, fehlte der Abteilung Kapitalverbrechen etwas. Nicht einfach etwas, dachte Tobias Fahrni, sondern das Zentrum. Das Herz. Warum, fragte er sich und griff sich an die Brust, warum lag das Herz nicht im Zentrum des Körpers?
Bülent Karan runzelte die Stirn und fragte, ob alles in Ordnung sei.
»Ich dachte nur gerade daran, dass das KV ohne den Häuptling leer ist. Eigentlich suche ich meinen Schirm.« Fahrni zeigte zum Fenster, vor dem der Regen niederfiel, als fände auf dem Dach des Kripo-Gebäudes eine Löschübung der Feuerwehr statt.
»Hast du es eilig?«
»Nein, Christina hat Spätdienst.«
Karan blicke ihn seltsam an. »Aleyna schwärmt von ihr.«
Als Fahrni den Namen von Karans ältester Tochter hörte, trübte sich sein Blick. Aleyna litt am unheilbaren Bardet-Biedl-Syndrom und stand kurz davor zu erblinden. Fahrni hatte sie kennengelernt, als er Christina von der Arbeit abholte.
»Wie geht es ihr?«
»Die Thalassotherapie war ein Erfolg. Kannst du dir den Rapport des AGT in Wiedikon anschauen?«
Fahrnis Gedanken verharrten bei Aleyna. Ihr Tod, der in den nächsten Jahren mit Sicherheit eintreten würde, fiele nicht unter den Begriff »Außergewöhnlicher Todesfall« oder AGT, obwohl er alles andere als gewöhnlich sein würde.
Karan reichte ihm den Rapport. »Stefan Mullis war dabei, als man ihn herunterholte.«
»Weiß man, warum er sich erhängt hat?«
»Eben nicht. Seine Frau behauptet, er hätte das nie freiwillig getan. Sie haben zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren.«
»Das behaupten sie alle. Ein Suizid ist immer ein Schock. Und wenn man zu graben beginnt, kommen Tragödien zum Vorschein.«
Karan schwieg. Auf der Straße fuhr ein Fahrzeug durch eine Wasserlache, Fahrni fröstelte. Er versprach, die Sache anzuschauen.
»Rapport von Det Wm Stephan Mullis. Dienststelle: Kriminaldienstkreis Sihl. Betrifft: Suizid durch Erhängen. Tatbestand: Außergewöhnlicher Todesfall. Ort: 8003 Zürich. Örtlichkeit: Mehrfamilienhaus, Estrich. Zeit: Dienstag, 3. Mai, ca. 03.00 Uhr. Name: Knecht. Vorname: Philippe. Geboren: 9. Oktober 1968.« Fahrni legte die Seiten aus der Hand.
Philippe Knecht war 37 Jahre alt gewesen, als er sich das Leben genommen hatte. Nur zwei Jahre älter als er selbst, dachte Fahrni und drehte sich zum Fenster. Als er genug hatte vom Grau, holte er seinen Regenschirm hervor und ließ ihn aufspringen. Er hielt ihn unter die Neonröhre an der Decke, so dass das Licht über ihm blau schimmerte. Dunkelblau zwar, aber immerhin, sagte er sich und las weiter.
»Leichenidentifikation: Die Identifizierung der Leiche erfolgte am Sterbeort durch die Ehefrau des Verstorbenen (Viola Knecht). Leichenschau: Doktor med. Uwe Hahn, IRM Zürich, ca. 09.30 Uhr am Wohnort des Verstorbenen. Verfügung Leiche: Durch STA lic. iur. Ruedi Ochsenknecht, Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Zürich. Zuletzt lebend gesehen: Montag, 2. Mai, 07.45 Uhr, durch Viola Knecht, als Philippe Knecht die Wohnung verließ, um zur Arbeit zu gehen.«
»Haben wir ein Leck in der Decke?« Jasmin Meyer ließ ihre Tasche fallen und schüttelte ihr Haar.
Fahrni schloss den Schirm. Während sich Meyer aus der nassen Lederjacke schälte, erzählte Fahrni vom Fall. Dann fragte er, wie es bei den Grenadieren gewesen sei. Er liebte Meyers Erzählungen über die Einsatzgruppe Diamant.
»Nass. Unsere Übung …« Sie verstummte, als Fahrnis Telefon klingelte.
Fahrni meldete sich ungeduldig.
»Tobias?«
»Regina! Entschuldige, ich … rufst du aus Georgien an? Wie geht es dem Häuptling?«
»Schwer zu sagen. Frag ihn lieber selber. Wie kommt ihr ohne ihn zurecht?«
»Jasmin hat alles im Griff. Ehrlich gesagt, es läuft nicht viel.«
»Umso besser. Ich habe eine Bitte.« Regina berichtete von ihrer Suche nach Isabelle Jenny. Sie bat Fahrni, Isabelles Mutter aufzusuchen, da sie sie nicht am Telefon befragen wollte. Fahrni sagte sofort zu und bot an, Nachforschungen über das Hilfswerk Teamwork anzustellen.
»Nur, wenn du nichts Wichtigeres zu tun hast«, wandte Regina ein.
Fahrni erinnerte sich daran, dass er beim Schießen durchgefallen war. Er sollte dringend für die Wiederholung üben. Ohne Meyer anzusehen, fragte er Regina nach der Adresse von Isabelles Familie. Nachdem er aufgelegt hatte, schaute er auf die Uhr. Es war erst halb sieben.
»Hat Christina schon wieder Spätdienst?«, fragte Meyer. »Bist du deswegen noch hier?«
Fahrni nickte. »Kennst du das Hilfswerk Teamwork?«
»Noch nie gehört.« Meyer nahm ihre Post aus dem Fach.
Während Fahrni im Feierabendverkehr die Birmensdorferstraße hinaufkroch, legte er eine CD von Kenny Rogers ein und ließ seine Gedanken zu seinen bevorstehenden Ferien wandern. Christina und er planten, mit den Pferden zwei Wochen lang durch die Steppen der Causse Méjean zu reiten. Fahrni stellte sich die Thymianwiesen und Kastanienwälder vor und hätte am liebsten gleich die Satteltaschen gepackt. Auf der Waldegg bog er nach Ringlikon ab und suchte die Adresse der Jennys hervor. Die Husacherstraße lag fast am Waldrand.
Barbara Jenny war eine hochgewachsene Frau. Trotzdem wirkte sie zierlich, bis auf die Hände, die Fahrni an die Plastikrechen erinnerten, mit denen er als Kind im Sandkasten gespielt hatte. Als er ihr erklärte, dass er keine Neuigkeiten über Isabelle hatte, fiel sie in sich zusammen. Sie war sicher, dass ihrer Tochter etwas zugestoßen war.
»Stehen Sie sich nahe?«, fragte er.
»Sehr. Isabelle ist ein Einzelkind. Wir hätten gern weitere Kinder gehabt, aber es sollte nicht sein. Isabelle hat sich immer für andere Menschen eingesetzt, schon als Kind. Sie fühlt sich zu Schwächeren hingezogen. Sie findet es nicht gerecht, dass es uns so gut geht.«
Fahrni nickte.
»Was ist schon gerecht?«, fuhr Barbara Jenny fort. »Isabelle und mein Mann gerieten sich manchmal deswegen in die Haare. Sie stellte unseren Wohlstand in Frage und erwartete, dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Edi arbeitet hart, in seiner Freizeit will er das Leben genießen.«
»Was macht Ihr Mann beruflich?«
»Er hat das Malergeschäft seines Vaters übernommen und ausgebaut. Er verbringt den größten Teil seines Lebens im Betrieb.«
Fahrni ließ seinen Blick durch das Wohnzimmer der Jennys schweifen. Ein bescheidener Luxus, stellte er fest, wie er in vielen Schweizer Wohnzimmern zu finden war. Nicht einmal der Flachbildfernseher konnte als extravagant bezeichnet werden.
Barbara Jenny folgte seinem Blick. »Edi liebt Fußball. Er schaut sich alle Übertragungen an.«
»Was wissen Sie über das Leben Ihrer Tochter in Georgien?«
»Wir haben Isabelle letzten Sommer in Tiflis besucht. Wir können uns in der Schweiz gar nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen die Menschen dort leben. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen Fotos zeigen.« Sie holte ein Album.
Fahrnis Magen knurrte, und er fragte, ob er das Album mitnehmen dürfe. Er versprach, es in einigen Tagen zurückzubringen. Nach kurzem Zögern stimmte Barbara Jenny zu. Fahrni hätte noch weitere Fragen gehabt, doch sein Hunger war auf einmal überwältigend. Er würde sich zu Hause die Fotos ansehen und das Gespräch fortsetzen, wenn er das Album zurückbrachte.
Der Verkehr hatte inzwischen nachgelassen, und die Fahrt nach Affoltern am Albis dauerte lediglich zwanzig Minuten. Die neue Wohnung, die Fahrni vor vier Monaten mit Christina bezogen hatte, war ihm immer noch fremd. Er fragte sich, was Isabelle zum Neubau sagen würde. War sie wirklich so bescheiden, wie ihre Mutter sie darstellte?
Aus dem Kühlschrank holte er den Rest des Hackbratens, den ihm seine Mutter am Vortag mitgegeben hatte. Er schob ihn in den Mikrowellenherd und beobachtete, wie sich der Teller im Kreis drehte.
Sie musste sich abmelden. In wenigen Stunden begann ihre Schicht im Hotel National. Kalter Schweiß bildete sich zwischen ihren Brüsten und lief ihr über den Bauch. Gleichzeitig schlotterte sie vor Kälte. Erstmals war Mirjana Racic froh, dass ihre Einzimmerwohnung so klein war. Bis zum Telefon waren es keine drei Meter.
Als sie ihr Gewicht verlagerte, wurde sie von heftigen Unterleibsschmerzen gepackt. Sie sank auf die Knie, da wurde es warm zwischen ihren Beinen, und ein übler Geruch breitete sich aus. Entsetzt beobachtete sie, wie sich auf dem Parkett ein brauner Fleck bildete. Sie vergaß das Telefon und umklammerte das Leintuch.
Der kalte Boden drückte schmerzhaft gegen ihre Kniescheiben. Als sich ein neuer Krampf anbahnte, presste sie ihre Stirn gegen das Parkett. Die Kälte war unerträglich. Mirjana konnte sich nicht daran erinnern, jemals so gefroren zu haben. Vor zwei Jahren hatte sie mit einer Grippe im Bett gelegen, doch das war nichts im Vergleich zur Krankheit, die sie jetzt heimsuchte.
Sie unternahm einen weiteren Versuch, das Telefon zu erreichen, schaffte es aber nicht einmal, den Kopf zu heben. Ihr Körper glühte, ihr Verstand wurde jedoch immer schärfer. Die letzten Wochen zogen an ihr vorbei. Jeder Tag war wie der vorhergehende gewesen, kein Ereignis stach hervor. Sie machte die Betten im »National«, putzte hinter den Gästen her, füllte Seife und Körperlotion auf. Ein Schatten, für die Gäste so selbstverständlich wie die frischen Handtücher, die täglich im Bad hingen.
Manchmal hatte sie davon geträumt, in einen der blauen Sessel zu versinken, die Beine übereinanderzuschlagen und an einem Glas Champagner zu nippen. Gegenüber säße ein gut aussehender, reicher Mann, dessen Augen auf ihr ruhten, und sie würde sich aus ihrem Schattendasein lösen wie Julia Roberts im Film Pretty Woman. Doch daran dachte sie jetzt nicht mehr. Sie wünschte sich nur noch, dass die Schmerzen aufhörten. Ihr Darm entleerte sich weiterhin, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte. Sie wusste nicht, wie spät es war, Zeit hatte keine Bedeutung mehr. Endlich gelang es ihr, den Kopf zu heben. Gestank stieg ihr in die Nase, und Mirjana würgte die letzten Reste aus ihrem Magen. Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Sie schmeckten nach Blut. Gekochtes Blut, heiß und metallisch. Bevor sie sich darüber wundern konnte, packte sie der Schmerz erneut, diesmal so heftig, dass sie mit dem Gesicht in ihr Erbrochenes fiel.
Irgendwo draußen knatterte ein Mofa und zündete einen schwachen Lichtstrahl in den Raum. Kurz darauf quietschte der Briefkasten, als der Zeitungsausträger die Klappe aufstieß. Der Motor heulte wieder auf, das Mofa entfernte sich. Zurück blieb die Dunkelheit.
3
Von Arburg hatte sich wie versprochen gemeldet, doch er konnte Regina nicht weiterhelfen, da der zuständige Minister noch nicht zurückgerufen hatte. Kurz überlegte Regina, sich direkt an die georgische Polizei zu wenden, doch dann beschloss sie, den offiziellen Weg einzuhalten. Sie gab den Zimmerschlüssel an der Rezeption ab und berichtete Cavalli vom Telefonat mit Fahrni.
Eine Frau mit einer großen Hornbrille kam auf sie zu und stellte sich als Lili Tsagareschwili vor. Sie zeigte auf einen Lada mit laufendem Motor. Cavallis Gesicht war ausdruckslos, aber Regina merkte, wie er beim Anblick des alten Wagens den Arm gegen die Brust presste. Er ignorierte die Beifahrertür, die sie ihm öffnete, und nahm auf dem Rücksitz Platz.
»Erzählen Sie mir von Teamwork«, bat Regina auf Englisch. »Arbeiten Sie schon lange mit Isabelle zusammen?«
»Ich habe mit ihr das Büro in Tbilissi aufgebaut, damals, während der Flüchtlingswelle aus Südossetien und Abchasien.«
»Wann war das?«
»Anfang der Neunzigerjahre, nach den ersten freien Wahlen. Es ging bei uns zu und her wie im Bürgerkrieg. Unter Schewardnadse beruhigte sich die Lage etwas, doch das Flüchtlingsproblem löste auch er nicht. Der Krieg gegen die ossetischen Rebellen vertrieb Tausende.«
Regina drehte sich zu Cavalli um. »Die Südosseten wollen sich mit ihren Brüdern im Norden vereinigen. Sie werden von den Russen unterstützt. Der Konflikt bricht immer wieder aus.«
Cavalli versuchte, Interesse zu zeigen. »Und Teamwork kümmert sich um diese Flüchtlinge?«
»Wir haben Notunterkünfte organisiert«, erwiderte Lili Tsagareschwili, »auch für Georgier aus Abchasien. Dort war der Konflikt genauso blutig. Er verwüstete zudem eine der schönsten Landschaften im Kaukasus. Diese Kriege wurden natürlich instrumentalisiert. Sobald wir uns um innenpolitische Probleme kümmerten, passierte zufällig etwas in Abchasien oder Ossetien. Immer sind die Russen schuld – reine Ablenkungsmanöver der Regierung.« Der Lada schoss nach vorne, als sich vor ihnen eine Lücke auftat. »Bis zur Rosenrevolution war es dann ruhig. Für Saakaschwili hat die Wiederherstellung der territorialen Einheit Georgiens aber höchste Priorität.« Lili Tsagareschwili zeigte nach links. »Das sind übrigens die berühmten Schwefelbäder.«
Regina erhaschte einen Blick auf eine Lichtkuppel. »Sind sie noch in Betrieb?«
»Beschränkt. Ich würde sie von außen genießen.«
»Sie sollen heilend wirken«, sagte Regina.
»Wenn Sie Heilwasser suchen, empfehle ich Bordschomi. Haben Sie nicht vor, nach Batumi zu fahren? Auf der M1 biegen Sie in Chaschuri links ab. Nach rund dreißig Kilometern beginnt die Bordschomischlucht. Ein kleiner Umweg, der sich auf jeden Fall lohnt. Isabelle fährt übrigens oft nach Bordschomi.«
»Was ist sie für ein Mensch?«, fragte Cavalli.
»Isabelle ist wunderbar«, schwärmte Lili Tsagareschwili. »Sie hat in all den Jahren nie den Glauben daran verloren, dass wir etwas bewirken können. Viele Entwicklungshelfer werden irgendwann zynisch. Isabelle ärgert sich zwar über Rückschritte, aber sie beginnt einfach wieder von vorn, weil sie immer die Menschen vor sich sieht. Sie hat ein Gespür dafür, was wichtig ist. Manchmal hilft ein offenes Ohr mehr als ein Nahrungsmittelpaket, verstehen Sie?« Sie trat heftig auf die Bremse, als ihnen ein Kleinbus den Weg abschnitt. Dann erklärte sie, dass sie zum ehemaligen Hotel Kaukasus fuhren. Seit 1996 waren dort Flüchtlinge untergebracht. Teamwork hatte im Gebäude einen Coiffeurladen eingerichtet und bildete junge Frauen aus. Lili Tsagareschwili machte sich Sorgen um die Zukunft des Projekts. Sie beschrieb, wie die Tourismusbranche langsam erwachte und ausländische Investoren die Schätze Georgiens entdeckten. Plötzlich wurden die alten Hotels wieder interessant, so auch das Kaukasus.
Cavalli hustete. »Gehört das Gebäude Teamwork?«
»Die Stadt hat es uns zur Verfügung gestellt. Aber anscheinend laufen Verhandlungen über einen möglichen Verkauf. Wir sind noch nicht offiziell informiert worden. Isabelle glaubt, dass eine Schweizer Firma dahinter … Herr Cavalli? Soll ich anhalten?«
Sein Husten hörte nicht auf. Regina reichte ihm eine Flasche Wasser. Als er Lili Tsagareschwili ein Zeichen gab weiterzufahren, sah Regina Blut in seinem Mundwinkel. Augenblicklich war sie in Gedanken wieder auf dem Zugerberg, über Cavalli gebeugt, der reglos am Boden lag. Sie spürte die Verantwortung, die auf ihr gelastet hatte, und die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Regina hatte instinktiv zuerst dem entführten Mädchen geholfen, was sich im Nachhinein als richtig erwiesen hatte. Doch die ganze Zeit fürchtete sie, Cavalli würde sterben, weil sie ihn im Stich gelassen hatte.
Endlich ließ der Husten nach, und Cavalli machte mit der Hand eine abweisende Bewegung. Regina wandte sich ab. Sollte er doch langsam zugrunde gehen. Wenigstens könnte er sich im Sterben darüber freuen, dass er es ohne fremde Hilfe schaffte. Lili Tsagareschwili parkte vor einem baufälligen Gebäude am Straßenrand.
Vier Stunden später steckte Regina den Stadtplan von Tiflis zurück in ihre Handtasche. Da sie die georgische Schrift auf den Straßenschildern nicht lesen konnte, nützte er ihr nichts. Das Kyrillische war aus dem öffentlichen Leben verschwunden, und lateinische Buchstaben hatten sich noch nicht durchgesetzt. Isabelle sprach georgisch, dachte sie und rümpfte die Nase, als sich die vertraute Eifersucht zurückmeldete. Wenn sich eine Menschentraube im Gymnasium durch die Gänge bewegt hatte, war Isabelle in ihrer Mitte gewesen. Auch in der Flüchtlingsunterkunft hatten die Frauen sofort nach Isabelle gefragt. Die Enttäuschung, dass sie nicht zu Besuch kam, stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Regina hätte sich beinahe dafür entschuldigt, nicht Isabelle zu sein. Wie oft hatte Reginas Mutter einen Satz mit »Isabelle würde …« begonnen? Erst als sich langsam abzeichnete, dass Isabelle einen unkonventionellen Weg einschlagen würde, verstummte der Lobgesang. Isabelle war nicht Hausfrau und Mutter geworden, dachte Regina mit Genugtuung, genauso wenig wie sie selbst.
An der nächsten Kreuzung sah sie sich um. Geradeaus erhob sich der Mtazminda, der höchste Berg auf Stadtgebiet. Davor leuchtete ein Schriftzug, den Regina erkannte: McDonald’s. Laut Stadtführer befand sie sich am Rustaweliplatz. Von hier aus fand sie das Marriott problemlos.
Pierre-Richard von Arburg saß bereits vor einem Glas Weißwein. Als er Regina erblickte, erhob er sich sofort und nahm ihr den Mantel ab. Regina betrachtete seine makellose Gestalt. Sie fragte sich, ob ihn sein Leben als Botschafter so geformt hatte oder ob er den Beruf gewählt hatte, weil dieser wie zugeschnitten war auf ihn.
»Nehmen Sie auch ein Glas Wein?«, fragte er.
»Gern. Täusche ich mich oder höre ich einen leichten französischen Akzent?«
Von Arburg neigte den Kopf zustimmend. »Ich stamme aus Genève.«
»Ihr Schweizerdeutsch ist ausgezeichnet.«
»Ich habe das Internat in Samedan besucht. Außerdem war mein Großvater Luzerner.« Nach einer kurzen Pause fragte er: »Sind Sie Ihrem Ziel näher gekommen?«
»Isabelle Jenny zu finden? Leider nein. Ich glaube langsam, dass ihr tatsächlich etwas zugestoßen ist. Deshalb wollte ich Sie sehen. Ich habe in diesem Zusammenhang einige Fragen.«
Wieder diese Neigung des Kopfes. Regina glaubte, eine Spur Unsicherheit in von Arburgs Augen entdeckt zu haben. Vermutlich hatte er ein schlechtes Gewissen, weil es ihm noch nicht gelungen war, Kontakt zu den Behörden herzustellen. Sie erzählte von den Flüchtlingen im Hotel Kaukasus.
»Ist Ihnen eine Schweizer Firma bekannt, die in georgische Hotels investiert?«, fragte Regina.
»Nein, aber viele ausländische Investoren beginnen sich für Georgien zu interessieren, darunter auch Schweizer. Die Zukunft gehört dem Tourismus. Wissen Sie eigentlich, wie die Georgier zu ihrem Land kamen?«
»Nein, wie?«, fragte sie, erstaunt darüber, wie rasch er das Thema wechselte. Sie hatte sich mehr Informationen über Investoren erhofft. Von Arburgs distanzierter Blick hielt sie jedoch davon ab, weiterzubohren.
»Eine Legende besagt, dass die Georgier zu spät kamen, als Gott die Erde unter den Völkern verteilte. Doch der Charme der Abgesandten besänftigte die Wut Gottes, und er schenkte ihnen den Flecken, den er sich vorbehalten hatte.«
Regina lachte.
Von Arburg stimmte in das Lachen mit ein. »Die Landschaft wird Sie kaum unberührt lassen. Mögen Sie Berge?«
»Wenn sie nicht zu steil sind.«
»Dann empfehle ich Ihnen einen Ausflug in den kleinen Kaukasus.«
»Isabelle war letzten Sommer mit ihren Eltern im Höhlenkloster Wardsia.«
Das Lächeln in von Arburgs Gesicht verblasste, sein Kopf schien plötzlich zu schwer für seinen Hals. »Erzählen Sie von sich. Wie kamen Sie dazu, Staatsanwältin zu werden?«
Regina schilderte ihren beruflichen Werdegang. Von Arburg fragte nicht aus Höflichkeit, er interessierte sich sowohl für die Justizreform als auch für die technischen Fortschritte bei der Polizei. Sie erklärte, dass Cavalli mehr über Letztere wusste. Ihr Ärger auf Cavalli war verflogen, an seine Stelle war die Angst zurückgekehrt, er leide unter Komplikationen, die er verschwieg. Auch deswegen hatte sie von Arburg um das Treffen gebeten. Sie hoffte, er könne ihr einen Arzt in Tiflis empfehlen, damit sie für einen Notfall gerüstet war. Der Botschafter erklärte, dass es nicht schwierig sei, einen guten Arzt zu finden, es jedoch oft an Medikamenten fehle. Aus seiner Brieftasche holte er eine Visitenkarte und notierte darauf eine Nummer. »Das ist mein Privathandy. Rufen Sie an, wenn Sie Hilfe brauchen.«
4
Die Bürotür sprang auf, und Heinz Gurtner schob seinen massigen Körper in den engen Raum. Er ließ einen Stapel Papier auf Fahrnis Pult fallen; eine Postkarte behielt er zurück und fächerte sich damit Luft zu. »Eine Karte aus Kiew!«
»Von Pilecki? Zeig her.« Fahrni streckte die Hand aus.
»Gestern bin ich fast im Regen ertrunken, und heute herrscht eine unbeschreibliche Hitze. Verdammt, hier drinnen stinkts.« Gurtner schaute Jasmin Meyer an. »Hast du Knoblauchpizza zum Frühstück gegessen?«
Meyer ignorierte die Anspielung auf ihren sizilianischen Freund. Sie stand auf und riss Gurtner die Postkarte aus der Hand. »Frühling in Kiew«, las sie laut. »Fußball, Riesenrad, Vanilleglacé, Schaschlik, Hidropark, Frauen. Gruß aus dem Reich der Lebenden.«
»Frauen?« Fahrni entzog Meyer die Karte. »Hat er sich von Irina getrennt?«
»Idiot. Er meint damit Irina und Katja.« Gurtner verließ ohne ein weiteres Wort das Büro.
Fahrni öffnete die Fenster. »Klingt nicht schlecht. Pilecki, meine ich. Ich hätte das nicht so einfach weggesteckt. Wenn ich mir vorstelle, Christina wäre vergewaltigt worden, ich würde mich nicht mehr trauen, sie anzufassen.«
»Und wenn ich mir vorstelle, meine Arbeitskollegen würden mein Eheleben diskutieren, würde ich kündigen.«
»Nicht, weil ich damit Mühe hätte«, fuhr Fahrni unbeirrt fort, »sondern weil …«
»Hast du den AGT von Mullis studiert? Den Suizid?«
Fahrni setzte sich. Seit Meyer für eine Führungsposition im Gespräch war, gab sie sich distanzierter. Sie lästerte nicht mehr mit ihm über Mitarbeiter, warf ihm keine leeren Coladosen an den Kopf und schob keine Schreibarbeiten mehr auf ihn ab. Es war, als hätte er eine Freundin verloren.
»Auf den ersten Blick habe ich nichts Ungewöhnliches entdeckt.«
»Ein Blick genügt nicht. Wenn Mullis ein ungutes Gefühl hat, dann ist meistens etwas dran. Schau dir den Fall genau an.«
Fahrni nickte und holte die Akte hervor. Er starrte auf den Rapport, ohne die Worte zu begreifen. Plötzlich stand er auf, verließ das Büro und eilte nach draußen. Zu Fuß ging er die Zeughausstraße entlang, vorbei an den Motorrädern, die hinter dem Eisenzaun auf dem Kasernenareal standen. Meyers Ducati war auch dabei. Statt den direkten Weg nach Wiedikon einzuschlagen, nahm er einen Umweg über die St. Jakobs-Bäckerei, wo er sich einen Nussgipfel genehmigte. Erst als er bei der Familie Knecht klingelte, kam es ihm in den Sinn, dass er sich telefonisch hätte anmelden sollen.
Die Frau, die ihm öffnete, sah zu alt aus, um Mutter eines sechs- und eines achtjährigen Kindes zu sein. Nachdem sich Fahrni vorgestellt hatte, erklärte sie, ihre Tochter sei beim Notar. Fahrni schämte sich auf einmal für den Nussgipfel, den er genossen hatte. Mit dem Handrücken fuhr er sich über den Mund, damit ihn keine Krümel verrieten. Ein Junge in einem FCZ-Trikot stand im Hintergrund und beobachtete ihn. Im Wohnzimmer lief der Fernseher. Die Frau erklärte, die Kinder hätten schulfrei.
»Höre ich Pikachu?«, fragte Fahrni den Jungen. »Läuft Pokémon?«
»Sind Sie Polizist? Darf ich Ihre Pistole halten?«
»Ich zeig dir etwas Besseres. Das sind meine Handschellen.«
»Ich habe mich gar nicht vorgestellt«, bemerkte die Frau. »Regula Nussbaumer. Pascal!«
Der Junge jagte mit den Handschellen hinter seinem kleinen Bruder her. Fahrni deutete Regula Nussbaumers vorwurfsvollen Blick als Aufforderung, seine Handschellen zurückzuverlangen. Pascal ließ sich nicht dazu überreden.
»Nur, wenn ich Sie fesseln darf.«
»Er ist seit Philippes Tod nicht gut auf Polizisten zu sprechen.«
Fahrni hielt Pascal seine Hände hin. Erst als der Junge ihn unschädlich gemacht hatte, kehrte er vor den Fernseher zurück.
»Warum glauben Sie, dass Ihr Schwiegersohn keinen Suizid begangen hat?«, fragte Fahrni. Er versuchte, eine bequemere Position auf dem Küchenstuhl einzunehmen, doch Pascal hatte dafür gesorgt, dass er die Arme kaum bewegen konnte.
»Soll ich nicht aufschließen?«
»Pascal wird das schon machen.«
»Philippe hatte ganz einfach keinen Grund, Suizid zu begehen. Keine finanziellen Schwierigkeiten, keine Eheprobleme, keine Depressionen. Er war glücklich.«
»Er hat Karten für das Match FCZ gegen Basel gekauft«, flüsterte es plötzlich hinter Fahrni. »Und er hat Pascal versprochen, an seinem Geburtstag mit ihm ins Alpamare zu fahren.«
Eine drahtige Frau, die Viola Knecht sein musste, stellte ihre Handtasche auf die Küchenablage und schaute Fahrni an, ohne ihn richtig zu sehen. Ihre mausbraunen Haare wurden im Nacken von einer silbernen Spange zusammengehalten. Fahrni flehte Pascal innerlich an, endlich die Handschellen aufzuschließen.
»Hatte er Feinde?«
»Feinde?«
»Wenn er sich nicht selber … erhängt hat, dann muss ihm jemand den Tod gewünscht haben.« Aus dem Augenwinkel sah Fahrni, wie sich Pascal hinter einem Schrank versteckte um zuzuhören.
»Philippe hatte keine Feinde.«
»Sie haben zu Protokoll gegeben, dass … das Seil … schon längere Zeit im Estrich hing. Und dass jeder im Haus Zugang zum Estrich hatte.«
Als sie bejahte, bat Fahrni sie, am folgenden Tag für eine ausführliche Befragung ins Kripo-Gebäude zu kommen. Er wollte eine Liste der Personen zusammenstellen, die Philippe Knecht gekannt hatte. Viola Knecht nickte dankbar, als hätte sie nicht damit gerechnet, dass er ihre Bedenken ernst nähme. Auf Zehenspitzen schlich Pascal in die Küche und legte den Schlüssel auf den Tisch.
»Warum hattest du ein ungutes Gefühl?«, fragte Fahrni.
Stefan Mullis strich sich über sein Ziegenbärtchen. »Ich würde es nicht ungut nennen. Ich hatte bloß das Gefühl, dass etwas anders war als gewöhnlich in solchen Fällen. So viel ungläubiges Entsetzen ist mir bei einem Suizid noch nie begegnet. Irgendwo gibt es immer jemanden, der nicht überrascht ist. Ein Arbeitskollege, eine Geliebte, ein Freund, der hinter die Fassade sah. Wasser?«
Fahrni nickte.
»Knecht arbeitete bei der Stiftung Zewo«, sagte Mullis. »Das ist die Fachstelle für Spenden sammelnde Organisationen. So eine Art Gütesiegel, das garantieren soll, dass Spendengelder richtig eingesetzt werden. Er hat in St. Gallen Wirtschaft studiert und sich auf Finanzen spezialisiert. Sein Beruf gefiel ihm, und er leistete gute Arbeit. Das gleiche privat: glückliche Ehe, vorbildlicher Vater. Er arbeitete 80 Prozent, war freitags für die Kinderbetreuung zuständig. Hast du mit Viola Knecht gesprochen?«
Fahrni nickte und schenkte Wasser nach.
»Ich habe mich gefragt, ob sie vielleicht fremdging«, fuhr Mullis fort. »Sie streitet es ab. Aber das würde sie vermutlich auch, wenn es zuträfe. Kurz: Welches Blatt ich auch umgedreht habe, nichts erklärt den Suizid.«
»Krankheiten?«
»Ich habe mit dem Hausarzt telefoniert. Kerngesund.« Mullis starrte auf ein Foto mit seinen eigenen Kindern, das auf dem Schreibtisch stand. Seine asketischen Züge wurden auf einmal weich. »Sie sind im gleichen Alter. Du hast keine, oder?«
»Leider nein.«
»Wenn du Vater wirst, verändert sich dein Leben grundlegend. Alles, was du tust, wirkt sich plötzlich auf die ganze Familie aus. Wenn du Mist baust, leiden die Kinder darunter. Vor etwa vier Jahren machten meine Frau und ich eine Krise durch. Wir stritten uns oft. Einmal habe ich die Beherrschung verloren und schlug die Haustür hinter mir zu. Als ich zurückschaute, sah ich, wie Nico am Fenster stand, den Daumen im Mund. Diesen Anblick vergesse ich nie. Ich weiß nicht, was mich zu einem Selbstmord treiben könnte.«
Fahrni musterte den glasklaren Blick von Mullis. »Ein Vierzig-Tonner könnte dich überfahren, du würdest einfach wieder aufstehen. Das ist nicht normal.«
Mullis unterdrückte ein Lachen. »Danke.«
»Das war kein Kompliment«, stellte Fahrni klar. »Wenn Knecht so ehrlich und aufrichtig war, wie er beschrieben wird, war ihm sein Image bestimmt wichtig. Dort müssen wir ansetzen. Es würde ihn zum Beispiel belasten, wenn er sich etwas zuschulden kommen ließe. Auch unverschuldet. Weißt du, was ich meine?«
»Ja.« Mullis dachte nach. »Denkst du, er könnte schwul sein?«
»Warum?«
»Er wird als feinfühlig und ängstlich beschrieben. Außerdem hat mir Viola Knecht ein Foto gezeigt, auf dem er einen hellen Rollkragenpullover trägt. Und auf einem Pferd sitzt.«
Fahrni schoss die Röte ins Gesicht. »Muss man Eishockey spielen, um ein Mann zu sein? So wie du?«
»Was hast du? Reitest du?«
Fahrni stand auf. »Ich will mir die Spuren noch einmal genau ansehen. Befrag inzwischen weitere Freunde von Knecht.«
Gemäß Rechtsmediziner Uwe Hahn hatte sich Philippe Knecht atypisch erhängt. Der Aufhängepunkt befand sich unter dem seitlichen Unterkieferrand. Doch Hahn wies in seinem Inspektionsbericht darauf hin, man könne daraus keine Rückschlüsse auf Fremdeinwirkung ziehen. Nach fünf bis zehn Sekunden sei Knecht infolge Sauerstoffmangels im Gehirn bewusstlos gewesen.
Als Fahrni beim Kapitalverbrechen angefangen hatte, glaubte er wie die meisten Laien, ein Erhängter sterbe an Luftmangel. Doch es war der Blutzufluss zum Kopf, der durch das Strangwerkzeug unterbrochen wurde. Bereits ein Druck von dreieinhalb bis fünf Kilogramm genügte, um die Halsschlagadern vollständig zu verschließen. Um die geschützten Wirbelschlagadern zu komprimieren, waren sechzehn bis dreißig Kilogramm erforderlich. Das eigene Körpergewicht reichte also problemlos aus.
Fahrni tröstete sich damit, dass Knecht bewusstlos war, als er das Krampfstadium erreichte. Vermutlich hatte er nichts von seinem eigenen Todeskampf gemerkt. Doch ganz sicher war Fahrni nicht. Die Tränenspuren auf Knechts Gesicht verunsicherten ihn, obwohl Hahn sie als typisches Erhängungsmerkmal definiert hatte. Im Bericht erklärte der Rechtsmediziner, dass während des Krampfstadiums vermehrt Tränenflüssigkeit abgeflossen sei. Was aber, wenn es sich Knecht plötzlich anders überlegt hatte und das Sterben nicht mehr aufhalten konnte?, fragte sich Fahrni. Der Kugelschreiber in seiner Hand zitterte, und er legte ihn auf Hahns Bericht.
»Sehe ich schwul aus?«, fragte er Jasmin Meyer.
»Nein. Geistig behindert«, antwortete sie, ohne den Blick vom Bildschirm zu lösen.
Auf den Innenseiten von Knechts Lippen hatte Hahn punktförmige Stauungsblutungen gefunden, las Fahrni weiter. Er führte sie jedoch nicht auf Würgen oder Drosseln zurück, dazu waren sie zu schwach. Weil Knechts Gesicht bläulich war, vermutete Hahn, hatte sich die Schlinge nur langsam zugezogen. Mehr schrieb er dazu nicht.
Fahrni überlegte, ob er Hahn um ein Obduktionsgutachten bitten solle, bis der endgültige Bericht vorlag. Darin würde sich der Rechtsmediziner vielleicht dazu äußern, wie groß die Wahrscheinlichkeit eines Suizids war. Als er weiterblätterte, sah Fahrni, dass eine Untersuchung der Hautzellen im Bereich der Strangmarke angeordnet worden war. Die Histamin-Konzentration würde darüber Auskunft geben, ob sich Knecht selbst aufgehängt hatte oder ob jemand der Leiche nachträglich eine Schlinge um den Hals gelegt hatte.
Warum erhängt sich ein siebenunddreißigjähriger Familienvater?, fragte sich Fahrni erneut und dachte an Pascal. Würde der Junge nun je im Alpamare baden können, ohne an den Tod seines Vaters denken zu müssen? Fahrni erinnerte sich daran, wie sein eigener Vater mit ihm im Wellenbad gespielt hatte. Fast jeden Sonntagmorgen waren sie zusammen ins Hallenbad gegangen, doch das Alpamare war etwas Besonderes gewesen. Dorthin fuhren sie, wenn Fahrni ein gutes Zeugnis nach Hause gebracht hatte. Da ihm die Schule nie Mühe bereitet hatte, kam das immer wieder vor. Sogar als er die Glückwünsche des Rektors für das beste Maturazeugnis seines Jahrgangs entgegennahm, sah Fahrni in Gedanken das Alpamare vor sich.
»Iss endlich etwas«, sagte Meyer. »Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn dein Magen dauernd knurrt.«
»Reiten schwule Männer?«
»Woher soll ich das wissen?« Meyer tippte kurz weiter, dann sah sie Fahrni an. »Bist du … hast du dich … in einen Mann verliebt?«
Fahrni schüttelte heftig den Kopf. Meyer wandte sich mit einem Seufzer wieder dem Bildschirm zu. Philippe Knecht hatte an Händen und Füßen leichte Verletzungen gehabt, las Fahrni. Laut Hahn keine Abwehr-, sondern Anschlagspuren. Auch Schleifspuren an der Leiche fehlten. Ebenso Zugrillen, die auf ein Hochziehen einer Leiche hätten deuten können, oder Polierspuren. Keine postmortalen Begleitverletzungen, einfach nichts, das auf die Anwesenheit einer weiteren Person hinwies. Fahrni legte den Bericht beiseite. Mullis täuschte sich. Philippe Knecht hatte sich am 3. Mai, um drei Uhr morgens, erhängt. Ohne physische Fremdeinwirkung.
5
Als Dschaba Iosseliani Georgien zusammen mit verschiedenen Warlords unter sich aufgeteilt hatte, florierte das Geschäft. Erpressung, Spekulationen mit Erdöl und Immobilien, Schmuggel und Drogen sorgten dafür, dass Geld floss. Iosselianis wilde Reiter, die sogenannten Mchedrioni, waren gefürchtet.
Tamaz Glonti legte als neunzehnjähriger seinen Eid auf Georgien, sein Volk und die Orthodoxe Apostelkirche ab. Er war mit dabei, als die Mchedrioni das Land mit Terror überzogen. Zusammen mit anderen Rebellen belagerte Glonti 1991 das Regierungsgebäude in Tiflis. Nach dem Sturz Gamsachurdias holten die Paramilitärs Schewardnadse ins Land zurück. Unter dem neuen Staatschef kontrollierten sie die profitablen Exportbranchen und beteiligten sich an der illegalen Privatisierung zweier Mineralwasserfabriken in Glontis Heimatstadt Bordschomi.
In den wilden Neunzigerjahren war klar gewesen, wer die Herrschaft ausübte. Heute waren die Strukturen des organisierten Verbrechens komplex. Glonti verstand nicht, wo die Fäden zusammenliefen. Die lokalen Clans hatten an Macht verloren, die Oligarchen im Hintergrund bekam Glonti nie zu Gesicht. Seine Aufträge erhielt er von einer Kontaktperson, die ihm nur so viel wie nötig mitteilte.
Glonti zog das Foto aus dem Umschlag. Bisher hatte er nur Lokalgrößen getötet. Dass er nun einen Schweizer beseitigen sollte, erfüllte ihn mit Stolz. Er hielt den Auftrag für einen Vertrauensbeweis. Wenn er ihn zur Zufriedenheit erfüllte, konnte er mit einer Beförderung rechnen. Fünfzehn Jahre lang hatte er an vorderster Front mitgewirkt, es war Zeit für einen Hintergrundjob mit mehr Prestige. Das Geld konnte er gut gebrauchen. Er setzte seine Sonnenbrille auf, das letzte Relikt aus seiner Mchedrioni-Zeit. Seine stählerne Jericho 941 blieb im Versteck. Zuerst musste er sich mit den Gewohnheiten des Schweizers vertraut machen.
Unter normalen Umständen hätte Regina nicht dreihundertzwanzig Dollar für ein Hotelzimmer bezahlt. Das Zar Franco bot zwar Schweizer Komfort, doch Regina konnte gut auf Sicherheitsschleusen, gewärmte Handtücher und importierte Schokolade verzichten. Trotzdem hatte sie Cavalli dazu überredet, die Fahrt nach Batumi zu unterbrechen, um zwei Nächte im Zar Franco zu verbringen. Regina hatte nicht vor, ein zweites Mal einem Rettungshubschrauber nachzuschauen.
Über das Doppelzimmer hatte sich Cavalli nicht gefreut. Regina sah ihm an, dass er lieber allein gewesen wäre. Doch zwei Einzelzimmer hätten die finanzielle Schmerzgrenze eindeutig überschritten.
»Fenster oder Bad?«
Cavalli betrachtete wortlos die schmiedeeisernen Gitter und zeigte auf das Bett am Fenster.
»Morgen treffe ich Lewan Kupatadze«, sagte Regina. »Er koordiniert die Landwirtschaftsprojekte für Teamwork. Vermutlich werden wir den ganzen Tag unterwegs sein. Du hättest Zeit, die Heilbäder aufzusuchen.«
»Du hast bestimmt schon eine Behandlung für mich reserviert.«
»Nein … soll ich das machen?«
»Natürlich nicht! Das Essen in diesem Goldkäfig ist sicher unbezahlbar. Spazieren wir ins Zentrum hinunter?« Als Cavalli Reginas Blick auffing, fügte er schroff hinzu: »Ja, das schaffe ich.«
»Hat sich Chris mal gemeldet?«
»Können wir zur Abwechslung über etwas Angenehmes sprechen?« Cavalli ging am Fahrstuhl vorbei zur Treppe. Sein Sohn Christopher verbrachte die Ferien im Tessin bei Cavallis Familie. Da sich Cavalli sowohl mit seinem Vater als auch mit seinen Halbbrüdern zerstritten hatte, hatte er versucht, Christopher vom Besuch abzuhalten. Doch Christopher ließ sich nicht umstimmen.
Regina folgte Cavalli durch die Hotellobby am Portier vorbei und knöpfte ihren Mantel zu. Der Winter wich erst langsam aus dem Tal; sobald die Sonne unterging, wurde es empfindlich kalt. Als sie draußen waren, fragte Cavalli, was Regina gegen Isabelle habe. Er nahm mehr wahr, als sie ihm zurzeit zutraute, stellte Regina fest. Sie erzählte ihm von ihrer Zeit im Gymnasium, von ihrer Unsicherheit und ihrem Gefühl, nie zu genügen. Ihre Abneigung hatte in Wirklichkeit nichts mit Isabelle zu tun gehabt, sondern nur mit ihr selbst.
»In den letzten Jahren hast du dich gebessert«, witzelte er. »Ich würde dich sogar herrisch nennen.«
Regina schmunzelte. »Ich fass das als Kompliment auf.«
»Siehst du. Früher wärst du beleidigt gewesen.« Cavalli sog die Düfte ein. Rhododendren, stellte er fest, verwoben mit Frittieröl und Tannennadeln. Es tat gut, außerhalb der Stadt zu sein.
Sie waren beim Zarenpark angekommen, und Regina zeigte auf die Ruinen der Petrisziche-Festung. Im Reiseführer hatte sie gelesen, dass sich zwei Brüder um den Nachlass gestritten und es vorgezogen hatten, ihr Erbe zu zerstören, statt sich zu einigen.
»Willst du mir damit etwas sagen?«, fragte Cavalli, als sie ihm die Geschichte erzählte.
»Käme mir nicht im Traum in den Sinn. Welchen Eindruck hast du von Isabelle?«
»Sie glaubt an das, was sie tut.«
»Überzeugt dich ihre Arbeit nicht?«
Cavalli schwieg lange. Erst als sie sich in einem unscheinbaren Lokal zu Tisch setzten, beantwortete er die Frage. »Ich weiß nicht, wie es in Georgien aussieht, aber meiner Meinung nach ist Entwicklungshilfe kontraproduktiv. Sie unterstützt ein System, das nicht funktioniert. Verleiht einer Regierung Glaubwürdigkeit, die sie nicht verdient, und erschwert damit die Bildung einer Demokratie.«
»Das kommt darauf an, wohin das Geld fließt«, wandte Regina ein. »Heute ist ›Hilfe zur Selbsthilfe‹ selbstverständlich. Kein Hilfswerk verteilt einfach Geld, schon gar nicht an den Staat. Auch Teamwork investiert direkt in Projekte, die die Zukunft von Bauern und Flüchtlingen sichern.«
»Aber wäre das nicht Aufgabe des Staates? Gibt man der Regierung damit nicht das Signal, sie brauche sich nicht um soziale Missstände zu kümmern?«
Sie bestellten zwei Portionen Ghomisghomi, ohne zu wissen, was es war.
»Was ist die Alternative?«, fragte Regina. »Willst du die Ungleichheit akzeptieren? Kein Mensch kann um seine Rechte kämpfen oder sogar etwas in der Gesellschaft verändern, wenn er hungert. Dazu muss man ihm zuerst auf die Beine helfen.«
»Die Frage ist, ob er dann noch motiviert ist zu kämpfen.«
»Nein, die Frage ist, ob er ohne Starthilfe überhaupt eine Chance gegen die Mächtigen hat.« Sie lehnte sich zurück, um der Bedienung Platz zu machen, die ihnen zwei Suppenteller vorsetzte. Mit hochgezogenen Augenbrauen musterte sie den Brei.
»Hirse!« Cavalli roch erfreut am Dampf und sagte: »In den USA leben 800 000 Indianer in Reservaten. Ein Drittel davon unter dem Existenzminimum. Teilweise beträgt die Arbeitslosigkeit achtzig Prozent, Gewalt und Alkohol gehören zum Alltag. Kennst du Wilma Mankiller?« Als er Reginas ungläubigen Ausdruck sah, lächelte er. »Doch, sie heißt wirklich so. 1987 wurde sie die erste Frau an der Spitze der Cherokees. Mit einem jährlichen Budget von fünfundsiebzig Millionen Dollar und eintausendzweihundert Angestellten führte sie einen Großbetrieb. Sie war Häuptling, als Bushs sogenannte self-governance initiative in Kraft trat. Die Cherokees gehörten zu den großen Befürwortern der Initiative. Sie sah vor, dass die Stämme Regierungsgelder selber verwalteten. Davor lief alles über das Bureau of Indian Affairs, das BIA …« Cavalli rührte im Hirsebrei. »Das BIA …«
Regina sah, dass er den Faden verloren hatte. »Wilma Mankiller?«
»Wilma Mankiller hatte den Mut zu sagen, dass wir uns an die Abhängigkeit vom BIA gewöhnt hatten. Tatsächlich fällt es heute vielen Stämmen immer noch leichter, in der Opferrolle zu verharren, als ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.« Wieder machte er eine Pause, als wüsste er nicht mehr, wie sie auf das Thema gekommen waren.
»Ich verstehe, was du sagen willst: dass Entwicklungshilfe zu Passivität führen kann.« Zwar teilte Regina seine Meinung nicht, aber sie ließ es im Moment dabei bewenden und schlug vor, ins Hotel zurückzukehren. Falls Cavalli merkte, dass sie ihre Müdigkeit vortäuschte, zeigte er es nicht. Regina bestellte ein Taxi und bezahlte die Rechnung. Im Zar Franco begleitete sie ihn nach oben und kehrte dann unter dem Vorwand, telefonieren zu müssen, in die Lobby zurück, damit er ungestört zu Bett gehen konnte. Sie beschloss, die Zeit mit einer Tasse Tee totzuschlagen.
Die junge Frau an der Bar kannte die Teesorte nicht, die Regina bestellte. Nervös holte sie eine Schachtel mit verschiedenen Beuteln hervor. Regina staunte, als sie die Schweizer Marken sah. Sie zeigte auf den Grüntee. Tanja Begiaschwili las sie auf dem Namensschild der Georgierin. Sie fragte auf Englisch, ob sie aus Bordschomi stamme.
»Aspindsa, ganz nahe bei Wardsia. Kennen Sie?«
»Das Höhlenkloster? Ich würde gern hinfahren, doch es liegt nicht auf dem Weg. Wir fahren nach Batumi.«
»Wardsia müssen Sie besuchen! Sie können Georgien nicht verlassen, ohne Wardsia gesehen zu haben. Die Höhlen in der Felswand sind mit Treppen und Terrassen miteinander verbunden. Tausende von Menschen haben darin Platz.« Mitten in der Erzählung sog Tanja Begiaschwili Luft ein. Sie wandte sich von Regina ab und räumte die Gläser so schnell ein, dass ihr eines aus der Hand fiel. Regina spürte jemanden hinter sich und drehte sich um. Ein Mann in ihrem Alter gestikulierte verärgert. Sein Armani-Anzug war maßgeschneidert, trotzdem sah er aus wie verkleidet. Er begrüßte Regina mit einer kleinen Verbeugung, die ihr bekannt vorkam. Doch was bei Pierre-Richard von Arburg natürlich wirkte, sah bei diesem Mann aus, als hätte er eine Rolle einstudiert. Er stellte sich als Frank Bolay vor und hieß sie in seinem Reich willkommen. Als er Reginas Hand nahm und an seine Lippen führte, konnte sie dem Impuls kaum widerstehen, sie zurückzuziehen.
Bolay erkundigte sich, ob sich Regina wohlfühle. Nachdem sie ihm versichert hatte, dass das Zar Franco keine Wünsche offen lasse, lächelte er höflich und nahm den Platz hinter der Bar ein. Er gab Tanja Begiaschwili ein Zeichen, und sie huschte davon, um kurz darauf mit Besen und Schaufel zurückzukehren. Während sie die Scherben zusammenwischte, bediente Bolay die Gäste.
Reginas Handy klingelte, und sie wandte sich erleichtert ab. »Tobias! Immer noch auf?«
Stotternd erklärte Fahrni, er habe die Zeitverschiebung vergessen. Nachdem Regina ihm versicherte, er habe sie nicht geweckt, erzählte er ihr vom Gespräch mit dem Sachbearbeiter, der Isabelles Flug nach Tiflis gebucht hatte. Die Reise sei so dringend gewesen, dass Isabelle einen Nachtflug in Kauf genommen habe. Fahrni wusste jedoch weder, auf welches Datum ihr Ticket ursprünglich ausgestellt gewesen war noch, wer während des Fluges neben ihr gesessen hatte. Er versprach, beiden Punkten nachzugehen. Dann erkundigte er sich nach Cavalli. Regina wich der Frage aus und bat Fahrni stattdessen, sich nach Schweizer Firmen zu erkundigen, die in georgische Hotels investierten.
Cavalli erwachte mit einem Schlag. Seine Hand schoss zur Stelle, wo er normalerweise seine Waffe trug. Er berührte nackte Haut. Es dauerte einen Moment, bis er begriff, dass keine Gefahr drohte. Er hörte Regina gleichmäßig atmen, und die Realität verdrängte den Traum, der ihn geweckt hatte. Benommen löste er das schweißnasse T-Shirt von seiner Brust. Zu spät. Er war immer zu spät. Jedes Mal nahm er sich im Traum vor, rechtzeitig die Waffe zu ziehen. Es gelang ihm nie.
Hätte er damals nicht den Kopf gedreht, sich nicht vom Kind ablenken lassen, das hinter der Tür stand, wäre alles anders gekommen. Ein einziger Fehler, der ihn beinahe das Leben gekostet hatte. Ein Anfängerfehler. Die anschließende Geiselnahme wäre zu verhindern gewesen. Efimows Tod auch, obwohl er nicht um den Russen trauerte.