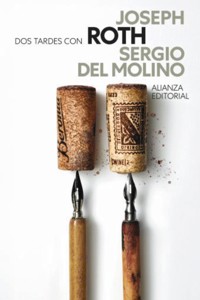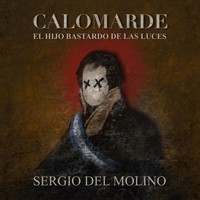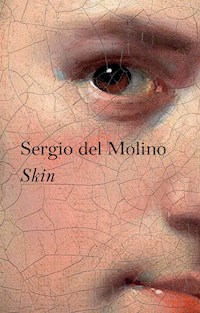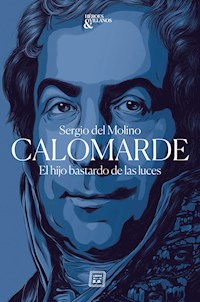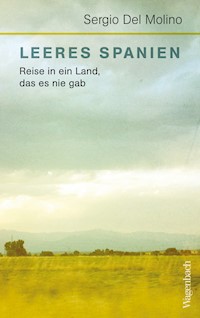
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mehr als die Hälfte Spaniens ist leer: Die Bevölkerung verteilt sich zu etwa 75 % auf Madrid im Zentrum sowie die Küstenregionen. Der Rest ist Landschaft, mit sterbenden Dörfern und einer Bevölkerungsdichte, die in Europa nur von Lappland und Teilen Finnlands unterschritten wird. Sergio Del Molino hat die Geschichte dieses »leeren Spaniens« geschrieben: Er geht den Ursachen nach, wie der brutalen Industrialisierung unter Franco, und ebenso den Versuchen, die Landflucht aufzuhalten. Und er zeigt anschaulich, wie bedeutsam das »leere Spanien« in der kollektiven Bildwelt des Landes ist: im »Don Quijote« und bei Buñuel, in pädagogischen Missionen und Reiseberichten des 19. Jahrhunderts, als romantisierter oder dämonisierter Gegenpart der Stadt, die sich die Provinz immer neu erfindet – bis hin zu den Konflikten der Gegenwart. Del Molinos Buch hat in Spanien eine kaum vorstellbare Wirkung entfaltet, Parlamentsdebatten, Gegenbücher, sogar die Gründung einer Partei angeregt. Wer das Land und sein Selbstverständnis begreifen will, muss »Leeres Spanien« lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die spanische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel La España vacía. Viaje por un país que nunca fue bei Turner Publicaciones S.L. in Madrid.
La traducción de esta obra ha contado con la participación de Acción Cultural Española, AC/E. Die Übersetzung dieses Werks wurde gefördert von Acción Cultural Española, AC/E.
Editorische Notiz:
In Absprache mit dem Autor wurde der Text für die deutsche Ausgabe teils bearbeitet und ergänzt, an anderen Stellen unwesentlich gekürzt.
E-Book-Ausgabe 2022
© 2016 Sergio del Molino
Published with special arrangements with The Ella Sher Literary Agency
© 2022 für die deutsche Ausgabe: Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin
Covergestaltung Julie August unter Verwendung einer Fotografie © Guillermo Trapiello. Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 978 3 8031 4357 0
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 3721 0
www.wagenbach.de
Für Daniel. Für Cristina. Die einzigen Bewohner meines Landes.
Die Madrider Bohémiens hatten Angst vor allem, was sich jenseits des Teatro Real und der Kirche San José befand.
Ricardo Baroja
Viele Spanier, die führenden Kreise des Landes, waren der Ansicht, Spanien sei nur in den Hauptstädten und Städten zu finden, und sie wussten nichts von der Wirklichkeit der Dörfer und Weiler, der kleineren Ortschaften, den Bedürfnissen und oft unmenschlichen Lebensbedingungen großer Teile der Nation, und von all dem wird Euch unsere Bewegung befreien.
Francisco Franco
Die Spanier haben in der neuen Welt unermessliche Entdeckungen gemacht und kennen ihr eigenes Land noch nicht: Über ihre Flüsse führen Brücken, die sie noch nicht entdeckt haben, und in ihren Gebirgen gibt es Stämme, die ihnen unbekannt sind.
Charles de Montesquieu
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Es wäre schön, die deutschen Leser wüssten zu Beginn der Lektüre dieses Buches ebenso wenig, was sie erwartet, wie die ersten ahnungslosen spanischen Leser, die sich Leeres Spanien 2016 vornahmen. Doch leider hat dieses Buch eine Geschichte, es ist kein harmloser, unschuldiger Text mehr, weshalb ein wenig Kontext sicherlich hilft.
Als ich Leeres Spanien schrieb, scherte sich niemand um die Entvölkerung und das Verschwinden des ländlichen Lebens im spanischen Hinterland. Es war viel darüber geschrieben worden, es gab sehr aktive Bürgerbewegungen, in der Literatur und im Film tauchte das Thema immer wieder auf, aber es stand keineswegs im Zentrum der Aufmerksamkeit, war weder auf Covern in den Schaufenstern der Buchhandlungen noch auf den Titelseiten der Zeitungen zu finden. Bestenfalls sah man es als ethnologische Angelegenheit oder Sache für Nostalgiker. Dass es größere politische Bedeutung annehmen, ja dass irgendwelche Gefahren oder ernstzunehmende Konflikte davon ausgehen könnten, glaubte niemand. Alle Spanier und viele ausländische Reisende wussten, welch ungeheure demografische Leere Madrid umgibt und dass diese sich fast auf das gesamte Landesinnere der Iberischen Halbinsel erstreckt, aber niemand hielt das für eine Frage von besonderer Relevanz.
Diese erzählerische Leerstelle brachte mich dazu, diesen Essay zu schreiben. Nachdem ich jahrelang dort umhergereist war, Zeitungsartikel verfasst und jede Menge gelesen hatte, war ich überzeugt, dass man Spanien nicht verstehen könne, wenn man das kulturelle, gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Gewicht dieser demografischen Eigenart unbeachtet lässt. Dabei habe ich stets betont, dass dies kein Essay über die Gründe oder mögliche Lösungen für das Problem der Entvölkerung ist, es geht hier vielmehr um deren Folgen, Auswirkungen und Spuren im heutigen Spanien. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass ich es für ein äußerst wichtiges Symptom halte, das jedoch in den sozioökonomischen Analysen und politisch-journalistischen Debatten bis dato kaum aufgetaucht war. Stets war die Rede vom Erbe des Bürgerkriegs und der Franco-Diktatur oder von den Spannungen zwischen den verschiedenen regionalen Nationalismen, der demografische Abgrund blieb dagegen unsichtbar. Weshalb ich mir vornahm, zu erklären, warum diese demografische Eigenart so wichtig ist und warum jeder, der über dieses Land genauer Bescheid wissen möchte, sie berücksichtigen sollte. In der Literatur und im Film ist diese Leere häufig präsent. Aber auch in der Ausgestaltung der demokratischen Institutionen, in unserem Verhältnis zur Vergangenheit, im Fortleben einer bestimmten politischen Kultur, in der wirtschaftlichen Ungleichheit, ja selbst im Profifußball zeigt sich ihr Einfluss. Am 8. September 2017 veröffentlichte As, eine der wichtigsten Sportzeitungen des Landes, einen Bericht mit der Überschrift »Die spanische Liga als Abbild der wirtschaftlichen Verhältnisse Spaniens«. Darin wurde mit Verweis auf mein Buch ausgeführt, dass in der Primera División kein einziger Verein aus dem leeren Spanien zu finden, die erste Liga des spanischen Profifußballs also eine exklusive Angelegenheit des »vollen« Spaniens sei.
Dieser Bericht ist nur einer von zahllosen Belegen dafür, dass die Gleichgültigkeit der spanischen Gesellschaft gegenüber der Entvölkerung des Landesinneren inzwischen der Vergangenheit angehört. Seit 2016 haben sich zahlreiche Stimmen in Politik, Kultur und Gesellschaft lautstark bemerkbar gemacht und meine These damit quasi widerlegt. Diese Konsequenz wird im vorliegenden Buch nicht erzählt, weil all dies erst nach seinem Erscheinen begann – ohne falsche Bescheidenheit (und mit umso größerem Erstaunen) muss ich daher darauf hinweisen, dass ich teilhatte an einem der äußerst seltenen Fälle, in dem die Literatur die Wirklichkeit beeinflusst, ja verändert.
Durch den Erfolg des Buches wurde Leeres Spanien zu einem vor allem in politischen Zusammenhängen weit verbreiteten und viel verwendeten Begriff. Von einem Tag auf den anderen fand er sich auf den Titelseiten von Zeitungen wieder, in Parlamentsdebatten, Fernsehdokumentationen und neuen Buchveröffentlichungen. Die Entvölkerung des Landes stand plötzlich im Mittelpunkt des Interesses, und ganz Spanien schien sich schlagartig der demografischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Situation im ländlichen Raum bewusst zu werden. Sogar außerhalb Spaniens wurde das Thema wahrgenommen. Journalisten von Le Monde, der New York Times und der BBC interviewten mich für ihre Reportagen und berichteten von den sich vollziehenden Veränderungen. Mehrere amerikanische Universitäten nahmen das Buch als Gebrauchsanweisung für das Spanien der Gegenwart in die Lektürelisten ihrer hispanistischen Studiengänge auf. Und zum ersten Mal ließ eine größere Anzahl ausländischer Reisender Madrid und die üblichen Tourismuszentren hinter sich und machte sich auf den Weg ins wüste Land im Inneren der Iberischen Halbinsel, wo sie eine unverhoffte, faszinierende Welt entdeckten, während die Bewohner dieser Landstriche sich geschmeichelt im Licht einer bislang nie erlebten Aufmerksamkeit sonnten. Bürgerbewegungen, die seit den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts Investitionen, Dienstleistungen und Schaffung und Sicherung von Infrastruktur in den wenig besiedelten Gegenden eingefordert hatten, erfuhren zum ersten Mal breite Zustimmung und Unterstützung seitens der Gesellschaft. Bei den Parlamentswahlen 2019 nahmen alle Parteien Pläne für den Kampf gegen die Entvölkerung der ländlichen Regionen in ihre Wahlprogramme auf und machten sie zu einem der thematischen Schwerpunkte ihrer Wahlkampagnen. Die aus diesen Wahlen hervorgegangene Regierung schuf eigens die Stelle eines Staatssekretärs für »demografische Herausforderungen«, die mit sehr vielen Mitteln für die damit verbundenen strategischen Aktivitäten ausgestattet wurde. Für Spanien war das etwas völlig Neues. Noch nie hatte eine Regierung Fragen von Entvölkerung und Landflucht zu einem der zentralen Themen ihrer Politik gemacht.
Die erhöhte Sensibilität für diese Fragen konterkariert die im letzten Teil dieses Buchs aufgestellten Thesen etwas, bestätigt dafür aber meine Behauptung, das Verschwinden der ländlichen Kultur sei das wichtigste Ereignis in der jüngeren Geschichte Spaniens, neben dem Bürgerkrieg, dessen Widerhall auch auf den folgenden Seiten an der einen oder anderen Stelle zu vernehmen ist.
Von den hier beschriebenen Vorgängen abgesehen, die weit über die ursprüngliche Absicht dieses Buches hinausgingen und tatsächlich die gesamte gesellschaftliche Debatte, ja die politische Landschaft Spaniens verändert haben, hat Leeres Spanien einen universellen und überzeitlichen Anspruch. Das Land, von dem ich darin zu erzählen versuche, ist unabhängig von Moden und Konjunkturen, es basiert stark auf sehr wirkmächtigen literarischen und historischen Traditionen, deren Deutungen die Leser bei der Entdeckung dieser Nation ohne Meer und Touristen begleiten werden – dieses stillen, manchmal menschenscheuen und misstrauischen, aber auch weisen Spanien, das sich seines ruinösen Zustands sehr wohl bewusst ist. Ein Spanien, das viele Reisende und auch viele Spanier bislang lieber nicht sehen wollten, mich hingegen berührt es weiterhin so wie an dem Tag, an dem ich anfing, darüber zu schreiben. Herzlich willkommen, liebe deutsche Leser, in einem Spanien, wie Sie es sich womöglich nicht erwartet haben.
Saragossa, November 2021
Das Rätsel der verbrannten Häuser
Als die Polizisten ihm erklärten, es könne sich um einen Terrorangriff handeln, atmete der Priester auf. Vielleicht verwendeten sie gar nicht den Ausdruck »Terrorangriff«. Vielleicht war vielmehr von »politischen Beweggründen« die Rede. Für die Polizei war der Angriff jedenfalls Teil einer Kampagne, verhaftet worden war allerdings niemand, und Verdächtige gab es auch keine. Falls sie doch nicht von »Terrorangriff« gesprochen haben sollten, lag das daran, dass es in Irland richtigen Terrorismus gab. Hier dagegen schien es sich um etwas anderes zu handeln. Auch dem Priester kam das so vor. Seiner Ansicht nach steckten Leute aus dem Dorf dahinter, und er fürchtete, es könne der Beginn einer Gewaltspirale sein, doch die Polizisten beruhigten ihn. Der Angriff habe nicht ihm gegolten, ja nicht einmal seinem Haus. Er habe sich gegen das gerichtet, wofür es stehe. Der Priester war aus England, und das Haus, das angezündet worden war, sein Sommerhaus, ein einsam gelegenes cottage auf der Llŷn-Halbinsel.
Zwischen 1979 und 1991 zündete eine Gruppe mit dem Namen Meibion Glyndŵr (Söhne Glyndŵrs) in Wales 228 Landhäuser an. Es kam nur zu einer einzigen Festnahme – 1993 wurde ein Mann verhaftet, der mutmaßlich Briefbomben an englische Bewohner in der Gegend geschickt hatte. Mehr fand man nicht heraus. Der Fall der verbrannten Häuser blieb ein Rätsel. Gegen niemanden wurde Anklage erhoben.1 Nach Ansicht der Ermittler hatte die Gruppe Meibion Glyndŵr nur sehr wenige Mitglieder.2
Im Europa der siebziger und achtziger Jahre stellte Terrorismus, ob er aus nationalistischen oder aus ideologisch-revolutionären Motiven erwuchs, eines der größten Probleme dar. Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien und natürlich auch Spanien waren davon betroffen. Für britische Verhältnisse – in Nordirland galt damals der Ausnahmezustand – waren nächtliche Überfälle auf ein paar Ferienhäuser kein Grund, von Terrorismus zu sprechen, auch wenn wiederholt Gruppen die Anschläge für sich reklamierten. Im Vergleich zu den Gewalttaten der ETA, der IRA oder der Roten Brigaden nahmen sich die Aktionen der Meibion Glyndŵr fast wie Dummejungenstreiche aus.
Die im Nordwesten von Wales gelegene Llŷn-Halbinsel ist eine sehr dünn besiedelte, ländliche Gegend. Anders als im walisischen Süden gibt es hier keine Industriestädte, und der englische Einfluss war bis vor einiger Zeit so gering, dass auf den Dörfern bis heute mehr Walisisch als Englisch gesprochen wird. In den siebziger Jahren kam dieser Landstrich vor allem unter Angehörigen der englischen Mittelschicht in Mode und erlebte einen regelrechten Immobilienboom. Innerhalb weniger Jahre legten sich viele Engländer hier Ferienhäuser zu, was das Leben der Dorfbewohner gehörig veränderte. Es gab Reibereien, und schon bald schlug den neuen Nachbarn nicht nur Misstrauen, sondern offene Feindseligkeit entgegen.
Daher auch die von dem Priester einem BBC-Reporter gegenüber zum Ausdruck gebrachte Erleichterung – es handelte sich also um keine Vendetta gegen ihn persönlich. Denn die Angriffe erschienen doch zunächst als eine aus dem Ruder gelaufene Reaktion erboster Dörfler, die durch das Auftauchen der Fremden ihr gewohntes Leben gefährdet sahen. Hatte die Sache dagegen einen politischen Hintergrund, konnte der Priester unbesorgt vor Ort bleiben, ohne bei jedem Pub-Besuch, Einkauf in der Metzgerei oder Spaziergang das Gefühl zu haben, in den Nachbarn potenzielle Verdächtige sehen zu müssen, Leute, die nicht wollten, dass er hier war, ja, Leute, die, damit er von hier verschwand, sogar bereit waren, sein Haus abzufackeln. Wie hätte er unter solchen Leuten leben sollen? War der Brand jedoch ein nationalistischer Angriff unter vielen gewesen, waren seine Nachbarn automatisch von jedem Verdacht befreit.
Hinter den Brandanschlägen schienen allerdings sehr wohl Dörfler zu stecken, die es auf unerwünschte Fremde abgesehen hatten. Wären sie auf Anweisung einer politischen Bewegung aktiv geworden, hätte die Polizei sie aufgespürt. Da sie jedoch offensichtlich auf eigene Faust gehandelt hatten, war höchstwahrscheinlich ihr ganz persönlicher Hass auf die Sommergäste, mit denen sie es vor Ort zu tun hatten, noch vor irgendwelchen nationalistischen Motiven entscheidend gewesen. Das Rätsel der verbrannten Häuser der Engländer sagt jedenfalls mehr über die Beziehung zwischen Stadt und Land aus als über die zwischen London und seiner Peripherie oder über Terrorismus und Nationalismus.
Ich denke an das Rätsel der verbrannten Häuser, während ich im Sommer mit meiner Familie durch Wales reise. Die Landsträßchen sind häufig so schmal, dass ich am Rand nach einer Stelle zum Ausweichen suchen muss, wenn uns ein Auto entgegenkommt. Oder ich danke dessen Fahrer, weil er uns die Vorfahrt lässt. Alle sind freundlich, lächeln unentwegt, scheinen sich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Passen so vollkommen zu der grünen Landschaft und den behäbigen, dickfelligen Schafen. Wie soll es hier zu Hass und Gewalt kommen, hier, wo es nichts als Bauernhöfe und kleine Häuschen und noch mehr Bauernhöfe und kleine Häuschen gibt? Ich muss an Straw Dogs (Wer Gewalt sät) denken, einen der besten Filme von Sam Peckinpah, einem meiner Lieblingsregisseure. Dustin Hoffman spielt darin einen amerikanischen Mathematiker, der eine Engländerin heiratet (Susan George, Sexsymbol der Siebziger). Zu Beginn des Films ziehen sie in ein abgelegenes Dorf in England. Die Frau stammt von dort, er nicht. Die jungen Männer des Ortes haben das Gefühl, der Amerikaner habe ihnen das hübscheste Mädchen weggeschnappt. Als Vorlage dieser Geschichte brutaler Verfolgung und Gewalt diente The Siege of Trencher’s Farm, ein ziemlich konventioneller Thriller des schottischen Schriftstellers Gordon Williams.3 Das Paar, das im Roman ein Kind hat, im Film jedoch nicht, wirkt in Peckinpahs Version noch stärker isoliert. Auch den Titel änderte Peckinpah, er wird im Film selbst aber nicht erklärt. Die Straw Dogs beziehungsweise »Hunde aus Stroh« beziehen sich auf ein Zitat aus Laotses Tao Te King: »Himmel und Erde sind nicht gütig. Ihnen sind die Menschen wie stroherne Opferhunde.«4
Alle Häuser, an denen wir vorbeifahren, erinnern mich an das aus dem Film. Ich denke an die vielen gewalttätigen Vorfälle, die sich so oft in kleinen Gemeinschaften zugetragen haben und immer noch zutragen. An den jahrhundertealten Hass und die Streitereien, die durch das enge Beisammensein und die ebenso engstirnigen Moralvorstellungen verstärkt werden, an die Langeweile. Vor allem aber denke ich an dieses Buch, für das ich einige Monate mit Lektüren, Recherchen und intensivem Nachdenken verbracht habe. Das Rätsel der verbrannten Häuser und Sam Peckinpahs Film aus dem Jahr 1971 sagen mir, dass ich darin etwas Allgemeingültiges erzähle, eine Geschichte des Misstrauens. Ich hatte vor, über mein Land zu schreiben und inwiefern es sich von anderen Ländern unterscheidet, aber in Wales, mit einem Mietwagen über die Dörfer fahrend, habe ich irgendwann begriffen, dass sich alles im Grunde auf die Frage nach der Angst vor dem Anderen reduzieren lässt.
Die hat wiederum mit unserer überkommenen tribalistischen Organisation zu tun, mit der Aufteilung in wir und die anderen sowie der Gleichsetzung dieser anderen mit Bedrohung. Wir Menschen sind unfähig, außerhalb unserer Gruppe zu leben. Für diesen – evolutionär gesehen – Vorteil haben wir seit jeher einen hohen Preis in Form von Kriegen und Massakern bezahlt. In komplexen, urban geprägten Gesellschaften ist der eigene Stamm jedoch immer schwieriger zu erkennen, es fällt dort schwer, die Unsrigen zu identifizieren. Wer gehört dazu? Unsere Landsleute? Die sind viel zu verschieden. Mit einem dreißigjährigen Schriftsteller aus Melbourne verbindet mich viel mehr als mit meinem unmittelbaren Nachbarn. Unsere Arbeitskollegen also? Nicht ohne Weiteres, auch wenn die »Arbeiterklasse« während der letzten hundert Jahre einer der am meisten diskutierten Stämme gewesen ist. Mit meinen Geschlechtsgenossen, den Leuten, die dieselbe Muttersprache sprechen, den Angehörigen derselben Religion, den Gleichaltrigen, den Mitgliedern derselben Rentengruppe, den Menschen derselben sexuellen Orientierung, den Menschen, die Kinder haben, oder denen, die keine haben? Bevor ich jetzt schreibe, die Heimat des Menschen sei seine Kindheit, finde sich in seinen Freunden oder ähnlichen Unfug, würde ich lieber klarstellen, dass die komplexen Gesellschaften unserer Tage die Stammesloyalität durch sehr spezielle, subtile und häufig wechselnde Wahlverwandtschaften ersetzt haben.
Was zwei Vorteile mit sich bringt: Diese Affinitäten zwingen uns nicht, in den Krieg gegen den Nachbarstamm zu ziehen, und sie beruhen zu einem großen Teil auf eigener Entscheidung. Viele haben mit Vorlieben zu tun, etwa für einen bestimmten Fußballverein oder eine bestimmte Musikrichtung. Eine derartige Vielfalt und Wandlungsfähigkeit ist jedoch nur in Städten möglich. Andere Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle, aber in erster Linie ist es schlichtweg eine Frage der Menge an Menschen – je größer eine Stadt ist, desto mehr Möglichkeiten bietet sie, auf den unterschiedlichsten Ebenen und in die verschiedensten Richtungen Verbindungen zu knüpfen. In der Geschichte der Menschheit ist das etwas Neues. Bis vor etwa zweihundert Jahren verbrachten die Menschen ihr Leben normalerweise innerhalb eines Stamms, den sie sich nicht ausgesucht hatten, beziehungsweise dem sie von Geburt an angehörten. In kleinen Gemeinschaften funktionieren Stammeszugehörigkeiten weiter und können dafür sorgen, dass eines Nachts eine Handvoll Krieger die Häuser des anderen, invasorischen Stamms anzündet.
Es gibt zwei verschiedene Spanien, aber nicht die, von denen der Dichter Antonio Machado spricht.5 Es gibt ein urbanes, europäisches Spanien, das sich in nichts von anderen urbanen europäischen Gesellschaften unterscheidet, und ein ländliches, entvölkertes Spanien, das ich das leere Spanien nenne. Das Verhältnis zwischen diesen beiden war und ist schwierig. Oft wirken sie wie zwei einander fremde Länder. Trotzdem lässt sich das urbane Spanien ohne das leere Spanien nicht verstehen. Die Geister des Letzteren leben auch in den Häusern des Ersteren.
Als Bewohner des urbanen Spanien ist meine Perspektive unweigerlich die des Engländers, der sich ein Haus in Wales zulegt. Ich stamme nicht von dort und neige dazu, meine Wahlheimat zu idealisieren, zu karikieren oder aus ihrer angeblichen Unverfälschtheit Profit zu ziehen. Als Verfasser dieses Buchs bin ich jedoch in der Pflicht, auch die Waliser zu verstehen, die mein Haus anzünden. Zu verstehen, warum sie mich hassen, warum sie mich nicht zum Nachbarn haben wollen. Ich werde weit in die Geschichte zurückgehen, viele Kilometer im Auto zurücklegen und noch einmal aufmerksam all die Bücher lesen müssen, die ich nur zerstreut durchgelesen habe, als ich noch nicht wusste, dass ich dieses Buch schreiben würde. Es geht mir aber weniger darum, zu verhindern, dass man mir das Ferienhaus niederbrennt, sondern vielmehr darum, seine verkohlte Ruine ohne Erstaunen zu betrachten und die Hände dabei in den Taschen zu lassen, statt sie über dem Kopf zusammenzuschlagen.
Erster Teil Das große Trauma
1 Die Geschichte der Gabel (Eine Art Einführung)
Alle ihre Dörfer wurden zerstört und niedergebrannt, alle ihre Felder in Weide verwandelt. Britische Soldaten wurden zur Execution kommandirt und kamen zu Schlägen mit den Eingebornen. Eine alte Frau verbrannte in den Flammen der Hütte, die sie zu verlassen sich weigerte.
Karl Marx, Das Kapital (1867)
Ich bin im Ausland und möchte gerade anfangen zu essen, da merke ich, dass man mir keine Gabel hingelegt hat. Ich hebe die Hand, um den Kellner zu bitten, mir eine zu bringen, doch unversehens habe ich einen Blackout. Wie heißt Gabel noch gleich auf Französisch? Oder auf Englisch? Oder auf Italienisch? Ich überlege. Als das Wort fork in mir aufsteigt, hat der Kellner meine bis dahin vollführten Gesten längst verstanden und kommt mit einer Gabel in der Hand zu mir. Nicht zu wissen, wie man in fast egal welcher europäischen Sprache Gabel sagt, ist absurd, schließlich ist es nahezu überall ein ähnliches Wort: Gabel heißt auf Englisch fork, auf Französisch fourchette, auf Italienisch forchetta, auf Holländisch vork, auf Katalanisch forquilla, auf Maltesisch furketta, auf Rumänisch furculiţă. Alle diese Wörter leiten sich vom lateinischen furca ab. Auch die germanischen Sprachen verwenden ein gemeinsames Wort. Es ähnelt zwar nicht der lateinischen Vokabel, seine Bedeutung entspricht aber dem spanischen Wort horca oder forca, das jenen Dreizack aus Holz bezeichnet, mit dem die Bauern früher das Heu wendeten oder das Dreschgut zur Seite räumten. Das gilt für das Wort Gabel genau wie für das skandinavische gaffel oder das isländische gaffal.
Die meisten europäischen Sprachen bezeichnen also ein landwirtschaftliches Werkzeug und einen Teil des Bestecks mit ein und demselben Wort, weil es sich im Grunde um denselben Gegenstand handelt, nur dass Letzterer gewissermaßen die Miniaturversion ist. Warum gebrauchen wir im Spanischen aber ein völlig anderes und äußerst seltsames Wort dafür? Tenedor – von dem Verb tener, haben, besitzen, halten. Ein tenedor ist eigentlich ein Mensch, der etwas hat beziehungsweise besitzt, und so wurde das Wort im Spanischen auch ursprünglich verwendet. Wie kam es dazu, dass dieser tenedor zusätzlich die Bedeutung Gabel annahm?
Verglichen mit Löffel oder Messer sind Gabeln erst seit recht kurzer Zeit Teil des gewöhnlichen Bestecks. Im Don Quijote isst zum Beispiel kein Mensch mit einer Gabel. Im Spanien des Siglo de Oro waren Gabeln etwas Besonderes, das sich nur Reiche leisten konnten, und so blieb es bis zum Spanischen Unabhängigkeitskrieg Anfang des 19. Jahrhunderts. Karl V. hatte Gabeln von irgendeinem Ort in Europa aus nach Spanien mitgebracht, aber dass er sie benutzte, erschien den anderen als kaiserliche Exzentrik. Erst einige Zeit nach Beginn des 19. Jahrhunderts lagen Gabeln regelmäßig auf den Esstischen bereit. Unter Hirten und Bauern verbreitete sich ihr Gebrauch erst kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts, und in vielen abgelegenen Dörfern, wo man weiterhin für die dicke Brotsuppe dem Löffel und für den Käse dem Messer die Treue hielt, blieben sie eine exotische Erscheinung. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts nahm eine spanische Fabrik die Massenproduktion von Gabeln auf.
In der damals sogenannten zivilisierten Welt war die Gabel ein Distinktionsmerkmal und Zeichen des Elitismus: »Englands Oberschicht erfreute sich im frühen 20. Jahrhundert am ›Gabellunch‹ oder ›Gabeldinner‹ – buffetartigen Mahlzeiten, bei denen man vollständig auf das Messer verzichtete. Die Gabel galt als vornehm, weil sie nicht so brutal wie ein Messer zu sein schien und man bei der Benutzung weniger Unordnung anrichtete oder gar wie ein Kleinkind wirken konnte. Gabeln wurden einfach für alles empfohlen: von Fisch bis zum Kartoffelpüree; von grünen Bohnen bis zur Sahnetorte. Man entwickelte Spezialgabeln für Eiscreme und Salat; für Sardinen und für Schildkröten. Die Grundregel aller westlichen Tischkultur im 19. und 20. Jahrhundert lautete, im Zweifel eine Gabel zu verwenden.«6
Das Rätsel des Wortes tenedor sagt viel über die Spanier und ihre einstige und jetzige Lebensweise aus. Über eine Geschichte elitären Denkens und der Verachtung, die dahinter steht. Über Grausamkeit, Herrschaft und Angst vor dem Anderen, wenn dieser Andere arm ist. Über das Bedürfnis, sich von den Ungeheuern abzugrenzen, die außerhalb des Palastes lauern. Ungeheuer, die mit den Händen essen und den Löffel, mit dem sie ihre Schüsseln auskratzen, anschließend benutzen, um irgendwelche barbarischen Folklore-Rhythmen zu klopfen.
Womöglich ist diese seltsame Eigenart paradoxerweise das Zeichen einer vollends gelungenen Romanisierung. Das moderne Spanien hat seine historischen Wurzeln in zwei Reichen, die die städtische Lebensweise verfeinert haben – dem römischen und dem arabischen. Das Wort Zivilisation kommt vom lateinischen civitas, Stadt. Neben civitas hatten die Römer auch den Begriff urbs. Die so vollzogene Unterscheidung ist bei uns verlorengegangen. Für die Römer war die civitas die Gesamtheit der Bewohner einer Stadt, die städtische Gesellschaft, wohingegen die urbs die Summe aller Gebäude, Straßen, Brunnen und Abwasserkanäle, also die Infrastruktur der Stadt umfasste. Kastilien und später Spanien war eine Welt aus Städten. Römer wie Araber teilten die Auffassung, dass das Land nichts weiter sei als das Gebiet, das der Versorgung der Stadt diene, beziehungsweise der weiße Fleck zwischen einer urbs und der nächsten. Teil der Zivilisation war das Land jedenfalls nicht. Kastilien erstreckt sich von Stadt zu Stadt. Der Hof wanderte beständig von einem Ort zum anderen, brauchte jedoch jeweils eine Stadt als Sitz. Es gab großartige Exemplare solcher Sitze: aus Stein, von starken Mauern umgeben, sicher. Als Kastilien die sogenannte Neue Welt erreichte, brachte es seine Städte mit. Die urbs mit rechtwinkligem Grundriss war das Modell der spanischen Stadtgründungen an den Küsten und im Inland gleichermaßen, vor allem entlang von Handelsstraßen wie der, auf der das Silber aus Peru über die Anden nach Buenos Aires gebracht wurde.
Spätestens zu Beginn des 19. Jahrhunderts war klar, dass Spanien das, was wir heutzutage Lateinamerika nennen, nicht wirklich beherrschte. Seine Macht konzentrierte sich auf eine Handvoll Städte, wenige Meilen landeinwärts aber schwand sie rapide. Im Großteil des Kontinents gab es keine Spanier, und niemand sprach ihre Sprache. Dass Alexander von Humboldt ungehindert Venezuela erforschen konnte, lag auch daran, dass die Spanier kein Interesse am Urwald hatten, sie wussten damit nichts anzufangen. Und dass ein Franzose und ein US-Amerikaner als Erste eine systematische Erforschung der Ruinenstadt Palenque im mexikanischen Chiapas in Angriff nahmen, lag daran, dass die Spanier für gewöhnlich San Cristóbal de las Casas und ähnliche Enklaven, die sie nach dem Modell Salamancas oder Valladolids errichtet hatten, nicht verließen.
In Spanien selbst war das, freilich nicht in vergleichbarem Ausmaß, kaum anders. Auch dort existierte das Land außerhalb der Städte nicht. 1539 erschien ein Buch, das sich seinerzeit europaweit zu einem wahren, häufig übertragenen Bestseller entwickeln sollte: Menosprecio de corte y alabanza de aldea. Die erste deutsche Übersetzung erschien bereits 1598 unter dem Titel Verachtung dess Hoflebens und Lob dess Landtlebens.7 Verfasst hatte es ein asturischer Adliger, der am Hof Karls V. lebte. Manche Spezialisten vergleichen seinen Humor mit dem eines Rabelais, aber wie man weiß, neigen viele Philologen dazu, es mit der Feier nationaler Größe ein wenig zu übertreiben. Man kann das Buch auch heute noch lesen, schließlich ist es recht kurz, und dennoch zieht sich die Lektüre, weil seine Sprache so geschwollen und affektiert daherkommt. Der Autor, ein gewisser Antonio de Guevara, hatte keinerlei Hemmungen, seine Werke mit falschen lateinischen Zitaten und erfundenen gelehrten Referenzen anzureichern. In diesem Buch, das zugleich sein bekanntestes ist, stellt er eine Reihe zu seiner Zeit überaus beliebter Topoi über die Vorteile des einfachen Landlebens dem hektischen Treiben der Stadt gegenüber. Sein Erfolg verdankte sich vor allem der Tatsache, dass es einen Gegenstand behandelt, der vielen Lesern des 16. Jahrhunderts, insbesondere Adligen wie Guevara selbst, am Herzen lag: Das Leben bei Hofe eröffnete in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht vielerlei Möglichkeiten, das Dorfleben dagegen, ach ja, das Dorfleben …! Nur auf dem Dorf besteht Aussicht, Frieden und zu sich selbst zu finden. Mit anderen Worten: Das wahre Leben gibt es nur auf dem Dorf. Neben einem anderen Geistlichen, Luis de León, war Antonio de Guevara wohl der erste Spanier, der die Rückkehr zum ursprünglichen Landleben predigte und darüber klagte, dass seine Landsleute selbiges zugunsten des Lebens in der Stadt mit all ihrem Lug und Trug, das ja gar kein Leben war, aufgegeben hätten. Wenigstens in der Theorie, denn Guevara selbst handelte nicht gemäß seinen Einsichten. Der König ernannte ihn zum Bischof: zunächst in Guadix, später auch in Mondoñedo, wo er schließlich starb. Angeblich ließ er sich an seinen Amtssitzen jedoch kaum sehen. Lieber verbrachte er seine Zeit bei Hofe oder als Begleiter Karls V. auf dessen zahlreichen Reisen durch Europa. Aufs Dorf, das er in seinen Pamphleten so rühmte, das bei ihm selbst aber nur allergische Reaktionen hervorzurufen schien, zog er sich offensichtlich bloß zurück, wenn es nicht anders ging. Der Erfolg seines Buches verweist jedoch darauf, dass die Spannungen zwischen dem ländlichen und dem städtischen Spanien schon lange vor der industriellen Revolution und jedweder Landflucht bestanden.
Die spanischen Herrscher hatten seit jeher die Gewohnheit, ihre politischen Gegner in abgelegene Landstriche zu verbannen. Francisco de Quevedo beispielsweise musste sich gezwungenermaßen in das in der heutigen Provinz Ciudad Real gelegene Torre de San Juan Abad zurückziehen. Wen man bestrafen oder sich aus den Augen schaffen wollte, den schickte man aufs Land. Lange bevor die Zaren damit anfingen, ihre Gegner nach Sibirien zu verschicken, nutzten die spanischen Inquisitoren, Könige, deren Günstlinge ebenso wie kleinere oder größere Diktatoren die Madrid umgebende riesige Hochebene dafür, all diejenigen von der Bildfläche verschwinden zu lassen, die meinten, besonders schlau zu sein. Für ein Land, in dem öffentliche Ketzerverbrennungen zur Belustigung des Volks durchgeführt wurden, war das zugegebenermaßen eine vergleichsweise milde Strafe. Dennoch offenbart es ein eigenartig imperialistisches Verhältnis zum eigenen Staatsgebiet. Während andere Reiche ihre Kolonien als Verbannungsorte für politische Gegner oder besonders schlimme Verbrecher nutzten, bedienten sich die spanischen Machthaber zum selben Zweck der Iberischen Halbinsel (und gelegentlich der dazugehörigen Inseln), und das, obwohl ihnen am anderen Ufer des Atlantiks ein ganzer Kontinent zur Verfügung gestanden hätte. Diese Gewohnheit hielt sich bis ins 20. Jahrhundert.
Alle Zivilisationen sind notwendigerweise städtisch geprägt, und doch unterscheiden sie sich durch die Art, wie sie die weißen Flecken zwischen ihren Städten integrieren oder ignorieren. Wie viele und welche Art von Menschen diese weißen Flecken bewohnen, spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle. In Spanien waren es immer sehr wenige, und die waren sehr arm und lebten weit verstreut auf einer Hochebene mit äußerst unwirtlichem Klima. Dieser Umstand war von grundlegender Bedeutung für eine Geschichte der Grausamkeit und Verachtung, die im ganzen Land bis heute sehr einflussreich ist, jedoch kaum je in Betracht gezogen wird. Genauso, wie sich niemand Gedanken darüber macht, dass Spanisch die einzige europäische Sprache ist, in der das Wort für Gabel nichts mit einem landwirtschaftlichen Werkzeug zu tun hat, weil den kultivierten Sprechern aus der Stadt, also jenen, die die Sprachnormen bestimmen, der Gedanke unerträglich war, einen landwirtschaftlichen Begriff für einen derart feinen Gegenstand im Mund zu führen.
Eine grausame portugiesische Redensart lautet: »Portugal é Lisboa eo resto é paisagem.« (»Portugal, das ist Lissabon, der Rest ist Landschaft.«) Hierzulande könnte man sagen, Spanien ist Madrid, und der Rest ist nicht einmal Landschaft.
Die heutige Welt ist eine der Städte, nicht nur in demografischer und politischer Hinsicht, sondern auch aufgrund der Vorstellung, die wir uns von der Welt machen, in der Art, wie wir über sie nachdenken. Man könnte in Mesopotamien anfangen, bei den Skylines seiner Zikkurat-Tempeltürme, verortet wird die »Wiege der Kultur« jedoch normalerweise in der Modellstadt Athen. Endgültig durchgesetzt hat sich dann allerdings als Ideal die Stadt Rom. Die Römer füllten Europa, Nordafrika und den Nahen Osten mit lauter kleinen Rom-Kopien an und schufen auf diese Weise ein ganzes Netz von Städten. Die Zerstörung des Römischen Reichs war gleichbedeutend mit der Zerstörung dieser Städte. Woraufhin die Römer sich aufs Land zurückzogen, aufhörten, Latein zu sprechen, und den Feudalismus erfanden, eine barbarische Angelegenheit, von der die Historiker schon seit Längerem nachzuweisen versuchen, dass sie gar nicht so schlimm war. Ohne Erfolg. Bis heute erzählt man die Geschichte des Mittelalters mit der Stimme eines gebildeten Florentiners des 15. Jahrhunderts als eine Abfolge bestialischer Grausamkeiten.
In der Schule lernt man, dass das Wachstum der Städte begann, als der Handel wieder das zur Zeit des Römischen Reichs bestehende Niveau erreicht hatte, also ungefähr im 13. Jahrhundert, und dass sie von da an trotz der großen Pest von 1348 weiterwuchsen, und mit ihnen ihre immer höheren Kathedralen und ihre Hanse-Häfen und immer einflussreicheren Bankhäuser. Die Klasse, die die Demokratie erfand oder neu erfand, war das sogenannte Bürgertum, das im »burgus«, in der befestigten Stadt, zu Hause war. Und die gesamte Geschichte Europas in der Neuzeit und teilweise auch in der Gegenwart ist erzählt worden als die eines Kampfes zwischen den immer stärkeren und freieren Städten und dem immer ärmeren und immer mehr unter dem Einfluss der Kirche stehenden Land.
Während der so romverliebten und klassizistischen Französischen Revolution begnügte man sich nicht damit, die ländlichen Grundbesitzer mit der Guillotine hinzurichten, man machte sich vielmehr daran, per Dekret die ländlichen Gebiete insgesamt abzuschaffen. Der vom Abbé Sieyès in der Hitze des Gefechts 1789 in der Nationalversammlung präsentierte Entwurf einer territorialen Neuordnung Frankreichs vereinfachte und vereinheitlichte die Verwaltung des in Herzogtümer, Markgrafschaften, Grafschaften, Provinzen und Marken aufgeteilten Landes nicht nur, er löschte das historisch Gewachsene vielmehr mit einem Federstrich aus, indem er die überkommenen Ortsnamen einfach abschaffte. An ihre Stelle traten einundachtzig Départements, deren Namen bloßen geografischen Gegebenheiten geschuldet waren. Historisch überlieferte Gebietsbezeichnungen wie Provence, Languedoc, Aquitaine, Anjou, Pays Basque oder Picardie wurden durch die Namen von Flüssen, Bergen oder Himmelsrichtungen und zusätzlich durch Nummern ersetzt, allerdings gelang es seitdem keiner einzigen Regierung, die Franzosen dazu zu bewegen, ein Gefühl größerer Verbundenheit zu ihrer Départementsnummer zu entwickeln. Das blieb der Autoindustrie vorbehalten oder vielmehr der Tatsache, dass die Herkunft eines Fahrzeugs sich in Frankreich an den letzten beiden Ziffern seines Kennzeichens ablesen lässt, wodurch ein Provinzler in Paris wie auch umgekehrt ein Pariser in der Provinz sofort zu erkennen ist.
Bis zur Einführung der Regionen im Jahr 19828 blieben die alten französischen Ortsbezeichnungen den Weinetiketten und den Namen regionaler kulinarischer Spezialitäten vorbehalten, denen sich die Pariser Restaurants verweigerten. Außerdem lebten sie in den Gerüchen und Geschmäckern der von eben den Bauern erzeugten Produkte fort, die seit jeher den Großteil der Arbeit in jener feudal organisierten Welt geleistet hatten, aber sukzessive von den Landkarten wie auch aus der Verwaltung verschwunden waren. Der Verwendung der Nummern haftete allerdings stets etwas Künstliches und rein Funktionales an, die Verwendung von Namen geografischer Besonderheiten dagegen verfolgte eindeutig eine ideologische Absicht: Da ging es um ein ewiges, reines Frankreich, das dort zu finden war, wo niemand je einen Fuß auf den Boden gesetzt hatte. Von dem feudalen Frankreich der Scheunen und Weinkeller und seinen verstaubten Adelsnamen wollte man nichts mehr wissen.
Das neue Frankreich wurde in eine von freien Bürgern bewohnte Hauptstadt und die dazugehörige, von ihr beherrschte Umgebung gegliedert, eine Umgebung, auf die man jederzeit im Namen des Fortschritts einwirken konnte, und keine mehr oder weniger eigenständigen Teilgebiete, deren mehr oder weniger adlige Herrscher untereinander um die Vormacht wetteiferten. Die Aufteilung in Départements machte klar, dass Frankreich Paris war und der Rest Landschaft, aber eine Landschaft älter als der Absolutismus, soll heißen, so, wie die Flüsse und Berge sie gestaltet hatten, denen die affektierten Landschaftsgärtner von Versailles mit ihren Heckenscheren nichts hatten anhaben können. Vielleicht zum Ausgleich hierfür dachte der Nationalkonvent sich einen republikanischen Kalender aus – der 22. September 1792 des gregorianischen Kalenders, also der Jahrestag der Ausrufung der Republik, der zugleich die Herbsttagundnachtgleiche bezeichnete, wurde zum ersten Tag des ersten Jahres der neuen Ära erklärt. Das republikanische Jahr begann folglich mit der Weinlese – beziehungsweise mit dem nach ihr benannten Monat Vendémiaire – und endete mit dem Einsammeln der Feldfrüchte – beziehungsweise dem Monat Fructidor. Die Benennung der dazwischenliegenden Monate folgte den Entwicklungsschritten der Pflanzen und den sie bedingenden klimatischen Erscheinungen. Auf diese Weise fand das Land Eingang ins neue Frankreich, aber natürlich frei von adligem oder feudalem Beigeschmack.
Im ersten Band des Kapitals beschreibt Karl Marx den ursprünglichen Akkumulationsprozess des Kapitals als einen Triumph der Stadt über das Land.9 In seiner Schrift Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte wiederum stellte er einen vielfach gefeierten und vom Marxismus ohne Marx zum Dogma erhobenen Vergleich an: Die Bauern seien wie lauter Kartoffeln in einem Sack.10 Womit er sagen wollte, dass die Bauern egoistisch und unfähig zur Entwicklung eines Klassenbewusstseins seien, eben wie Kartoffeln, die, auch wenn man sie alle zusammen in einen Sack steckt, ihr eigenes unverwechselbares Aussehen und ihre Individualität beibehalten. Die Bauern können zwar große Menschenmengen bilden, aber niemals Massen. Zumindest keine organisierten, solidarischen Massen. In Rumänien, Albanien, der sowjetischen Ukraine, China oder Kambodscha begründete man mit eben diesem Zitat Massaker, erzwungene Hungersnöte und Umsiedlungen im großen Ausmaß, wofür man meiner Ansicht nach aber nicht den deutschen Philosophen verantwortlich machen sollte. Jeder gebildete Verbrecher wird, wenn er will, eine Äußerung von wem auch immer finden, von der er sich zur Tat inspiriert fühlt, die Weltliteratur ist voll von Aufrufen zum Verbrechen. Was man Marx dagegen sehr wohl zum Vorwurf machen darf, ist die Tatsache, dass er sich das so bürgerliche Vorurteil gegen alles Bäuerliche dermaßen zu eigen gemacht und immer wieder zum Ausdruck gebracht hat und dass er wie so viele Denker vor und nach ihm die Bauern als unfähig betrachtet hat, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, weshalb man sie für einen Störfaktor zu halten habe, dessen Wirkmacht auf ein Minimum zu reduzieren sei.
Bis auf die sozialistischen Utopisten und die Anarchisten des 19. Jahrhunderts haben alle politischen Reformer das Land stets nur als lästiges Hindernis empfunden. Liberale und Marxisten treffen sich in ihren romanisierten Vorlieben, in den Planungen der einen wie der anderen kamen die Menschen, die in der weiten Leere zu beiden Seiten der Landstraßen oder Eisenbahnstrecken lebten, schlichtweg nicht vor. Und wenn die Bauern sich zu Bauernparteien oder politischen Bewegungen zusammentaten, sahen viele Liberale wie Marxisten darin nur ein reaktionäres Aufflackern, das wilde Umsichschlagen einer Welt, die sich weigerte, unterzugehen, oder, wenn sie schon sterben musste, möglichst viele andere mit in den Tod reißen wollte. Nur die Anarchisten waren der Ansicht, die Bauern könnten tatsächlich Akteure der Veränderung und des Fortschritts sein. Weiterhin in so mancher Vorstellung der Renaissance befangen, betrachten wir, die Europäer von heute, die Geschichte als einen Prozess der Rückeroberung der Macht durch die Städte und der Niederlage des Feudalismus, und in diesem Sinne ist auch einer der am häufigsten geäußerten Kritikpunkte an den anarchistischen Klassikern zu verstehen – ihr angeblicher Archaismus. Marxisten wie Liberale beschuldigten Bakunin und seine Anhänger, es auf eine Zivilisation ohne Städte abgesehen zu haben, eine Rückkehr zur selbstgenügsamen Welt des Lehnswesens, nur dass die Lehnsherren hier keine Adligen, sondern Revolutionsräte sein sollten.
Diese beinahe natürlichen Tendenzen verstärkten sich in Spanien noch, war es doch bis weit ins 20. Jahrhundert ein in hohem Maße agrarisch geprägtes Land. Nach den Kriterien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gilt das bis heute für mehr als die Hälfte des spanischen Staatsgebiets, auch wenn die Bevölkerung inzwischen zu 80 Prozent in Städten lebt. Das damit verbundene »große Trauma« (siehe das folgende Kapitel) rührt daher, dass diese Verstädterung in kürzester Zeit erfolgte: Innerhalb von nicht einmal zwanzig Jahren verdoppelte, ja verdreifachte sich die Einwohnerzahl der Städte, während weite Gebiete im Hinterland, die noch nie besonders dicht bevölkert gewesen waren, sich endgültig leerten. Dieser Exodus vollzog sich zwischen 1950 und 1970. Zwar hatte es seit Ende des 19. Jahrhunderts eine beständige Abwanderung vom Land in die Stadt (wie auch von der Iberischen Halbinsel nach Lateinamerika) gegeben, doch innerhalb dieser zwei Jahrzehnte setzten Millionen von Menschen zu einer Reise ohne Wiederkehr an – was beinahe zum Kollaps in den überfüllten Städten führte. Die Baufirmen kamen mit der Errichtung billiger Wohnblocks an den Stadträndern nicht nach, sodass sich dort schon bald elende Hüttensiedlungen bildeten. Gleichzeitig verschwanden tausende Dörfer, während sich ebenso viele andere quasi in Altersheime verwandelten, in denen sämtliche wirtschaftlichen Aktivitäten zum Erliegen kamen und selbst grundlegende Versorgungsleistungen nicht mehr gewährleistet waren. Viele tausend Menschen wurden außerdem von der Guardia Civil mit vorgehaltener Waffe zum Verlassen ihrer Häuser gezwungen, da die Dörfer, in denen sie gelebt hatten, einer Infrastrukturpolitik der forcierten Errichtung großer Staudämme zum Opfer fielen. Und von den weiteren Millionen, die in derselben Zeit in andere europäische Länder oder nach Lateinamerika auswanderten und meist ebenfalls aus verarmten Dörfern stammten, war dann noch gar nicht die Rede.11 Das hat im gesamten Land tiefe Spuren hinterlassen. Heute gibt es ein leeres Spanien, in dem bloß noch eine Handvoll Menschen leben, und ein zweites leeres Spanien, das im Bewusstsein und im Gedächtnis von Millionen Spaniern weiterlebt.
Diese Spannungen zwischen Stadt und Land hat man in Spanien in einer sonderbaren, ja bizarren Form der Dramatik durchlitten. Es gibt eine ganze Literatur, die ihren Stoff aus diesem »großen Trauma« bezieht. Vor allem aber gibt es eine Art des Blicks auf diese Vorgänge und auf sich selbst, die in anderen geografischen Zusammenhängen nur schwer zu verstehen ist. Einen Blick voller Hass. Voller Selbsthass.
Die Puerta del Sol ist bis heute der gefühlte Mittelpunkt Madrids. Obwohl die Geschäftszentren und sonstigen wichtigen Einrichtungen des Alltags sich längst anderswo befinden, ist der Platz mit seinen Strichern, Taschendieben, Verkäufern von gefälschten Lotterielosen und anderen Kleinganoven und den Touristen aus aller Herren Länder, die seit einiger Zeit die Madrider Müßiggänger verdrängt haben, noch immer das Herz der Stadt. Gewissermaßen die Definition des Urbanen in Spanien, der Salon der Nation. Hier wurden Republiken ausgerufen und Invasoren bekämpft. Hier wird in jeder Silvesternacht im Namen des ganzen Landes das neue Jahr eingeläutet.
Auf diesem so symbolträchtigen Platz steht auch eine symbolträchtige Statue. Noch nicht allzu lange – errichtet wurde sie 1967. Seither hat sie mehrfach den Standort gewechselt, ist aber stets an der Puerta del Sol geblieben und ein beliebter Treffpunkt der Madrider. Die Stadtverwaltung beauftragte seinerzeit den Bildhauer Antonio Navarro Santafé mit einer Darstellung des Madrider Stadtwappens. Was er letztlich ausführte, war das, was sich in der Mitte des Wappens befindet, ein Bär und ein Erdbeerbaum (madroño), auch wenn es in den historischen Quellen keinerlei Hinweis darauf gibt, dass es sich tatsächlich um einen Erdbeerbaum handelt. Die Wappen-Legende besagt lediglich, dass Bär und Baum eine Übereinkunft aus dem 13. Jahrhundert zwischen Bürgerschaft und Stadtregierung symbolisierten, der zufolge Erstere die städtischen Weidegründe nutzen durfte, der Letzteren die Wälder und das darin lebende Wild zugesprochen wurden. Der sich am Baum abstützende Bär soll beides verkörpern, das Jagd- und das Forstrecht. Oftmals beruhen heraldische Erklärungen auf Dokumenten aus einer Zeit lange nach den Ereignissen, auf die sie sich beziehen. Das gilt auch für das Madrider Wappen, die Angaben dazu stammen aus Chroniken des 18. Jahrhunderts, die erzählten Ereignisse spielten sich jedoch im 13. Jahrhundert ab, also fünfhundert Jahre früher. Kein Richter würde wohl ein derartiges Beweismittel in einem Prozess zulassen, aber die Geschichte ist ja keine Gerichtsverhandlung. Und so kommt es, dass wir oft genug Quellen akzeptieren, die bei genauerer Betrachtung mindestens eine Überprüfung nötig hätten. Sagen wir also trotzdem, dass es so war wie behauptet, auch wenn schwer nachzuvollziehen bleibt, warum ein Bär einen Erdbeerbaum umarmen sollte. Das eigentliche Rätsel ist jedoch die Frage, warum es sich unter allen möglichen Baumarten ausgerechnet um einen Erdbeerbaum handeln soll.
Die Stadtverwaltung, die von der Erdbeerbaum-These überzeugt war, ließ jedenfalls seit Beginn der sechziger Jahre überall in der Stadt Erdbeerbäume pflanzen, im Retiro, in der Casa de Campo und vielen anderen Parks. Das Symbol Madrids sollte in der Hauptstadt schließlich an so vielen Stellen wie möglich zu sehen sein. Zum Glück kam man nicht auf die Idee, an jeden Erdbeerbaum auch noch einen lebendigen Bären zu ketten. Die städtischen Gärtner merkten allerdings bald, dass die Erdbeerbäume nur schlecht wuchsen, der Madrider Boden war für die Baumart offensichtlich nicht geeignet, nur wenigen Exemplaren gelang es, ordentlich Wurzeln zu schlagen.
Die Botaniker bestätigten die Beobachtungen der Gärtner: Madrid gehört nicht zum natürlichen Lebensraum des Erdbeerbaums. Manche vermuteten gar, vielleicht sei auf dem Wappen doch ein anderer Baum abgebildet, schließlich kämen wildwachsende Erdbeerbäume auch in der Umgebung nicht vor. Im Prado und in der Gegend nördlich der Stadt sind Steineichen zu finden, Erdbeerbäume dagegen erst in höheren Gebirgslagen und auch in Segovia, in jedem Fall aber weit entfernt von dem Gebiet, das dem mittelalterlichen Madrid unterstanden hatte. Der einzige größere Erdbeerbaum im Stadtzentrum steht heute auf der Plaza de la Lealtad, neben dem Hotel Ritz. Der Arbutus unedo, wie er botanisch korrekt heißt, wächst wild im gesamten Mittelmeerraum, gerne am Rand von Schluchten oder auf abschüssigem Gelände. Neben der Steineiche gehört er zu den für das Landesinnere Spaniens typischen Bäumen.
Es ist offensichtlich dem Zufall geschuldet, dass der Erdbeerbaum, der normalerweise in der Einsamkeit abgelegener Gegenden zu Hause ist, als Wahrzeichen der größten Stadt Spaniens fungiert und als Bronzeskulptur auf dem bekanntesten Platz des Landes steht. Und dass diese Skulptur ausgerechnet 1967 auf ihrem Granitsockel platziert wurde, also zur Hochzeit des großen Exodus der spanischen Landbevölkerung, als so viele Bewohner der Gebiete, wo der Erdbeerbaum natürlicherweise vorkommt, sich eine Nische in der Stadt suchten. Ein Zufall, klar, aber es gibt auch schöne Zufälle. Wie die Erdbeerbäume, die die städtischen Gärtner damals erfolglos anzupflanzen versuchten, versuchten die neuen Bewohner Madrids damals Wurzeln in einer Stadt zu schlagen, die keinen Platz für sie hatte. Das Schöne daran ist, dass ein Vertreter eben der Landschaft, die dabei war, sich inmitten des »großen Traumas« in nichts aufzulösen, in Bronze gegossen im Herzen der Hauptstadt wiederauftauchte.
Es gibt eine sehr grausame Stelle in einem Reisebuch eines Schriftstellers, der aus der Grausamkeit eine Stilfrage gemacht hat. In Viaje a la Alcarria (Reise in die Alcarria, 1948) erzählt Camilo José Cela, dass die jungen Männer aus den Dörfern der Provinz Guadalajara junge Frauen, die in Madrid als Dienstmädchen gearbeitet hatten, nicht heiraten wollten – wer wusste schon, welche Hände sie dort berührt hatten. Ein uraltes, bereits aus der Bibel bekanntes Motiv. Die Stadt als Sündenbabel.
Die Genesis berichtet davon, wie die Menschen durch die Errichtung der Städte ihre Unschuld verloren. Wie sie von Hochmut und Verdorbenheit erfüllt wurden und die schlichte, fromme Lebensart aufgaben, die sie auf dem Land gepflegt hatten, bis sie anfingen, Tyrannen zu huldigen, und zur Strafe der gemeinsamen Sprache beraubt wurden. Eine Vorstellung, die ihre Wirksamkeit bis heute beibehalten hat. Die Stadt als das Falsche, Unreine, Sündhafte, als Sinnbild des Todes. Und das Land als das Wahre, Reine, Tugendhafte, als Sinnbild des Lebens. Ein Mythos, der sich in allen möglichen Variationen durch sämtliche Zeiten und Gesellschaften zieht. Auch in Spanien. Nur dass die Spanier seltsamerweise im Lauf der Zeit den Spieß umgedreht haben: Obwohl die Bauern und eine Vielzahl anderer von dieser Vorstellung durchdrungener Menschen dem Stadtleben weiterhin aus politischen, ökologischen oder religiösen Gründen misstrauen, gibt es eine untergründige Gegenströmung, die das Land als Wildnis betrachtet. Die Zivilisation im Kampf mit der Barbarei lautet die Parole eines anderen, jüngeren Mythos, dessen Entstehung eng mit der Ausbreitung von Ideen der Freiheit und des Fortschritts verknüpft ist. In einem Land wie Spanien, das so viele Eroberer und Plünderer hervorgebracht und sie zu beiden Seiten des Atlantiks hat wüten lassen, kann man gar nicht anders, als das wüste Land, das einen Großteil seines Territoriums ausmacht, als barbarischen Ort voller ebenso barbarischer Unholde zu betrachten. Indigene, die häufig die Sprachen der Christen nicht verstehen, untereinander unverständliche Dialekte brabbeln und hartnäckig an ihren Hexereien und heidnischen Bräuchen festhalten. Das Entsetzen – oder selbstgerechte Gelächter – Camilo José Celas angesichts der Bauernburschen, die Frauen verschmähen, die in Madrid in Dienst gestanden haben, ist um nichts geringer als das des Bauern, der sich beim Anblick dieses von allen Lastern und Sünden der Großstadt befallenen schriftstellernden Bürgersöhnchens bekreuzigt.
Politisch hat sich dies häufig in gewalttätigen Auseinandersetzungen, ja Kriegen niedergeschlagen. Karlisten gegen Liberale (siehe Kapitel 7). Zentralisten gegen nationalistische Separatisten.
In den sechziger Jahren begann Radio Barcelona, begünstigt durch das Klima einer vorsichtigen kulturellen Öffnung, die die neue Generation in der franquistischen Führung beförderte, mit der Ausstrahlung von Sendungen auf Katalanisch. Genau genommen handelte es sich um eine einzige Sendung, ein Folkloreprogramm unter dem Titel La comarca ens visita (Unser Landkreis zu Gast). Viele gutbürgerliche Barceloneser, die damals noch weit davon entfernt waren, sich zu katalanisieren, empfanden das als ländlich-rückständige Beleidigung. Was sollte das heißen, »unser Landkreis zu Gast«? Woher kamen auf einmal all diese Bauerntölpel mit ihrer derben Sprache, die sich nicht zu benehmen wussten und nach Salami rochen? Für den Schriftsteller Francisco Ferrer Lerín (der diese Anekdote in seinem Buch Familias como la mía [Familien wie meine] erzählt),12 der damals noch sehr jung war und zur neuesten Autorengeneration gezählt wurde, war das der Anfang vom Ende des kosmopolitischen Barcelona.
Der Nationalismus hat große Städte bekanntlich noch nie gemocht. Ihre Komplexität und Vielschichtigkeit sind nicht kompatibel mit Versuchen, eine Gemeinschaft zu homogenisieren. Hitler hasste Berlin und liebte Bayern. Berlin sollte wie München werden, nicht umgekehrt. »Würde das Schicksal Roms Berlin treffen, so könnten die Nachkommen als gewaltigste Werke unserer Zeit dereinst die Warenhäuser einiger Juden und die Hotels einiger Gesellschaften als charakteristischen Ausdruck der Kultur unserer Tage bewundern«,13 schreibt er in Mein Kampf. Ein Extrembeispiel, natürlich, vergleichbare Formulierungen lassen sich jedoch überall auf der Welt finden. Der Nationalismus hat meistens zuerst auf dem Land Fuß gefasst, die Bauern wurden mit Hetzreden gegen die Städte aufgeputscht, die den alten Mythos vom Sündenbabel beschwörten – was oftmals zu grotesken Auseinandersetzungen geführt hat. Als Ende der siebziger Jahre in Spanien die Autonomen Gemeinschaften eingeführt wurden, kam es in mehreren davon zu erbittertem Streit über die Frage, welchen Orten die Hauptstadtfunktion zukommen solle. Nach Ansicht der lokalen Nationalisten repräsentierten gerade die jeweils größten Städte einer Region, die herkömmlicherweise auch ihre Hauptstädte gewesen waren, deren Wesen nicht. Durch ihr Wachstum hätten sie sich der heimatlichen Umgebung entfremdet, zu viel Neues, Andersartiges in sich aufgenommen und darüber ein Gutteil ihrer Urtümlichkeit verloren. In anderen Fällen, wo es zwei etwa gleich große Kandidaten gab, schlug man, um Konflikte zu vermeiden, eine dritte Stadt als Kompromisslösung vor, die antiurbanen Vorurteile waren aber auch in diesen Debatten deutlich vernehmbare Hintergrundgeräusche. Im Allgemeinen entschieden sich die neuen Gemeinschaften für eher kleine Städte von umso größerer historischer Bedeutung. Traditionsbewusste und klerikal geprägte Städte, die nach Ansicht der jeweiligen Nationalisten die nationalen Werte und Besonderheiten in Reinform repräsentierten. So wurde Santiago de Compostela zur Hauptstadt Galiciens, obwohl in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht La Coruña diese Rolle zufällt. Und so setzte sich in Extremadura Mérida mit seiner römischen – soll heißen: unsterblichen, tiefverwurzelten, essentiellen – Vergangenheit gegen Cáceres und Badajoz durch. Wie auch im Baskenland Vitoria gegen Bilbao, das wichtigste Industriezentrum im Norden der Iberischen Halbinsel. In Andalusien oder Aragón wiederum kam es zu Auseinandersetzungen, weil die Nationalisten Sevilla oder Saragossa das Recht auf die Hauptstadtrolle absprachen. In Aragón erschien damals eine Streitschrift mit dem vielsagenden Titel Zaragoza contra Aragón (Saragossa gegen Aragón), in der die Forderung erhoben wurde, Jaca und nicht das flatterhafte und korrupte Saragossa solle zur Hauptstadt der neuen Autonomen Gemeinschaft erkoren werden, da sich in der am Südrand der Pyrenäen gelegenen Stadt, dem einstigen aragonesischen Königssitz, das wahre Wesen Aragóns doch viel besser erhalten habe, seine Essenz. Und genau das ist das leere Spanien letztlich, eine Ansammlung von Fläschchen voller Essenzen. Obwohl sie fast leer sind, haben sich alle möglichen seltenen Düfte darin erhalten, eben weil sie so fest verschlossen sind …
Aber ist von alldem im heutigen, so modernen und perfekt in die Europäische Union und den Westen integrierten Spanien tatsächlich noch etwas wahrnehmbar? Ich nehme es sehr wohl wahr. Es wäre auch verwunderlich, wenn der Charakter und die Lebensweise der Spanier des 21. Jahrhunderts nicht von den Erfahrungen so vieler Jahrhunderte und insbesondere vom »großen Trauma« der fünfziger und sechziger Jahre geprägt wären. Spanien hat noch immer viel zu verdauen – und nur einen sehr kleinen Magen.
Wer durch das leere Spanien reist, trifft allerorten auf Namen, die ihm bekannt vorkommen. Kaum verlässt man die Autobahn und setzt die Fahrt auf einer kleinen Landstraße fort, kommt man an Abzweigungen vorbei, die zu Dörfern führen, deren Namen von den Familien, die einst dort lebten, aber nie mehr zurückkehrten, in die Städte getragen wurden. Im dicht besiedelten und so homogenen Europa unserer Tage ist eine Reise durch das leere Spanien eine unvergleichliche Erfahrung. Karge Landschaften, Wüsten, öde Gebirge, Dörfer an den unmöglichsten Stellen, und bei alldem die Frage: Wer lebt hier? Und warum? Wie haben die Menschen jahrhundertelang so viel Einsamkeit, Hitze, Staub, Trägheit, Dürre, ja Hunger überstanden?
In Madrid, an der Puerta del Sol oder auf der Gran Vía, ist davon nichts zu spüren. Nur wenige zeigen Neigung – ungefähr so wenige, wie in der Ödnis des leeren Spanien ausharren –, die Weiten der Hochebene, der Meseta, unmittelbar vor Ort in Augenschein zu nehmen. Ich bin in Madrid geboren. Mütterlicherseits bin ich Madrider in der vierten Generation, für eine vor allem aus Zuwanderern bestehende Stadt etwas durchaus Seltenes. Mein Vater dagegen stammt aus Arcos de Jalón, einem Ort in der Provinz Soria. Aus Gründen, die mir nie recht klargeworden sind, haben meine Eltern eines Tages die der allgemeinen Wanderungsbewegung entgegengesetzte Richtung eingeschlagen und sind, statt in Madrid zu bleiben, wo meine Mutter einen guten Arbeitsplatz und viele Freunde hatte, in das nicht weit von Arcos de Jalón entfernte Almazán gezogen, in eine Wohnung an der dortigen Plaza Mayor. Meine Mutter erzählt, es sei dermaßen ungewöhnlich gewesen, dass ein junges Paar mit Kind aus Madrid sich hier niederließ – ausgerechnet aus Madrid, wo alle jungen Leute aus dem Ort unbedingt hinwollten –, dass sich sämtliche Nachbarn versammelten, um sich das Schauspiel ihres Einzugs nicht entgehen zu lassen. Almazán ist ein hübsches Städtchen mit mittelalterlichen Gässchen, in den schneereichen Wintern ist es dort jedoch neblig und kalt, und die Temperatur klettert kaum je über null Grad. Kein Wunder, dass meine Eltern bei der ersten sich bietenden Gelegenheit erneut einen Umzugslaster bestellten und sich an der Küste niederließen, in dem Dorf in der Provinz Valencia, wo ich aufgewachsen bin. Kulturell hatte dieser Ort womöglich nicht mehr zu bieten als Almazán, aber das Klima war herrlich, im Frühling dufteten die Orangenblüten, und mein Bruder und ich konnten vier Monate ununterbrochen am Strand verbringen.
Das Landesinnere haben wir darüber aber nie vergessen. Häufig besuchten wir die Verwandten meines Vaters auf dem Dorf in Soria. Mein Großvater mütterlicherseits hatte außerdem ein Haus in einem Dorf in Aragón, nahe der Grenze zu Kastilien. Diese im Sommer drückend heißen und im Winter schneebedeckten Orte sind für mich auf beinahe unerträgliche Weise emotional aufgeladen – meine zwei Combrays. Das Strandkind, das ich war, fragte sich jedes Mal, warum dort überhaupt Menschen wohnten.
Das Dorf meines Vaters war ein Eisenbahnknotenpunkt an der Strecke zwischen Madrid und Saragossa, das mit seinem Niedergang nur sehr schlecht zurechtkam. Zur Zeit der Dampflokomotiven belud man hier die Tenderwagen mit neuer Kohle und wechselte das Zugfahrzeug. Die Elektrifizierung sorgte für den Verlust fast sämtlicher Arbeitsplätze, der Abstieg des Orts begann. Meine Großmutter und eine unverheiratete Schwester meines Vaters lebten noch dort. Meine Tante wurde eines Tages an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Talgo-Zug überfahren, der in voller Geschwindigkeit angerast kam. So wie sie starb auch das Dorf daran, dass die schnellen und wichtigen Züge hier nicht mehr hielten. Tante Vivi, wie wir sie nannten, studierte Geschichte und sammelte begeistert römische Münzen. Das Dorf war zu Zeiten des Römischen Reichs ein Militärstützpunkt gewesen und davor eine Festung der Iberer, weshalb hier archäologische Reste reichlich vorhanden waren und sind. Einmal ging Tante Vivi mit mir hinauf zur Burgruine und zeigte mir etwas, das bei mir, der ich zu diesem Zeitpunkt sechs oder sieben war, einen großen Eindruck machte. »Schau mal«, sagte sie, dem unter uns liegenden Dorf den Rücken zukehrend, und deutete auf ein weiteres Dorf aus Lehmziegeln. Sich in steilen Gassen aneinanderdrängende Häuser ohne Dächer, dazwischen immer wieder Haufen roter Ziegel. Kein Mensch lebte hier. Die tiefroten Ziegelmauern schienen kurz davor, zu zerfallen und wieder von der roten Erde der Umgebung verschlungen zu werden. Es war das alte Dorf. Oder vielmehr der alte Teil des Dorfes. Nach der Ankunft der Eisenbahn hatten die Leute ihn verlassen und waren in Häuser rund um den Bahnhof gezogen. Als ich Jahre später zum ersten Mal in das im Bürgerkrieg fast völlig zerstörte Belchite kam, musste ich an dieses Kindheitserlebnis zurückdenken. Heute weiß ich, dass der verlassene Teil des Dorfes meines Vaters längst nicht so groß war, wie er mir damals erschien. Als Kind hielt ich ihn für riesig.
Als Journalist und Reporter des Heraldo de Aragón bin ich viel im leeren Spanien umhergereist. Es verging kaum eine Woche, in der ich nicht mindestens einmal um fünf Uhr morgens aufstehen und, begleitet von einem Fotografen, mit dem Auto hundert, zweihundert, ja manchmal auch dreihundert Kilometer zurücklegen musste, um über einen Vorfall in irgendeinem abgelegenen Kaff zu berichten. Saragossa, wo ich wohne und wo sich auch die Chefredaktion dieser Zeitung befindet, hat etwa 700.000 Einwohner und ist die Hauptstadt einer Autonomen Gemeinschaft mit rund 1,3 Millionen Einwohnern. Anders gesagt, die Hälfte der Bevölkerung lebt zusammengedrängt in einer Stadt, der Rest dagegen über ein Gebiet verstreut, das größer ist als die Niederlande (wo 17 Millionen Menschen leben). Nach den Kriterien der OECD ist Aragón eine Mischregion, die sowohl urbane als auch ländliche Züge aufweist, weshalb sie als Musterbeispiel für die spanische Bevölkerungsstruktur betrachtet wird. Ein Spanien in Miniaturformat, fast wie aus dem Labor.
Hier habe ich die schier unendliche Weite der Landschaft gründlich kennengelernt. Saragossa ist eine mittelgroße europäische Stadt mit einigen Besonderheiten, insgesamt jedoch anderen Städten dieser Größe wie Toulouse, Bordeaux, Bologna oder Bristol ohne Weiteres vergleichbar. Allerdings ist sie umgeben von Wüste. Wenn ihre Bewohner einen Sonntagsausflug machen wollen, müssen sie zunächst mindestens hundert Kilometer durch eine Gegend fahren, in der es außer Stromleitungen, Osborne-Stieren am Horizont und der einen oder anderen Ruine kaum ein Anzeichen menschlichen Lebens gibt. Gegenverkehr begegnet einem ebenfalls kaum. Meine journalistische Arbeit führte mich hier in Dörfer, in denen es so gut wie nichts gibt. Einmal pro Woche schaut ein Arzt vorbei, die aufgegebene Schule dient als Warenlager oder Laden, und an manchen Gebäuden prangen noch immer die in Stein gemeißelten Wappenschilde aus der Zeit von Alfons XIII., weil sie damals, also Anfang des 20. Jahrhunderts, zum letzten Mal für öffentliche Zwecke genutzt wurden. Die Dorfkneipen öffnen jede Woche ein paar Stunden als Gemeinschaftstreff, Handyempfang gibt es keinen, und der Bürgermeister wohnt hundert Kilometer entfernt und übt sein Amt vor Ort nur für ein Weilchen am Freitagnachmittag aus. Im Winter leben hier oft bloß zwei oder drei alte Menschen, die den ganzen Tag am warmen Ofen sitzen und, sobald ein Fremder auftaucht, die Guardia Civil rufen. Dörfer, die kurz davor sind, zu verschwinden, beziehungsweise die verschwinden werden, wenn ihre letzten zwanzig oder dreißig Bewohner gestorben oder so krank sind, dass ihre Kinder sie zu sich in die Stadt holen.
Die Bewohner dieses leeren Spanien haben das Gefühl, dass man sie ihrem Schicksal überlassen hat. Viele sind verbittert. Sie reden sich ein, früher sei bei ihnen alles voller Leben gewesen und es habe viele Kinder und Nachbarn gegeben. Manche träumen davon, diese mythische Vergangenheit mithilfe von Einwanderern aus Osteuropa oder Lateinamerika wieder zum Leben zu erwecken – die einzigen jungen Menschen, die den Mut hatten, sich an Orten wie diesen niederzulassen.