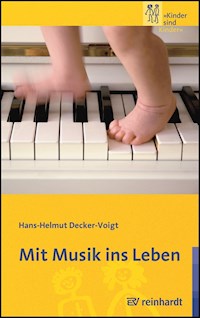38,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Das Lehrbuch stellt die theoretischen Grundlagen, Behandlungstechniken und klinischen Anwendungen der Musiktherapie umfassend dar. Der Aufbau des Werkes folgt der Entwicklung des Menschen – vom intrauterinen Klangraum angefangen bis zum letzten Lebensabschnitt – und der Rolle der Musik als Therapeutikum darin. Erläutert werden u. a. Setting, Wirkfaktoren, Indikationen und Instrumentarium. Die praktische Anwendung wird für verschiedene Alters- und Entwicklungsstufen mit je typischen Störungsbildern und Konflikten beschrieben und mit vielen Falldarstellungen illustriert. Ein Ausblick auf Forschungsfragen und Entwicklungstrends und ein Überblick über Ausbildung und Organisationen runden das Werk ab
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Ähnliche
utb 3068
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Böhlau Verlag · Wien · Köln · Weimar
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Wilhelm Fink · Paderborn
Narr Francke Attempto Verlag · Tübingen
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Ernst Reinhardt Verlag · München
Ferdinand Schöningh · Paderborn
Eugen Ulmer Verlag · Stuttgart
UVK Verlag · München
Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Hans-Helmut Decker-Voigt
Dorothea Oberegelsbacher
Tonius Timmermann
Lehrbuch Musiktherapie
3., aktualisierte Auflage
Mit 8 Abbildungen und 4 Tabellen
Ernst Reinhardt Verlag München
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans-Helmut Decker-Voigt, 1990–2010 Direktor des Instituts für Musiktherapie der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, seitdem dort Senior-Professor in der Lehre und Forschung für Künstlerische Therapien, Gast-und Stiftungsprofessuren in USA, Japan, Ungarn, Estland, Russland, Gründungsherausgeber der Zt. „Musik und Gesundsein“, freier Schriftsteller. www.decker-voigt-archiv.de
Von Hans-Helmut Decker-Voigt außerdem im Ernst Reinhardt Verlag lieferbar: „Schulen der Musiktherapie“ (ISBN 978-3-497-01574-0) und „Mit Musik ins Leben“ (ISBN 978-3-497-01928-1).
Dr. Mag. Dorothea Oberegelsbacher lehrt Musiktherapie an der Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien, und Psychotherapie an der Sigmund Freud Privat-Universität, Wien. Niedergelassene Musiktherapeutin und Psychotherapeutin.
Prof. Dr. Tonius Timmermann, leitete die Berufsbegleitende Musiktherapieausbildung am Freien Musikzentrum München und den Masterstudiengang an der Universität Augsburg. Zahlreiche Veröffentlichungen. Freie Praxis in München und Wessobrunn. Nähere Informationen unter www.timmermann-domain.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
UTB-Band-Nr.: 3068
ISBN 978-3-8252-5295-3
© 2020 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in EU
Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
Foto auf S. 51 von Ulrike Höhmann, Haslach
Satz: ew print & medien service gmbh, Würzburg
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Vorwort
Einleitung
IGrundlagen
1Definition
von Dorothea Oberegelsbacher
2Praxisfelder und Indikation
von Tonius Timmermann und Dorothea Oberegelsbacher
3Forschungsstand Musiktherapie
von Dorothea Oberegelsbacher und Tonius Timmermann
4Forschungsstand Musikmedizin und Musikpsychologie oder:„Das Gehirn hört mehr als die Ohren“
von Hans-Helmut Decker-Voigt
5Das Instrumentarium: Streicheln und Ermorden – Musikinstrumente: ihr Appell, ihre Symbolik
von Hans-Helmut Decker-Voigt
6Praxeologie
von Tonius Timmermann
7Improvisation
von Tonius Timmermann
8Rezeption
von Tonius Timmermann
9Das Wort in der Musiktherapie
von Tonius Timmermann
10Anthropologische und ethnologische Aspekte
von Tonius Timmermann
11Historische Aspekte
von Tonius Timmermann
12Die Musiktherapie der Gegenwart
von Dorothea Oberegelsbacher und Tonius Timmermann
13Zusammenfassung
von Dorothea Oberegelsbacher,Tonius Timmermann und Hans-Helmut Decker-Voigt
IIMensch und Musik: Lebenszyklen – Klinische Praxis – Theoriemodelle
14Der pränatale Raum oder: „An-Stoß und An-Spiel“
14.1Normalverlauf und Störungsmöglichkeiten
14.1.1Der ungestörte Schwangerschaftsverlauf unter Aspekten der Entwicklungspsychologie und der Rolle der Musik
von Hans-Helmut Decker-Voigt
14.1.2Pränatale Prävention
von Dorothea Oberegelsbacher
14.2Beispiele aus der klinischen Praxis – Musiktherapie mit belasteten Schwangeren
von Dorothea Oberegelsbacher
14.3Theoriebildung
von Dorothea Oberegelsbacher
15Der perinatale, postnatale und präverbale Raum (0–2): „Da, da, da“
15.1Normalverlauf und Störungsmöglichkeiten
15.1.1Normalverlauf unter Aspekten der Entwicklungspsychologie und der Rolle der Musik
von Hans-Helmut Decker-Voigt
15.1.2Störungsmöglichkeiten
von Dorothea Oberegelsbacher
15.2Beispiele aus der klinischen Praxis
15.2.1Musiktherapie in der Neonatologie
von Dorothea Oberegelsbacher
15.2.2Musiktherapie mit einem sog. „Schrei-Baby“
von Dorothea Oberegelsbacher
15.2.3Musiktherapie mit einem autistischen Patienten
von Dorothea Oberegelsbacher
15.3Theoriebildung
15.3.1Die Sphäre des Traumatischen in der Musiktherapie
von Dorothea Oberegelsbacher
15.3.2Narzissmus:Wer klingt am schönsten im ganzen Land?“
von Hans-Helmut Decker-Voigt
15.3.3Das Spezifische des Nonverbalen in den künstlerischen Psychotherapien und die Rolle der Musiktherapie
von Tonius Timmermann
16Kleinkindphase (2–6): „Alle meine Entchen“
16.1Normalverlauf und Störungsmöglichkeiten
von Hans-Helmut Decker-Voigt
16.2Ein Beispiel aus der klinischen Praxis – Musiktherapie mit einem vierjährigen Mädchen nach dem Tod der Mutter
von Tonius Timmermann
16.3Theoriebildung
16.3.1Theorien zum Kleinkindalter von Kohut, Erikson, Piaget und Winnicott: „Kindsein hat viele Theorieväter“
von Hans-Helmut Decker-Voigt
16.3.2Entwicklungsretardierungen
von Dorothea Oberegelsbacher
17Späte Kindheit (6–12)
17.1Normalverlauf und Störungsmöglichkeiten
von Tonius Timmermann
17.2Beispiele aus der klinischen Praxis
von Hans-Helmut Decker-Voigt
17.2.1Musiktherapie mit Trennungskindern
17.2.2Musiktherapie mit einem elfjährigen Jungen
17.2.3Musiktherapie bei einem sexuell missbrauchten Mädchen
17.2.4Gruppenmusiktherapie mit kriegstraumatisierten Kindern
von Tonius Timmermann
17.3Theoriebildung
von Tonius Timmermann
18Pubertät (12–16): „Weder Fisch noch Fleisch“
18.1Normalverlauf und Störungsmöglichkeiten
von Hans-Helmut Decker-Voigt
18.2Beispiele aus der klinischen Praxis
18.2.1Musiktherapie mit einem 14-jährigen magersüchtigen Mädchen
von Tonius Timmermann
18.2.2Musiktherapie mit einem 16-jährigen verhaltensauffälligen Jungen
von Tonius Timmermann
18.2.3Musiktherapie mit einer 15-jährigen Patientin mit Schädel-Hirn-Trauma
von Tonius Timmermann
18.2.4Gruppenmusiktherapie mit geistig behinderten Jugendlichen
von Dorothea Oberegelsbacher
18.3Theoriebildung: „Vom Kindsein im Erwachsenwerden“
von Hans-Helmut Decker-Voigt
19Adoleszenz (16–28)
19.1Normalverlauf und Störungsmöglichkeiten
von Dorothea Oberegelsbacher
19.2Beispiele aus der klinischen Praxis
19.2.1Musiktherapie mit einer 26-jährigen bulimischen Patientin
von Tonius Timmermann
19.2.2Gruppenmusiktherapie in der stationären Jugendpsychiatrie
von Tonius Timmermann
19.2.3Musiktherapie mit einem schizophrenen Mann
von Dorothea Oberegelsbacher
19.3Theoriebildung
von Dorothea Oberegelsbacher
20Mittlere Lebensphase (28–60)
20.1Normalverlauf und Störungsmöglichkeiten
von Tonius Timmermann
20.2Beispiele aus der klinischen Praxis
20.2.1Musiktherapie mit einer 29-jährigen bulimischen Patientin
von Tonius Timmermann
20.2.2Musiktherapie mit einer forensischen Patientin
von Tonius Timmermann
20.2.3Dora – Eine musiktherapeutische Aufstellungsarbeit
von Tonius Timmermann
20.2.4Gruppenmusiktherapie in der stationären Behandlung von Alkoholkranken
von Dorothea Oberegelsbacher
20.2.5Musiktherapie mit einer Dialysegruppe
von Hans-Helmut Decker-Voigt
20.3Theoriebildung: Systemische Grundorientierung in der Erwachsenentherapie und Aufstellungsarbeit
von Tonius Timmermann
21Senium (60–75)
21.1Normalverlauf und Störungsmöglichkeiten
von Dorothea Oberegelsbacher
21.2Beispiele aus der klinischen Praxis
21.2.1Ein Lebenslauf – musikalisch betrachtet
von Tonius Timmermann
21.2.2Eine Fallvignette aus der Einzelmusiktherapie mit einer neurologisch erkrankten Patientin
von Hans-Helmut Decker-Voigt
21.3Theoriebildung
von Tonius Timmermann
22Letzter Lebensabschnitt (ab 75)
22.1Normalverlauf und Störungsmöglichkeiten
von Tonius Timmermann
22.2Ein Beispiel aus der klinischen Praxis – Musiktherapie in einem Hospiz
von Tonius Timmermann
22.3Theoriebildung
von Tonius Timmermann
IIIBerufsprofile – Ausblicke – Vernetzungen
23Berufliche Identität
von Dorothea Oberegelsbacher
24Musiktherapie – Psychotherapie – Ausblick auf die Forschung
von Tonius Timmermann
25Aspekte zu den Musiktherapie-Ausbildungen vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Rahmen der EU
von Hans-Helmut Decker-Voigt
Schlussakkord: „Lieber Herr Kohl …“ – Friedrich Fröbel im Jahre 1847 an den Komponisten Robert Kohl 306
Literatur
Anhang: Adressen von Ausbildungstätten und Organisationen
Sachregister
Vorwort
Persönliches von drei Personen … denn Sie könnten dem Irrtum verfallen, ein „Lehrbuch“ versammele alles gegenwärtige Wissen zu einem Fach, hier: zur Musiktherapie. Nicht einmal an Lexika oder Handbücher kann dieser Anspruch gestellt werden, obwohl der Anspruch „Lehrbuch“ die Denkrichtung hin zu einem Buch mit enzyklopädischem Wissensinhalt auslöst. Irrtümlicherweise. Lehrbücher zeigen auch immer nur Ausschnitte. Unser Anspruch ist am besten zu umreißen mit einem Zitat von Antoine de Saint-Exupéry:
„Vollkommenheit ist nicht erreicht,
wenn nichts mehr hinzuzufügen ist,
sondern wenn nichts mehr da ist,
was man weglassen könnte.“
Gefunden wurde das obige Zitat von Saint-Exupéry auf der Speisekarte während eines Aeroflot-Fluges von Berlin nach Moskau, und „Speisekarte“ passt gut zum Anspruch dieses Lehrbuches: Auf unserer Speisekarte stehen die Lehrpositionen und Praxisforschungen von uns drei AutorInnen, die der Ausgang für die Entwicklung dieses Buches waren. Auch vor solcher Ausgangsposition gibt es meist einen Anfang: Zunächst wurde dieses Buch vom Ernst Reinhardt Verlag bei Hans-Helmut Decker-Voigt nach seinem allgemeinen Einführungsvortrag in Musiktherapie im Münchner Gasteig in Auftrag gegeben. Bald die Unmöglichkeit einsehend, ein Lehrbuch mit dem Anspruch i. S. des Antoine de Saint-Exupéry allein schreiben zu können, begann Decker-Voigt die Suche nach Mit-TrägerInnen dieses Projekts, und so entstand unser bemerkenswertes AutorInnen-Trio. Bemerkenswert, weil wir in mehreren Jahren immer zusammenrückender Zusammenarbeit keinen einzigen wirklichen Streit hatten – und dies, obwohl unsere theoretischen und wissenschaftlichen Positionierungen nicht identisch sind. Im Blick auf Menschenbild und ethische Ziele trafen wir uns jedoch immer konsensual und in einer Schnittfläche aus folgenden inhaltlichen Positionen: Tiefenpsychologisch-phänomenologisch, besonders Individualpsychologie und Psychoanalyse, bei Dorothea Oberegelsbacher – tiefenpsychologisch orientiert, dabei humanistische und systemisch-phänomenologische Aspekte einbeziehend, bei Tonius Timmermann. Intermodal-ausdruckstherapeutisch vor dem Hintergrund humanistischer Psychologie und damit auch tiefenpsychologisch-phänomenologisch arbeitend: Hans-Helmut Decker-Voigt. Alle zusammen arbeiten wir am Brückenschlag zwischen qualitativen und quantitativen Erforschungsinstrumentarien zur Rolle der Musik im Menschsein zwischen Gesundheit und Krankheit.
Wir schauen mit Dankbarkeit auf das halbe Jahrzehnt unserer Zusammenarbeit als Trio zurück – immerhin die Zahl, die die normalerweise anstrengendste Gruppierung im menschlichen Miteinander bedeutet.
Insgesamt haben wir vier Jahre an diesem Buch gearbeitet, geschätzt hatten wir am Anfang – ein Jahr! Bei 360 Seiten – vom Verlag vorgegeben durch den Reihencharakter bei UTB – klang ein Jahr geradezu viel: „Nur“ 120 Seiten pro AutorIn … Wir haben uns selten in unseren zusammengezählt 85 Jahren Berufs- und Publikationserfahrung derart geirrt! Denn die verabredete Pflicht, die jeweiligen Themen der beiden anderen AutorInnen zu bearbeiten, zu redigieren i. S. eines teaminternen Fachlektorats, wurde zur Lust, und zwar zur zeitraubenden. Denn diese „kreuzmodale“ Bearbeitung und Begleitung der anderen löste wiederum lebhafte tags- und nachtsüber geführte Gespräche aus. Wir gerierten zu einem Dauer-Symposion.
In diesem Zusammenhang muss unbedingt zur Lektüre unserer Danksagung motiviert werden. Denn unsere professionelle Lektorin im Verlag und unsere nächsten Menschen (Familie, KollegInnen, StudentInnen) wurden während der Dauerankündigung, wir befänden uns in der Fast-Schlussphase und das Buch erschiene in einem halben Jahr, auf eine für sie harte Geduldsprobe gestellt. Sie antworteten mit Sanftmut und Verständnis für diese Ablösungsprobleme von einem gemeinsamen geistigen Kind – gezeugt, getragen, geboren zu Dritt. Neben der Heimarbeit trafen wir uns zweimal jährlich wechselnd an unseren Wohnsitzen
●im bayerischen Wessobrunn,
●in Allenbostel/Lüneburger Ostheide und – als zugehöriges Gegenteil zum dörflichen Teil
●in der Metropole Wien.
Lachen Sie nicht: Die Orte und ihre Einbindung in unterschiedlichste Land- und Stadtschaft prägten auch dies Buch: Es ist gefüllt mit Einladungen zu Überblicken, zu Overviews, mit denen Bewohner von Flachlandschaften leben. Es ist gefüllt mit Tiefengrabungen zu vielen unserer Spezifizierungen in der Musiktherapie, zu denen der Blick von Bergen in Täler einlädt. Und es ist gefüllt mit der Dichte von beidem, Überblicke und Spezialisierungen, die sich teilweise bedingen, teilweise widersprechen, nur erkennbar in der Dichte einer lange gewachsenen Metropole.
Tiefsinnigerweise arbeiteten Dorothea Oberegelsbacher und Tonius Timmermann lange in der Stadt Sigmund Freuds mit seinen Verzweigungen zu C. G. Jung, zu Skinner. Sie, später wir drei, arbeiteten in der Stadt, in der der erste Studiengang für Musiktherapie im deutschsprachigen Westeuropa an der damaligen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst gegründet wurde; wir wanderten nach Hamburg, von wo aus die ersten Hochschulstudiengänge für Musiktherapie in der (damals westlichen) BRD gegründet wurden und trafen uns am meisten in der fast geografischen Mitte bei München, das im Freien Musikzentrum eine der führenden nicht staatlichen Ausbildungen in Musiktherapie anbietet und von dem wesentliche Impulse für neuere Studiengangsgründungen aus gingen (z. B. Augsburg).
Addiert verfügen wir drei über genau 85 Jahre musiktherapeutische und psychotherapeutische Berufserfahrung sowie pädagogische Erfahrung in der Ausbildung junger Menschen in diesem Beruf. Das machte uns angesichts des großen Netzwerks zu anderen KollegInnen und deren Institutionen auch mutig genug, verschiedene Musiktherapieströmungen in dieses Buch zu integrieren – mindestens durch eindrucksvolle Fallbeispielvignetten, die nicht unbedingt unsere eigenen musiktherapeutischen Repertoires spiegeln müssen.
Wir stellten fest, dass wir langsam „weise“ zu werden im Begriff sind – „weise“ i. S. von den beiden Baltes, die 1990 Weisheit definierten als „Expertenwissen im Bereich grundlegender Lebensfragen“ und weiter ausführten, dass zur Weisheit gehören:
●viel Faktenwissen zu verschiedenen Lebensbereichen,
●reichhaltiges Handlungswissen,
●ein hohes Maß an Verständnis der unterschiedlichen (oft widersprüchlichen) Kontextgebundenheiten des Lebens,
●Wissen, dass jedes Urteil immer nur relativ zu persönlichen und kulturellen Wertsystemen gültig ist und
●die Erkenntnis, dass jede Analyse von Lebensproblemen zwangsläufig unvollständig bleibt (Baltes/Baltes 1990).
So viel zu unserer gewachsenen und wachsenden „Weisheit“, die wir denjenigen entgegensetzen wollen, die die Weisheit aus einem Pott löffelten, dessen Inhalt bekanntlich ebenso absolut richtig wie begrenzt ist. Der immerwährende rote Faden: Wir wollten ein Lehrbuch zur Musiktherapie schreiben,
●das wir gerne in unseren eigenen Jahren als StudentIn gehabt hätten,
●das wir als Musiktherapie-Lehrende unseren heutigen Studierenden als Arbeitsmittel an die Hand geben und
●welches KollegInnen unserer und mehr oder minder benachbarter Disziplin sowie
●allgemein Interessierte als Wissens-, Anregungs- und Motivationsquelle hoffentlich mit Gewinn nutzen können.
Mögen Sie, liebe Leserinnen und Leser, ruhig und nüchtern mit diesem Buch arbeiten, mögen Sie dieses und jenes gut finden und anderes zu einseitig – dann holen Sie sich andere Bücher zu Rate.
Gewidmet unseren Studierenden in Augsburg, Hamburg, Wien, Zürich, Tallinn, Budapest, Orenburg/Russland, München, Bozen, Assisi sowie jenen aus unseren freien Seminaren.
Hans-Helmut Decker-Voigt,
Hamburg/Allenbostel – Lüneburger Heide
Dorothea Oberegelsbacher, Wien
Tonius Timmermann, Wessobrunn, München
Einleitung
Hinweise zum Aufbau dieses Lehrbuchs
Teil I („Exposition“) beschäftigt sich mit den Grundlagen der Musiktherapie. Hier findet man Historisches, Definitorisches, Theoretisches, Praxeologisches …
Teil II („Durchführung“) orientiert sich am Lebenskreis und wie Musiktherapie darin zu wirken vermag. Dieser Mittelteil nimmt den größten Lese- und Denkraum ein und folgt heutiger entwicklungspsychologischer Betrachtung menschlichen Lebens – bezogen auf seine ganze Lebensspanne – in unserem Kulturkreis. So folgen alle Aspekte zur Rolle und Bedeutung der Musik in der jeweiligen Lebensphase dem Dreierschritt:
●Normalverlauf und Störungsmöglichkeiten,
●Beispiele aus der Praxis,
●Theoriebildung (s. Inhaltsverzeichnis).
Teil III („Reprise und Coda“) greift das thematische Material des ersten und zweiten Teils in Form schlussfolgender Reflexionen auf: Berufliche Identität, Einordnung in den Rahmen der Psychotherapie, Ausblick auf Forschung und Ausbildung sowie Adressmaterial zu Organisationen.
Hinweise zur Benutzung
1) Lehrbücher sind nicht nur zum Durchlesen, sondern zum Nach- und Vorarbeiten und Beschäftigtsein mit Teilthemen. Deshalb verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick durch die Kenntnisnahme der Gliederung im Inhaltsverzeichnis.
2) Zur Vertiefung mit einem Teilthema finden Sie am Schluss eines jeden Kapitels Literaturempfehlungen, mit denen wir gute Erfahrungen beim Ausweiten, Vertiefen und Einbinden des Teilaspekts gemacht haben.
3) Wenn Sie zitieren, so bitten wir Sie, den Namen des jeweiligen Autors eines Kapitels zu nennen und nicht nur das Lehrbuch mit allen drei AutorInnen.
4) Der Adressteil mit Angaben zu Organisationen und Verbänden wurde im besten Wissen der Aktualität erstellt. Da sich aber Adressen am schnellsten ändern, stehen wir gerne für Auskünfte dann bereit, wenn Sie keinen sofortigen Kontakterfolg haben.
5) Wir stehen nicht nur bereit, sondern hoffen auf und danken für Feedbacks, für Anregungen aller Art – aus Ihrer Arbeit mit diesem Buch heraus!
IGrundlagen
1Definition
von Dorothea Oberegelsbacher
„Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen;und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.“(Ludwig Wittgenstein)
Musiktherapie ist die gezielte Verwendung des Mediums Musik oder seiner Elemente zu therapeutischen Zwecken. Sie ist immer in eine bewusst gestaltete therapeutische Beziehung eingebunden und verwendet nicht sprachliche und sprachliche Kommunikation sowie psychologische Mittel und Techniken.
Musiktherapie wendet sich an Menschen mit Leidenszuständen, Verhaltensstörungen und Entwicklungsrückständen, um an der Wiederherstellung, Erhaltung oder Verbesserung von seelischer, geistiger und körperlicher Gesundheit mitzuwirken (Oberegelsbacher 2004). Ihre spezifische Möglichkeit ist, dass sie Menschen über einen präverbalen bzw. extraverbalen, emotionsbetonten Zugang erreicht, in allen Lebensaltern und Störungen einen Wiederanschluss an diesen Bereich findet und von dort aus ihr Wirken entfaltet.
präverbaler
Zugang
Musiktherapie kann einzeln, in Gruppe sowie unter Einbeziehung von Angehörigen stattfinden. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen der Musik erlebende und sich durch Musik ausdrückende Mensch sowie die Resonanz, die er im Therapeuten und bei den anderen Beteiligten auslöst, mithin das Beziehungsgeschehen in all seinen Aspekten (Timmermann 2004a, 4).
Ausdruck und
Resonanz
Die Resonanz umfasst die äußere und innere Wirklichkeit der Beziehung, also die Realbeziehung und auch die begleitend auftretenden Phantasien dazu. In der musiktherapeutischen Situation wird der behandelte Patient/Klient in seinem Umgang mit Musik und seinen Reaktionen auf das musikalische Geschehen wahrgenommen. Besondere Berücksichtigung finden dabei die sich herausbildenden Erlebens-, Einstellungs- und Verhaltensmuster, unbewusste (Re-)Inszenierungen, aber auch psychovegetative und physiologische Reaktionen. Der Therapeut gestaltet die musikalischen Handlungen oft aktiv mit, beachtet dabei die Indikation und den Zeitpunkt im therapeutischen Prozess. Spielen, Reden und Zuhören wechseln einander ab.
Beziehungs-gestaltung durch Musik
Die Angebote der Musiktherapie, aktiv – auf leicht spielbaren Instrumenten und mit der Stimme – oder rezeptiv – im vorbereiteten Hören gezielt angebotener Musik –, dienen folgenden Zielen:
Ziele der
Musiktherapie
●Anbahnung von Kommunikation und Beziehung;
●Öffnung von psychovegetativen Kommunikationskanälen;
●Offenlegung und Veränderung sozialer Interaktionsmuster;
●Nachreifung krankheitswertiger früher Defizite;
●Probehandeln im Dienste von Problemlösung (Oberegelsbacher 2004, 1555).
Weitere Ziele sind:
●klinische Diagnostik;
●kathartisches Freilegen verschütteter Emotionen und Traumata;
●Darstellung intrapsychischer Zustände und Konflikte;
●nonverbale Konfliktbearbeitung;
●Transformieren und Strukturieren von Desintegrationszuständen bei Zerfall der Persönlichkeit;
●Herstellung von Realitätsbezug über Symbolisierung;
●Anregung freier Assoziation; Bewusstmachung von krank machenden Einstellungen;
●Förderung der Erlebnis- und Genussfähigkeit.
Die Definition der Musiktherapie im Rahmen von Psychotherapie bedarf einer Abgrenzung zu entwicklungs- und persönlichkeitsfördernden Methoden (Fitzthum et al. 2000, 445); zu Psychotherapien oder Kunsttherapien, die fallweise Musik verwenden, sowie zur Musikmedizin (Oberegelsbacher/Rezzadore 2003, 98).
Als Pioniere einer psychotherapeutischen Musiktherapie in Europa können Edith Lecourt, Gertrud Loos, Mary Priestley, Alfred Schmölz, Christoph Schwabe und Harm Willms genannt werden. Viele ihrer Gedanken bereiteten eine Kultur, die dem heutigen „Mainstream“ der Musiktherapie zugrunde liegt.
Pioniere
Die Kasseler Konferenz Musiktherapeutischer Vereinigungen in Deutschland hat zehn Kasseler Thesen zur Musiktherapie vorgestellt (1998, 232 f.): Musiktherapie gilt dort als Sammelbegriff für eine praxisorientierte Wissenschaft, die interdisziplinär und – in Abgrenzung zu pharmakologischer und physikalischer Therapie – psychotherapeutisch ist.
Kasseler Thesen
Es wird von einem bio-psycho-sozialen Krankheitsverständnis ausgegangen und von einem Methodensystem, das sich auf therapeutische, rehabilitative und präventive Aufgaben einstellen kann. Die Methoden sind abhängig von Theorie und Kontext, vor allem bei Indikation, Zielen, Praxeologie, Umgang mit Dynamik der Gruppe und Dyade. Es bedarf eines Settings und einer therapeutischen Beziehung, damit sich die Wirksamkeit der Therapie im Wahrnehmen, Erkennen und Handeln des Patienten entfalten kann. Niemals wirkt dabei nur ein Faktor.
Die gestaltete Musik mit ihren Tönen, Klängen und Geräuschen, mit Rhythmus, Melodie und Harmonie ist zeitstrukturierend. Sie artikuliert menschliches Erleben, hat die Funktion von Ausdruck, von Kommunikation und ist ein subjektiver Bedeutungsträger für verinnerlichte Erfahrungen. Musik wird als präsentatives Symbolsystem verstanden, aber auch unter semiotischen und ästhetischen Aspekten betrachtet.
Die musiktherapeutischen Methoden folgen tiefenpsychologischen, verhaltenstherapeutisch-lerntheoretischen, systemischen, anthroposophischen und ganzheitlich-humanistischen Theoriebildungen und Handlungskonzepten. Gefordert wird auch eine eigene musiktherapeutische Diagnostik, welche Krankheitsbild, Therapieprozess und musikalische Phänomene mit den körperlichen, seelischen und sozialen Vorgängen in Verbindung bringt.
Ein Versuch, die Definitionen verschiedenster Musiktherapien zu kommentieren, wurde im angloamerikanischen Raum von Kenneth Bruscia (1989) unternommen.
Bunt, L. (1998): Musiktherapie. Eine Einführung für psychosoziale und medizinische Berufe. Beltz, Weinheim/Basel
Decker-Voigt, H.-H. (1993): Aus der Seele gespielt. Eine Einführung in die Musiktherapie. Goldmann, München
Timmermann, T. (2004): Tiefenpsychologisch orientierte Musiktherapie. Bausteine für eine Lehre. Reichert, Wiesbaden
2Praxisfelder und Indikation
von Tonius Timmermann und Dorothea Oberegelsbacher
„Die Zukunft der Medizin als Heilkunstliegt in der Reaktivierung der Künste.“(James Hillman)
Musiktherapie hat sich im Laufe der letzten fünf Jahrzehnte zunehmend in einer breiten Skala von Tätigkeitsbereichen etabliert, und zwar dort, wo Klienten oder Patienten zu finden sind, bei denen eine musiktherapeutische Behandlung indiziert ist. Dies ist der Fall, wo psychotherapeutische Behandlung bzw. psychohygienische Begleitung krankheits-, behinderungs-, störungs- oder krisenbedingter körperlich-seelisch-geistiger Zustände und Prozesse am wirkungsvollsten unter Einbezug des Mediums Musik geschehen kann. Hier ein erster Überblick, der Altersstufen und klinische Bereiche unterscheidet:
Überblick Praxisfelder
Babys, Kinder, Jugendliche: Neonatologie, „Schrei-Babys“, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychotherapie.
Psychotherapie und Psychosomatik: die klassischen Indikationen für psychotherapeutische Maßnahmen: neurotische und Essstörungen, Belastungs-, Persönlichkeits- und somatoforme Störungen.
Psychiatrie: große Bandbreite von Erkrankungen und Störungen: verschiedene psychotische Krankheitsbilder wie Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen, affektive Störungen; Suchterkrankungen; zunehmend gerontopsychiatrische Patienten; zunehmend psychotherapeutische Stationen mit Borderline-Störungen.
Menschen mit Behinderung: geistige, körperliche und mehrfache Behinderung.
Neurologische Rehabilitation: z. B. Schädel-Hirn-Traumen, Komata, Aphasien.
Innere Medizin: emotionale Verarbeitung körperlicher Erkrankungen.
Onkologie: Coping, Akuthilfe bei der Krankheitsbewältigung, insbesondere bei schweren, lebensverändernden Krankheiten.
Geriatrie: Betreuung und Behandlung alter Menschen.
Palliativmedizin: moribunde Patienten.
Hospiz: Begleitung beim Sterbeprozess.
Im Bereich Kinder und Jugendliche finden wir zunächst den Einsatz von Musiktherapie bei neugeborenen und frühgeborenen Kindern in der Neonatalogie (Nöcker-Ribaupierre 2003a). In der Altersentwicklung danach anzusetzen ist die musiktherapeutische Arbeit mit sog. „Schrei-Babys“ (Lenz 2001). In der Folge sind alle Formen von Entwicklungs-, Verhaltens- und emotionalen Störungen, alle Krankheitsbilder der Kinder- und Jugendpsychiatrie relevant. Musiktherapie kann ambulant oder in kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen durchgeführt werden. In der psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen spielt die Arbeit mit Medien, wie z. B. Musik oder Malstiften, eine besondere Rolle, da spontanes unbewusstes Ausdrucksverhalten, die Gestaltung von Konflikten und die Suche nach Lösungen hier im Allgemeinen sinnvoller ist als das Reden über Konflikte (s. Füg 1991; Mahns 1997; Haffa-Schmidt et al. 1999; Büchele 2000; Aurora/Seidel 2002). Ein Schwerpunkt liegt auf Nachreifung, beispielsweise bei autistischen Kindern (Schumacher 1994; 2004).
Im Bereich Psychotherapie und Psychosomatik werden im Allgemeinen sprachfähige erwachsene Menschen behandelt, bei denen jedoch die Ursache ihrer Konflikte sehr häufig in frühen, vorsprachlichen Phasen der Persönlichkeitsentwicklung liegt – man spricht daher von frühen Störungen oder Grundstörungen. Die präverbalen Schichten der Persönlichkeit haben also wesentlichen Anteil an der psychischen Erkrankung oder Störung. Deswegen wird Musiktherapie angeboten, um Zugang zu diesen Schichten zu ermöglichen. Nonverbaler musikalischer Ausdruck und Kommunikation ist hierbei Mittel der Wahl, da sie eine erlebnishafte Analogie zu frühen lautmalerischen Dialogen mit der Mutter und das schwingungsmäßige Sicheinstellen i. S. von Sterns (1992) „tuning in“ auf Kommunikationspartner darstellen (s. z. B. Schmölz 1985; Loos 1986; 1996; Gathmann et al. 1990; Schmidt 1999; Kächele et al. 2003). Musiktherapeuten arbeiten in den entsprechenden Kliniken in einem Team aus Ärzten, Psychologen, verschiedensten Therapeuten, Schwestern und Pflegern.
Psychotherapie, Psychosomatik
Aufgrund der großen Bandbreite von Erkrankungen und Störungen werden in der Psychiatrie Patienten auf den verschiedenen Stationen mit unterschiedlichen therapeutischen Konzepten behandelt, auf die der Musiktherapeut sich jeweils einstellen muss. Außer auf den explizit psychotherapeutischen Stationen ist Musiktherapie oft die einzige Form von Psychotherapie (also nicht medikamentöser Therapie), die diese Patienten erhalten. Insofern ist dieser Bereich für die Musiktherapie wichtig und zukunftsträchtig (Willms 1977; Strobel 1985; Baumgartner/Mahns 1986; Strobel/Huppmann 1991; Burghardt 1996; De Backer 1996; Metzner 1997; Storz 2003).
Psychiatrie
Die Arbeit mit geistig, körperlich und mehrfach behinderten Menschen ist eines der ältesten musiktherapeutischen Betätigungsfelder, da diese im Allgemeinen sehr stark auf Musik ansprechen (Koffer-Ullrich 1971; Rett/Wesecky 1975). Gerade im Hinblick darauf, dass Musiktherapie an frühe Interaktion anknüpft, ist sie für die Arbeit in diesem Bereich besonders gut geeignet (Alvin 1988; Becker 2002; Oberegelsbacher 2001, Halmer-Stein 2001; Orff 1985; 1990; Schumacher 1994; Niedecken 2003).
Behinderung
Seit etwa 20 Jahren wird Musiktherapie, und zwar in zunehmendem Maße, in der Neurologischen Rehabilitation eingesetzt. Die speziellen nonverbalen Qualitäten kommen gerade den Patienten zugute, bei denen aufgrund ihrer Hirnverletzung das Sprachzentrum gestört ist (Gadomski/Jochims 1986; Jochims 1990; 2005; Gustorff/Hannich 2000).
Neurorehabilitation
Für die Bereiche Onkologie, Palliation und Hospiz wurde in den letzten Jahren zunehmend das sog. Coping in seiner Bedeutung für ein humanes Gesundheitssystem erkannt. Dabei handelt es sich um ein Angebot seelischer Begleitung bei schweren, lebensverändernden Krankheiten, wie z. B. Krebs (Steidel-Röder 1993; Bossinger/Griessmeier 1994; Verres 1999), und beim Sterbeprozess. Es geht um das Recht auf einen würdigen Tod daheim bei den Angehörigen oder in speziell dafür eingerichteten Häusern, sog. Hospizen. In diesen arbeiten seit einigen Jahren zunehmend MusiktherapeutInnen, da sich künstlerische Medien hier oft besser eignen als klassische verbale Psychotherapie (Munro 1986; Dehm 1997; von Hodenberg 1999; Heinze 2003).
Onkologie, Palliation, Hospiz
Ebenfalls ein eher neuerer Arbeitsbereich für die Musiktherapie ist die Innere Medizin. Auch hier geht es um die emotionale Verarbeitung körperlicher Erkrankungen. Dies soll den Heilungsprozess unterstützen, indem der Patient Kontakt zu seinen gesunden Anteilen (Ressourcen) findet und Blockaden gelöst werden, die dem im Wege stehen (Röhrborn 1992; Decker-Voigt/Escher 1994; Aldridge 1999).
Innere Medizin
Moderne technologische Gesellschaften mit hoher medizinischer Kompetenz bei gleichzeitig geringer Zahl von Neugeburten sind überalternde Gesellschaften. Daher ist die Versorgung, Betreuung und Behandlung alter Menschen in Einrichtungen der Geriatrie eine zentrale Zukunftsaufgabe. Unser Gesundheitssystem hat die ethische Aufgabe, für das Senium einen würdigen Rahmen anzubieten. Musiktherapie kann helfen, Momente von Lebendigkeit und Heiterkeit zu spenden, wo Ermüdung und Depressionen leicht das Leben quälend werden lassen (Bright 1984; Aldridge 2000; Themenheft der Musiktherapeutischen Umschau 1997/2, Nr. 18). Musiktherapie kann darauf eingehen, dass die Erinnerung bei alten Menschen eine zentrale Rolle spielt. Musik und Lieder aus wichtigen Lebensphasen (Muthesius 2003), aber auch eine adäquate Aktivierung durch eigenes Musizieren und achtsame Bewegung wird angeboten. Neben der psychiatrischen Geriatrie geschieht dies in speziellen Institutionen wie Altenheimen oder geriatrischen Rehabilitationskliniken.
Geriatrie
Das Grundrepertoire an musiktherapeutischen Vorgehensweisen (s. Kap. 6 Praxeologie) wird in den verschiedenen Bereichen in jeweils der Situation adäquater modifizierter Form angeboten. Auf bestimmte Angebote muss dabei dann auch verzichtet werden, ohne dass dabei auf die Musiktherapie überhaupt – i. S. einer Kontraindikation – verzichtet werden muss. Bei genauerer, differentialdiagnostischer, Betrachtung werden auch die Möglichkeiten und Grenzen der Musiktherapie im Vergleich zu anderen nicht sprachlichen, zu leiborientierten und zu anderen künstlerischen Therapien deutlich, z. B., wann es für den Patienten in seiner momentanen Verfassung sinnvoller sein kann, in Stille für sich ein Bild zu malen und dabei ein konstantes Objekt zu schaffen (s. Timmermann 2004a, 166 ff.)
Indikation
Die Indikation zu Musiktherapie kann neben den dargestellten Praxisfeldern auch aus einer phänomenologischen Beschreibung von typischen Patienten der Musiktherapie sichtbar werden. Es sind dies:
●Menschen, mit denen sprachliche Kommunikation erschwert oder unmöglich ist, wie etwa Mutisten und Autisten, deren Verbalisierungsfähigkeit reduziert ist oder deren Störungen und Defizite aus der präverbalen Zeit stammen. Personen, die auch Bedarf an Nachreifung und Weckung von Ressourcen haben (Strobel 1990, 334 f.);
●Menschen, die einen erhöhten Bedarf an Ausdruck und Gehörtwerden haben; bei geringer Fähigkeit zu Triebaufschub und erhöhtem Bedarf an Katharsis und Regression; bei fehlender Symbolisierungsfähigkeit, Alexithymie; bei schwerster Ich-Desintegration; in existenziellen Extremsituationen (Oberegelsbacher 1998, 64);
●Menschen, die zu den benachteiligten psychosozialen Randgruppen unseres Gesundheitswesens zählen, weil sie wegen der oben beschriebenen Defizite von der Gesundheitspolitik als nicht therapiefähig eingestuft und damit von Therapie ausgeschlossen werden (Jochims 2001).
Auch die Frage der Kontraindikation von Musiktherapie stellt sich mit zunehmender Spezifität des Verfahrens. Allgemeine Kontraindikationen können sein: fehlende Motivation des Patienten; sehr hoher sekundärer Krankheitsgewinn oder Rentenwunsch; wenn Musiktherapie institutionell dauerhaft als Ersatz für mögliche reale Beziehungen dient oder aus Prestigegründen angeboten wird. Musiktherapie ist beispielsweise nicht indiziert als Kompensationsangebot für strukturelle Mängel in der Gesellschaft oder in ihren Institutionen, wie z. B. Behindertenwerkstätten (Oberegelsbacher 1990, 176). Oft werden auch bestimmte Personengruppen genannt, etwa akute Psychotiker, Berufsmusiker, suizidale Patienten, Suchtpatienten, die Musik wie eine Droge verwenden (Schroeder 2000, 289 f.). Bei vielen dieser Beispiele gilt, dass mit zunehmender Berufserfahrung die nötige Feinabstimmung und Dosierung des musiktherapeutischen Angebotes ein solches durchaus sinnvoll erscheinen lässt.
Kontraindikation
allgemein
Damit kommt die differentielle Kontraindikation in den Blick. Diese gilt viel häufiger als eine umfassende und wird als ein selektiver, maßgeschneiderter Verzicht auf gewisse Angebote unter bestimmten Umständen verstanden.
Kontraindikation
differentiell
In der Neurorehabilitation ist z. B. für einen Komapatienten im künstlichen Tiefschlaf Musiktherapie für jenen Zeitraum tabu, in dem er noch Sedativa erhält. Diese halten ihn in Ruhe, während Musik ihn gleichzeitig aktivieren würde. Das wäre eine gegensätzliche Botschaft (Gustorff/Hannich 2000). In der stationären Psychotherapie ist für eine angespannte Borderline-Patientin eine abendliche letzte Therapiestunde, in der sie kathartisch frei trommelt, zu spät. Sie kann anschließend die Kontrolle über ihren Triebdurchbruch vielleicht nicht mehr wiedergewinnen und riskiert einen Zusammenbruch, selbstdestruktive Handlungen bis hin zum Suizidversuch (Oberegelsbacher 2003, 100). Die vorübergehende emotionale Destabilisierung durch Musiktherapie und Ergotherapie – beide sind nicht so reflexiv wie eine analytische Gesprächstherapie – wurde bei dieser Störung in der Psychotherapieforschung von Löffler-Stastka und Kollegen festgestellt (2003; 2006).
Im interkulturellen Vergleich kann es ebenfalls Kontraindikationen geben. Der Ausdruck von Emotionen, der in einer extravertierten Kultur problemlos zugelassen wird, kann in einer introvertierten mehr Vorbereitung benötigen. Denken wir an die verbale Aufarbeitung nach einer Musikrezeption durch sofortiges Reden über intime eigene Empfindungen. Eine europäische aufdeckende Fragetechnik ist für den asiatischen Kulturkreis ungeeignet, wenn sie nicht abgewandelt wird. Stattdessen kann das Beschreiben von Gemütsbewegungen oder deren instrumentaler Ausdruck über Metaphern, Farben und Naturbilder angebahnt werden, wofür die japanische Kultur eine große Neigung hat (Shiobara 2006).
kulturelle
Kontraindikation
Bradt, J., Dileo, C., Shim, M. (2013): Music Interventions For Preoperative Anxiety. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. Nr. CD006908. John Wiley & Sons, Ltd.
Evers-Grewe, B., Körber, A. (2012): Zum Stand der Leitlinienarbeit der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft (DMtG). In: Musiktherapeutische Umschau 4, 2012, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 363 – 369
Frohne-Hagemann, I., Pleß-Adamczyk, H. (2005): Indikation Musiktherapie bei psychischen Problemen im Kindes- und Jugendalter. Musiktherapeutische Diagnostik und Manual nach ICD-10. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen
Gold, C., Solli, H. P., Krüger, V., Lie, S. A. (2009): Dose–response relationship in music therapy for people with serious mental disorders: Systematic review and meta-analysis. In: Clinical Psychology Review 29, 193 – 2007
Gühne, U., Weinmann, S., Arnold, K., Ay, E.-S., Becker, T., Riedel-Heller, S. (2012): Künstlerische Therapien bei schweren psychischen Störungen. Sind sie wirksam? In: Der Nervenarzt 2012 / 83, 855–860
Hauck, M., Metzner, S., Rohlffs, F., Lorenz, J., Engel, A. K. (2013): The influence of music and music therapy on pain-induced neuronal oscillations measured by magnetencephalography. PAIN (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.pain.2012.12.016
Illner, J., Smetana, M. (Hrsg.) (2011): Wiener Schule der differenziellen klinischen Musiktherapie – Ein Update. Wiener Beiträge zur Musiktherapie, Bd. 9, Praesens, Wien, 47–109
Kraus, W. (Hrsg.) (1998): Die Heilkraft der Musik. C. H. Beck, München
Münzberg, Ch. (Hrsg.) (2010): Musiktherapie in der Psychosomatik. Reichert Verlag, Wiesbaden
Mössler, K., Chen, X., Heldal, T. O., Gold, C. (2011): Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders. In: The Cochrane Library 2011, Issue 12.
Nöcker-Ribaupierre, M. (Hrsg.) (2009): Musiktherapie und Schmerz. Reichert Verlag, Wiesbaden
Rentmeister, U. (Hrsg.) (2006): Lärmende Stille im Kopf. Musiktherapie in der Psychiatrie. Reichert Verlag, Wiesbaden
Schmidt, H. U., Kächele, H. (2009): Musiktherapie in der Psychosomatik. Entwicklung und aktueller Stand. Zeitschrift Psychotherapeut 1/2009
Wigram, T., Nygaard Pedersen, I., Bonde L. (2002): A Comprehensive Guide to Music Therapy. Theory, Clinical Practice, Research and Training. Jessica Kingsley Publishers, London
Zhang, F., Liu, K., An, P., You, C., Teng, L., Liu, Q. (2012): Music therapy for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents. In: The Cochrane Library 2012, Issue 8.
3Forschungsstand Musiktherapie
von Dorothea Oberegelsbacher und Tonius Timmermann
„Die Brille des Forschers steuert seinen Gegenstand,weswegen der Forscher erforscht werden muss.“(Wissenschaftstheorie nach Maturana)
Wenn man an eine musiktherapeutische Wirkung denkt, scheint es zunächst immer um eine musikalische Wirkung zu gehen. Ist das wirklich so? Ist die Musik das Medikament in der Musiktherapie? Sind die Worte das Medikament in einer Gesprächstherapie? Oder was alles wirkt da in hoher Komplexität zusammen?
Unbestritten ist zunächst einmal die Musik als Medium in der Musiktherapie – wie auch immer mit diesem Medium konkret gearbeitet wird (s. Kap. 6 Praxeologie). Auch gibt es in zeitgenössischen Richtungen der Musiktherapie Ansätze, die sich auf spezifische Wirkfaktoren musischer Elemente (z. B. bestimmter Intervalle, Skalen bei bestimmten Beschwerden) bzw. daraus resultierende methodische Systeme begründen, z. B. die Anthroposophische (s. Ruland 1981) und Altorientalische (Tucek 1997) Musiktherapie. Allerdings stehen noch immer kontrollierte Studien aus, die sich der psychischen Wirkung der verwendeten musikalischen Elemente systematisch annehmen. Somit bleiben die postulierten Wirkqualitäten bislang Arbeitshypothesen, die allerdings im jeweiligen Setting auch ohne Objektivierbarkeit durchaus wirksam sind.
Es mag an der Sehnsucht des Menschen nach schmerzfreien Heilungsprozessen liegen, jedenfalls nimmt die Suche nach universellen Wirkfaktoren in der langen Geschichte der musiktherapeutischen Literatur einen relativ breiten Raum ein (s. a. Kap. 16 und Timmermann 1983b). Immer wieder geht es dabei um Grundfragen an das Medium, mit dem therapeutisch umgegangen werden soll: Wie wirkt Musik bzw. ihre Elemente? Gibt es verlässliche Standards oder ist alles beliebig oder nur situationsabhängig?
Spezifischer
Wirkfaktor
Musik?
Die Mehrzahl der heutigen MusiktherapeutInnen stimmt darin überein, dass Verallgemeinerungen bezüglich der Musikwirkung in der alltäglichen Erfahrung nicht bzw. nur sehr begrenzt feststellbar sind. Gleichzeitig will auch moderne Musiktherapie nicht ohne funktionelles Wissen über Musikwirkung im Bereich der Stimulation oder Relaxation auskommen, also beispiels-weise
keine
generalisierte
Wirkung
„ohne den beruhigenden Sechsachteltakt eines Wiegenliedes, ohne ein Metrum in der Frequenz des Ruhepulses, ohne tranceinduzierendes Klanggeschehen, ohne sinnstiftende Melodieverläufe oder auch Textpassagen“ (Oberegelsbacher/Timmermann 1999).
Hegi entwickelt in seinen Büchern (1986; 1998) fünf Wirkungskomponenten der Musiktherapie: Klang, Rhythmus, Melodie, Dynamik und Form (1998, 51 f.). Diese können in musiktherapeutischen Interventionen gezielt eingesetzt werden. Allerdings gilt auch hier, dass die Intention des Therapeuten bezüglich des musikspezifischen Effektes und die tatsächliche Wirkung beim Klienten von vielen weiteren Faktoren abhängen.
Der Beweis einer Objektivierbarkeit von Musikwirkung ist der Musikpsychologie und ihren wissenschaftlichen Metho-den der empirischen Wirkungsforschung bisher nicht gelungen (Gembris 1996). Zu groß ist die Zahl von Variablen, so dass man die Wirkung einer Musik kaum trennen kann von der Wirkung der Umstände, unter denen sie gehört wird (persönliche Erlebnisse mit dieser Musik, Geschmacksfragen, momentane Stimmung, die Beziehung zum Versuchsleiter und den anderen Versuchspersonen, die Atmosphäre der Testsituation usw.). Gleichzeitig erhebt sich aber auch die Frage, inwieweit ein moderner Musiktherapeut überhaupt an einer messbaren Objektivierung von Musikwirkung interessiert ist, wenn es ihm eigentlich um die individuellen Erfahrungen des Klienten geht?
In der tiefenpsychologisch orientierten Musiktherapie geht es jedenfalls nicht um eine „pharmakologische“ oder „mechanistische“ Verwendung von Musik und ihren Elementen. Sie geht aus von der grundlegenden Bedeutung der therapeutischen Beziehung, die hier mit Hilfe der Musik als wesentlichem Faktor mitgestaltet wird. Die Wirkungen der Musik selbst werden innerhalb des Gesamtwirkungsgeschehens unter zwei grundsätzlichen Aspekten betrachtet: dem sich aktuell Ereignenden und diesem biografischen Hintergrund. Die entstehende Beziehungs- und Musikwirklichkeit wird weder als zufällig noch als beliebig betrachtet. Die Musik ist sinnvoll eingebettet in diesen Gesamtzusammenhang der Situation. Insofern ist sie nichts, was von außen hineingetragen wird. Sie repräsentiert die Gebundenheit an das Gegebene und Gewordene ebenso wie den Spiel-Raum im jeweiligen Schicksal. Sie folgt den Gesetzmäßigkeiten der Musik und den Freiheiten der Intuition.
„keine
Musikpharma-kologie“
Die Musiktherapeutin lernt im Rahmen ihrer Ausbildung einerseits den Umgang mit der Musik als künstlerischem Medium, andererseits den Umgang mit seelischen Prozessen, mit ihrer Wahrnehmung, mit Gegenübertragungsphänomenen usw. Die geschulte Intuition führt dann beides zusammen.
Im musiktherapeutischen Beziehungsgeschehen kommen Struktur und Dynamik des Unbewussten in Verbindung mit der persönlichen Geschichte des Klienten zum Ausdruck und können leidstiftende Elemente wandeln. Dies bildet den Hintergrund für das Erleben von Musik, für frei improvisierten, musikalischen Ausdruck und musikalische Interaktion. Von besonderer Bedeutung für die Musiktherapie sind außerdem entwicklungspsychologische Erkenntnisse, insbesondere die Ergebnisse der Säuglingsforschung bezüglich der frühen, präverbalen Interaktion (Stern 1992).
Im therapeutischen Setting konnte dieses Beziehungsgeschehen als zentraler Heilfaktor nachgewiesen werden. Das zentrale Ergebnis der Psychotherapieforschung ist: Nicht die Methode, die angewendet wird, ist das eigentlich Bedeutsame, sondern die Qualität der therapeutischen Beziehung (Czogalik 1988). Das gilt dann natürlich sowohl für verbale Psychotherapie als auch für die Therapien, die mit künstlerischen Medien arbeiten. Im Besonderen ist es allerdings entscheidend für die Wirkung, ob Medium und Methode nicht nur der Persönlichkeit des Therapeuten, sondern auch der des Patienten und seiner Problematik entsprechen, also einer speziellen Indikation gemäß gewählt werden.
Heilfaktor
Beziehung
Nach dieser allgemeinen Einleitung möchten wir im Folgenden einen Überblick über den Stand der Forschung in der Musiktherapie geben. Hier zunächst ein Überblick über die wichtigsten Zentren für musiktherapeutische Forschung im deutschsprachigen Raum:
●Universität Ulm: Aufbau eines musiktherapeutischen Forschungsfeldes seit 1987; von 1988 bis 2008 jährliche, d. h. 1. bis 20. „ulmer werkstatt für musiktherapeutische grundlagenforschung“ (ab 2009 an der Universität Augsburg, s. u.).
●Heidelberg: Deutsches Zentrum für musiktherapeutische Forschung seit 1995; http://www.dzm.fh-heidelberg.de/deutsch/index.htm (31.1.12).
●Deutsches Institut für angewandte Therapieforschung (DIAT e. V.) Heidelberg, http://www.musiktherapie.de/typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif, (31.1.12), www.fh-heidelberg.de.
●Universität Witten-Herdecke: Institut für Musiktherapie, Lehrstuhl für qualitative Forschung. http://www.musictherapyworld.de
●Hochschule für Musik und Theater Hamburg: Institut für Musiktherapie. Promotion zum Dr. mus. www.rrz.uni-hamburg.de
●Forschungsstelle Musik und Gesundheit an der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg. Seit 2009 jährliche „werkstatt für musiktherapeutische forschung augsburg“ Promotion zum Dr. phil. Erstellen einer kompeletten deutschsprachigen Dissertationsliste http://www.musiktherapie.de/typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif, www.philso.uni-augsburg.de, 31.1.12
In Norwegen befasst sich die Forschergruppe rund um Christian Gold (Grieg Academy Music Therapy Research Center, Uni Research, Bergen, Norwegen) mit der Erforschung musiktherapeutischer Wirkweisen (Effektforschung) und Wirkmechanismen (Process-Outcome Forschung). „Wie wirkt Musiktherapie?“ und „Was wirkt in der Musiktherapie?“ sind die zentralen Themen, die überwiegend im Bereich psychischer Erkrankungen erforscht werden.
Als nächstes blicken wir auf ihren situativen Kontext. Die Forschungslandschaft der Musiktherapie ist derzeit in ihren Untersuchungsgegenständen und Methoden sehr heterogen. Die Vielfalt rührt daher, dass
heterogene
Forschungsland-schaft
1.unterschiedliche musiktherapeutische Identitäten existieren;
2.verschiedene Klienten, Patienten und Indikationen zu finden sind;
3.musiktherapeutisches Geschehen an sich einen hohen Grad an Komplexität hat;
4.mehrere wissenschaftliche Forschungstraditionen bestehen;
5.viele abgestufte Forschungsebenen existieren;
6.unterschiedliche Zielrichtungen möglich sind.
Treffen nun diese sechs Dimensionen aufeinander, so gibt es zwischen ihnen nahezu unendliche Kombinationen, aus denen eine mögliche Fragestellung entsteht. Die Fragestellung wird zu einer Untersuchung, einer Studie oder einem Projekt führen. Alle können ihr Gutes haben und Ausdruck von Sehnsucht nach mehr Klarheit sein.
a) Kunst, ihrem kreativen Prozess, ihren Wirkfaktoren, den Gestaltungsmitteln und -formen, Instrumenten, dem gestaltenden Subjekt, dem Kunstprodukt usw.,
b) der Heilkunde, ihren Spezialgebieten, ihren angewandten Heilmitteln, dem Medikamentenmodell, ihren funktionellen Organsystemen, den Orten der Heilung, wie z. B. ambulant oder stationär, usw.,
c) der Psychologie, ihren Spezialgebieten wie etwa den Bereich der Kognition, der Lernprozesse, vor allem aber der Interaktion und Beziehung, der Emotion, der Kommunikation; des Weiteren die zugehörigen Konstrukte und Messinstrumente (Fragebogen und Tests), mehr oder weniger operationalisierte (d. h. planmäßige) Behandlungssysteme.
Dimension „musiktherapeutische Komplexität“: Die Komplexität des musiktherapeutischen Geschehens wurde bereits eingangs aufgezeigt. Wiederholend sei gesagt, dass die Wirkung der Musik, der Einfluss der therapeutischen Beziehung, der Aspekt des aktiven Handelns und das Verhältnis von Verbalsprache und Musiksprache usw. zu bedenken sind. Alles wirkt ineinander und kommt in der therapeutischen Situation nicht isoliert vor. Forschung wird in ihrem Design versuchen, die Mischungsverhältnisse so zu variieren, dass einzelne Wirkgrößen isoliert hervortreten können.
Dimension „Forschungstradition“: Die Forschungstraditionen schließlich sind in unserer abendländisch-mitteleuropäischen Kultur seit jeher zwei (s. a. Kap. 4). Sie stehen gleichberechtigt nebeneinander, obwohl dies einige Forschungs- und Lehrstätten ablehnen.
Musiktherapieforschung hat heute Anteil an beiden Paradigmen, oft auch innerhalb eines Forschungsvorhabens, und benötigt beide für ihre Weiterentwicklung. Sie lehnt sich im Wesentlichen an die Psychotherapieforschung an.
Dimension „Forschungsebene“: Ergänzend zu den Forschungstraditionen wollen auch Forschungsebenen unterschieden werden. Drei hierarchische Ebenen der Musiktherapieforschung unterscheidet bereits 1985 der Niederländer Frans Schalkwijk (zit. n. Oberegelsbacher 1985):
a) Die allgemeine Musiktherapie: Dazu zählen Grundlagenforschung, einzelne Parameter betreffend, Abgrenzungsbemühungen zu verwandten Therapieformen, Erwartungen an die Musiktherapie, Befragungen von Therapeuten, Inhaltsanalysen von Stellenangeboten usw.
b) Die Entwicklung von Methoden: Diese sei in der Psychiatrie am weitesten, in der Geistigbehindertenarbeit am wenigsten entwickelt. Viele Praktiker halten ihre Methoden kaum fest und arbeiten nach impliziten Theorien. Durch systematische Befragung, Beobachtung durch Einwegspiegel oder Fallbeschreibungen durch die Forscherin kann die Methode erforscht werden.
c) Die Prüfung von Methoden: Diese sei in den USA am weitesten fortgeschritten, wobei dort derzeit noch ein vorwiegend lerntheoretischer Hintergrund bestehe. Die Ergebnisforschung („Ist eine Therapie wirksam?“) erfolgt mit psychologischen Messmethoden. Oft ist in dieser Phase der Musiktherapeut gewissermaßen sozial ausgeschaltet. Häufig würden vielen Wissenschaftlern geeignete Messinstrumente und das Wissen um die zentralen Vorgänge in der Musiktherapie fehlen. Ergebnisforschung werde oft zu früh angepeilt, lange bevor eine formulierte Methode vorliege.
„Für Musiktherapieforschung muß als eine erste und notwendige Bedingung die Beteiligung von ausgebildeten MusiktherapeutInnen an den sensiblen Stellen des Forschungsvorganges, v. a. im Planungsstadium, aber auch bei der Durchführung der Therapie und bei der Interpretation gefordert werden.“ (Oberegelsbacher 1993, 86)
Dimension „Forschungsziel“: Die Zielrichtung einer Forschung hat mit der „causa finalis“ (der „Zielursache“, dem letzten „Zweck“) zu tun. Will ich mikroskopisch fein in die Musiktherapie hineinsehen, z. B. durch Mikroanalysen in einer Prozessforschung, oder mit Weitwinkel auf sie blicken, z. B. durch Makro- oder Metaanalysen? Auch die Beweggründe sind hier maßgeblich. Forschung sieht je anders aus, wenn dadurch Finanzierung, ein akademischer Grad, soziale oder berufliche Veränderung, Qualitätsabsicherung oder eine Weiterentwicklung der Disziplin erreicht werden soll. Die Unterschiedlichkeit von Forschungsarbeiten ausgebildeter MusiktherapeutInnen soll an der folgenden kurzen Auswahl von Beispielen deutlich werden.
Eine Einteilung in Stadien der Musiktherapieforschung nimmt Horst Kächele (2001) in
Anlehnung an die Psychotherapieforschung vor:
●Stadium 0: Klinische Fallstudien
●Stadium I: Deskriptive Studien
●Stadium II: Experimentelle Analog-Studien
●Stadium III: Kontrollierte Studien
●Stadium IV: Anwendungs-Beobachtungs- Studien
●Stadium V: Patientenorientierte Studien
Kächele hält fest, dass erst IV und V über die Nützlichkeit entscheiden, dass jedoch derzeit ausschließlich strenge, limitierte, kontrolliert saubere Bedingungen (III) finanziert werden würden.
Die Analyse einer Einzelmusiktherapie mit einem lernbehinderten, verhaltensauffälligen Mädchen präsentiert J. Wimmer-Illner (2000). Diese kombinierte Prozess-Erfolgsstudie wählt ein einzelfallmethodisches Design und Zeitreihenanalysen, die inferenzstatistisch, also quantitativ ausgewertet werden. Zum Einsatz gelangten Teile eines Fragebogens (Marburger Verhaltensliste, MVL), den die Mutter zweimal wöchentlich ausfüllte – insgesamt 50-mal. Auch Videomitschnitte wurden von Experten beurteilt. Die Durchführung der Musiktherapie führte zu einer signifikanten Abnahme unangepasster sozialer Verhaltensweisen. Ebenfalls signifikant waren Korrelationen, die zeigen, dass die Patientin das Medium Musik vor allem kathartisch und kreativ nützen kann und dass die emotionale Übereinstimmung zwischen Patientin und Therapeutin für den Therapieerfolg wichtig sind.
Prozess/Outcome, Einzelfall
Aus der mehrjährigen Einzeltherapie mit dem schwer entwicklungsretardierten autistischen Buben Max entwickelt Karin Schumacher (1998) mittels Videoanalyse auf der Grundlage der Entwicklungstheorie nach Jean Piaget und Daniel Stern ein siebenstufiges System zur Einschätzung von Beziehungsqualitäten (EBQ). Diese reichen von totaler Kontaktlosigkeit (Modus 1) bis gemeinsamer Begegnung im Spiel (Modus 6). Somit liegt ein sehr praxisrelevantes musiktherapeutisch-diagnostisches Instrument zur Feststellung von Veränderungen bei sehr frühen Kommunikationsstörungen vor.
Prozess, Entwicklungs-diagnostikum
Prä-Post/Outcome, Gruppenvergleich
Dieses Beispiel ist der Ausbildungsforschung zuzurechnen. Dorothea Oberegelsbacher (2002) führte eine katamnestische Befragung an 80 Musiktherapiestudenten durch, die berufsbegleitend eine psychodynamische musiktherapeutische Selbsterfahrungsgruppe von 24 Einheiten besucht hatten. Mit Hilfe eines Fragebogens zur Erfassung der Wirkfaktoren von Musiktherapie (WIMU; Danner/Oberegelsbacher 2001) durch Faktorenanalyse wurde untersucht, was von der Musiktherapie in Erinnerung bleibt. Es zeigte sich u. a., dass von den spezifisch musiktherapeutischen Wirkfaktoren vor allem musiktherapeutisches Durcharbeiten von Problemen, Ausdruck, Darstellung und Kommunikation mittels Musik sowie die Wirkung der Musik tragend sind. An unspezifischen Wirkfaktoren waren die wertschätzende Haltung der Therapeutin, die Wichtigkeit der Gruppe an sich und sich dort mit anderen vergleichen zu können am wichtigsten. Es gab Unterschiede bei den Vorqualifikationen der Befragten: Erzieher und und Lehrer haben gegenüber Musikern größere Schwierigkeiten, Gruppe an sich als hilfreich zu erleben. Mit Vorsicht könnte gesagt werden, dass für sie prozessorientierte psychodynamische Gruppenaktivitäten mehr Unsicherheiten und Abwehr auslösen.
Deskriptiv-Katamnestik, Ausbildungs-forschung
Die folgenden Beispiele, dankenswerterweise skizziert von Karin Mössler, zeigen Forschungsergebnisse der bereits erwähnten Gruppe um Christian Gold in Norwegen. Im Rahmen von Cochrane Reviews wurden in den letzten Jahren die Wirkweise von Musiktherapie bei Autismus, Depression und Schizophrenie erforscht. Ergebnisse dieser systematischen Übersichtsarbeiten zeigten, dass Musiktherapie zu signifikanten Verbesserungen sozialer Fähigkeiten bei autistischen Kindern führt (Gold et al. 2006) und depressive Symptomatik signifikant zu reduzieren vermag (Maratos et al. 2008). Letzteres Ergebnis konnte auch innerhalb einer aktuellen Studie gezeigt werden, die zusätzlich zu einer signifikanten Reduktion von depressiver Symptomatik auch eine Verringerung der Angstsymptomatik demonstrierte (Erkkilä et al. 2011).
Effektforschung, Process-Outcome-Forschung
Musiktherapie bei Erwachsenen mit Schizophrenie und schizoformen Störungen bewirkt eine signifikante Verbesserung des allgemeinen Zustandsbildes, der Negativsymptomatik sowie des sozialen Funktionsniveaus. Die qualifizierte Anwendung von musiktherapeutischer Methodik sowie die Anzahl von besuchten Therapieeinheiten scheinen dabei wesentliche Faktoren zu sein, die den Effekt beeinflussen. So wurden signifikante Effekte erst ab einer Stundenanzahl von 20 Einheiten gefunden (Mössler et al. 2011). Dieses Ergebnis stimmt mit jenen Resultaten überein, die Gold et al. (2009) in einer Dosis-Wirkung-Studie fanden. Diese Übersichtsarbeit zeigte, das mittlere Effekte von Musiktherapie auf das allgemeine Zustandsbild, die Negatvisymptomatik und das soziale Funktionsniveau erst ab einer Frequenz von 16 bis 24 besuchten Therapieeinheiten auftreten. Spezifische Wirkfaktoren scheinen in der Musiktherapie eine wesentliche Rolle zu spielen (Danner/Oberegelsbacher, 2001) und Forschung konzentriert sich neuerdings auf die Anwendung musiktherapeutischer Techniken als Outcome-Prädiktoren (Mössler et al. 2011). Gold et al. (2007) fanden in diesem Zusammehang bereits, dass die Vewendung musiktherapiespezifischer Techniken (z. B. freie Improvisation) zu besseren Ergebnissen in der Therapie mit Kindern und Jugendlichen führt, als die Verwendung nicht-spezifischer Techniken (z. B. freies Spiel).
Am Ende dieses Kapitels soll nun ein ausführlicheres Beispiel zeigen, wie ein musiktherapeutisches Forschungsdesign aussehen kann. Dieses Projekt wurde im Rahmen einer der frühen musiktherapeutischen Dissertationen durchgeführt (Timmermann 1999a). Es orientiert sich an bewährten und anerkannten Methoden aus der Psychotherapieforschung.
Die aktive Musiktherapie geht von der Hypothese aus, dass in musikalischem Ausdruck und Interaktionsverhalten Persönlichkeit und Probleme eines Patienten erkennbar und bearbeitbar werden können. Um diese Hypothese zu prüfen, wurde danach gefragt, ob externe Beobachter in der Tat aufgrund von videografierten Ausschnitten aus einer Musiktherapie in der Lage sind, Aussagen über den Patienten zu machen, und inwiefern sich dabei Experten und Laien unterscheiden. Eine zehnstündige einzelmusiktherapeutische Intervention wurde auf Video mitgeschnitten. Der Patient litt unter einer narzisstisch-schizoiden Persönlichkeitsstörung verbunden mit einer Fesselsymptomatik. Die bisherigen Therapien waren geprägt durch eine kontrollierende Beziehungsregulation, die sich auch in der Musiktherapie wiederholte. Indem der Patient die musikalische Beziehung abbrach, sobald der Therapeut etwas lauter, schneller oder sonstwie dynamischer spielte, erzeugte er in diesem sukzessiv das Gefühl, „gefesselt“ zu sein, und reinszenierte damit seine eigene Kindheitssituation.
Prozess, Methodenforschung
Der Therapeut verfasste nach jeder Sitzung ein „Affektives Spontan-Protokoll”, später ein ausführliches Protokoll anhand der Videoaufzeichnung sowie Protokolle von den Konsultationen mit einer Kollegin. Aus dem gesamten Videomaterial wurden zunächst alle musikalischen Dialoge herausgeschnitten und codiert. Sodann wählten drei Musiktherapeuten zunächst unabhängig voneinander intuitiv Szenen aus, die sie für klinisch relevant hielten, d. h. die Pathologie des Patienten spiegelten oder Veränderungsprozesse zeigten. Gemeinsam einigten sie sich schließlich auf acht Szenen (Länge jeweils ca. 2 Minuten). Diese Szenen wurden dann 20 Musiktherapeuten, zehn Psychotherapeuten und 20 Laien vorgespielt, die zunächst nach jeder Szene standardisierte und freie Fragen zum Patienten und Therapeuten beantworten sollten. Nach Beobachtung aller Szenen sollten sie noch einmal frei Patient und Therapeut beurteilen.
Die Auswertung der standardisierten Fragen erfolgte durch eine zweifaktorielle Varianzanalyse. Die freien Äußerungen wurden als Inhaltsanalyse, qualitativ, heuristisch und in Form von Kategorien ausgewertet. Die Hypothesen über den Patienten aufgrund der hinlänglich bekannten Pathologie („Hypothesen-Kategorien”) wurden verglichen mit den „Rater-Kategorien”, die sich aus den freien Äußerungen bilden ließen. Der Patient und seine Problematik wurde von den Ratern insgesamt überzeugend erkannt und beschrieben, obwohl sie außer den zusammen etwa 16 Minuten musikalischen Dialogen mit dem Musiktherapeuten keinerlei Informationen über ihn erhielten. Auch die inneren Konflikte des Therapeuten angesichts des Patienten spiegeln sich in den Ergebnissen. Die drei Gruppen urteilen sehr übereinstimmend; der Signifikanz-Test weist keine signifikanten Unterschiede auf. Sie differieren jedoch tendenziell dahingehend, dass die Psychotherapeuten am stärksten die Pathologie des Patienten wahrnehmen, während die Laien diesen am positivsten beurteilen. Die Musiktherapeuten liegen zwischen den beiden Gruppen: Sie sehen mehr Pathologisches als die Laien und mehr Gesundes als die Psychotherapeuten.
Diese Forschungsarbeit zeigt anhand eines praktischen Beispiels, dass und wie im musikalischen Ausdrucks- und Interaktionsverhalten die Persönlichkeit und die pathologischen Strukturen eines Patienten erkennbar und bearbeitbar werden. Sie hat damit einerseits Relevanz für den Nachweis dessen, was in der Musiktherapie geschieht, und zeigt den musiktherapeutisch Arbeitenden bzw. Studierenden, wie dies genau geschieht.
Argstetter, H., Hillecke, T., Bradt, J., Dileo, C. (2007): Der Stand der Wirksamkeitsforschung – Ein systematisches Review musiktherapeutischer Meta-Analysen. In: Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin 28 (1), 39–61
Gold, C. (2009): Systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse. In: Musiktherapeutische Umschau 30 (1), 65–68
Kächele, H. (2003): Qualitätssicherung in der ambulanten Musiktherapie – noch einmal … Musiktherapeutische Umschau 24, 5–9
Mössler, K., Fuchs, K., Heldal, T. O., Karterud, I. M., Kenner, J., Næsheim, S., Gold, C. (2011): The clinical application and relevance of resource-oriented principles in music therapy with psychiatric clients. Accepted for publication British Journal of Music Therapy
Petersen, P. (Hrsg.) (2003): Forschungsmethoden Künstlerischer Therapien. Grundlagen – Projekte – Vorschläge. Mayer, Berlin
Smeijsters, H., Rogers, P. (1993): European Music Therapy Research Register. Vol I: Werkgroep Onderzoek Muziektherapie NVKT
Smeijsters, H., Rogers, P., Kortegaard, H.-M., Lehtonen, K., Scanlon, P. (1995): European Music Therapy Research Register. Vol II: Stichting Muziektherapie, Castricum
Wosch, T., Wigram, T (2007): Microanalysis in Music Therapy: Methods, Techniques and Applications für Clinicians, Resesrchers, Educators an Students. Jessica Kingsley Publishers, London/Phildelphia
4Forschungsstand Musikmedizin und Musikpsychologie oder:„Das Gehirn hört mehr als die Ohren“
von Hans-Helmut Decker-Voigt
Daran erkenn ich den gelehrten Herrn,Was ihr nicht tastet, steht euch meilenfern,Was ihr nicht fasst, das fehlt euch ganz und gar,Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr,Was ihr nicht wägt, hat für euch kein Gewicht,Was ihr nicht münzt, das, meint ihr, gelte nicht.(Johann Wolfgang von Goethes Mephisto, Urfaust,1. Akt; dieses Kapitel beschreibt Gelehrsamkeit,die nicht so orthodox-dogmatisch denkt und handelt …)
Musikmedizin und Musikpsychologie sind zwei der Musiktherapie zugehörige Entitäten innerhalb jenes Zeitkontinuums frühesten Einsatzes von Musik in Heilungsritualen bis zur Gegenwart, in der sich Musiktherapie als Gesundheitswissenschaft profiliert – vor dem Hintergrund der „überlebenswichtigen Rolle, die Musik durch die Entwicklungsgeschichte des Menschen, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hindurch spielt“ (Spintge 2000, 406).
Definitionen Musikmedizin:
Eine kurze: Musikmedizin ist die Einbeziehung von Musik in die schulmedizinische Behandlungskonzeption.
Eine umfassende: „Musikmedizin ist […] die präventive, therapeutische und rehabilitative Anwendung musikalischer Reize im Gesundheitswesen, mit der Absicht, übliche medizinische Verfahren zu komplementieren, wobei die spezifische, drohende oder tatsächlich gegebene Gesundheitsstörung und deren medizinische Behandlung individuell berücksichtigt wird.“ (Spintge 2001, 8)
Definition Musikpsychologie:
„Musikpsychologie ist die Wissenschaft der Wahrnehmung von Musik, der Herstellung und Reproduktion von Musik und der Wirkungen von Musik.“ (Bruhn 1996, 241)
Musikpsychologie und Musikmedizin (Spintge nutzt die Schreibweise „MusikMedizin“) sind mit musiktherapeutischer Praxis und Forschung interdependent verbunden, d. h. sie arbeiten in einem Verhältnis wechselseitiger Bedingung und Abhängigkeit voneinander. So wie jede denkbare musiktherapeutische Fragestellung (aktuell-spezifisches Beispiel: Musiktherapeutische Begleitung von sexuell missbrauchten Kindern unter Einbeziehung von Aspekten der Psychotraumatologie) im heutigen Forschungsstand ein interdisziplinäres Arbeiten erfordert, reflektieren auch Musikmedizin und Musikpsychologie als „Nahverwandte“ der Musiktherapie ihre Forschungsthemen durch deren Einbettung in ein Netzwerk benachbarter Disziplinen.
Spintge sieht die wissenschaftliche Evaluierung von Musikmedizin „insbesondere mittels medizinischer, musiktherapeutischer, physiologischer, psychologischer und mathematisch-physikalischer Forschung“ (2000, 396). Damit definiert er auch namens der Ärzte, die Musik in die schulmedizinische Behandlung integrieren, als Teil eines komplexen Wissensnetzwerkes über die Grenzen der Schulmedizin hinaus. Der Zusammenschluss musikmedizinisch arbeitender Ärzte ist die weltweit arbeitende Forschungsgemeinschaft der „International Society for Music in Medicine“ – ISMM.
internationale
Musikmedizin
Interdisziplinäre Fachkomplexe im Wissensnetzwerk
Netzwerkdenken gilt bei jeder spezifisch musikmedizinischen Fragestellung. Ein spezifisches Beispiel: Einfluss musikalischer Rezeption auf das Schmerzempfinden des chronischen Schmerzpatienten. Eine solche Fragestellung wird musikmedizinisch nur im o. g. interdisziplinären Netzwerk bearbeitet werden können.
Netzwerke und
Interdisziplinarität
Dasselbe in der Musikpsychologie. Diese wird von Bruhn und Kollegen (1993) als Teilbereich der Systematischen Musikwissenschaft gesehen, jedoch auch in Interdependenz zu folgenden Fächern gesetzt: Sozial- und Kulturpsychologie, Wirtschafts- und Medienwissenschaften, Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie, Pädagogik, Medizin und Psychotherapie, Psychoakustik und Neuropsychologie sowie Psychophysik. Jeder musikpsychologischen Fragestellung wird sich also ebenfalls nur von dem o. g. Netzwerk interdisziplinärer Perspektiven aus genähert werden können. Ein solch spezifisches Beispiel: Wie ist der Einfluss der Musikberieselung im Supermarkt auf das Konsumverhalten des Kunden?
Apropos „Verwandtschaften“ unter den Fächern, in die Musiktherapie eingebunden ist: Wie in der menschlichen Genealogie trennen sich auch früher näher Verwandte durch die Ausformung eigener Profile im Zeitablauf der Generationsfolge von Fächern. So war Musiktherapie noch in den 70ern des 20. Jh. von der Musikpsychologin Helga de la Motte definiert worden als „Angewandte Musikpsychologie“ – zeitgleich also zu den häufigsten Definitionen durch Mediziner, wie z. B. Harm Willms. Diese sahen die Musiktherapie als Heilhilfsmaßnahme, als „Adjuvans“ der Schulmedizin, was sie medizingeschichtlich in den letzten 200 Jahren auch war.
Forschungsmethodische Unterschiede
So weit die Gemeinsamkeiten. Die Abgrenzungen zueinander und zur Musiktherapie beginnen in der Forschungsmethodik und ihrer Instrumente. Die bis heute wirkenden Unterscheidungen begründeten sich im neuen Wissenschaftsverständnis im Zuge des Aufklärungszeitalters mit seinem Höhepunkt in der zweiten Hälfte des 18. Jh. Die bis dahin ganzheitlichere Sicht auf den Patienten (die psychologische, soziale u. a. Perspektiven einbeziehende Sicht des Medicus) wurde jetzt mehr und mehr geprägt vom naturwissenschaftlichen Kausaldenken und -forschen im Blick auf Ursache und (Aus-)Wirkung im Krankheitsgeschehen. (Kausalitätsprinzip vereinfacht: Wenn die und die Symptome beim Patienten zutreffen – dann verdichtet sich diese oder jene Diagnose und erfordert diese oder jene Behandlung …). Medizin wurde von dem amerikanischen Psychoanalytiker und Arzt James Hillman in den 1970er Jahren bis zu Ralph Spintge (2000) als in einer ständigen Reduzierung begriffen: Von der früheren Heilkunst über die Heilkunde bis zur heutigen angewandten Naturwissenschaft und Hochtechnologie. Die heutige Forschungsmethodik im naturwissenschaftlich-(musik)medizinischen Bereich basiert auf
naturwissen-schaftliche
Position
●der Objektivität des therapeutischen Experiments,
●der Reproduzierbarkeit des therapeutischen Erfolgs,
●den Erkenntnisfortschritten über therapeutische Erfolge durch Vergleichsgruppen.
Die Beobachtung des musikmedizinischen Forschungsgegenstandes, die Trias „Mensch (Patient) – Musikwirkung-Krankheitsentwicklung – Krankheitserleben“, wird mit erheblichem mathematisch-statistischen Aufwand begleitet und ausgewertet. Sie bezieht sich letztlich immer auch, wenn nicht zentral, auf die Auswirkung der Musik auf die Soma, auf die Körperantworten des Patienten. Sekundär, aber interdependent wird dabei auch mit der inzwischen ebenfalls in der Musikmedizin als streng individuell gesehen akzeptierten Steuerfunktion der Psyche und des emotionalen Haushaltes auf eben diese Körperantworten. Wegen der Notwendigkeit der Vergleichsgruppenarbeit (Randomisierung), die die Datenmengen nochmals potenziert, werden diese Forschungsmethoden als quantitative Verfahren bezeichnet.
Musikwirkung
auf Körper
Zweifach ist dagegen der Zugang zum Menschen in der musikpsychologischen Forschung, wenn es zentral um das Verstehen seiner seelischen Prozesse geht, wenn es um die Beobachtung seiner Gesundheit/Krankheit, um sein Musikerleben und dessen Einfluss auf Prävention, Therapie und Rehabilitation geht: Zum einen sind dann qualitative, hermeneutische Methoden angesagt, weil Diagnose und Indikation nicht immer vor der Entscheidung zur Forschungsperspektive stehen (wie in der Musikmedizin). Sie werden oft erst während des therapeutischen Prozesses deutlich. Vergleich und Kontrolle sind außerhalb des naturwissenschaftlichen Kausaldenkens in der psychologisierenden „qualitativen Forschung“ auch möglich, aber jeweils innerhalb der individuell verlaufenden Therapieprozesse. Zum anderen erfordert eine musikpsychologische Fragestellung nach der Häufigkeit des Musikhörens in bestimmten Patientengruppen bzw. überhaupt soziologisch erfassten Gruppensystemen wiederum quantitativ gestützte Auswertung empirischer Methoden (wie in der Musikmedizin). Insgesamt arbeitet Musikpsychologie der musiktherapeutischen und musikmedizinischen Behandlungsbereiche zu, sie behandelt und begleitet und untersucht Patienten nicht selbst.
Musikwirkung
auf Erleben
In der westeuropäischen Szene künstlerischer Therapien und damit der Musiktherapie, auch wenn sie in musikmedizinische und musikpsychologische Zusammenhänge eingebunden ist, gilt,
Musikwirkung im
therapeutischen Prozess
●dass jeder Therapieverlauf nur mit sich selbst vergleichbar ist,
●dass statt Reproduzierbarkeit die „dialogische Erinnerung“ besteht (gestützt durch Supervision, Intervision usw.),
●dass nicht der therapeutische Erfolg i. S. der Symptombeseitigung der Forschungsgegenstand ist, sondern der therapeutische Prozess, dessen Erfolgsbeurteilung in wissenschaft-lichen Beschreibungsverfahren tiefenpsychologisch-psychoanalytisch-morphologischer Art stattfindet (Petersen 1990).
quantitativ vs.
qualitativ
Die Unterscheidung in die später quantitativ genannte Forschung der Naturwissenschaften (einschl. Medizin) versus der qualitativen Forschung der psychologisierenden Fächer (von der frühen Psychoanalyse bis zur heutigen Musiktherapie) begann die Wissenschaftswelt in naturwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche und (seit Mitte des 20. Jh.) sozialwissenschaftliche Bereiche zu differenzieren, teilweise schmerzhaft zu trennen und zu spalten durch die jeweiligen Ansprüche und Durchsetzungen vermeintlich „wahrer Wissenschaft“.
Des Wissenschaftsphilosophen Gadamers Erkenntnis, dass es keinen wirklich sicheren Zusammenhang zwischen Forschungsmethode und der „Wahrheit von Erkenntnissen“ gibt (1965), hat sich auch dadurch weich etabliert, dass die quantitativen Forschungsansätze (der Naturwissenschaften, hier: Musikmedizin) und die qualitativen Methoden (der Psychologie, hier: Musikpsychologie) heute einander nicht mehr einander widersprechend gegenüberstehen, sondern in gemeinsamen Forschungsthemen einander ergänzen. Beispiel Musikpsychologie:
„Die Frage nach der Häufigkeit des Musikhörens in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen [eine musikpsychologische Frage, Anm. d. Verf.] erfordert die Anwendung quantifizierender Verfahren und statistischer Auswertungsmethoden, während die Frage nach den Gründen für diese Hörgewohnheiten mit diesen Verfahren wiederum nicht zu ermitteln ist.“ (Tüpker 1996, 103)
Solche u. ä. komplexen Fragestellungen der Forschung werden in der Musikpsychologie ebenso inzwischen mit sowohl quantitativen als auch qualitativen Methoden angegangen wie entsprechende wichtige Fragestellungen der Forschung in der Musikmedizin und Musiktherapie.
Aktuelle Situation
David Aldridge stellt in einem Symposium über Grundlagenforschung fest: „Vor mindestens 10 Jahren haben forschende Musiktherapeuten weltweit den Unsinn einer solchen Trennung [von qualitativen und quantitativen Verfahren, Anm. d. Verf.] bereits erkannt“ (2005, 151). Er betont zwar die Notwendigkeit quantitativ klinischer Studien in der Musiktherapie (mit Forschungsinstrumenten der Schulmedizin und der klinischen Psychologie, Anm. des Verf.), um den Forderungen der evidenzorientierten Medizin und damit im Gesundheitswesen zu genügen, bedauert gleichzeitig aber die Vernachlässigung qualitativer Forschung.
quantitativ
und qualitativ
Der heutige Forschungsstand der Musiktherapie-Nachbarn Musikmedizin und Musikpsychologie stellt sich aktuell wie folgt dar: Musikpsychologieforschung, per se der Erforschung der Musikwahrnehmung verpflichtet, hat mit ihrer bisher überwiegenden Methodik empirisch ausgerichteter Wirkungsforschung keine Objektivierbarkeit erreicht.
Anders die Musikmedizin. Sie erreichte mit Computertomografie, Kernspintomografie und vor allem der Magnetresonanztomografie und anderen bildgebenden Verfahren Quantensprünge in ihrer Forschung und arbeitet – neben den musikmedizineigenen Zielen der kausalitätsorientierten Musikmedizin – der Musiktherapieforschung zu. Herausragend erscheint in der musikmedizinischen Forschung das „missing-link-concept“ (Spintge 2000) der Rhythmizität als Brücke zwischen Musik einerseits und Physiologie und Medizin andererseits. Dahinter stand die (erfolgreiche) Suche der Musikmedizin nach biologischen Zeitstrukturen im menschlichen Organismus. Sie entsprechen musikalischen Zeitstrukturen, welche wiederum als Resonanzadresse fungieren.
„missing-link-concept“
Rhythmizität