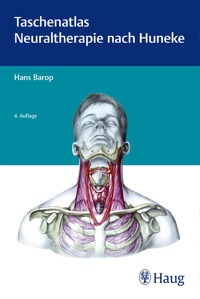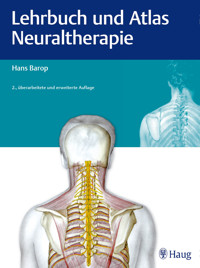
179,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haug Fachbuch
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Lehrbuch und Atlas zur Neuraltherapie: theoretische Grundlagen, sicher nachvollziehbare technische Instruktionen und klare therapeutische Anleitungen - großflächige Abbildungen "Anatomie in vivo" mit eingezeichneten tieferen Strukturen Neu in der 2. Auflage: komplett überarbeitet und um neue Erkenntnisse aus der neurovegetativen Anatomie und Physiologie erweitert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Lehrbuch und Atlas Neuraltherapie
Hans Barop
2., überarbeitete und erweiterte Auflage
175 Abbildungen
Widmung
Den Brüdern Ferdinand und Walter Huneke und allen nachfolgenden Ärztinnen und Ärzten in Dankbarkeit für die Entwicklung der Neuraltherapie als umfassende neue Behandlungsmethode zum Wohle der Patienten gewidmet.
Vorwort zur 2. Auflage
Die ersten Beobachtungen der „Nebenwirkungen“ der Lokalanästhetika beginnen in der gleichen Zeit, in der sich die Lokalanästhesie zu operativen Zwecken entwickelte. Wie so häufig in der angewandten Medizin entstand aus aufmerksamer und detaillierter Beobachtung schließlich ein neues Therapiekonzept mit einem sehr breiten Anwendungsbereich. Es ist der konsequenten Arbeit der Ärzte und Brüder Ferdinand und Walter Huneke zu verdanken, dass diese zunächst auf Einzelbeobachtungen beruhende Behandlungsmethode mit Lokalanästhetika entstehen und durch vielfältige Anwendung verbreitet werden konnte.
Peter Dosch veröffentliche 1963 das erste umfassende Lehrbuch für Neuraltherapie, indem er die über 60-jährigen Erfahrungen der therapeutischen Anwendungsmöglichkeiten von Lokalanästhetika zusammenfasste und damit für die Lehre verfügbar machte. Weitere wichtige Träger der Verbreitung der Neuraltherapie sind die zahllosen Ärzte, die zum Teil auch schon vor Huneke durch ihre Beobachtungen bei der Anwendung von Lokalanästhetika zur Therapie die Richtigkeit der ersten Erfahrungen bestätigten und damit der Methode zur Stabilisierung und zu ihrem weiteren Ausbau verhalfen.
Vor 20 Jahren entstand die 1. Auflage meines Lehrbuchs „Lehrbuch und Atlas Neuraltherapie nach Huneke“. Als Grundlage diente zum einen die enorme Vielfalt an therapeutischen Erfahrungswerten, veröffentlicht über Jahrzehnte von Neuraltherapeuten als reproduzierbare „Erfahrungsmedizin“, zum anderen wurden die medizinischen Kenntnisse der neuroanatomischen und neurophysiologischen Grundlagen des vegetativen Nervensystems als wissenschaftliche Basis der Neuraltherapie benutzt.
Die wissenschaftlichen Fakten über die Neuroanatomie und Neurophysiologie des vegetativen Nervensystems haben sich in der Zwischenzeit erheblich erweitert. In zahlreichen Untersuchungen und Studien konnte eine wesentliche Beteiligung dieses Systems an der Pathogenese verschiedener Erkrankungen (z. B. Entzündung, Schmerz, Degeneration) gezeigt werden. Viele in den letzten 20 Jahren international veröffentlichte anatomische und neurophysiologische Lehrbücher und Einzelarbeiten zeigen immer detaillierter das Zusammenwirken vegetativer Fehlfunktionen bei zahlreichen Erkrankungen. Hierbei steht die Regulation der Mikrozirkulation und gleichzeitiger Organ- und Gewebefunktion durch das vegetative Nervensystem im Vordergrund. Parallel dazu hat eine intensive Suche nach Möglichkeiten begonnen, um diese Erkenntnisse therapeutisch umzusetzen. Die aktuellen Überlegungen deuten vornehmlich in Richtung medikamentöser Therapieverfahren.
Die wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Neuraltherapie haben sich mit diesen stark angewachsenen Kenntnissen über das Neurovegetativum gefestigt. Die inzwischen ebenfalls erweiterten Erfahrungen in der praktischen Anwendung der Neuraltherapie, die allmähliche Übernahme einiger Anteile der Methode in verschiedenen Fachbereichen der Medizin sowie die Einführung der Neuraltherapie als Lehrfach für Medizinstudenten an einigen Universitäten weisen auf eine zunehmende Integration der Neuraltherapie als eigenständiges Behandlungsverfahren hin.
Dieses Buch kann dem Studenten die Möglichkeit geben, die Grundlagen der Neuraltherapie kennenzulernen und vor allem zusammenfassend den Einfluss des vegetativen Nervensystems auf zahlreiche Erkrankungen zu verdeutlichen. Dem bereits ausgebildeten Arzt soll dieses Lehrbuch zusammen mit einer praxisorientierten 2-jährigen Ausbildung als Erweiterung seiner therapeutischen Möglichkeiten in der Praxis dienen, unabhängig von seiner fachärztlichen Ausbildung.
Die Neuraltherapie bietet die Möglichkeit, die noch offene Frage der therapeutischen Umsetzung pathogenetischer Zusammenhänge unterschiedlicher Erkrankungen, bedingt durch Fehlfunktionen des vegetativen Nervensystems, speziell des Sympathikus, zu beantworten. Hierzu stehen die Jahrzehnte langen Erfahrungen der pragmatischen Neuraltherapie zur Verfügung. Im aufmerksamen und kritischen Aufeinanderzugehen hat einerseits die universitäre Medizin ein erprobtes Therapiekonzept als wertvollen und zuverlässigen Erfahrungswert zur Verfügung, die eine weitere Suche nach z. B. das Vegetativum beeinflussenden Medikamenten erübrigt, wie andererseits die Neuraltherapie ihre theoretischen Grundlagen aus den umfassenden universitären Erkenntnissen dankbar erweitert und bestätigt sieht.
Die 2. Auflage „Lehrbuch und Atlas Neuraltherapie“ wurde um die zunehmenden Erkenntnisse der neurovegetativen Anatomie und Physiologie erweitert. Sowohl die anatomischen Details der vegetativen Endformation sind durch moderne Darstellungsverfahren wie die Immunhistochemie und Tracertechniken in der Elektronenmikroskopie klarer geworden als auch gleichzeitig die Kenntnis um die Vielfalt der Überträgersubstanzen zugenommen hat mit dem Ergebnis, dass die gegenseitigen Abhängigkeiten von Reiz und Reizantwort, den physiologischen und pathologischen Vorgängen, die über das vegetative Nervensystem unter gleichzeitiger Rückkopplung ablaufen, in der Ätiologie und der Pathogenese von Erkrankungen klarer geworden sind. Dadurch bestätigen sich nicht nur die Beobachtungen Rickers, die er in der Relationspathologie zusammenfasste, sondern verdeutlichen auch die logische therapeutische Konsequenz, die sich in der Neuraltherapie konzeptionell wiederfindet.
Die Entstehung der 2. Auflage wurde u. a. möglich durch die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch zwischen Neuraltherapeuten und den universitären Instituten der Anatomie und Neurophysiologie. Die Erfahrungswerte, die aus der Behandlung von Patienten resultieren, konnten im kontinuierlichen Gespräch mit der universitären Medizin auf eine umfassende wissenschaftliche Basis gestellt werden, die beiden Seiten, Neuraltherapeuten wie Wissenschaftlern, klarere Vorstellungen über die Funktion des vegetativen Nervensystems, seines Einflusses auf den Organismus sowie die therapeutische Nutzbarkeit vermitteln.
Mein besonderer Dank gilt Prof. J. Giebel und Prof. T. Koppe vom Anatomischen Institut der Universität Greifswald für die kontinuierliche Beratung und Diskussion über die Anatomie des Neurovegetativums im Präpariersaal sowie die literarischen Empfehlungen. Prof. L. Fischer, Dozent und Lehrstuhlinhaber für Neuraltherapie an der Universität Bern, Autor des in der 4. Auflage veröffentlichten Lehrbuchs „Neuraltherapie, Neurophysiologie, Injektionstechnik und Therapievorschläge“, der weiterhin viele Arbeiten über die Wissenschaftlichkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Neuraltherapie veröffentlichte, danke ich für die zahllosen detaillierten Gespräche und Diskussionen über die Beobachtungen in der Neuraltherapiepraxis im Verbund mit den wissenschaftlichen Grundlagen. Weiterhin geht mein herzlicher Dank an Frau Dr. S. Resch, Neuraltherapeutin und Oberärztin an der Kopfschmerzklinik Königstein, für ihre detaillierte Hilfe bei der Revision und Korrektur des Buchtexts. Frau Silvia Mensing vom Haug Verlag danke ich für ihre jederzeit freundliche Betreuung und Beratung bei der Entstehung der 2. Auflage des Lehrbuchs.
Nicht zuletzt geht mein Dank an die Patienten, die mir jeder für sich als Einzelfall den Hauptanteil der Erfahrungswerte gaben, aus denen die Praxis der Neuraltherapie in Abgleichung mit den wissenschaftlichen Grundlagen erst möglich wurde.
Hamburg, im Sommer 2014
Hans Barop
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort zur 2. Auflage
Teil I Geschichte und Theorie
1 Geschichte der Lokalanästhesie und der Neuraltherapie
1.1 Einleitung
1.2 Schmerzausschaltung und Schmerzbehandlung
1.2.1 Lokalanästhesie
1.2.2 Neuraltherapie
2 Theoretische Grundlagen und praxisorientierte Hypothesen
2.1 Einleitung
2.2 Vegetatives Nervensystem
2.2.1 Anatomie und Funktion
2.2.2 Sympathische Efferenz
2.2.3 Sympathische Afferenz
2.2.4 Parasympathische Efferenz
2.2.5 Parasympathische Afferenz
2.2.6 Afferenz des N. phrenicus
3 Grundregulationssystem nach Pischinger und Heine
3.1 Einleitung
3.2 Struktur und Funktion
3.3 Bedeutung der vegetativen Endformation
3.4 Grundregulationssystem und Neurovegetativum
3.5 Zusammenfassung
4 Die Relationspathologie Rickers
4.1 Einleitung
4.2 Grundlagen der Experimente, Reiz und Reizungsfolgen
4.2.1 Sympathikus im Experiment
4.2.2 Besonderheiten des Sympathikus
4.2.3 Medikamentöse Reizunterbrechung
4.2.4 Reaktion des Gefäßsystems
4.2.5 Verhalten des Blutes und seiner Bestandteile
4.2.6 Folge der pathologischen Sympathikusreizung
4.2.7 Die Auswirkung auf das spezifische Gewebe
4.3 Stufengesetze
4.4 Relationspathologie und Neuraltherapie
5 Vegetatives Nervensystem unter funktionellen Aspekten
5.1 Einleitung
5.2 Reaktion und Funktion des Sympathikus
5.3 Therapeutische Nutzung des Sympathikus
6 Begriff des Segments in der Neuraltherapie
6.1 Definition
6.2 Therapeutische Konsequenzen
7 Theorie und Grundlagen des Störfelds
7.1 Einleitung
7.1.1 Reiz und Sympathikus
7.1.2 Ursachen der chronischen Reizung
7.1.3 Reizunterbrechung – Störfeldausschaltung
7.2 Pathogenese des Störfelds
7.2.1 Zeitliche Zusammenhänge
7.2.2 Entstehung eines Störfelds
7.3 Klinischer Beweis des Störfelds
7.4 Störfeld- und Segmenterkrankung
7.4.1 Fließender Übergang
7.5 Kasuistiken und Interpretation
7.6 Neurophysiologische Kriterien des Störfelds
7.7 Zusammenfassung
8 Lokalanästhetikum in der Neuraltherapie
8.1 Einleitung
8.2 Lokalanästhetikum als Neuraltherapeutikum
8.2.1 Procain zur Neuraltherapie
8.2.2 Vergleich Procain – Lidocain
8.2.3 Wirkungen des Procains
8.3 Zusammenfassung
Teil II Praxis der Neuraltherapie
9 Klinische Untersuchung
9.1 Neuraltherapeutische Anamnese
9.2 Inspektion
9.2.1 Haut
9.2.2 Bewegungsapparat
9.2.3 Mundhöhle und Zähne
9.3 Palpation
9.4 Weitere Untersuchungsmöglichkeiten
9.5 Dokumentation
9.6 Neuraltherapeutische Praxiseinrichtung
9.7 Wahl des Neuraltherapeutikums
10 Segmente
10.1 Segmentdiagnostik – Segmenttherapie
10.2 Lungensegment
10.2.1 Diagnostik
10.2.2 Therapie
10.2.3 Zusammenfassung
10.3 Herzsegment
10.3.1 Diagnostik
10.3.2 Therapie
10.3.3 Zusammenfassung
10.4 Leber-Galle-Segment
10.4.1 Diagnostik
10.4.2 Therapie
10.4.3 Zusammenfassung
10.5 Magensegment
10.5.1 Diagnostik
10.5.2 Therapie
10.5.3 Zusammenfassung
10.6 Pankreassegment
10.6.1 Diagnostik
10.6.2 Therapie
10.6.3 Zusammenfassung
10.7 Darmsegment
10.7.1 Diagnostik
10.7.2 Therapie
10.7.3 Zusammenfassung
10.8 Nierensegment
10.8.1 Diagnostik
10.8.2 Therapie
10.8.3 Zusammenfassung
11 Segmentdiagnostik
11.1 Tabellarische Übersicht
12 Störfeld
12.1 Störfelddiagnostik
12.2 Systematik
12.3 Störfeldtherapie
12.4 Grundsätze
12.5 Die häufigsten Störfelder
13 Zahn-Kiefer-Bereich
13.1 Beispiel 1
13.2 Beispiel 2
13.3 Beispiel 3
13.4 Beispiel 4
13.5 Beispiel 5
13.6 Beispiel 6
13.7 Zusammenfassung
14 Neuraltherapeutische Phänomene
14.1 Neuraltherapeutische Phänomene und Reaktionsweisen
14.1.1 Segmentphänomen
14.1.2 Reaktionsphänomen (nach Hopfer)
14.1.3 Retrogrades Phänomen (nach Hopfer)
14.1.4 Sekundenphänomen (Huneke-Phänomen)
14.1.5 Verzögertes Sekundenphänomen
14.1.6 Unvollständiges Sekundenphänomen
14.1.7 „Stummes“ Sekundenphänomen
14.2 Taktisches Vorgehen
14.3 Nebenwirkungen
14.4 Scheitern der Neuraltherapie
14.4.1 Ursachen
14.4.2 Weitere diagnostische und therapeutische Möglichkeiten
Teil III Injektionstechnik und Indikationen
15 Allgemeine Hinweise
15.1 Einleitung
15.2 Lagerung des Patienten
15.3 Desinfektion
15.4 Injektionsvorgang
15.5 Aufklärung
15.6 Komplikationen, Risiken und Fehler
15.7 Dosierung der Lokalanästhetika
15.8 Häufige Injektionen
15.8.1 Die Quaddel
15.8.2 Infiltration von Gelosen
15.8.3 Injektion in muskuläre Triggerpunkte und Muskelinsertionen
15.8.4 Infiltration von Triggerpunkten
15.8.5 Infiltration von Narben
15.8.6 Die intravenöse Injektion
16 Kopf
16.1 Injektion unter die Kopfhaut
16.1.1 Indikationen
16.1.2 Anatomie und Neurophysiologie
16.1.3 Injektionstechnik
16.1.4 Material
16.2 Injektion an die Äste des N. trigeminus
16.2.1 Indikationen
16.2.2 Anatomie und Neurophysiologie
16.2.3 Injektionstechnik
16.2.4 Komplikationen
16.2.5 Material
16.3 Injektion an das Mastoid
16.3.1 Indikationen
16.3.2 Anatomie und Neurophysiologie
16.3.3 Injektionstechnik
16.3.4 Material
16.4 Injektion an A. facialis, A. temporalis superficialis und N. auriculotemporalis (aus dem N. mandibularis/N. trigeminus)
16.4.1 Indikationen
16.4.2 Anatomie und Neurophysiologie
16.4.3 Injektionstechnik
16.4.4 Material
16.5 Injektion an und in die Glandula parotis
16.5.1 Indikationen
16.5.2 Anatomie und Neurophysiologie
16.5.3 Injektionstechnik
16.5.4 Material
16.6 Injektion an das Kiefergelenk
16.6.1 Indikationen
16.6.2 Anatomie und Neurophysiologie
16.6.3 Injektionstechnik
16.6.4 Material
16.7 Injektion an das Ganglion ciliare (retrobulbäre Injektion)
16.7.1 Indikationen
16.7.2 Anatomie und Neurophysiologie
16.7.3 Injektionstechnik
16.7.4 Komplikationen
16.7.5 Material
16.8 Injektion an das Ganglion pterygopalatinum, den N. maxillaris und die A. maxillaris
16.8.1 Indikationen
16.8.2 Anatomie und Neurophysiologie
16.8.3 Injektionstechnik
16.8.4 Komplikationen
16.8.5 Material
16.9 Injektion an das Ganglion oticum und den N. mandibularis
16.9.1 Indikationen
16.9.2 Anatomie und Neurophysiologie
16.9.3 Injektionstechnik (nach Hauberrisser)
16.9.4 Material
16.10 Injektion an N. occipitalis major, die A. occipitalis und den N. occipitalis minor
16.10.1 Indikationen
16.10.2 Anatomie und Neurophysiologie
16.10.3 Injektionstechnik
16.10.4 Material
16.11 Injektion in den Bereich des Lymphabflusses des Gesichtsschädels
16.11.1 Indikationen
16.11.2 Anatomie und Neurophysiologie
16.11.3 Injektionstechnik
16.11.4 Material
16.12 Injektion an die Tonsillen
16.12.1 Indikationen
16.12.2 Anatomie und Neurophysiologie
16.12.3 Injektionstechnik
16.12.4 Material
16.13 Injektion an die Zähne
16.13.1 Indikationen
16.13.2 Anatomie und Neurophysiologie
16.13.3 Injektionstechnik
16.13.4 Material
17 Hals
17.1 Injektion in die Schilddrüse
17.1.1 Indikationen
17.1.2 Anatomie und Neurophysiologie
17.1.3 Injektionstechnik
17.1.4 Material
17.2 Injektion an den N. laryngeus superior
17.2.1 Indikationen
17.2.2 Anatomie und Neurophysiologie
17.2.3 Injektionstechnik
17.2.4 Material
17.3 Injektion an das Ganglion stellatum (Ganglion cervicothoracicum)Injektion an das Ganglion stellatum
17.3.1 Indikationen
17.3.2 Anatomie und Neurophysiologie
17.3.3 Injektionstechnik
17.3.4 Material
17.4 Injektion an das Ganglion cervicale superius
17.4.1 Indikationen
17.4.2 Anatomie und Neurophysiologie
17.4.3 Injektionstechnik
17.4.4 Material
17.5 Injektion an N. accessorius, N. auricularis magnus, N. transversus colli und N. occipitalis minor (Punctum nervosum)
17.5.1 Indikationen
17.5.2 Anatomie und Neurophysiologie
17.5.3 Injektionstechnik
17.5.4 Material
18 Wirbelsäule
18.1 Hinweise zur Diagnostik
18.2 Hinweise zur Therapie
18.3 Injektion an die Halswirbelsäule
18.3.1 Indikationen
18.3.2 Anatomie und Neurophysiologie
18.3.3 Injektionstechnik
18.3.4 Material
18.4 Injektion an die Brustwirbelsäule
18.4.1 Indikationen
18.4.2 Anatomie und Neurophysiologie
18.4.3 Injektionstechnik
18.4.4 Material
18.5 Injektion an die Lendenwirbelsäule
18.5.1 Indikationen
18.5.2 Anatomie und Neurophysiologie
18.5.3 Injektionstechnik
18.5.4 Material
18.6 Injektion an die Spinalwurzeln L1 – S3 (Plexus lumbosacralis)
18.6.1 Einleitung
18.6.2 Injektion an die Spinalwurzeln L1 – L4 (Plexus lumbalis)
18.6.3 Material
18.6.4 Injektion an die Spinalwurzeln L5 – S3 (Plexus sacralis)
18.7 Injektionen im Bereich des Beckens
18.7.1 Indikationen
18.7.2 Anatomie und Neurophysiologie
18.7.3 Injektionstechnik
18.7.4 Material
18.8 Injektion an den lumbalen Grenzstrang
18.8.1 Indikationen
18.8.2 Anatomie und Neurophysiologie
18.8.3 Injektionstechnik
18.8.4 Material
18.9 Injektion in den sakralen und lumbalen Epiduralraum
18.9.1 Indikationen
18.9.2 Anatomie und Neurophysiologie
18.9.3 Injektionstechnik
18.9.4 Material
19 Abdomen, Retroperitoneum
19.1 Injektion an den Nierenhilus und den Plexus renalis
19.1.1 Indikationen
19.1.2 Anatomie und Neurophysiologie
19.1.3 Injektionstechnik
19.1.4 Material
19.2 Injektion an das Ganglion coeliacum und den N. splanchnicus major et minor
19.2.1 Indikationen
19.2.2 Anatomie und Neurophysiologie
19.2.3 Injektionstechnik
19.2.4 Material
19.3 Injektion an die Ausläufer des Plexus hypogastricus inferior (Plexus pelvinus)
19.3.1 Indikationen
19.3.2 Anatomie und Neurophysiologie
19.3.3 Injektionstechnik
19.3.4 Komplikationen
19.3.5 Material
19.4 Injektion an die Ausläufer des Plexus prostaticus, in die Prostata
19.4.1 Indikationen
19.4.2 Anatomie und Neurophysiologie
19.4.3 Injektionstechnik
19.4.4 Komplikationen
19.4.5 Material
20 Gelenke
20.1 Injektion an Schultergelenk und Schultergürtel
20.1.1 Indikationen
20.1.2 Anatomie und Neurophysiologie
20.1.3 Injektionstechnik
20.1.4 Material
20.2 Injektion an das Ellengelenk
20.2.1 Indikationen
20.2.2 Anatomie und Neurophysiologie
20.2.3 Injektionstechnik
20.2.4 Material
20.3 Injektion an das Handgelenk und an die Fingergelenke
20.3.1 Indikationen
20.3.2 Anatomie und Neurophysiologie
20.3.3 Injektionstechnik
20.3.4 Material
20.4 Injektion an das Hüftgelenk
20.4.1 Indikationen
20.4.2 Anatomie und Neurophysiologie
20.4.3 Injektionstechnik
20.4.4 Material
20.5 Injektion an das Kniegelenk
20.5.1 Indikationen
20.5.2 Anatomie und Neurophysiologie
20.5.3 Injektionstechnik
20.5.4 Material
20.6 Injektion an das obere und untere Sprunggelenk, an die Fußwurzel-Mittelfußgelenke und die Zehengelenke
20.6.1 Indikationen
20.6.2 Anatomie und Neurophysiologie
20.6.3 Material
Teil IV Indikationen und Therapie
21 Indikationen und Therapie
21.1 Einleitung
22 Kopf
22.1 Kopfschmerzen
22.1.1 Diagnosen
22.1.2 Therapie
22.2 Neuralgien
22.2.1 Diagnosen
22.2.2 Therapie
22.3 Erkrankungen und Verletzungen des Gehirns
22.3.1 Diagnosen
22.3.2 Therapie
22.4 Augenerkrankungen
22.4.1 Diagnosen
22.4.2 Therapie
22.5 Erkrankungen der Nase und der Nasennebenhöhlen
22.5.1 Diagnosen
22.5.2 Therapie
22.6 Erkrankungen des Ohres und des Gleichgewichtsorgans
22.6.1 Diagnosen
22.6.2 Therapie
22.7 Erkrankungen des Mund- und Rachenraums
22.7.1 Tonsillen und Pharynx
22.7.2 Speicheldrüsen, Mund- und Rachenschleimhaut
22.7.3 Zähne, Zahnhalteapparat und Zahnfleisch
23 Hals
23.1 Erkrankungen und Funktionsstörungen der Schilddrüse
23.1.1 Diagnosen
23.1.2 Therapie
23.2 Erkrankungen und Funktionsstörungen des Kehlkopfs
23.2.1 Diagnosen
23.2.2 Therapie
24 Thorax
24.1 Erkrankungen der Bronchien und der Lunge
24.1.1 Diagnosen
24.1.2 Therapie
24.2 Erkrankungen des Herzens und des mediastinalen Raumes
24.2.1 Diagnosen
24.2.2 Therapie
24.3 Erkrankungen der Brustdrüse
24.3.1 Diagnosen
24.3.2 Therapie
25 Abdomen, kleines Becken, Retroperitoneum
25.1 Erkrankungen des Magens
25.1.1 Diagnosen
25.1.2 Therapie
25.2 Erkrankungen des Dünn- und Dickdarms
25.2.1 Diagnosen
25.2.2 Therapie
25.3 Erkrankungen der Leber und Gallenwege
25.3.1 Diagnosen
25.3.2 Therapie
25.4 Erkrankungen des Pankreas
25.4.1 Diagnosen
25.4.2 Therapie
25.5 Erkrankungen der Nieren und ableitenden Harnwege
25.5.1 Diagnosen
25.5.2 Therapie
25.6 Erkrankungen des inneren Genitale der Frau
25.6.1 Diagnosen
25.6.2 Therapie
25.7 Erkrankungen des inneren und äußeren Genitale des Mannes
25.7.1 Diagnosen
25.7.2 Therapie
26 Wirbelsäule und Becken
26.1 Degenerative und entzündliche Erkrankungen, Verletzungen
26.1.1 Diagnosen
26.1.2 Therapie
27 Extremitäten und Gelenke
27.1 Degenerative Erkrankungen, Entzündungen und Verletzungen
27.1.1 Diagnosen
27.1.2 Therapie
28 Nerven
28.1 Erkrankungen der peripheren Nerven und Hirnnerven
28.1.1 Diagnosen
28.1.2 Therapie
29 Gefäße
29.1 Erkrankungen der arteriellen Gefäße
29.1.1 Diagnosen
29.1.2 Therapie
29.2 Erkrankungen der venösen Gefäße
29.2.1 Diagnosen
29.2.2 Therapie
30 Lymphsystem
30.1 Erkrankungen der Lymphbahnen und Lymphknoten
30.1.1 Diagnosen
30.1.2 Therapie
31 Haut
31.1 Erkrankungen und Verletzungen der Haut und ihrer Anhangsgebilde
31.1.1 Diagnosen
31.1.2 Therapie
32 Tumoren
32.1 Bösartige Erkrankungen
33 Zusammenfassung
Teil V Anhang
34 Literatur
Autorenvorstellung
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum
Teil I Geschichte und Theorie
1 Geschichte der Lokalanästhesie und der Neuraltherapie
2 Theoretische Grundlagen und praxisorientierte Hypothesen
3 Grundregulationssystem nach Pischinger und Heine
4 Die Relationspathologie Rickers
5 Vegetatives Nervensystem unter funktionellen Aspekten
6 Begriff des Segments in der Neuraltherapie
7 Theorie und Grundlagen des Störfelds
8 Lokalanästhetikum in der Neuraltherapie
1 Geschichte der Lokalanästhesie und der Neuraltherapie
1.1 Einleitung
Die Geschichte der Schmerzausschaltung ▶ [274], sei sie prophylaktisch vor einem operativen Eingriff oder therapeutisch zur Behandlung bestehender Schmerzen, nimmt einen vorrangigen Platz in der Medizin ein, ist doch der durch Krankheit oder Verletzungen verursachte Schmerz eines der häufigsten Symptome im medizinischen Alltag. Die Wege einer gezielten Schmerzbehandlung waren bis Ende des 19. Jahrhunderts sehr unterschiedlich. Neben der allgemeinen medikamentösen Form wurden unterschiedliche Verfahren zur lokalen Schmerzverringerung für operative Eingriffe wie die Gewebsquetschung, später Nervenkompression mit Pelotte oder die Lokalanwendung von Kälte zur Schmerzreduktion entwickelt.
Eine völlig neue Form der lokalen Schmerzbehandlung wurde erstmals 1839 von Lundy, Taylor und Washington beschrieben. Sie versuchten mithilfe von Morphinlösungen, die mit Vorstufen der heutigen Injektionsspritze unter die Haut appliziert wurden, eine Schmerzreduktion zu erreichen. Mit der Entwicklung der Spritze durch den Franzosen Pravaz (1843) und der Hohlkanüle durch den Schotten Wood im gleichen Jahr gelang es dann erstmals, durch gezielte Injektionen von Morphinlösungen in schmerzhafte Zonen und an Nerven eine Schmerzlinderung zu erreichen. Die lokale Anästhesie, d. h. die völlige Schmerzfreiheit, war mit Morphinen jedoch nicht erreichbar.
Koller, Ophthalmologe an der Universität Wien, kam 1883 im Rahmen seiner neurologischen Weiterbildung in Kontakt mit Freud▶ [274], ▶ [282]. Dieser besaß Erfahrungen mit Kokain, das er zur Behandlung von Herzkrankheiten und nervösen Erschöpfungszuständen bzw. bei Depressionen einsetzte. Im Eigenversuch stellte Freud neben der analeptischen Kokainwirkung zusätzlich den anästhesierenden Effekt auf die Zunge und die Mundschleimhaut fest und berichtete dem Kollegen hierüber. Koller konnte diese anästhesierende Wirkung im Eigenversuch selbst erleben, vor allem als er an einer schmerzhaften Zahnfleischentzündung litt und auf Anraten von Freud diese mit Kokainlösung bepinselte.
Koller, dem als operativ tätigen Ophthalmologen im Gegensatz zu Freud die schmerzfreie Operation mithilfe von Kokain naheliegend erschien, setzte diese Eigenschaft des Kokains therapeutisch um und führte nach Vorversuchen am Tier am 11. September 1883 die erste Staroperation in Lokalanästhesie durch. Am 17.10.1883 berichtete er erstmals von der erfolgreichen Anwendung von Kokain zur Lokalanästhesie am Auge in einer Sitzung der Ärzte in Wien. Dies war zugleich auch der Startschuss für die Lokalanästhesie in der gesamten operativen Medizin, die sich international daraufhin in atemberaubender Geschwindigkeit entwickelte.
Jetzt erst wurde Freud klar, an welch bahnbrechender Entdeckung er teilgenommen hatte. In einer Mitteilung in Heitlers „Zentralblatt für die gesamte Therapie" hatte er jedoch schon vor Koller über die anästhesierende Wirkung von Kokain berichtet und den Einsatz von Kokain bei örtlichen schmerzhaften Infektionen in Erwägung gezogen. Freud war eher am therapeutischen Einsatz interessiert als an der Möglichkeit einer lokalen Betäubung für operative Eingriffe. So empfahl er dem Ophthalmologen vonKönigstein, die Iritis und das Trachom mit Kokain anzugehen. Er selbst hatte versuchsweise (und erfolglos) mit einer gezielten Kokaininjektion an den N. trigeminus eine Trigeminusneuralgie zu behandeln versucht. Erwähnenswert ist der bereits 1863 in Paris veröffentlichte Bericht des peruanischen Generalarztes Moreno y Maiz über die tierexperimentelle Anästhesie des Ochsenfroschbeins mithilfe einer Kokaininfiltration.
1.2 Schmerzausschaltung und Schmerzbehandlung
1.2.1 Lokalanästhesie
Betrachtet man bis hierher die Anfangsphase der Lokalanästhesie, fallen bereits zu diesem sehr frühen Zeitpunkt 2 unterschiedliche Wege auf, die das neu entdeckte Medikament Kokain gehen sollte:
Die von der gesamten chirurgischen Medizin sehnlichst erwartete gezielte Lokalanästhesie, d. h. die Schmerzausschaltung zu operativen Zwecken.
Die von der Lokalanästhesie leicht verdeckte therapeutische Nutzung des Lokalanästhetikums bei bestehenden Schmerzen, sei es im Rahmen einer Neuralgie oder einer Gewebsentzündung (Freud).
Behält man diese zweigleisige Entwicklung im Auge und lässt sie sich nicht durch die auf den ersten Blick dominante reine Lokalanästhesie zu operativen Zwecken verdecken, gelingt mühelos die Differenzierung von Lokalanästhesie und Neuraltherapie. Dabei bedarf es auch weiterhin der Kenntnis um beide Wege, da die Technik der Lokalanästhesie bei der Durchführung der Neuraltherapie den handwerklichen Rahmen darstellt.
1.2.1.1 Infiltrations-, Leitungs- und Spinalanästhesie
In der raschen Fortentwicklung der Lokalanästhesie zu operativen Zwecken stehen die Namen Halstedt, Hall und Hartley für die Infiltrations- und Leitungsanästhesie, die sie tierexperimentell und später in der Humanchirurgie anwendeten. Dabei traten die ersten wesentlichen Nachteile des Medikaments Kokain zutage: Überdosierungsfolgen und die bei wiederholter Anwendung bestehende Abhängigkeit. Halstedt war durch zahlreiche Eigenversuche kokainabhängig geworden, konnte aber durch eine Entziehungskur geheilt werden; Hall, ebenfalls süchtig geworden, verstarb.
Die zunehmende Erfahrung mit dem Medikament Kokain brachte einerseits erfolgreiche Lokalanästhesien zur Operation, andererseits jedoch traten vermehrt Todesfälle durch Überdosierung auf. Es ist dem Pariser Chirurgen Reclus zu verdanken, dass mit der Korrektur der Dosierung des Kokains die Lokalanästhesie nach anfänglicher Euphorie durch eine Vielzahl iatrogener Todesfälle für die Chirurgie weiterhin bestehen blieb und weiterentwickelt werden konnte. Die von der Oberflächenanästhesie zunächst übernommene 20–30%ige Kokainlösung zeigte bei der Infiltrationsanästhesie gehäuft schwere Intoxikationsfolgen bis hin zum Exitus. Reclus gelang es, mit Verringerung der Konzentration, anfänglich auf 2–3%ige und später auf 0,5%ige Lösungen, sowohl Intoxikationen als auch Todesfälle zu vermeiden.
So entwickelte sich aus der Infiltrationsanästhesie, d. h. der lokalen Betäubung durch lokale Infiltration von Kokain, die Leitungsanästhesie, die selektive Ausschaltung von sensiblen peripheren Nerven. Mit einer weiter zentral ansetzenden Lokalanästhesie entwickelte Bier die Spinalanästhesie, die er am 15. August 1898 erstmalig erfolgreich durchführte. Seine Idee war es, durch die weiter zentral durchgeführte Anästhesie mit geringeren Mengen Kokain eine umfangreichere Anästhesie zu erzeugen als es die reine Leitungsanästhesie vermochte. Dies erreichte er durch intrathekale Injektion im Lumbalbereich mit 3 ml einer 0,5%igen Kokainlösung. Auch über den „postspinalen Kopfschmerz“ konnte Bier nach dem Selbstversuch mit dieser neuen rückenmarksnahen Anästhesie bereits berichten.
Der amerikanische Neurologe Corning hatte schon vor Bier erfolgreich die rückenmarksnahe Anästhesie durchgeführt, jedoch nicht zur Vorbereitung einer operativen Behandlung, sondern zur Therapie bestehender Schmerzen. Inwieweit es sich dabei um echte Spinalanästhesien durch intrathekale Applikation oder epidurale Anästhesien handelte, bleibt ungeklärt.
Soweit zur Geschichte der Lokalanästhesie, die unter den Augen der Öffentlichkeit eine bahnbrechende Entwicklung in der Chirurgie bedeutete. Mit dem Vormarsch der Lokalanästhesie konnte die Anzahl der bis dahin mittels Chloroform und Äther praktizierten Allgemeinnarkosen reduziert und so viele, teilweise tödliche Zwischenfälle der Allgemeinnarkose vermieden werden.
1.2.1.2 Entstehung der Segmenttherapie
Weniger aufregend dagegen verlief die Entwicklung in der therapeutischen Nutzung von Lokalanästhetika, da ihr die auch heute noch in der medizinischen Landschaft bestehende öffentliche Aufmerksamkeit der Chirurgie fehlte. Bei genauerer Betrachtung jedoch stellte sich heraus, dass die Anwendung von Lokalanästhetika zur reinen therapeutischen Nutzung mindestens ebenso viel Brisanz in sich birgt wie die Lokalanästhesie zur operativen Medizin.
In der Aufarbeitung der Geschichte der Neuraltherapie ist es sinnvoll, vorweg einige Hinweise zu geben, um den grundsätzlichen Unterschied zur reinen Lokalanästhesie klarzustellen. Die Namen, die für den Beginn der Neuraltherapie stehen, sind teilweise dieselben, wie für die Entwicklung der Lokalanästhesie, überwiegend Namen von chirurgisch tätigen Ärzten, zu deren Alltag die Injektion von Lokalanästhetika gehörte. Die ersten Beobachtungen, die Hinweise in Richtung Neuraltherapie zeigten, wurden gemacht, als das Lokalanästhetikum nicht zu operativen Eingriffen, sondern bei bereits bestehenden Schmerzen appliziert wurde ▶ [446], ▶ [469], ▶ [470]. Hierbei konnte nun häufig beobachtet werden, dass trotz Abklingen der Lokalanästhesie die vorher bestehende Schmerzsymptomatik geringer war oder sogar vollständig und anhaltend verschwand.
Gehen wir zurück zur 1. Stunde der Lokalanästhesie, als Freud seine ersten Beobachtungen über die Schleimhautanästhesie nach oraler Einnahme von Kokain Koller mitteilte. Freuds folgerichtige, eher intuitive Entscheidung zur Anwendung eines Lokalanästhetikums zur Therapie und nicht zur Anästhesie sollte sich im Schatten der galoppierenden Entwicklung der Lokalanästhesie in der Chirurgie als richtig erweisen. In derselben Zeit, in der der französische Chirurg Reclus über die Reduktion der Kokainkonzentration letztendlich verhinderte, dass die Lokalanästhesie wegen der sich häufenden toxischen Komplikationen in Verruf geriet, entwickelte Schleich in Deutschland zur gleichen Zeit die „verfeinerte Lokalanästhesie“, ebenfalls durch Verringerung der Kokainkonzentration, gezieltere Infiltration an Nerven sowie durch zusätzliche Abkühlung des Gewebes mit Chloräthyl. Diese Kombination ergab eine radikale Verringerung der toxischen Kokainwirkung, sodass sich die Lokalanästhesie in dieser „entschärften Form“ durchsetzte.
Schleich war es dann auch, der eine 0,5–1%ige Kokainlösung zu rein therapeutischen Zwecken nutzte ▶ [446]. Er beobachtete 1898 als erster, dass die lokale Infiltration von Kokainlösung bei rheumatischen Beschwerden diese nicht nur über die Anästhesiezeit unterbrechen konnte, sondern dass weit darüber hinaus die rheumatischen Beschwerden aufzuheben waren oder nur in geringerem Umfang wiederkehrten. Diese erste dokumentiere erfolgreiche Anwendung von Lokalanästhetika zu therapeutischen Zwecken kann als Geburtsstunde der Neuraltherapie bezeichnet werden. Im Verlauf der nächsten Jahre wurde die Methode verfeinert und entwickelte sich zum ersten Teil der Neuraltherapie, der Segmenttherapie.
Unabhängig von Schleich beobachtete Spieß ebenfalls in der klinischen Anwendung, dass die wiederholte Anästhesie einer Operationswunde nicht nur eine auffällige über die Anästhesiezeit hinausgehende Schmerzfreiheit brachte, sondern dass gleichzeitig die Wundheilung, hier im Bereich des Rachens nach Tonsillektomie, deutlich reizloser verlief als ohne die wiederholte Lokalanästhesie ▶ [469], ▶ [470]. Zusätzlich beobachtete er, dass bestehende entzündliche Wundheilungsstörungen schneller reizlos ausheilten. Diese neuen klinischen Beobachtungen veröffentlichte Spieß 1906 in der „Münchner Medizinischen Wochenschrift“ unter dem Titel „Heilwirkung der Anästhetika“ ▶ [470].
1.2.2 Neuraltherapie
1.2.2.1 Entwicklung
Parallel zur Anwendung der Lokalanästhesie und der Neuraltherapie wurde von pharmakologischer Seite intensiv an alternativen Substanzen zu Kokain geforscht mit dem Ziel, vergleichbare Anästhesiequalität zu erreichen, aber ohne die toxischen Nebenwirkungen des Kokains. Einhorn gelang es 1905, ein Lokalanästhetikum mit gleicher Anästhesiequalität herzustellen wie Kokain, jedoch ohne suchterzeugende Nebenwirkungen. Es handelte sich um ▶ Procain, das als Lokalanästhetikum ab 1905 weltweit zum Einsatz kam und heute aufgrund der kurzen Wirkdauer zu rein therapeutischen Zwecken benutzt wird.
Mit dem Wechsel des als Lokalanästhetikum bis 1905 benutzten Kokains zum Procain wurde gleichzeitig der Weg freigemacht zur gefahrloseren Anwendung der Lokalanästhesie und der Neuraltherapie. Nachdem die ersten Berichte über therapeutische Einsatzmöglichkeiten durch Schleich und Spieß wenig Echo fanden, erregten Arbeiten von Leriche und Mitarbeitern Aufmerksamkeit ▶ [299]. Sicher trug hierzu die extensive neurochirurgische Tätigkeit von Leriche bei, der die Wirkung der Lokalanästhesie zunächst intraoperativ nutzte ▶ [302].
Speziell die Beschäftigung mit dem Sympathikus, zunächst rein chirurgisch, später auch mithilfe der Neuraltherapie, gab Leriche wichtige Hinweise für die breitgefächerte Einsatzmöglichkeit des Lokalanästhetikums zur Therapie. Die zu therapeutischen Zwecken von ihm 1920 erstmals veröffentlichte operative Entfernung des Ganglion stellatum und die erste ebenfalls von ihm durchgeführte therapeutische „stelläre Infiltration“ stimmten im Vergleich der Ergebnisse prinzipiell überein, sodass die wiederholte Stellatuminjektion als weniger traumatisierender Eingriff im Vorfeld der Exstirpation von ihm empfohlen wurde. Aus dieser Erkenntnis stammt der von Leriche geprägte Begriff des „unblutigen Messers des Chirurgen“ ▶ [301], ▶ [302]. Seine therapeutischen Empfehlungen resultierten aus eindrucksvollen klinischen Versuchen, durch die Infiltration von Lokalanästhetika an sympathische Nervenstrukturen Einfluss auf Erkrankungen zu nehmen, die bislang nicht zufriedenstellend behandelt werden konnten. Die Stellatuminjektion bei Lungenembolie, Hirnembolie und Gefäßdyskinesien nach Verletzungen oder bei verschiedenen Kopfschmerzerkrankungen sind nur einige Beispiele. Die ebenfalls von Leriche gemachte Beobachtung, dass die Konsolidierung einer Fraktur unter lokaler wiederholter Procaininfiltration in halber Zeit erfolgte, unterstreicht die Wertigkeit des Sympathikus.
Nicht weniger wichtig sind seine Beobachtungen über die intra- und periarterielle Anwendung von Lokalanästhetika zur Therapie vasomotorischer Erkrankungen. In seinem Buch „Die Chirurgie des Schmerzes“ sind seine jahrzehntelangen Erfahrungen aus neurochirurgischer und neuraltherapeutischer Tätigkeit überzeugend dargelegt ▶ [302].
Ohne Kenntnis der von Leriche bereits praktizierten therapeutischen Nutzung von Lokalanästhetika kam Ferdinand Huneke, praktischer Arzt in Düsseldorf, 1925 erstmalig ungewollt mit dem Lokalanästhetikum Procain in Berührung, als er seiner an Migräne leidenden Schwester ein von einem anderen Kollegen empfohlenes Mischpräparat intravenös injizierte und die Migräne schlagartig verschwand ▶ [223]. Er injizierte Atophanyl, ein Präparat, das eigentlich zur Behandlung von rheumatischen Beschwerden gedacht war und in 2 Versionen zur Verfügung stand: zur intravenösen Injektion als reines Atophanyl sowie zur intramuskulären Injektion mit dem Zusatz von Procain. Versehentlich hatte er das zur intramuskulären Injektion vorgesehene Präparat intravenös gegeben, ohne dass es zu der vom Hersteller angekündigten Komplikation einer Herz-Kreislauf-Depression kam. Bei der Wiederholung der Injektion kam es nicht zum erwarteten Abklingen der Migräne; diesmal hatte er das zur intravenösen Injektion vorgesehene Präparat ohne Procainzusatz verwendet. So fand Huneke die Ursache dieser 2 unterschiedlichen Reaktionen in der eigentlichen Wirksubstanz Procain. Tatsächlich konnte er beim nächsten Migräneanfall seiner Schwester die Migräne kupieren, als er reines Procain intravenös injizierte. Als praktischer Arzt tätig begann Ferdinand Huneke nun zusammen mit seinem Bruder Walter Huneke, ebenfalls praktischer Arzt, dieses Präparat bei den unterschiedlichsten Erkrankungen einzusetzen. Neben der medikamentösen Therapie im klassischen Sinne durch intravenöse und intramuskuläre Gabe entwickelten sie die gezielte Injektion an schmerzhafte Gewebsstrukturen, an Nerven und Gefäße, an Gelenke und Ganglien.
Als die erste paravenöse Injektion bei einer Kopfschmerzpatientin den gleichen therapeutischen Effekt zeigte, wie die schon häufig durchgeführte intravenöse Injektion, reifte der Gedanke, dass nicht die allgemeine Verteilung des Procains im Organismus die entscheidende therapeutische Wirkung erbrachte, sondern dass dieser „Heilvorgang“ offensichtlich schon allein wegen der immer wieder auffälligen Geschwindigkeit seines Auftretens über nervale Strukturen ablaufen musste. Die Brüder Huneke vermuteten das vegetative System als Leitschiene dieses Vorgangs und veröffentlichten erstmalig 1928 ihre gesammelten therapeutischen Erfahrungen mit Procain im Artikel „Unbekannte Fernwirkung der Lokalanästhesie“ ▶ [223]. Sie bezeichneten im weiteren Verlauf ihre Therapie mit Lokalanästhetika als „Heilanästhesie“. Von der Idee der Anästhesie, die hier lediglich die reversible Ausschaltung von schmerzleitenden Fasern bedeutet, hatten sie sich noch nicht gelöst. Die pharmakologischen Grundlagen der Membranforschung, die die generelle stabilisierende Wirkung von Lokalanästhetika an jeder Membran und nicht nur an Nervenzellen beweisen sollten, waren seinerzeit noch nicht bekannt. Der immer wieder analog ablaufenden Heilungsvorgänge bei den unterschiedlichsten Erkrankungen ließ die Brüder Huneke von der Idee der einheitlichen Beteiligung des vegetativen Systems nicht abkommen.
1.2.2.2 Sekundenphänomen – Die Entdeckung des Störfelds
Im Jahr 1940 beobachtete Ferdinand Huneke erstmalig etwas völlig Neues ▶ [236]. Eine Patientin, die er kurz zuvor wegen einer sehr schmerzhaften Störung der Schulterfunktion links erfolglos behandelt hatte, erschien erneut wegen einer exazerbierten chronisch-rezidivierenden Osteomyelitis am rechten Unterschenkel. Mit der Erfahrung, dass Entzündungen mithilfe des Procains gut zu behandeln sind, infiltrierte er den entzündeten Unterschenkelabschnitt mit Impletol, einer 2%igen Procainlösung mit Koffeinzusatz. Unmittelbar danach war die schmerzhaft bewegungseingeschränkte linke Schulter völlig beschwerdefrei beweglich, was Arzt wie Patientin in gleicher Weise überraschte. Die direkt nach der fernab vorgenommenen Infiltration am rechten Unterschenkel auftretende Reaktion im Bereich der linken Schulter ließ auf einen Zusammenhang beider Erkrankungen schließen. Dieses Ereignis ließ die Brüder Huneke nicht mehr los, war dies doch der Schlüssel zu vielen chronischen Erkrankungen, die mit dem bisherigen therapeutischen Verfahren nicht zur Ausheilung gebracht werden konnten.
Dieses erste „Sekundenphänomen“ bedeutete die Revision der Vorstellung, die weit früher von Pässler formuliert wurde und den Herd als bakteriell kontaminiertes Gewebe definierte, mit metastatischer Verteilung der Bakterien und deren Toxine im gesamten Organismus. Die Geschwindigkeit, in der die linke Schulter der Patientin beschwerdefrei wurde, verwies darauf, dass die Erkrankung der linken Schulter nerval gesteuert über die Entzündung am rechten Unterschenkel ablief. Es war also möglich, dass chronische Erkrankungen durch eine Beherdung hervorgerufen oder unterhalten wurden und nur über deren „Ausschaltung“ mittels des Lokalanästhetikums oder durch operative Entfernung (Zähne!) geheilt werden konnten, wobei die Zuständigkeit des vermuteten Herdes sich erst nach der Injektion in den Herd herausstellte. Es ist das unbestreitbare Verdienst der Brüder Ferdinand und Walter Huneke, aus dieser Einzelbeobachtung die Grundsätzlichkeit erkannt und den Begriff des „Herdes“ neu geprägt zu haben. Sie führten ihn als „nervales Störfeld“ ein und entwickelten die Störfeldtestung als therapeutisches Prinzip. Dabei ergaben sich 3 Grundsätze:
Jede chronische Erkrankung kann störfeldbedingt sein.
Jede Erkrankung oder Verletzung kann ein Störfeld hinterlassen.
Jede Störfelderkrankung ist nur durch „Ausschaltung“ des Störfelds heilbar.
Sicherlich wurden ähnliche Beobachtungen schon vor Huneke gemacht. So erfuhren ohne Zweifel einige Zahnärzte von ihren Patienten, dass nach Entfernung eines kranken Zahnes beispielsweise langanhaltende Rückenschmerzen plötzlich verschwanden. Leriche beobachtete und beschrieb bereits 1936 das Sistieren fernabliegender Schmerzen nach Infiltration einer reizlosen Narbe. Die sich aus dieser Beobachtung ergebende therapeutische Konsequenz wurde jedoch erst durch Ferdinand und Walter Huneke erkannt und umgesetzt.
1.2.2.3 Begriff
Die bisher im Text verwendete Bezeichnung „Neuraltherapie“ zur Abgrenzung von der rein zu chirurgischen Eingriffen praktizierten Lokalanästhesie entstand erst 1940 nach Entdeckung des Sekundenphänomens durch Huneke.
Von Roques▶ [430], der ebenfalls in dieser Zeit – wie viele andere Ärzte – neuraltherapeutisch arbeitete, hatte ab 1938 ein Grundlagenbuch von Speransky▶ [467] aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt und war mit den ausgedehnten neurologisch-experimentellen Arbeiten, die unter Speransky in Russland durchgeführt worden waren, vertraut. So prägte von Roques den Begriff „Neuraltherapie nach Huneke“, der bis heute beibehalten wurde. Vor dieser Zeit wurde die therapeutische Nutzung der Lokalanästhetika mit anderen Bezeichnungen wie „Procaintherapie“, „Impletolbehandlung“ und „Heilanästhesie“ umschrieben. Da weder das Medikament für die Therapie unabdingbar ist – auch andere Lokalanästhetika können zur Neuraltherapie genutzt werden – noch die Lokalanästhesie Grundlage der Therapie ist, sondern nur eine Teileigenschaft des Lokalanästhetikums, war der Begriff der Neuraltherapie sicherlich umfassender.
Der Zusatz „nach Huneke“ ist nicht primär als Ehrung der „Erfinder“ aufzufassen, sondern weist darauf hin, dass die Neuraltherapie nach Huneke aus den folgenden 2 Teilen besteht:
Segmenttherapie, die vor 1940 praktiziert wurde. Sie beinhaltete die lokale Behandlung mit Lokalanästhetika „im erkrankten Segment“.
Störfeldtherapie; sie bedeutet, losgelöst vom Segment, die ubiquitär mögliche therapeutische Nutzung von Lokalanästhetika, je nach Lokalisation des vermuteten Störfelds.
Der noch heute verwendete Begriff „therapeutische Lokalanästhesie“, in Abgrenzung zur Neuraltherapie nach 1940 von Gross geprägt ▶ [179], ist insofern verwirrend, als dass es nicht die Lokalanästhesie ist, die die Therapie ausmacht. Auch schmerzlose Erkrankungen ohne den neuraltherapeutisch belanglosen Begleiteffekt einer lokalen Anästhesie können behandelt werden, z. B. Hyperthyreose, Drehschwindel oder chronische Sinusitis.
2 Theoretische Grundlagen und praxisorientierte Hypothesen
2.1 Einleitung
Um die Grundlagen der Neuraltherapie verständlich zu machen, ist es erforderlich, zunächst das anatomische Substrat darzustellen, das den diagnostischen und therapeutischen Zugriff zum Organismus ermöglicht. Voraussetzung ist die Erkenntnis, dass alle Funktionen im Gesamtorganismus an ein Informationssystem gebunden sind, das sie mithilfe von Regelkreisen koordiniert und die Homöostase gewährleistet. Hinsichtlich der Kausalzusammenhänge einer physiologischen oder pathophysiologischen Funktion ist dem vegetativen Nervensystem eine wesentliche Stellung einzuräumen ▶ [69], ▶ [425].
Die gesonderte Betrachtung einer anatomischen Struktur dient dazu, diese klarer zu erkennen, allerdings unter partieller Einbuße der Einsicht in die funktionellen Zusammenhänge. Die anatomische Isolation des vegetativen Nervensystems zeigt dies besonders deutlich, da die zentralen wie peripheren Verbindungen zu anderen anatomischen Strukturen extrem ausgeprägt sind. Die Kenntnisse um Anatomie und Physiologie des vegetativen Nervensystems sind nach wie vor in der Medizin nicht ausreichend verbreitet und finden daher auch nicht die notwendige Berücksichtigung in Diagnostik und Therapie.
Die Grundfunktion des vegetativen Nervensystems besteht in der schnellen antagonistisch koordinierten Steuerung der einzelnen Gewebefunktionen eines Organismus, um die Homöostase – oder besser – die Homöodynamik zu ermöglichen und äußere Einflüsse, denen der Organismus kontinuierlich ausgesetzt ist, situationsgerecht beantworten zu können mit dem Ziel, die Organeinzelfunktionen im Gleichgewicht zu halten. Das vegetative Nervensystem stellt also die Leitstruktur dar, auf der alle Reize qualitativ einheitlich, quantitativ variabel als stetig wechselnder Informationsfluss ablaufen.
Um Lebensfunktionen wie Atmung, Verdauung, Stoffwechsel, Sekretion, Wasserhaushalt, Elektrolythaushalt, Temperatur, Blutdruck, Fortpflanzung etc. steuern zu können, bedarf es einer bis in die Endstrombahn reichenden Verteilung des Systems sowie einer hochgradigen Vernetzung, um einen rückkoppelnden Informationsaustausch zwischen den einzelnen voneinander abhängigen Organ- und Funktionsbereichen zu ermöglichen. Es bedarf also eines nervösen Kreislaufs, eines afferenten wie efferenten Schenkels, analog zum Gefäßsystem mit seinem arteriellen und venösen Schenkel. Beides ist im gesunden Organismus vorgegeben.
2.2 Vegetatives Nervensystem
2.2.1 Anatomie und Funktion
Unter funktionellem Aspekt ist es sinnvoll, den Reizleitungsweg einmal efferent und dann afferent anatomisch nachzuvollziehen. Die Zentren des sympathischen sowie des parasympathischen Schenkels finden sich im Zwischenhirn im Bereich des Hypothalamus und stellen die übergeordnete funktionelle Verbindung zwischen den vegetativen, somatischen und endokrinen Systemen dar. Eine anatomische Differenzierung in dieser vegetativen Organisationsstufe zwischen sympathischem und parasympathischem Anteil ist nicht möglich, da eine enge anatomische und funktionelle Vernetzung beider Systeme besteht. Die experimentell gegliederte Reizung oder Durchtrennung dieser dienzephalen Zentren ergibt übergeordnete antagonistische Funktionen ganzer Organbereiche. Rohen hat hierzu eine Tabelle erstellt, die die Beeinflussungen der Organsysteme wiedergibt (▶ Tab. 2.1) ▶ [428].
Tab. 2.1
Beeinflussung der Organsysteme nach Rohen
▶ [428]
.
Organ
Wirkung des (Ortho-)Sympathikus(adrenerge Wirkungen)
Wirkung des Parasympathikus(cholinerge Wirkung)
Auge
Iris
Ziliarmuskel
Mydriasis
Desakkommodation
Miosis
Akkommodation
Herz
Frequenz
Kontraktionskraft
Rhythmus
Überleitungszeit
beschleunigend
verstärkt
ventrikuläre Extrasystolen, Tachykardie, Flimmern
verkürzt
verlangsamend
–
Bradykardie, AV-Block, vagaler Herzstillstand
verlängert
Gefäße
Aa. coronariae
Muskelgefäße
Darmgefäße
Erweiterung
Verengerung
Verengerung
Verengung?
–
Erweiterung
Lunge
Bronchialmuskulatur
Bronchialschleimhaut
Erschlaffung
verringerte Sekretion
Kontraktion
vermehrte Sekretion
Magen-Darm-Kanal
Peristaltik
Sphinkteren
Drüsensekretion
Kontraktion gehemmt
?
vermindert
gesteigert
Erschlaffung
gefördert
extrahepatische Gallenwege und Gallenblase
Erschlaffung
Kontraktion
Milz (Muskulatur)
Kontraktion
Erschlaffung
Speicheldrüsen
Sekretion (dickflüssiges Sekret)
Sekretion (dünnflüssiges Sekret)
Pankreas Inselorgan
verminderte Insulinsekretion
erhöhte Insulinsekretion
Leber
Glykogenolyse
Gallenabsonderung
Nebennierenmark
Absonderung von Adrenalin und Noradrenalin
Verminderung der Abgabe von Adrenalin und Noradreanlin
Harnblase
Muskulatur
Sphinkter
Erschlaffung
Kontraktion
Kontraktion
Erschlaffung
Gehirnrinde
allgemeine Aktivierung, Bewusstseinssteigerung
Hemmung, Bewusstseinsdämpfung
allgemeine Reaktionslage
ergotroper „Leistungsnerv“
trophotroper„Erholungsnerv“
Rohen bildet hier die Begriffe der ergotropen (sympathischen, adrenergen) und der trophotropen (parasympathischen, cholinergen) Reaktionslage, um die funktionellen Zusammenhänge klarzustellen. Die Region des Hypothalamus mit den entsprechenden vegetativen Kerngebieten ist afferent sowie efferent mit den Hirnnerven, der Hypophyse und der Hirnrinde verschaltet und hat damit einen fördernden oder hemmenden Einfluss auf Perzeptionsorgane, auf hormonbildende Organe (Hypophyse, Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nieren und Nebennieren, Gonaden) sowie Somatomotorik und Somatosensibilität. Weiter peripher wird die Anatomie des vegetativen Nervensystems insofern übersichtlicher, als dass über eine segmentale Gliederung des Sympathikus auf der Ebene des Rückenmarks die anatomische Zuordnung weniger komplex und damit differenzierbarer wird.
Der Parasympathikus weist zwar keine segmentale Verteilung auf, jedoch ist sein Verlauf definiert mit den Hirnnerven III (N. oculomotorius), VII (N. facialis), IX (N. glossopharyngeus) sowie den parasympathischen Kopfganglien (Ganglion ciliare, Ganglion pterygopalatinum, Ganglion oticum, Ganglion submandibulare). Der umfangreichste parasympathische Anteil wird vom X. Hirnnerv, dem N. vagus, dargestellt. Mit dem sakralen Anteil des Parasympathikus aus den Segmenten S2 – S4 vervollständigt sich das Bild des Parasympathikus, der über die beschriebene Topografie anatomisch und funktionell fassbar und damit diagnostisch und therapeutisch erreichbar wird.
Dem sympathischen sowie dem parasympathischen Anteil gemeinsam ist der zelluläre Aufbau. Die relativ kleinen Nervenzellen weisen in der Regel multiple Nervenfasern pro Zelleinheit auf, die efferent das Prinzip der Divergenz gewährleisten und auf dem afferenten Wege Impulse aus der Peripherie zusammenfassen. Hierauf beruht die für das vegetative Nervensystem typische Divergenz, die auf dem efferenten Schenkel eine breit divergierende Informationsübermittlung ermöglicht und damit ganze Organbereiche harmonisierend beeinflusst. Die Leitgeschwindigkeit im vegetativen Nervensystem ist deutlich langsamer als im somatischen System. Da die Nervenfasern markarm oder marklos verlaufen und einen sehr geringen Durchmesser in der peripheren Organaufteilung von bis zu 0,3 µm aufweisen, liegt die Leitgeschwindigkeit zwischen maximal 25 m/s (afferente A-δ-Faser) bis 0,5 m/s (C-Faser).
Die vegetativen Ganglien weisen neben verschiedenen Zelltypen eine starke Vaskularisierung auf. Dies dient sicherlich nicht nur der nutritiven Versorgung der Nervenzellen, sondern wohl auch den über Neurotransmitter vermittelten Stoffwechselfunktionen ▶ [429]. In den Ganglien finden Umschaltvorgänge statt, z. B. vom präganglionären auf das postganglionäre Neuron. Dabei leiten nicht nur cholinerge Synapsen die Informationen weiter, sondern auch dopaminhaltige Zellen (SIS-Zellen) mit dopaminergen Synapsen, die an den Perikarien der postganglionären Neurone enden und deren Reizleitung modulierend beeinflussen.
2.2.2 Sympathische Efferenz
Die Kerngebiete des Sympathikus liegen im Nucleus intermediolateralis des Rückenmarks in Höhe der Segmente C8 – L2 (L3). Die über die Foramina intervertebralia zusammen mit den Vorderwurzelanteilen aus dem Spinalkanal austretenden präganglionären Fasern laufen zunächst eine kurze Strecke zusammen mit den Spinalnerven, um sie über die markhaltigen Rr. communicantes albi zum paravertebralen Grenzstrangganglion zu verlassen. Hier treten sie zum Teil synaptisch mit den Nervenzellen der Grenzstrangganglienzellen auch höher und tiefer liegender Segmente in Verbindung und verlassen nach Umschaltung auf das 2. Neuron über die Rr. communicantes grisei das Grenzstrangganglion, um mit dem Spinalnervenbündel in Richtung Peripherie zu ziehen.
Daraus ergibt sich der erste zur Peripherie gerichtete efferente Verteilungsweg des Sympathikus bis hin zu den Erfolgsorganen. Er umfasst die sympathische Versorgung der Haut und der Extremitäten. Daraus resultiert, dass der periphere, segmental gegliederte somatomotorische und somatosensible Nerv immer in Begleitung von sympathischen postganglionären Fasern verläuft. Diese sympathischen Fasern wiederum stammen aus mehreren paravertebralen Ganglien des sympathischen Grenzstrangs, woraus sich eine weiterreichende Divergenz im Vergleich zum somatomotorischen und somatosensiblen Innervationsgebiet ergibt. Das somatosensible Innervationsgebiet eines Hautareals ist genauer abgrenzbar, während die sympathische Versorgung der Haut keine derartige streng segmentgebundene Aufteilung aufweist.
Der 2. Verteilungsweg des Sympathikus erfolgt aus dem Nucleus intermediolateralis des Rückenmarks über die Grenzstrangganglien ohne Umschaltung zu den prävertebralen Ganglien (z. B. Ganglion coeliacum, Ganglion aorticorenale, Ganglion mesentericum superius et inferius). Erst in diesen prävertebralen Ganglien erfolgt die Umschaltung auf das 2. Neuron. Von hier aus erreicht der Sympathikus die Bauch- und Beckenorgane vornehmlich in Begleitung der arteriellen und venösen Gefäße sowie als freie Nervenbündel. Die sympathische Versorgung des Brustraums und der Brustorgane sowie des gesamten Kopfes und der oberen Extremitäten läuft über die 3 zervikalen Grenzstrangganglien, in denen die Umschaltung auf das 2. Neuron stattfindet sowie über die 6 ersten thorakalen sympathischen Grenzstrangganglien; der zervikale wie auch der thorakale Grenzstrangabschnitt erhalten ihre präganglionären Fasern aus den Nuclei intermediolaterales der Segmente C8 – Th6. Die sympathische Versorgung des Bauchraums, des Retroperitonealraums, des kleinen Beckens sowie der unteren Extremitäten erfolgt überlappend ab den Segmenten Th5 – L2 (L3) und den dazugehörigen lumbalen (abdominellen, sakralen und kokzygealen) Ganglien.
Der efferente Sympathikus verläuft also zusammen mit den Hirn- und Spinalnerven sowie mit den Gefäßen bis in die kapilläre Endstrombahn, um in die Peripherie zu gelangen. Damit ist seine ubiquitäre Verteilung anatomisch beschrieben. Der Sympathikus ist damit der einzige Anteil des Nervensystems, der den gesamten Organismus versorgt, was für die Neuraltherapie relevant ist. Der Parasympathikus weist diese generalisierte Verteilung nicht auf, da er nach heutigem Wissen nicht an der Versorgung der Extremitäten und der Haut beteiligt ist.
Der 3. Verteilungsweg des Sympathikus kann als interganglionär bezeichnet werden. So bestehen über die perlschnurartige Verbindung der 23 einzelnen Grenzstrangganglien einerseits homolaterale Verbindungen nach kranial und kaudal sowie andererseits nach kontralateral über interganglionäre Nervenäste zu den para- und prävertebralen sympathischen Ganglien. Da den 23 paravertebralen und 5 prävertebralen Gangliengruppen nur 15 sympathische Ursprungskerngebiete im Rückenmark gegenüberstehen, müssen zahlreiche präganglionäre Fasern eines Rückenmarkssegments im Sinne der Divergenz in mehreren Ganglien auf das 2. Neuron umgeschaltet werden. So entsteht in vertikaler homolateraler Richtung eine größere „Sicherheit“ der Impulsweitergabe, d. h. der Ausfall eines Ganglions verursacht keine wesentliche Einschränkung der Sympathikusfunktion; andererseits wird auf spinaler Ebene bei einseitiger Sympathikusreizung das – wenn auch eingeschränkte – Mitreagieren des Sympathikus auf kontralateraler Seite durch die horizontal verlaufenden Rr. interganglionares möglich. Dies erklärt beispielsweise, warum die Degeneration eines Hüftgelenks, die u. a. an eine Minderdurchblutung, also vermehrte Sympathikusreizung, gebunden ist, zunächst auf der einen, später auch auf der anderen Seite auftritt; ebenso die klinische Beobachtung, dass das CRPS (complex regional pain syndrome) der einen Köperseite auch auf der kontralateralen Seite „spiegelbildlich“ entstehen kann oder erklärt das Phänomen der „kontralateralen Schmerztherapie“, bei der spiegelbildlich eine Segmenttherapie auf der „gesunden Seite“ einen therapeutischen Effekt auf der „erkrankten Seite“ ermöglicht.
Einer besonderen Beachtung bedarf der Sympathikus in der Peripherie, d. h. im Bereich der Endstrombahn, in der der geleitete Impuls am Axonende auf das Erfolgsorgan übertragen werden soll. Als erster beschäftigte sich etwa ab 1925 Stöhr mit der Anatomie des vegetativen Nervensystems im Bereich der Endstrombahn, also mit dem auslaufenden Faseranteil in der Peripherie. Er schuf den Begriff des „Terminalreticulums", der beschreibt, dass die feinsten marklosen vegetativen Nervenendigungen als unentwirrbares Faserwerk ohne direkten Kontakt zu anderen Zellen im interstitiellen Raum enden ▶ [477], ▶ [478]. So erfolgt die über das vegetative Nervensystem ablaufende Informationsübermittlung an die zu versorgenden Organe über das Interstitium.
Pischinger et al. gelang ein weiterer wesentlicher Schritt ▶ [399], ▶ [400]. Sie beschrieben das terminale vegetative Faserwerk als einen Bestandteil des als System zu definierenden Interstitiums. Als weitere Bestandteile fassten sie die 3 kapillaren Strukturen (arteriell, venös, lymphatisch), den zellulären Anteil (Fibrozyt, Makrophage) sowie die extrazelluläre Flüssigkeit (Grundsubstanz) zum sogenannten ▶ Grundregulationssystem zusammen. Der efferente Sympathikus endet also als freie „Synapse“ im Interstitium, wo die Impulsweiterleitung der Nervenfaser über die Abgabe von Neurotransmittern in die extrazelluläre Flüssigkeit erfolgt und damit Einfluss sowohl auf das Kapillarsystem ausübt wie auch auf das Zellsystem des Interstitiums.
Neben der freien Endigung des efferenten Sympathikus wiesen Fujita et al. bei zahlreichen Tierspezies Synapsen zwischen der Endformation des Sympathikus und den sogenannten Paraneuronen nach ▶ [154]. Dies sind spezielle Zellen im Zellverband der epithelialen Auskleidung von Hohlorganen, Drüsenausführungsgängen und Gefäßwänden, die Transmitter produzieren, deren Freisetzung über direkte vegetative Synapsen moduliert wird. Ähnliche Verhältnisse finden sich in der Haut und Schleimhaut bei den dendritischen Zellen, deren Funktion u. a. in der Modulation immunologischer Vorgänge (Monozyten-Makrophagen-System) durch Aufnahme von antigenem Material und Weitergabe an die Lymphozyten besteht.
Die Beschreibung der Funktion des efferenten Sympathikus unter Einbeziehung des Grundregulationssystems und der Paraneurone betont dessen ubiquitäre Verteilung im Gesamtorganismus. Auf dieser neurophysiologischen Grundlage kann der Sympathikus als Informationssystem an allen Gewebestrukturen regulierend tätig werden.
2.2.3 Sympathische Afferenz
Die Aufteilung der Nervenfasern in A-, B- und C-Fasern erlaubt keine vollständige Beschreibung der dem afferenten Sympathikus zuzuordnenden Faseranteile. Eindeutig definiert ist die sympathische Efferenz, die, von ihren Kerngebieten im Nucleus intermediolateralis des Rückenmarks (Segment C8 – L2) ausgehend, über die Vorderwurzel, die Rr. communicantes albi den Grenzstrang und die prävertebralen Ganglien zusammen mit Gefäßen und Spinal- bzw. Hirnnerven verläuft. Die präganglionären Fasern nehmen ihren Weg als myelinisierte Fasern bis zum para- und prävertebralen Ganglion, die postganglionären Fasern als wenig oder nicht myelinisierte Fasern zum Interstitium des Erfolgsorgans. Die sympathische Afferenz ist nicht nur durch die Fasercharakteristik (wenig oder nicht myelinisiert) zu identifizieren, sondern primär aus ihrer afferenten Funktion. Hier sind mikroanatomische Fragen offen, die nur indirekt über die klinische, physiologische und pathophysiologische Funktion zu deuten und zu überbrücken sind.
Die separierende Betrachtung des efferenten Sympathikus und alleinige Bezeichnung der Efferenz als Sympathikus ▶ [436] ist anzufechten, da die Bezeichnung des Sympathikus aus seiner Funktion erfolgt. Diese wiederum ist nur aus der Berücksichtigung der Efferenz und Afferenz, also über den neuralen Leitungsbogen zu erschließen. In Analogie hierzu ist es ebenso nur sinnvoll, die Bezeichnung „Gefäßsystem“ aus dem efferenten arteriellen Schenkel und dem afferenten venösen und lymphatischen Schenkel vorzunehmen, um der zusammenhängenden Aufgabe des Gefäßsystems gerecht zu werden.
Die sympathische Afferenz ergibt somit unter ausschließlicher Berücksichtigung der Faserqualität kein einheitliches Bild. Eine sinnvolle Betrachtung berücksichtigt vielmehr die direkte oder indirekte Zuträgerfunktion der Afferenz über das Hinterhorn zum efferenten Kerngebiet im Rückenmark, der Retikularisformation im Rautenhirn und im Hypothalamus. Unter diesem Aspekt ergibt sich als Faserqualität der sympathischen Afferenz ein Mischbild, bestehend aus:
A-Fasern: für Druck, Wärme und Dehnung (Herz, Venen, Arterien und Lunge)
B-Fasern: für viszerale Sensibilität, Herzvorhöfe und Lungen
C-Fasern: für Wärme, Kälte, Jucken, dumpfen Oberflächenschmerz, protopathischen Tiefenschmerz und Viszeralschmerz
Die afferenten Impulse, die von der Peripherie zentralwärts geleitet werden und den Reflexbogen mit den sympathischen Efferenzen bilden sowie über zahlreiche Schaltungen mit dem somatischen Nervensystem in Verbindung stehen, verlaufen in der Regel in denselben Nervenbündeln wie die entsprechenden efferenten sympathischen Nervenfasern. Hier ist der gleiche, nunmehr konvergierende Verteilungsweg vorgegeben, wie beim divergierenden – efferenten – sympathischen System ▶ [69]. Der Faserverlauf erfolgt also über:
sensible Fasern der Spinalnerven via Spinalganglion und Hinterwurzel zum Rückenmark
sensible Nerven, dann jedoch über die Rr. communicantes albi zum Grenzstrangganglion und über den R. communicans griseus; danach über Vorder- bzw. Hinterwurzel zum Rückenmark; die entsprechenden Ganglienzellen liegen im Spinalganglion, wohl aber auch im Grenzstrang und den para- und prävertebralen sympathischen Ganglien
rein vegetative Nervenbündel; Rami viscerales, Nn. splanchnici direkt zum Grenzstrang
sympathische perivaskuläre Geflechte zum Grenzstrang und weiter über die Rr. communicantes zur Vorder- und Hinterwurzel der Spinalnerven zum Rückenmark
Aus den afferenten Faserverläufen und der damit verbundenen Lokalisation der synaptischen Verbindungen ergibt sich die vielschichtige Informationsübermittlung innerhalb des sympathischen Nervensystems sowie vor allem zwischen dem somatosensiblen und somatomotorischen System, im Bereich des Kopfes und der Hirnnerven. Damit regelt sich der vegetative Funktionsbereich autonom im Rahmen der rein vegetativen Verschaltungen. Die rein vegetative Autonomie wird dort relativiert, wo nervale Verbindungen zum somatischen Nervensystem bestehen. Teilweise finden sich diese engen vegetativen und somatischen Verbindungen bereits am Rezeptororgan, z. B. an den Lamellenkörperchen. Diese Tiefensensibilitätsorgane entlassen sowohl eine afferente markhaltige als auch eine afferente marklose vegetative Faser, sodass funktionell sowohl das somatosensible als auch das vegetative Nervensystem von ein- und demselben „Informationsorgan“ versorgt wird ▶ [69]. Ähnliche Verhältnisse finden sich u. a. in den Muskelspindeln, am Dogiel-Körperchen und am Krause-Endkolben▶ [69].
Die Funktionen der sympathischen Afferenzen sind sehr unterschiedlich. Sie beinhalten die Vermittlung von Spannungsgefühl, z. B. der Harnblase, bis hin zum Schmerz bei Überfüllung der Blase oder des Gefäßschmerzes bei Reizung des sympathischen perivaskulären Geflechts, z. B. im Rahmen einer Entzündung. Bei Reizung des Halsgrenzstrangs oder des sympathischen Karotisgeflechts meldet sich der afferente sympathische Schenkel mit Kopf-, Gesichts-, Hals-, Zahn- und Ohrenschmerzen ▶ [69].
In der Betrachtung der den gesamten Organismus umfassenden Versorgung durch den efferenten Sympathikus, der sowohl die einzelnen Organe als auch das Gefäßsystem erreicht, wird der Einfluss des Sympathikus deutlich. Der efferente Sympathikus moduliert die Organfunktion in zweierlei Hinsicht: Einerseits steuert er die Organfunktion direkt über die interstitielle Verteilung im Grundregulationssystem, andererseits über die Vasomotorik die Mikrozirkulation derselben Organe. Berücksichtigt man neben der efferenten Aufgabe des Sympathikus die afferenten Impulseingänge, die nicht nur den rein sympathischen Leitungsbogen gewährleisten, sondern in zahlreichen direkten und indirekten afferenten Kontakten mit dem Parasympathikus (z. B. Darmschleimhaut) und dem somatosensiblen sowie somatomotorischen System bestehen, so zeigt sich die Leistungsbreite des Sympathikus im Gesamtorganismus. Es gibt, um es zu wiederholen, schlechthin kein weiteres in der Peripherie wirksames Nervensystem mit dem Umfang des Sympathikus.
2.2.4 Parasympathische Efferenz
Im Gegensatz zum Sympathikus, dessen präganglionäre Neurone im Nucleus intermediolateralis des Rückenmarks im Segment C8 – C2 vorliegen, finden sich die präganglionären Neurone des Parasympathikus in unterschiedlichen Kerngebieten. Diese bilden, anders als der Sympathikus, mit Ausnahme des N. vagus, keine eigenständigen Nerven und benutzen Hirnnerven und im Sakralbereich Spinalnerven als Leitschiene. Da es keinen parasympathischen Grenzstrang gibt, in dem die Umschaltung auf das 2. Neuron erfolgt, ist die Faserlänge der präganglionären Neurone im Unterschied zum Sympathikus sehr lang. Die Umschaltung auf das 2. Neuron erfolgt entweder kurz vor dem Erfolgsorgan in parasympathischen Ganglien oder im Erfolgsorgan selbst.
Über die Lage der Ursprungszellen des parasympathischen Schenkels liegen unterschiedliche Angaben vor. Clara unterscheidet einen kranialen, einen spinalen und einen sakralen Anteil, der sich in neueren Lehrbüchern der Anatomie nicht mehr findet ▶ [69]. Durch den Nachweis der „durchgehenden“ auch postganglionären Neurosekretion von Acetylcholin, die als Definition des Parasympathikus besteht und den Unterschied zum Sympathikus bedeutet, der in der postganglionären Endformation Noradrenalin sezerniert, werden in der weiteren Ausführung, gestützt auf Clara, 3 Anteile berücksichtigt. Darin gehen auch die Bezeichnungen der „sympathetic adrenergic“ und „sympathetic cholinergic“ efferenten Innervation ein, die sich am immunhistochemischen Nachweis der Neurotransmitter des Sympathikus und Parasympathikus orientieren ▶ [420], ▶ [428].
Der kraniale parasympathische Anteil verläuft in den 4 Hirnnerven: N. oculomotorius, N. facialis, N. glossopharyngeus und N. vagus. Die präganglionären Fasern, die mit dem N. oculomotorius laufen, entspringen dem Nucleus Edinger-Westphal, werden im Ganglion ciliare umgeschaltet und versorgen den M. sphincter pupillae und den M. ciliaris.
Die mit dem N. facialis verlaufenden präganglionären Fasern entspringen im Nucleus salivatorius superior, werden im Ganglion pterygopalatinum umgeschaltet und versorgen über den N. zygomaticus die Tränendrüsen sowie die Drüsen der Nase und des Gaumens. Im Ganglion pterygopalatinum bestehen weiterhin Neurone, die als Vasodilatatoren mit den Hirngefäßen (A. carotis interna) intrakraniell verlaufend die Hirndurchblutung modulieren ▶ [558].
Weitere parasympathische Fasern aus dem N. facialis verlaufen über die Chorda tympani zum N. lingualis, werden im Ganglion submandibulare auf das 2. Neuron umgeschaltet und versorgen die Drüsen am Mundhöhlenboden. Schließlich verlaufen parasympathische Fasern mit den peripheren Ästen des N. facialis und versorgen einen Teil der Schweißdrüsen des Gesichts.
Die präganglionären parasympathischen Fasern, die zusammen mit dem N. glossopharyngeus verlaufen, entspringen dem Nucleus salivatorius inferior und verlaufen zum Ganglion oticum, werden dort auf das 2. Neuron umgeschaltet und versorgen die Ohrspeicheldrüse sowie Lippen- und Wangendrüsen.
Den größten kranialen Teil des Parasympathikus bildet der N. vagus, dessen Ursprungskerne im Nucleus dorsalis nervi vagi liegen. Der Versorgungsbereich des N. vagus umfasst die Brust- und Bauchorgane, wobei die Umschaltungen auf das 2. Neuron in den Ganglien des N. vagus selbst (Ganglion superius und Ganglion inferius nervi vagi) oder in Ganglien unmittelbar vor oder in den Erfolgsorganen stattfinden. Die Hauptaufgabe des N. vagus besteht in der motorischen Versorgung der Gaumen- und Schlundkopfmuskulatur sowie der gesamten Kehlkopfmuskulatur, der sensiblen Versorgung der hinteren Schädelgrube, eines Teiles des Trommelfells, eines Teiles der Haut des äußeren Gehörgangs, des äußeren Ohres und des Kehlkopfs sowie der sensiblen, sekretorischen und motorischen Versorgung sämtlicher Brust- und Baucheingeweide bis zum mittleren Drittel des Colon transversum (Cannon-Böhm-Punkt). Der restliche Dickdarm sowie die Beckeneingeweide werden über den sakralen Parasympathikus versorgt.
Der 2. Abschnitt des Parasympathikus ist der spinale Anteil von C1 – S1 mit seinen Wurzelzellen aus der Pars intermedia des Rückenmarks, die ihre Nervenfasern sowohl über die hintere als auch über die vordere Wurzel des Rückenmarks entsenden ▶ [69]. Die efferenten dünnkalibrigen, markhaltigen Fasern der hinteren Wurzel wirken hautgefäßerweiternd, schweißhemmend und pilomotorisch. Immunhistochemische Untersuchungen der reichlichen Innervation der Schweißdrüsen, Talgdrüsen, Haarbälge und M. arrector pili bestätigen die Acetylcholinsekretion, wie sie typisch für den Parasympathikus ist, bezeichnen sie jedoch als „sympathisch-cholinerg“. In geringerer Menge finden sich auch „sympathisch-adrenerge“ Fasern sowie sympathische und parasympathische Fasern im Bereich der Blutgefäße der Haut ▶ [74], ▶ [428].
Die efferenten Fasern, die über die Vorderwurzel verlaufen, lassen sich im Brust- und oberen Lendenmark nicht von den sympathischen Fasern unterscheiden. Ihre Funktion besteht zum Teil in der segmententsprechenden Schweißsekretion, möglicherweise kommt ihnen auch eine Bedeutung für den Muskeltonus zu.
Der 3. parasympathische Abschnitt ist der sakrale Anteil und umfasst die Segmente S2 – S4. Aus dem Nucleus intermediolateralis sacralis strahlen über die Vorderwurzel die efferenten Nervenfasern als Nn. pelvici in den sympathischen Plexus pelvinus ein. Ob die parasympathischen Efferenzen in ihrem Verlauf mit den Spinalnerven und den Gefäßen in Analogie zum Sympathikus auch bis in die Haut ziehen, bleibt offen. Klinisch kann es bei Reizung der Haut über dem Os sacrum (S1 – S5) zu Reaktionen des Enddarms (z. B. Durchfall) kommen, als Hinweis einer vermehrten parasympathisch induzierten Dickdarmtätigkeit. Die Umschaltung auf das 2. Neuron erfolgt in den Ganglia pelvina sowie in den intramuralen Ganglien der Erfolgsorgane. Der Versorgungsbereich des sakralen parasympathischen Anteils umfasst das letzte Drittel des Colon transversum, Colon descendens, Sigma, Rektum und Anus, die Blase mit Urethra sowie innere und äußere Geschlechtsorgane. Gefördert wird die Darm- und die Blasenentleerung durch Kontraktion der Muskulatur und Entspannung der inneren Schließmuskeln. Die Nn. erigentes entspannen die Gefäße des äußeren Genitale, was zu Blutfüllung der Schwellkörper führt.
Die Verteilung erfolgt teilweise mit den Gefäßen, ähnlich wie beim sympathischen System, teilweise frei ohne Gefäßbegleitung über das Mesenterium und die Hohlorgane. An und in den Hohlorganen werden die bis dorthin präganglionären markhaltigen Fasern in zahlreichen intramuralen Ganglien umgeschaltet auf das 2. Neuron. Sie versorgen sowohl den Plexus myentericus (Auerbach), der die glatte Muskulatur des Magen-Darm-Trakts innerviert, wie auch den Plexus submucosus (Meissner), der für die Schleimhaut des Gastrointestinaltrakts zuständig ist. Eine Reizung des efferenten cholinergen parasympathischen Systems hat also eine vermehrte Peristaltik sowie eine vermehrte Sekretion der Schleimhaut zur Folge bei gleichzeitiger cholinerg induzierter Vasodilatation der versorgenden Gefäße. Die auslaufenden parasympathischen Fasern enden einerseits blind im Interstitium, andererseits bestehen nach Heine ▶ [204] und Fujita ▶ [154], wie bereits beim sympathischen System beschrieben, zahlreiche synaptische Verbindungen zu den Paraneuronen, die sich im Verbund der Schleimhautauskleidung der Hohlorgane befinden. Offen bleibt bislang die Frage, ob die Paraneurone sowohl vom sympathischen als auch vom parasympathischen oder nur von einem dieser beiden Schenkel Impulse erhalten. Bei der Vielzahl der von den Paraneuronen gebildeten Neurotransmitter, die sowohl ins Intestinum als auch ins unter der Basalmembran gelegene Interstitium abgegeben werden, ist die sympathische sowie parasympathische Innervation der Paraneurone durchaus denkbar. Das intramurale Nervensystem gewährleistet dem Gastrointestinaltrakt eine gesonderte Autonomie, sodass z. B. ein isolierter gefäßversorgter Darmabschnitt weiterhin eine gerichtete Peristaltik wie auch Schleimhautfunktion beibehält und somit u. a. chirurgisch zur Blasenrekonstruktion oder als intestinales Interponat benutzt werden kann.
2.2.5 Parasympathische Afferenz
Die Afferenzen des Parasympathikus zeigen den gleichen, allerdings zentralwärts gerichteten anatomischen Verlauf wie die Efferenzen, d. h. ein efferentes parasympathisches Nervenbündel führt gleichzeitig auch afferente Fasern. Diese treffen sich konvergierend im N. vagus und in den Nn. pelvici (▶ Abb. 2.1). Die in mehreren Lehrbüchern vertretene Auffassung, dass die Afferenzen des Parasympathikus nur einen unwesentlichen Anteil der nervalen Struktur ausmachen, steht im Gegensatz zu den 1994 veröffentlichten Untersuchungen von Linda Rinaman (Universität Pittsburgh, Pennsylvania) sowie von Grundy (Universität Sheffield, England). Die Untersuchungsergebnisse weisen darauf hin, dass ca. 80 % der Fasern des N. vagus eine afferente und nur etwa 20 % eine efferente Funktion haben. Dies bedeutet, dass eine sehr enge Beziehung zwischen dem gesamten Gastrointestinaltrakt, dem Hirnstamm und dem Hypothalamus besteht. Ein Teil der afferenten Fasern des N. vagus tritt mit den spinalen Kerngebieten des N. trigeminus, vor allem aber wohl mit dem Nucleus terminalis tractus spinalis und mit der Hintersäule des 1. und 2. Halssegments in Verbindung ▶ [69]. Bei Erkrankungen im Versorgungsbereich des N. vagus kann es also durch Reizung der afferenten parasympathischen Fasern zu einer Reizung der spinalen Kerngebiete des N. trigeminus sowie der Hintersäule in Höhe des 1. – 3. Zervikalsegments mit entsprechenden klinischen Beschwerden (Gesichtsschmerz, Zervikozephalgie).
Abb. 2.1 Viszeral efferent/afferente Innervation als Grundlage der mesorhombospinalen Organisation der vegetativen Reflexe (modifiziert nach Fulton).
Die sensible Versorgung des Intestinums ist gewährleistet durch den afferenten Sympathikus, der als eigentliche schmerzleitende Struktur anzusehen ist, während der afferente Parasympathikus eher spezifische Organempfindungen vermittelt. So ist der Schmerz bei Cholezystitis oder einer Gastritis vom Sympathikus übermittelt, während das Unwohlsein, die Übelkeit und der Brechreiz über die parasympathischen Afferenzen ablaufen.
2.2.6 Afferenz des N. phrenicus
Eine Besonderheit, die nicht das vegetative Nervensystem, sondern den N. phrenicus betrifft, soll hier erwähnt werden, da sie klinische Relevanz hat. Die Hauptaufgabe des N. phrenicus besteht in der motorischen Versorgung des Zwerchfells. Zusätzlich verlaufen in ihm sensorische Afferenzen der unteren Pleura, des Perikards, des Peritoneums subdiaphragmal sowie des Peritonealüberzugs der Leber und des Pankreas. Weitere klinische Beobachtungen lassen eine noch ausgedehntere afferente Versorgung durch den N. phrenicus als wahrscheinlich erscheinen, zumal Schulterschmerzen und sensomotorische Störungen im 3. – 5. Zervikalsegment, dem Kerngebiet des N. phrenicus, nicht nur bei Entzündungen des thorakalen Raumes und des Oberbauchs auftreten, sondern ebenso bei Erkrankungen der Organe des kleinen Beckens (Adnexe, Uterus, Samenbläschen und Prostata). Da die Kerngebiete des N. phrenicus nicht nur konstant im 3. – 5. Halssegment ausgebildet, sondern immer wieder über die Segmente C3 – C7 oder C8 verteilt sind, können bei Abdominalerkrankungen reflektorisch Beschwerden in diesen entsprechenden Halssegmenten auftreten ▶ [69].
Die etwas ausführlichere Beschreibung der Topografie insbesondere der peripheren vegetativen Strukturen erfolgt unter dem Aspekt, dem Leser die Vielfältigkeit der Verteilungswege des Sympathikus und Parasympathikus zu vermitteln und zu verdeutlichen, die mit dem Verlauf des peripheren vegetativen Nervensystems assoziierten Strukturen orientierend zu diagnostischen und therapeutischen Anwendungen von Lokalanästhetika benutzt werden können.
Beachte
Die Topografie des vegetativen Nervensystems ist eine der Grundlagen der Neuraltherapie und Voraussetzung für die gesamte Injektionstechnik.
Die Kenntnis um die makro- und mikroskopische Anatomie sowie die neurophysiologischen Zusammenhänge helfen bei der Klärung pathogenetischer und ätiologischer Zusammenhänge der vielseitigen Symptomatiken „idiopathischer Erkrankungen“. Die differenzierte Benutzung dieses Systems zu Diagnostik und Therapie ermöglicht eine fachübergreifende Anwendung.
3 Grundregulationssystem nach Pischinger und Heine
3.1 Einleitung
„Der Zellbegriff ist genau genommen nur eine morphologische Abstraktion. Biologisch gesehen kann er nicht ohne das Lebensmilieu der Zelle betrachtet werden“▶ [399], ▶ [400]. Dieses Zitat Pischingers verdeutlicht den Unterschied zwischen der Virchow‘schen Zellenlehre und der heute geforderten Denkweise, die Zelle in einen funktionellen Zusammenhang zum Gesamtorganismus zu stellen. Die Vorstellung Virchows, dass jede Zelle eines Organismus für sich alleine einen Elementarorganismus darstellt, der im arbeitsteiligen Verbund die Funktion des Ganzen ermöglicht, vernachlässigt nach Pischingers Ansicht das Milieu, das für jede Zelle die Grundlage ihrer Existenz bedeutet.
Das Milieu stellt im Wesentlichen das Ergebnis einer zellulären Funktion dar, ist also nach Virchow wiederum auf die Zelle als Elementarorganismus zurückzuführen. Somit besteht der Unterschied zwischen der Denkweise Virchows und Pischingers darin, dass von Virchow die Zelle selbst als Ureinheit eines Organismus betrachtet wird, während Pischinger von der spezifischen Zellleistung ausgeht. Virchows Denkweise schuf die Basis für die heutige bis in den molekularen Bereich gehende Aufklärung bezüglich der Zusammensetzung des Elementarorganismus Zelle, während Pischinger und Heine die bis in molekulare Größen reichende Aufklärung der Funktion des unspezifischen Bindegewebes gelang.
Für die angewandte Medizin sind beide Blickrichtungen wichtig. Die eher statische Betrachtungsweise des Pathologen Virchow dient zur Erkennung und Beschreibung der pathologischen Struktur, die dynamische Denkweise des Physiologen und Anatomen Pischinger zum Erkennen von Krankheitsabläufen. Die Konsequenz der Virchow‘schen Zellenlehre ist die in der heutigen Medizin übliche lineare Denkweise in Diagnostik und Therapie mit dem Risiko, durch die geringere Berücksichtigung der hochgradigen Vernetzung aller organischen Systeme die kausalen Zusammenhänge, insbesondere der chronischen Erkrankung, nicht oder nur unvollständig zu erkennen. Das Ergebnis findet sich in einer vornehmlich symptomatisch ausgerichteten Therapie chronischer Erkrankungen durch Medikamente (Antihypertonika, Antirheumatika, Antipyretika u. a.), die die Symptome eines Krankheitsbilds stetig supprimieren, was gleichzeitig bedeutet, dass mit Absetzen der Medikation die Symptome wieder auftreten. Dagegen erlaubt die auf Pischinger zurückgehende Denkweise durch die gleichzeitige Betrachtung der Funktion des Grundregulationssystems, in Diagnostik und Therapie Einfluss auf erkrankte Organe und Organsysteme zu nehmen unter Ausnutzung der Eigenregulation des Organismus.
Vor Virchow und Pischinger hatten die Pathologen Bordeu aus Paris und Reichert aus Dorpat in den Jahren 1767 bzw. 1854 auf die Bedeutung des Bindegewebes hingewiesen, das neben der mechanischen und stützenden Funktion im Wesentlichen die der Mikrozirkulation, des Stoffwechsels zwischen Kapillare und Zellsystem innehat. Pischinger erkannte, dass dem Bindegewebe nicht nur eine statische, filternde Funktion in der Zellversorgung zukam, sondern dass aufgrund der gleichförmigen Zusammensetzung des Extrazellularraums eine den gesamten Organismus durchziehende Struktur für alle zellulären Funktionen des Organismus wie auch für die auf ihn treffenden inneren und äußeren Reize gefunden war.
In der schematisierten Zeichnung (▶ Abb. 3.1) ist das System der Grundregulation dargestellt. Für den kapillaren Schenkel, bestehend aus arterieller, venöser und lymphatischer Kapillare, steht die angeschnittene einzelne Kapillare. Über das Gefäßsystem erfolgt der Zu- und Abstrom von Sauerstoff und Nährstoffen, Botenstoffen und Zellstoffwechselprodukten sowie Zellen für immunologische Vorgänge.
Abb. 3.1 Schematische Darstellung des Systems der Grundregulation modifiziert nach Pischinger und Heine, basierend aus der funktionellen Einheit von Kapillare, vegetativer Endformation, freier Zelle und der Grundsubstanz.
Die vegetative Endformation ist durch 2 terminale Axone vertreten, deren efferente Impulsabgabe und Neurotransmitter (Acetylcholin, Adrenalin) die afferente Impulsaufnahme ermöglicht, moduliert durch Veränderungen der Grundsubstanz (z.B. Stoffwechselprodukte, Hormone, Neuropeptide). Nach Fujita▶ [154] und Heine▶ [204] bestehen zusätzlich synaptische Verbindungen der vegetativen Endformation mit sogenannten Paraneuronen, die über Transmitterfreisetzung auf spezifisch arbeitende Zellsysteme (z. B. Schleimhautzellen), aber auch rückkoppelnd auf das Interstitium Einfluss nehmen. Die freie zelluläre Komponente des Grundregulationssystems ist dargestellt durch den pluripotenten Fibrozyten, der über seine Zellfortsätze mit ca 30 % aller Fibrozyten kommuniziert und der für die Synthese der Grundsubstanz und der Produktion von Kollagen und Elastin zuständig ist, wie auch für die Zellneubildung u. a. immunkompetenter Zellen, durch die Mastzelle dargestellt als Beispiel einer Gewebehormon produzierenden Zelle sowie durch die Abwehrzelle (Makrophagen), die für die immunologische Verarbeitung und Weitergabe von Abbauprodukten, Viren und Bakterien u. a. m. zuständig ist. Weitere Zellen, die immunologisch wie auch für die Entsorgung der Grundsubstanz arbeiten, sind als Beispiel in ▶ Abb. 3.1 aufgeführt.
Die Grundsubstanz ist dargestellt als homogene extrazelluläre Flüssigkeit in einem das gesamte Interstitium durchwebenden Netzwerk von Glykosaminoglykanen (Hyaluronsäure und Heparin) als langgestreckte Polysaccharidketten, die mit bürstenförmigen, kurzkettigen Proteoglykanen besetzt sind. Durch ihre Ladung und Struktur ist dieses Netzwerk zur Wasserbindung und zum Ionenaustausch befähigt, also zur Isotonie, Isoionie und Isoosmie. Das System der Grundregulation findet sich im gesamten Organismus als Interstitium.
3.2 Struktur und Funktion
Die Interzellularstruktur besteht grundsätzlich aus den pluripotenten Fibrozyten, die u. a. für die Synthese der strukturierten Anteile (Kollagen, Elastin) und die Interzellularsubstanz des Interstitiums zuständig sind, den Makrophagen, deren Funktion u. a. in der Phagozytose von pathologischen Interzellularstrukturen (Viren, Bakterien) besteht, den Kapillaren (arteriell, venös, lymphatisch), den