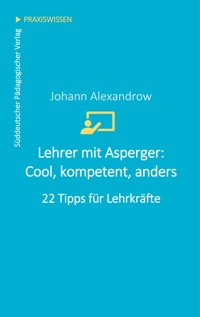
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Süddeutscher Pädagogischer Verlag GmbH
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Bei den Projekten mit seinen Schülerinnen und Schülern wurde Lehrer Johann Alexandrow mehrfach mit zum Teil bundesweiten Preisen ausgezeichnet. Allerdings ist Johann Alexandrow von Geburt an Autist. Die Diagnose erhielt er erst am Ende seiner 37-jährigen erfolgreichen Karriere als Lehrer. Wie er es geschafft hat, trotz seines anders verdrahteten Gehirns eine gute und kreative Lehrkraft zu werden, erschließt sich in diesem Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Manuela, die Frau an meiner Seite
Lehrer mit Asperger:Cool, kompetent, anders
22 Tipps für Lehrkräfte
vonJohann Alexandrow
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-944970-43-1 (Print)
ISBN 978-3-944970-44-8 (E-Book)
© 2024 Süddeutscher Pädagogischer Verlag GmbH
Silcherstr. 7a 70176 Stuttgart
www.spv-s.de
Gesamtverantwortung für Druck und Herstellung bei der Süddeutschen Pädagogischen Verlag GmbH.
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung vorbehalten.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Das in diesem Buch aus Gründen der besseren Lesbarkeit häufiger gewählte generische Maskulinum bezieht sich zugleich auf die männliche, die weibliche und andere Geschlechteridentitäten.
Die Weitergabe oder Vervielfältigung des E-Books ist ohne ausdrückliches Einverständnis des Verlages nicht erlaubt. Schon der Versuch einer solchen Urheberrechtsverletzung ist eine Straftat, die laut § 106 UrhG eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren mit sich ziehen kann.
Inhalt
Vorwort
1. Meine Kindheit
2. Meine Jugendzeit
3. Bei der Bundesmarine
4. Die Studienzeit
5. Die Referendarzeit
6. Aufbaustudium Beratungslehrer
7. Eigenverantwortlicher Unterricht
8. Für ein Jahr an einer Schule
9. Die Hauptschule auf dem Dorf
10. Die Londonfahrt
11. Die Wetterstation an der Hauptschule
12. Schultheater an der Hauptschule
13. Wettbewerb „Join Multimedia“
14. Elternarbeit an der Hauptschule
15. Intel®Lehren
16. Schulsponsoring – Computer für die Schule
17. Wettbewerb „Flucht und Vertreibung“
18. Filmprojekt „Graffiti“
19. Leitung des Kreismedienzentrums
20. Medienpädagogisch-informationstechnischer Berater
20. Die landkreisweiten Schulfilmtage
21. Das Projekt „Zeitung macht Schule“
22. Ein Comenius-Regio-Projekt mit Polen
23. Disziplinprobleme
24. Stärken und Talente nutzen
Literatur
Vorwort
Stellen Sie sich vor, Sie sind plötzlich Autist. Sie fühlen sich möglicherweise anfangs verwirrt und überfordert, da sich Ihre Wahrnehmung und Ihr Verständnis von der Welt verändert haben. Sie fühlen sich isoliert, da die sozialen Interaktionen für Sie schwieriger werden und Sie möglicherweise Schwierigkeiten haben, nonverbale Signale zu erkennen oder angemessen darauf zu reagieren. Gleichzeitig können Sie auch eine tiefe Verbundenheit mit bestimmten Interessen oder Aktivitäten spüren, die Ihnen Freude bereiten und in denen Sie aufgehen können. Ihr Gehör ist wesentlich empfindlicher als zuvor. Das führt dazu, dass laute Geräusche unangenehm oder sogar schmerzhaft sind. Sie haben sehr wahrscheinlich auch eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Berührungen. Das bedeutet, dass bestimmte Texturen oder Berührungen unangenehm sein können. Ihre Kommunikation verändert sich. Es fällt Ihnen möglicherweise schwerer, Ihre Gedanken verbal auszudrücken oder Gespräche flüssig zu führen. Struktur und Routine werden von großer Bedeutung. Sie geben Ihnen Sicherheit und helfen dabei, den Tag besser zu bewältigen. Manchmal kann es schwierig sein, Emotionen angemessen auszudrücken oder sie bei anderen Menschen richtig einzuschätzen – das kann frustrierend sein. Sie haben auf einmal ein starkes Bedürfnis nach visuellen Reizen. Farben, Muster oder Licht können eine große Faszination für Sie darstellen. Neue Situationen lösen Angst oder Stress aus, da Sie möglicherweise Schwierigkeiten haben, Veränderungen anzunehmen oder sich schnell an neue Umgebungen anzupassen.
Als autistisch gilt gemeinhin, wer sich nicht um seine Mitmenschen kümmert, nur seine eigenen Interessen im Blick hat, ohne Empathie und Gefühlsregungen ist, und kein Mitgefühl für andere aufbringt (vgl. Wilczek, 2018, S. 15). Tatsächlich aber ist Autismus diagnostisch eingeordnet unter tiefgreifende Entwicklungsstörungen und ist bei jedem anders ausgeprägt. Menschen mit dem Asperger-Syndrom haben eine ausgeprägte Reizfilterschwäche, alles stürmt gleichzeitig auf sie ein. Es bedeutet für Sie eine ganz erhebliche Anstrengung, den Alltag überhaupt normal zu bewältigen. „Am einfachsten versteht man das Asperger-Syndrom, wenn man es als die Beschreibung einer Person betrachtet, die die Welt anders als andere wahrnimmt und begreift.“ (Attwood, 2008, S. 15)
Oft fühlte ich mich wie ein Außerirdischer, wie im falschen Film in einer fremden Umgebung. Ich verstand es nicht, bei der Alltagskommunikation mit anderen Menschen zwischen den Zeilen zu lesen. So kam es, dass ich als Schüler immer als letzter in eine Fußballmannschaft gewählt wurde. Als Lehrer musste ich oft genug mit Fächern im Stundenplan vorliebnehmen, die ungeliebt waren, so wie Musik oder Technik. Generell zeigt die neueste Forschung, dass autistische Menschen viel mehr negative Lebensereignisse durchmachen müssen als Nicht-Autisten (vgl. Sedgewick et al., 2022, S. 95). Aber es gibt auch positive Seiten von Asperger.
Ein großer Vorteil, Asperger zu haben, ist die enorme Begeisterungsfähigkeit. Ist ein Asperger an einer Sache wirklich interessiert, gibt es keine halben Sachen. Das gilt vor allem, aber nicht nur, für die so genannten Spezialinteressen. Die zählen ja zu den Diagnosekriterien. Asperger-Betroffene setzen sich oftmals intensiv mit einer Thematik auseinander. Sie zeichnen sich nicht nur durch eine hohe intrinsische Motivation aus, sobald sie an einer Sache interessiert sind. Auch ihre Hartnäckigkeit kann beachtlich sein, ein Umstand, der sich gerade im Umgang mit Fehlschlägen bezahlt machen kann. Gibt es ein Problem, suchen Sie oft beharrlich und ausdauernd nach einer Lösung. Auch dann noch, wenn andere längst aufgegeben haben. Das mag bisweilen vergeblich sein, führt aber mitunter eben doch noch zum Ziel.“ (Huber, 2023, S. 52)
Falls Sie nun Tipps eines autistischen Lehrers für den Umgang mit und die Förderung autistischer Schüler erwarten: Nein, gerade das werden Sie in meinen Ausführungen nicht finden. Mir geht es vielmehr darum, die besonderen Fähigkeiten und Talente eines Lehrers mit Asperger-Autismus, die sich im Umgang mit den allermeisten Schülerinnen und Schülern als vorteilhaft erweisen, darzustellen. Ich werde in diesem kleinen Buch in erster Linie erfolgreich durchgeführte Projekte und Unterrichtsvorhaben vorstellen. Daraus ergeben sich letztendlich 22 hilfreiche Anregungen für die positive Entwicklung als Lehrkraft, die in allen Schularten in angepasster Weise Anwendung finden können. Und das gilt sowohl für behinderte als auch nichtbehinderte Lehrkräfte.
Ich bin also Autist, war immer mit Begeisterung Lehrer und möchte berichten, wie ich Erfolg hatte in meinem Berufsleben. Es ging mir dabei stets nicht darum, bei den Eltern der mir anvertrauten Schüler oder meinen Vorgesetzten gut dazustehen. Es ging mir in erster Linie um die von mir betreuten Schülerinnen und Schüler. Ich wollte etwas erreichen für sie und ihre Eltern. Aber nicht zuletzt wollte ich mich selber im Lehrerberuf weiterentwickeln. Das hat mich aufgrund sozialer Einschränkungen als Asperger gewaltige Kraftanstrengungen gekostet. Wie habe ich das geschafft? Ich habe ja erst mit 63 Jahren die Diagnose Asperger-Syndrom erhalten. Das ist ja von Haus aus schon ungewöhnlich. Vielleicht ist es auch spannend, zu erfahren, warum ich überhaupt den Lehrerberuf ergriffen habe. Dazu werde ich zunächst etwas aus meinem Leben in der Kindheit, als Schüler, der Zeit bei der Bundesmarine und im Studium erzählen.
37 Jahre lang habe ich recht erfolgreich und ohne Elternbeschwerden an Mittelschulen unterrichtet. Ich wurde sogar einmal befördert. Schwierige Schüler, teilweise verzweifelte und im Berufsalltag rudernde Kollegen, manchmal die Schulleiter haben mir teilweise Anstrengungen bis zur Erschöpfung abgefordert. Viele Schüler bescheinigten mir von sich aus, ein cooler Lehrer zu sein. Das bedeutet aus Schülersicht: Besser geht’s nicht! Ich habe in der Arbeit an den verschiedenen Schulen fähige und faire Vorgesetzte kennengelernt. Manche von ihnen konnten allerdings mein manchmal introvertiertes Verhalten nicht einordnen. Für mich im täglichen Umgang problematisch und aus Asperger-Sicht manchmal herausfordernd waren in erster Linie die Männer im Lehrerberuf. Ich weiß bis heute nicht, ob es dabei um Rivalität ging oder die unbewusste Reaktion auf meine Hochbegabung oder mein Anderssein. Mit den Lehrerinnen bin ich immer gut ausgekommen. Die zentrale Frage aber ist zunächst: Wie kann man als Asperger in einem Beruf bestehen, der auch für neurotypische Menschen anstrengend genug ist? Wie funktioniert das mit einer angeborenen Reizfilterschwäche? Denn nichts anderes ist Asperger. Alle Reize von außen, das, was man sieht oder hört, stürmte ohne Unterlass auf mich ein. Auch Berührungen und Gerüche gehörten dazu. Und dann hatte ich auf einmal einen Rektor, der mir oft meinen Arm tätschelte und mir auf die Schulter klopfte. Das war mir unangenehm. Das war ein Schulleiter gewesen, der sich in den Klassen durchsetzte. Seine Stimme schallte oft dröhnend durchs Schulhaus. Viele Schüler hatten Angst vor ihm. Dabei ist nach meiner Auffassung Angst gar nicht gut für Lernprozesse in der Schule. Manches im Schuldienst fand ich ungerecht und nicht zielführend. Ein weiteres Merkmal von Asperger ist nämlich ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Aber eins nach dem anderen. Ich möchte meine Strategien erläutern, mit denen ich 37 Jahre Schuldienst bewältigt habe. Ich werde also weitgehend die positive Seite der Medaille schildern und dazu Tipps geben. Ausgesprochen negative Erlebnisse im Umgang mit Vorgesetzten habe ich weggelassen oder nur als Randnotiz wiedergegeben. Meine Dienstorte habe ich bis auf wenige Ausnahmen geändert. Die Namen der Kolleginnen und Kollegen habe ich aus Gründen des Datenschutzes unkenntlich gemacht. Als Einführung möchte ich also zu Beginn etwas aus meinem Leben erzählen. Eine kleine Biografie soll zunächst einen Einblick geben, wer ich bin, mit welchen Problemen ich aufgewachsen bin und wie das meine Berufswahl beeinflusst hat.
1. Meine Kindheit
Ich bin im Jahr 1959 geboren. Im März 1959 hatte es im Mittel 2,4 Grad Celsius in meinem Geburtsort Einbeck. Das kann man heutzutage im Internet nachsehen. Es war ein schönes Städtchen mit heute 30.000 Einwohnern gewesen, in das es meine Eltern verschlagen hatte. Da gab es sogar damals schon eine Bürgermeisterin. Viele Jahrzehnte später erlebte ich es, dass gestandene Männer in einem kleinen Provinzstädtchen genau das verhindern wollten. Eine Frau als Bürgermeisterin? Das war ja noch nie da gewesen! Ich war im zarten Alter von sechs Monaten, da zogen meine Eltern aus Niedersachsen schon wieder nach Baden-Württemberg um. Mein Vater hatte gerade seinen Meister im Maschinenbau in der Tasche und wollte beruflich vorankommen. Diese Umzüge sollten sich noch oft in meinem Leben wiederholen. Evangelisch getauft wurde ich noch in dem Bundesland, in dem ich zur Welt kam. Die ersten bewussten Erinnerungen hatte ich dann in Plochingen in Baden-Württemberg. Dort blieben meine Eltern immerhin fünf Jahre. Einen Kindergarten besuchte ich nie, denn es gab damals zu wenige Kindergartenplätze. Vielleicht wären den Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen damals schon einige meiner Eigenheiten aufgefallen. Ich war ein ruhiges und verträumtes Kind und spielte am liebsten alleine mit meinen Legosteinen oder ich malte auf einer großen Schiefertafel. Davon gibt es noch ein Foto zusammen mit meinem Opa mütterlicherseits. Den Großvater lernte ich bewusst aber nur dieses eine Mal kennen. Kurz darauf starb er beim Mittagsschlaf im Alter von siebzig Jahren. Er war ein starker Zigarrenraucher gewesen. Bei einem der seltenen Besuche hatte er mir ein kleines Spielzeug-Segelflugzeug mitgebracht, das man mit einer Gummischleuder starten konnte. Prompt landete es nach einigen Flugversuchen auf dem Garagendach. Mit Hilfe meines Opas kletterte ich darauf und rettete das Flugzeug. Dieses Erlebnis werde ich nie vergessen. Meinen anderen Opa, den Vater meines Vaters, lernte ich nie kennen. Der hatte vor dem Zweiten Weltkrieg als Deutscher in Polen eine Strumpffabrik zusammen mit einem ehemaligen Lehrer, ebenfalls einem Deutschen, betrieben. Diese Fabrik war in dem kleinen Städtchen Alexandrow in der Nähe von Lodz in Polen errichtet worden. Die Auslieferung der Strumpfwaren erfolgte damals noch mit einem Pferdefuhrwerk. Eine ganze Zeit vor dem Krieg lebten in Alexandrow bei Lodz etwa je ein Drittel Juden, Polen und Deutsche friedlich miteinander. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten änderte sich allmählich das Klima. Deutsche und jüdische Kinder durften auf behördliche Anordnung plötzlich nicht mehr miteinander spielen. Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht am 7. September 1939 begann man mit der Deportation der jüdischen Bevölkerung. Es hieß, sie kämen in das Generalgouvernement. Mein Opa Johann sagte bereits damals: „Wir haben den Krieg verloren.“ Nach der Besetzung durch die Rote Armee im Jahr 1945 war seine Frau Lydia mit den vier kleinen Kindern in den Westen geflohen. Mein Großvater hielt die Stellung, weil er an das Gute in den Menschen glaubte. In seinen letzten Tagen wurde er in den Straßen von Alexandrow beim Betteln um Brot gesehen. Sein Haus durfte er nicht mehr betreten. Irgendwann später musste er schließlich am Waldrand sein eigenes Grab schaufeln und wurde kurzerhand erschossen. So wuchs ich irgendwann fast ohne Großeltern auf. Übrig war zunächst die Mutter meines Vaters geblieben. Sie besuchten wir öfter am Wochenende in ihrem Reihenhäuschen in Nürnberg. Als sie starb, ging ich in die vierte Klasse. Ich musste bei der Beerdigung als einziges Kind mitgehen, um hinter einer Art Schaufenster ihre aufgebahrte Leiche anzusehen. Das war für mich ganz furchtbar und es hätte mir fast den Boden unter den Füßen weggezogen und ich wäre umgefallen. Das bemerkte aber niemand. Meine Mutter war ausgebildete Kinderpflegerin. Sie arbeitete nach der Heirat aber nie wieder in ihrem Beruf und blieb als Hausfrau daheim. Mein Vater war nach seiner Gesellenzeit zunächst Meister im Maschinenbau. Dann bildete er sich nebenbei zum Ingenieur weiter. Außerdem studierte er noch nebenberuflich Betriebswirtschaft und erwarb einen weiteren Abschluss. Da er sich immer wieder eine noch besser bezahlte leitende Stellung suchte, zogen wir oft um. Meine Mutter sorgte für den Haushalt und uns insgesamt vier Kinder. Mein Vater lernte und arbeitete.
Im Alter von drei Jahren erlitt ich im Haus einen traumatischen Unfall beim Spielen mit meinem Vater. Ich weiß nur noch, dass er im Flur mit mir Fangen spielte. Ich rannte los, und irgendwann fing er mich nicht mehr auf. Beim Springen stürzte ich durch die Glastür im Flur. Das Glas splitterte, ich lag in einem Haufen Scherben und unter meiner Nase quoll das Blut hervor. Ich wurde auf den Wohnzimmertisch gelegt und bekam ein Pflaster. Genäht wurde nichts. Die Narbe über meiner Oberlippe ist heute noch sichtbar.
Aus der Kleinstadt in Baden-Württemberg zog ich im Alter von fünf Jahren mit meinen Eltern in ein anderes Städtchen in der Nähe von Nürnberg. Dort lernte ich das Fahrradfahren in einem kleinen Innenhof. Zunächst fuhr ich mit Stützrädern. Das ging natürlich ganz gut. Irgendwann aber montierte mein Vater die Stützräder ab. Dann fuhr ich los und stürzte oft. Aber irgendwann konnte ich mich dann auf dem Fahrrad halten. In Roth bei Nürnberg wurde ich eingeschult. Ich besitze heute noch ein Foto, auf dem ich mit meiner Schultüte neben einem kleinen Kachelofen stehe. Ich hatte mich damals sehr auf die Schule gefreut. Ich wollte unbedingt lesen und schreiben lernen. Vier Wochen nach meiner Einschulung zogen wir nach Schwabach. Ich hatte Mühe, mich in meiner neuen Umgebung zurechtzufinden. Ich hatte keine Freunde, und manchmal bedrohten und schlugen mich die Mitschüler. Ich flüchtete mich in die Welt der Bücher, und schon bald verschlang ich unter anderem die Abenteuer von Winnetou und Old Shatterhand. Mit meinen beiden Schwestern, die ein und fünf Jahre jünger waren, spielte ich kaum. Meist blieb ich für mich alleine und las oder malte. Oft war ich auch draußen in der Natur zu finden. Im Alter von acht Jahren bekam ich noch einen Bruder. Meine Eltern hatten damit vier Kinder. In der Schule war ich in allen Fächern ziemlich gut. Die Zeugnisbemerkung in der dritten Klasse gab einen Hinweis darauf, ich solle im Unterricht wieder reger mitarbeiten. Mein Betragen sei recht gut. In der vierten Klasse hatte ich fast nur Einsen. Die Lehrerin schrieb, ich sei ein anständiger, strebsamer und zuverlässiger Schüler, der aus eigenem Antrieb heraus seine Pflichten erfülle. Fleiß und Betragen verdienten volles Lob. Und so kam ich im Alter von zehn Jahren auf das Gymnasium.
2. Meine Jugendzeit
Nachdem ich auf der Grundschule ziemlich gut gewesen war, änderte sich das auf dem Gymnasium schon zum Teil. In der fünften Klasse erbrachte ich in den meisten Fächern nur durchschnittliche Schulleistungen. In Kunsterziehung, Musik, Sport und im Schreiben dagegen waren meine Leistungen gut. Dann zogen wir nach Ansbach. Dort gefiel es meinem Vater in seinem Betrieb nicht. So blieben wir dort leider nur ein Jahr. Anschließend verbrachten wir zwei Jahre in dem kleinen Städtchen Westerburg im Westerwald. Der Schulwechsel in ein anderes Bundesland tat mir gar nicht gut. Meine Leistungen waren in der neunten Klasse so weit abgefallen, dass ich fast sitzen geblieben wäre. Vielleicht lag das auch daran, dass ich als dritte Fremdsprache ein Jahr lang Französisch hatte. Es könnte aber auch an der Pubertät gelegen haben. In dieser Situation bot mir unser damaliger Vermieter eine Stelle als Maurerlehrling an. Glücklicherweise zogen wir aber dann wieder zurück nach Bayern. Am Steller–Gymnasium in Bad Windsheim verbrachte ich meine restliche Schulzeit ohne weitere größere Beanstandungen. In allen meinen Zeugnissen wurde allerdings immer meine zurückhaltende Mitarbeit im Unterricht bemängelt. Da vor allem mein Vater sehr streng war, bekam ich ab der Note befriedigend oder schlechter Probleme. Manchmal rastete er regelrecht aus. Schläge wie in meiner Kindheit bekam ich aber zum Glück keine mehr. Allerdings entwickelte ich mit der Zeit eine regelrechte Angst vor dem Fach Mathematik. Das lag aber auch zum Teil daran, dass ich mit dem mit seiner Familie im gleichen Haus wohnenden Wolfgang E. gemeinsam die Mathe-Hausaufgaben machen sollte. Weil er in dem Fach viel flinker war als ich und mir nichts erklären konnte oder wollte, blieb mir nur das Abschreiben der gelösten Aufgaben. So hatte ich natürlich Schwierigkeiten bei den anstehenden Probearbeiten. Dennoch erhielt ich einmal 7 und einmal 10 Punkte in Mathematik, also immerhin eine zwei minus und eine drei minus. Die Lust an diesem Fach aber hatte ich ein für alle Mal verloren. Insgesamt aber musste ich mich kaum für die Probearbeiten vorbereiten. Dennoch litt ich unter Schulangst. Ich sorgte selbst für Auszeiten und verschaffte mir gelegentlich einige Krankheitstage zu Hause mit einem Trick. Ich löste zwei, drei Löffel gemahlene Muskatnuss in Wasser auf, hielt mir die Nase zu und schluckte das Zeug. Es schmeckte extrem eklig, aber war wirksam. Am nächsten Tag hatte ich Schwindelanfälle, ich war leichenblass und durfte mindestens einen Tag die Zeit im Bett verbringen. So hatte ich wieder Zeit, ein paar Bücher zu lesen. Irgendwann war die Schulzeit zu Ende und ich schloss mein Abitur mit guten Leistungen ab. Das war nicht selbstverständlich, denn ein gutes halbes Jahr vorher hatte sich meine Schwester Uschi umgebracht. Sie hatte es wohl schon vorher probiert gehabt mit Schlaftabletten. Das hatten meine Eltern aber vor uns anderen Kindern verheimlicht. Am Abend vor ihrem schließlich erfolgreichen Suizid war ich mit ihr noch gemeinsam zur Kirchenchorprobe gegangen. Sie war da schon außergewöhnlich schweigsam gewesen, noch mehr als sonst. Am nächsten Tag, es war ein 11. November gewesen, hatte mein kleiner Bruder Geburtstag. Als Geschenk von meiner Schwester hatte er einen kleinen Kaktus bekommen. Als ich von der Schule heimkam, hieß es, meine Schwester Uschi sei verschwunden. Einfach so, mitten im Unterricht, sei sie aufgestanden und gegangen. Das war ein Freitag gewesen. Die Suche nach der Vermissten begann aber erst in der darauffolgenden Woche. Da muss sie schon tot gewesen sein. Suchhunde waren nicht im Einsatz, sonst hätte man sie vielleicht noch retten können. Jedenfalls blieben uns etwa fünf Monate bange Ungewissheit, in denen ich mich auch nicht großartig auf das anstehende Abitur vorbereiten konnte. Ich muss in dieser Zeit noch weiter in mich gekehrt gewesen sein und hörte viel Musik. Im April 1978 entdeckten spielende Kinder die Leiche von Uschi in einem Gebüsch, nicht einmal einen Kilometer von unserer damaligen Wohnung entfernt. Meine Eltern mussten sie glücklicherweise nur anhand ihrer Armbanduhr und anderen persönlichen Gegenständen identifizieren, die man bei ihr gefunden hatte. Bei ihrer Beerdigung erinnere ich mich nur noch an einen weißen Sarg, der vorne stand. Viele Menschen auf dem Friedhof. Mein Physiklehrer hatte mich damals vor dem offenen Grab einfach in den Arm genommen. Seine Frau war einige Monate zuvor an Krebs gestorben. Ich verstand.
3. Bei der Bundesmarine
Wie das damals so üblich war, irgendwann erhielt ich im Alter von 18 Jahren meinen Einberufungsbescheid für den Grundwehrdienst als Wehrpflichtiger. Ich hatte mich vorher eingehend durch das Lesen von Informationsmaterial informiert. Ich wollte entweder Fallschirmspringer werden oder zur Marine, auf jeden Fall weit weg von zuhause. Leider war kurz vorher die dreijährige Dienstzeit für Offiziere bei der Marine abgeschafft worden. Das hätte ich toll gefunden. Vier Jahre Bundeswehr erschienen mir allerdings schon zu lang. So liebäugelte ich mit der zweijährigen Dienstzeit und der damit verbundenen Ausbildung zum Unteroffizier. Irgendwann musste ich dann zunächst einmal für drei Tage zum Eignungstest mit dem Zug nach Köln fahren. Dort wurde man auf Herz und Nieren, auf körperliche Belastbarkeit, die politische Einstellung und natürlich auch eingehend psychologisch getestet. Bei der medizinischen Untersuchung ergab sich, dass ich aufgrund einer Wirbelsäulenverkrümmung nicht Fallschirm springen durfte. Bei den psychologischen Tests stellte man fest, dass ich zur Ausbildung als Signäler geeignet war. Ich reagierte schnell auf optische und akustische Signale und konnte sie hervorragend wiedergeben. Auch waren meine Englischkenntnisse sehr gut. Infolgedessen würden später der Sprechfunk an Bord, das Signalisieren mit Flaggen und Lichtmorsen hauptsächlich meine Aufgaben bei der Marine an Bord sein. Am 23. Juni unterschrieb ich meine Verpflichtungserklärung für die zweijährige Dienstzeit bei der Bundesmarine. Ab dem 1. Oktober 1978 wurde meine Dienstzeit zunächst auf sechs Monate festgesetzt. Es ging sofort los mit der Grundausbildung der Ausbildungsreihe 27 in der Marinefernmeldeschule in Eckernförde. Da wurde uns zunächst das soldatische Rüstzeug, der Umgang mit den Waffen, das Marschieren, aber auch viel Theorie vermittelt. Auch Sanitätsausbildung und Englisch gehörten dazu. In Erinnerung blieb mir ein 40-Kilometer-Marsch mit Gepäck sowie ein Biwak bei 30 Grad Minustemperaturen. Bei dieser Übernachtung, die zum Glück nur einen Tag dauerte, lagen wir Matrosen frierend in voller Montur bei klirrender Kälte angezogen in unseren Schlafsäcken. Die Herren Offiziere und Unteroffiziere dagegen hatten es gemütlich warm am offenen Feuer. Die Eingewöhnungszeit an das Militärische war aber schnell vorbei. Nach der Grundausbildung in Eckernförde wurde ich vom 3. Januar bis zum 2. Juli 1979 der Marinefernmeldeschule in Flensburg zugewiesen. Vorher hatte ich noch über Weihnachten Heimaturlaub gehabt und war stolz in meiner schönen Matrosenuniform mit dem Zug nach Hause gefahren. Die Rückfahrt in Richtung Flensburg stellte sich aber als sehr abenteuerlich heraus. Es hatte geschneit wie seit Jahren nicht mehr. In Kiel ging es dann aufgrund der meterhohen Schneeverwehungen mit der Bahn nicht mehr weiter. Gut war es in dem Fall, in Uniform unterwegs zu sein. Wir wurden am Bahnhof in Kiel von Feldjägern empfangen und durften die Nacht in Kiel an Bord eines Versorgungsschiffes übernachten. Irgendwann war die Bahnstrecke dann wieder frei und es ging weiter nach Flensburg. Der Fachlehrgang für alle Marinesoldaten der Ausbildungsreihe 27 dauerte vom 8. Januar 1979 und endete am 2. April 1979. Wir lernten Fernmeldeorganisation, Signalbuchkunde, Sprechfunkverfahren, optische Fernmeldeverfahren, Kryptodienst, Morsen, Englisch und Fernmeldegerätekunde. Am 1. April wurde ich zum Gefreiten befördert und durfte am Maatenlehrgang teilnehmen. Dort ging es mit den gleichen Fächern weiter wie vorher. Dazu kam noch die Ausbildung zum Vorgesetzten. Waren meine Noten beim Grundlehrgang noch gut bis sehr gut gewesen, so fielen sie beim Maatenlehrgang eher befriedigend bis gut aus. Ich war noch jung, aber es kostete doch sehr viel Kraft, mit den anderen mitzuhalten. Am 3. Juli 1979 ging es zum ersten Mal an Bord. Ich war dem Minenabwehrgeschwader Nordsee zugeteilt worden. Mein erster Einsatz war auf dem Minenjagdboot Minden. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis ich mich an das Leben an Bord und auf See gewöhnt hatte. Anfangs grüßte ich jeden Offizier auch unter Deck militärisch, bis man mir sagte, dass das überflüssig sei. Man musste auch nicht immer bestimmte Uniformteile tragen. Nur beim Ein- und Auslaufen in die Häfen wurde manchmal erste Geige befohlen. Das war der dunkelblaue Paradeanzug der Marinesoldaten. Ich fügte mich wie ein Rädchen ein in das Getriebe auf dem 30 Meter langen Minenjagdboot „Minden“ mit 34 Mann Besatzung. Nur einmal – wir befanden uns auf hoher See –- warf ich gedankenlos die Waschmaschine an Bord an. Ich hatte nicht mitbekommen, dass das während der Seefahrt verboten ist, denn die Waschmaschine verbrauchte unseren wertvollen Trinkwasservorrat. Das hätte mir fast eine Disziplinarmaßnahme eingebracht. Da ich aber mein Fehlverhalten einsah und bei nächster Gelegenheit meine gesamte Bordzulage dem Waisenhaus in Minden – der Patenstadt unseres Bootes – spendete, ging ich straflos aus. Das lag sicher in erster Linie an unserem vollbärtigen, manchmal etwas kauzigen Kommandanten. Manchmal ließ er über die Bordlautsprecher „Dire Straits“ spielen, wenn er gut drauf war. Kapitänleutnant Walter Dagobert, von seinen Freunden liebevoll Donald genannt, lebt immer noch mit Frau und Sohn in einem kleinen Dorf in Ostfriesland. Hier erwarb er vor Jahren ein altes, 1836 erbautes Landhaus, das er in nicht gezählten Stunden wieder reparierte. Dabei legte der Ex-Offizier viel Wert auf die Verwendung wertvoller Antiquitäten, die heute sein Familiendomizil zieren und zu einem Schmuckstück im Dorf machen. Das reetgedeckte Wohnhaus verrät die Handschrift eines Menschen, der alten Traditionen gegenüber verpflichtet ist. Dafür hat Donald, so seine Freunde, ein feines Gespür für das Überlieferte der





























