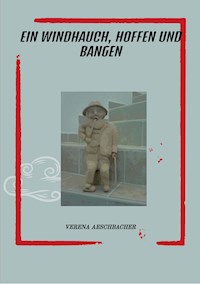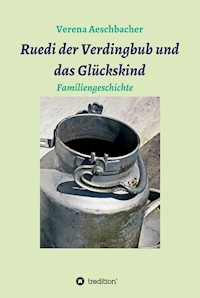9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vor über 30 Jahren von der Schweiz nach Südfrankreich ausgewandert. Endlich den wohlverdinten Ruhestand geniessen ist nun schwieriger geworden, dank der Pandemie. Aber wir schlagen uns recht tapfer. Wir umhäkeln "Bewohner" und sie dürfen sich rühmen, wenn sie denn in einem herrlichen Holzpuppenbett liegen können. Ab und zu bei einem Flohmarkt ausstellen und ein herzliches Verhältnis zu den Nachbarn im Quartier pflegen hilft, dass die Optik positiv bleibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
LEICHTIGKEIT ADE
Verena Aeschbacher
2022 Verena Aeschbacher
Lektorat: Erika Kühn, Dr. Elisabeth Steiner
ISBN Softcover: 978-3-347-69580-1
ISBN Hardcover: 978-3-347-69581-8
ISBN E-Book: 978-3-347-69582-5
ISBN Grossschrift: 978-3-347-69583-2
Druck und Distribution im Auftrag des Autors.
Tredition GmbH, An der Strusbek 10,
22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk einschliesslich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
Tredition GmbH „Impressumservice“
An der Strusbek 10, D-22926 Ahrensburg.
Herzlichen Dank an Therese Reichelt bei Tredition für Ihre grosse Geduld.
LEICHTIGKEIT ADE…
Das Leben nehmen wie es kommt! Il faut prendre la vie comme elle est! Dies waren die Worte von Claudine, natürlich in Französisch, bloss stimmen sie auch auf Deutsch. Wir schreiben bereits August 2021. Es war wettertechnisch ein erträglicher Sommer. Die Hitze hielt sich in Grenzen, das heisst die Temperaturen blieben mehrheitlich unter 40 Grad. Ab und zu bewölkte sich sogar der Himmel, und es gab auch manchmal einen kleinen, kurzen Regenguss. Nur das Sch…-Virus werden wir nicht so schnell los. Die Fallzahlen steigen überall wieder, denn schliesslich wollte während des Sommerurlaubs kaum jemand zu Hause bleiben, also wurde das Zeug in der halben Welt rumgetragen. Die verschiedenen grossen Sportanlässe halfen dabei natürlich mit. Ruedi und ich leben unser bescheidenes Leben weiter. Wir fahren regelmässig unsere Radtouren und trinken unseren Morgenkaffee mehrheitlich am selben Ort. Wegen Corona mussten einige Betriebe schliessen, und somit wurde unser Vergnügen ziemlich eingeschränkt. Alles nur halb so schlimm. Wir dürfen zumindest wieder jemanden treffen. Allerdings tun wir dies nur, wenn die Menschen denn zweimal geimpft sind. Man spricht bereits von einer dritten Dosis und zwar für ältere Semester. Ich denke, dass wir auch in diese Kategorie gehören. Ich warte darauf, dass uns der Hausarzt, bei einer Kontrolle von Ruedi, in dieser Sache beraten und weiterhelfen wird.
Es klingelte an unserer Haustüre und beim Öffnen streckte mir Rodolphe, unser Nachbar von gegenüber, eine kleine Torte, noch in der Springform belassen, entgegen. „Nathalie hat gebacken, wiederum viel zu viel, und sie bat mich, Ihnen dieses Stück zu bringen.“ Ich bedankte mich fröhlich und brachte das Erhaltene wenig später im Kühlschank unter. Ruedi meinte abends, dass es sehr lecker sei, denn ich kann leider keine Schokolade mehr vertragen. Am nächsten Tag wollte ich natürlich die abgewaschene Form zurückbringen und dabei einen kleinen Handel mit Nathalie machen. Ich packte Erdbeermarmelade ein, denn ich weiss, dass sie diese sehr mögen, und so gedachte ich, sie in Stoffe umzutauschen. Rodolphe erhielt den Auftrag, den grossen, schweren Koffer aus dem Obergeschoss zu holen. Nathalie und ich begutachteten nun gemeinsam dessen Inhalt. Sie legte zwei, drei Stücke zur Seite, denn für ihre Arlesienne- Kostüme könne sie noch einige Krawatten oder Dekorationen davon fertigen. „Aber alles andere gehört nun Ihnen.“ Ich stand vor einem sehr grossen Haufen und fragte: „Wie kriege ich den am besten rüber zu uns?“ „Ich helfe Ihnen dabei“, und schon holte Nathalie drei riesige Tüten, um alles darin zu verstauen. Sie half mir anschliessend noch beim Tragen. Ich leerte vorerst alles in unserem Gästezimmer auf den Boden, damit ich die Tüten gleich zurückgeben konnte. Mein Herz konnte sich vor lauter Freude kaum mehr beruhigen, denn die Stoffe blinkten in allen möglichen Farben in meine Richtung, und meine Gedanken schlugen gleich ein paar übermütige Purzelbäume. Natürlich konnte ich dieser bunten Vielfalt nicht lange wiederstehen, denn ich hatte von Claudine vorgestern ebenfalls eine Kiste mit Stoffen bekommen. Eigentlich sollte die Wäsche gebügelt werden, aber das liess ich für einmal bleiben und hielt mich an das Motto meiner jüngsten Schwester, die immer meinte, dass man sich vorgängig mit etwas Schönem motivieren solle. Sie spielt leidenschaftlich gerne Volksmusik auf einem „Schwyzerörgeli“ (eine Variante des diatonischen Akkordeons). Bevor sie eine Arbeit in Angriff nahm, griff sie sich ihr Akkordeon und legte los. Wie sie mir lachend gestand, funktioniert das Spielen beim Kochen nicht optimal. Ich kann diese Worte nur unterstreichen, denn bei mir geht das Telefonieren und Kochen nicht zusammen. Na gut, Bügelwäsche kann zum Glück nicht anbrennen, und sie wartet auch noch einen Tag länger auf das Eisen. Ich schnitt und kombinierte und vergass das Virus und die Zeit komplett. Ein erstaunter Blick zur Uhr, „oh, schon Essenszeit“, ich hetzte nach oben und stellte mich an den Herd. Ein solcher Nachmittag ist im Flug vorbei und im Kopf kreiert es immer noch weiter. Derartige Beschäftigungen sind Seelenbalsam in einer Pandemiezeit.
Die haben hier im Süden bei den Ämtern aber ein Arbeitstempo, da kommt man mit Staunen gar nicht mehr hinterher. Mitte Oktober 2020 stellte ich meinen Antrag zur Verlängerung meiner Aufenthaltsbewilligung. Dies muss man alle 10 Jahre tun. Eigentlich ist das keine grosse Sache, und vor allem ist es kein grosser Aufwand, denn nur zwei Zeilen müssen angepasst werden. Das heisst: Ablaufdatum und Tagesdatum. In fünf Minuten könnte man dies problemlos schaffen. Ich durfte dann zwei Monate später erst einmal das Provisorium persönlich abholen. Egal, ob Covid ist oder nicht, der Amtsschimmel kennt nur eine Spur. Jetzt, im Juli 2021, erhielt ich die Aufforderung, den endgültigen Ausweis persönlich abzuholen. Dummerweise kam der Brief zwei Tage nach dem anberaumten Termin bei mir an. Seit Jahren funktioniert die Postzustellung in den Sommermonaten mehr schlecht als recht. Natürlich kann man diese Ämter in der heutigen Zeit nicht einfach schnell anrufen, nein, man kann sie nur über Internet erreichen, wenn die Adresse denn funktioniert. Nach -zig Versuchen schien es geklappt zu haben, und ich erhielt den Bescheid, dass ich am Tag X pünktlich zu erscheinen hätte, ansonsten würde alles nach hinten verschoben. Bei meinem Eintreffen standen mindestens zwanzig Personen vor dem Amt. Ein Sicherheitsmann kontrollierte Handtaschen und andere mitgeführte Behältnisse. Schon sass ich im Warteraum. Nach einer Viertelstunde hielt ich endlich meine Bewilligung in den Händen und durfte nach Hause. Das Erstellen nahm ganze acht Monate in Anspruch, da ist jede Schnecke im Vergleich ein Raser. Die Angestellten dieser Ämter führen sich seit immer auf wie kleine Herrgötter. Man darf nur ja nicht aufmucken, sonst hat man schon verloren. Auch meine Händler-Karte sollte verlängert werden. Wir sind ja Rentner, aber wenn man mehrmals pro Jahr ausstellen will, muss die Bewilligung à jour sein. Ich will eben auch keinen Ärger, denn bis jetzt hielt ich mich exakt an die Vorgaben. Ich stellte meinen Antrag und lieferte die geforderten Papiere mit. Eine Woche später hielt ich alles wieder in den Händen, denn man verlangte noch ein zusätzliches Papier. Es ist oft eine Salamitaktik, denn nur so hält man das Arbeitsvolumen künstlich hoch. Ich wurde wieder einmal wütend und schrieb auf einem Stück Papier, dass ich davon absehen werde, wenn das so kompliziert sei, denn wir wären beide über 70 Jahre alt und natürlich seien wir Rentner. Ich hätte mich gerne an die Gesetze gehalten, aber ich könne dies natürlich auch lassen und Schwarz arbeiten gehen wie viele andere auch. Postwendend erhielt ich einen Anruf, dass ja alles bestens sei, und ich könne meine Karte abholen. Ich antwortete, dass man mir diese doch postalisch zustellen könne, denn wegen dem Virus wolle ich nicht selber erscheinen. Man akzeptierte. Auch hier waren nur die Daten zu ändern. Für einmal geschah das Ganze beinahe in Lichtgeschwindigkeit, denn es dauerte nur einen Monat. Was könnte man sonst noch so beklagen? Natürlich die Telefonie! Ich habe ein Grossmutterhandy, welches ich selten benutze, das heisst, nur als Pannengerät oder wenn wir Sport machen oder ich alleine unterwegs bin. Ich habe eine Prepaid-Karte, denn die ist günstiger als ein Abonnement. Pro Jahr lade ich mir 100 Euro drauf, damit ich das längst mögliche Ablaufdatum erreichen kann, nämlich ein Jahr. Bei kleineren Summen ist das Verfalldatum sehr kurz, das heisst bei zehn Euro auch gleich zehn Tage. Vorletzte Woche, als unser Haustelefon wieder einmal nicht funktionierte, kontrollierte ich den Handy-Betrag. Der Roboter meldete mir, dass ich noch 95 Euro Guthaben hätte. Wunderbar. Eine Woche später, ich wollte Ruedi anrufen, denn wir hatten uns beim Radfahren für einmal verloren. Der Roboter erzählte mir auch gleich, dass mein Guthaben nicht mehr existiere. Da schluckte ich doch schwer, denn die Telefongesellschaft hatte sich getraut, meine 95 Euro kommentarlos abzubuchen, wegen des Verfalldatums. Ja, so wird man als Gesellschaft reich und reicher. Stinksauer war ich, und beim Nachhausekommen rief ich wutentbrannt bei der Gesellschaft an. Für einmal hatte ich einen Menschen am Draht, was einem kleinen Wunder gleichkam. Ich schrie förmlich ins Telefon, dass man mir gerade 95 Euro klaute und das sei wirklich eine Schande. Der Mensch am anderen Ende versprach mir dann hoch und heilig, dass, wenn ich eine Kleinigkeit auflade, sie mir in fünf Tagen den gestohlenen Betrag ausnahmsweise wieder gutschreiben würden. Es sind bereits zehn Tage verstrichen, und noch ist nichts in Sicht. Wiederum angerufen und eine erneute Zusicherung erhalten, dass in etwa einer Woche alles wieder auf meinem Konto sei. Ich warte ab, ansonsten muss ich wieder einen eingeschriebenen Brief an die Direktion schicken, vielleicht hilft es dann der Gesellschaft weiter. Wenn ich die Rechnung für den Hausanschluss bekomme, muss ich mich immer sputen, denn innerhalb drei, vier Tagen muss die Rechnung beglichen sein, ansonsten stellen die mir das Telefon gleich ab. Beim Geldeintreiben ist hier jedes Unternehmen Weltmeister. Mehrheitlich wird kein Handstreich getan, wenn nicht ein Drittel der Rechnung im Voraus bezahlt wird. Ein Zahlungsziel verpassen ergibt sofort einen Aufpreis von 10 % der geforderten Summe. Da lernt man hurtig was Sache ist, denn sonst kann man sein Geld nur so wegflattern sehen. A propos: Gerade konnte ich im „Midi libre“ lesen, dass in unserem Departement in einer Gemeinde mit etwas über 80 Einwohnern seit zwei Monaten weder Internet noch Telefon benutzt werden kann. Es handelt sich um eine Gemeinde, die etwas abgelegen liegt. Einer Einwohnerin hätte Orange (die Telefongesellschaft) erklärt, dass vor Dezember nichts laufen werde, und wir haben gerade mal August. Man kenne zwar das Problem, aber man könne nichts oder nur wenig tun, um die Gegebenheiten zu verbessern. Aber in etwa anderthalb Jahren würde man die Gemeinde mit Glasfaser versorgen und dann solle alles besser werden. Da kommt doch leise Hoffnung auf, denn bei der Pandemie kann man noch kein Ende in Aussicht stellen.
Am letzten Sonntag unternahmen wir eine Ausfahrt mit unseren Rädern. Hoch zu Miggu, runter nach Collias und weiter nach Sanilhac. Eigentlich gedachten wir, unseren Kaffee gegenüber der Bäckerei unter den alten Bäumen zu trinken. Die Bäckerei war geschlossen, Ruhetag. Zwanzig Meter weiter weg gibt es ein Restaurant, welches ebenfalls als Bar funktioniere, hiess es auf einem Plakat. Hier bekommt man bei den Restaurants nur Mittag- und Abendessen, aber man kann nie einfach nur ein Getränk ordern. Eine Bar serviert sämtliche Getränke und manchmal vielleicht einen vorgefertigten Snack, wenn überhaupt. Also standen wir wenig später vor der Bar. Die Türe war offen und eine neugierige Bedienung blickte uns entgegen. Ein jüngerer Mann (es war der Gastwirt selber) kam zur Türe und fragte: „Sind Sie geimpft?“ „Ja.“ „Dann nehmen Sie bitte Platz.“ Zwei Minuten später sassen wir unter den Maulbeerbäumen an einem kleinen Tisch, welcher mit weissem Wachstuch belegt war. Der Wirt kommt und fragt nach dem „Pass sanitaire“. Ruedi zeigt sein Handy mit unseren QR-Codes. Alles bestens. Der Wirt hat auf seinem Handy eine App, mit der er unsere Codes einscannen kann. Wir bekommen den bestellten Kaffee und das Hörnchen. Ich frage nun den Wirt, ob er denn Leute wegweisen musste. „Jeden Tag mindestens 15 Personen. Es waren dies nicht nur junge Menschen, nein, auch solche in Ihrem Alter.“ Ja, die Polizei mache regelmässig Kontrollen und schaue nach, ob die anwesende Kundschaft eingescannt sei. In Uzès, zum Beispiel, musste ein Barbesitzer für vier Tage schliessen, weil er die Kontrollen der Gesundheitspässe nicht machte. Zudem bekommt er noch eine Busse von ein paar Tausend Euro. „Sie sehen, es lohnt sich nicht.“ Ich bin natürlich ein Befürworter dieser Kontrollen, denn sie bieten auch Sicherheit für alle Gäste. Dieser Wirt erzählte mir auch, dass seine ganze Familie und sein Personal vollständig geimpft seien. Ruedi und ich hatten uns nach all diesen Ausführungen vorgenommen, noch mehrmals dort unseren Kaffee zu trinken. Es ist nämlich auch ein stimmungsvoller Ort. Man sitzt wunderbar schön unter dem Blätterdach der Maulbeerbäume und geniesst dabei einen herrlichen Blick über die Reben- und Olivenfelder bis hin zur nahen Hügelkette. Man hat Platz genug, um die Abstände einzuhalten, und man hat die Sicherheit des geimpften Personals. Besser geht es kaum in einer Pandemie.
Heute fuhren wir unsere Kaffeetour. Ich habe seit ewigen Zeiten die Angewohnheit alles zu taufen. Dies können Tiere, Menschen oder Waldwege sein. Ruedi tut sich mit vielen richtigen Namen schwer. Als ich ihm vorschlug, sich doch jeweils eine Eselsbrücke zu machen, meinte er: „Das ist mir zu kompliziert, denn da kann ich mir auch gleich die richtigen Namen merken.“ Nun mache ich sozusagen die benötigten Eselsbrücken, und wir kommen wunderbar damit klar. So wissen wir nun beide, was der andere jeweils meint. Die Kaffeetour gehört seit neuestem auch dazu. Wenn wir von dieser sprechen, wissen beide, wohin die Reise geht. Den Kaffee trinken wir auf einem kleinen Balkon bei einem Tabakgeschäft, und die Hörnchen hole ich gleich nebenan bei der Bäckerei. Anschliessend fahren wir hoch nach Castillon. Jedes Mal kommt mir in den Sinn, wie wir vor vielen Jahren für ein deutsches Ehepaar gearbeitet haben. Die Leute waren sehr nett, aber wie alle Menschen auch mit einem kleinen Makel behaftet. Wir mussten dort unter anderem eine Terrasse und einen Weg mit Gartenplatten belegen. Es standen -zig Paletten mit diesen Waschbetonplatten rum. Ruedi kniete tagelang am Boden und klebte diese Platten. Ich musste ihm die Platten Stück für Stück zureichen und zwischendurch einen Betonmischer mit Material befüllen. Schwere Arbeit! Die deutsche Dame holte eine Waage, denn sie wollte wissen, wie schwer so eine Platte war. Staunend teilte sie uns das Resultat mit, das 12, 5 Kg hiess. Endlich war alles fertig. Jeden Nachmittag so gegen vier Uhr schallte der Ruf „Kaffee ist fertig!“ über die Baustelle. Einen kurzen Moment pausieren und eine Tasse dieses Kaffees trinken. Aber das ist alles ja positiv zu bewerten. Bloss… Sämtlicher Schutt und sämtliche Baureste mussten hinten über die Felsen gekippt werden. Ich musste immer aufpassen, dass ich nicht mitsamt der Schubkarre ins Tobel flog. Ich schämte mich unendlich, dass ich all diesen Müll dort über Bord ins darunterliegende Gebüsch werfen musste. Unten im Tal fuhren regelmässig etliche Autos durch, während ich oben den Abfall talwärts schmiss. Ich stellte mir immer vor, dass mich die vorbeifahrenden Menschen bei meinem ungesetzlichen Tun sehen würden. Als ich dann endlich einmal die Zeit fand, dort unten die Strasse zu befahren, konnte ich feststellen, dass mich bestimmt keine Menschenseele bei meinem frevelhaften Tun hatte beobachten können. Jetzt fahren wir auf unserer Kaffeetour in Castillon durch und dann unten auf der Strasse weiter. Öfter blicke ich noch mit leisem Schamgefühl nach oben. In all diesen Jahren wurde das Gerümpel bestimmt von allerlei Grünzeug überwachsen, und kein Mensch kann sich mehr daran stören. Einmal, es war in der Adventszeit und bitterkalt, als wir dort noch arbeiteten. Wir hatten zuvor eine grössere Garage erhöhen müssen und jetzt waren nur noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Das heisst, Ruedi musste das neue Rolltor richtig befestigen, und mich hatte er auf die Nordseite geschickt, um das Sichtmauerwerk fertig zu bauen. Ein beissender Mistral zog um die Ecken, und ich war schon fast zum Eiszapfen mutiert, als ich eine Frauenstimme hörte. „Oh, Herr Aeschbacher, Sie armer, müssen bei dieser Kälte noch arbeiten. Kommen Sie doch ins Nachbarhaus zu einem heissen Kaffee, damit Sie sich etwas aufwärmen können.“ Es war eine deutsche Frau, die etwas weiter weg ein grosses Haus besass. Beim Wort ‚heissen Kaffee‘ taute ich beinahe schon auf, darum trat ich dann auch vor die Garage. „Oh, da ist ja noch jemand!“ Nun säuselte die Dame nicht mehr so freundlich und von heissem Kaffee wurde auch nicht mehr gesprochen. Im Gegenteil, sie verabschiedete sich schon bald. Ruedi und ich werkelten weiter, bis wir unser Pensum geschafft hatten und machten uns dann auf ins Warme bei uns zu Hause.
Heute, Sonntagmorgen, stellten wir bei einem „vide grenier“, was so viel heisst, wie „Estrichentrümpelung“ in Saint Quentin aus. Neben uns stellte ein sehr nettes französisches Ehepaar aus. Der Herr war ein pfiffiger Kerl und erzählte allerlei lustige Begebenheiten.
Seine Gattin war ein zierliches Wesen und äusserst sympathisch. Als sie wissen wollten, wo wir wohnten, hatten sie keine Ahnung, wo denn Lédenon liegen würde. Erklärend fügten sie an, dass sie erst seit zwei Wochen hier im Süden wohnten, denn sie kämen aus dem französischen Nordwesten. Die Dame stand wenig später bei den Schürzen und suchte sich schon mal ein Set aus. Der Vormittag verflog im Flug, denn immer wieder konnte ich etwas verkaufen, und bis zum Schluss hatte ich dreizehn Schürzen an verschiedene Kunden eingepackt. Die ausgesprochenen Komplimente hätten einen grösseren Schrank problemlos füllen können. Zwischendurch immer wieder mit den netten Ausstellern von nebenan quatschen war einfach nur wunderbar. Nun stand plötzlich ein Ehepaar bei den Schürzen, und sie schienen sehr angetan vom Angebot. Der Mann fragte nach meiner Karte, welche umgehend von seiner Gattin fotografiert wurde. Er erklärte nun, dass sie in Belgien ebenfalls bei Märkten ausstellen. Allerdings würden sie alles Mögliche aus unserer Region verkaufen. Natürlich auch Schürzen, aber diese aus den schönen provenzalischen Stoffen. „Meine Frage an Sie, würden Sie auch Schürzen aus diesen Stoffen auf Bestellung nähen? Wir könnten Ihnen die Stoffe zur Verfügung stellen.“ Ich war für einmal sprachlos und wusste nicht so recht, was ich zu diesem Ansinnen antworten könnte. „Es würde sich natürlich nicht gerade um 1000 Stück handeln, nein, es wären so 50 bis 60 Stück von Zeit zu Zeit.“ Ich kaute immer noch an einer passenden Antwort und dachte plötzlich: ‚Egal, am besten machst du ein freundliches Gesicht und eine Zusage, denn da kommt bestimmt nichts mehr.‘ Der Herr schien zufrieden und versprach, sich demnächst zu melden. Wenig später erzählte ich lachend Ruedi von diesem Angebot. Er konnte sich ein breites Grinsen ebenfalls nicht verkneifen und meinte: „Dann kann ich dir endlich eine ordentliche Nähmaschine kaufen.“ Die Maschine wäre wohl mein kleinstes Problem, denn für ein paar Nähte zu fertigen, taugt doch das billigste Modell ebenfalls. Ich sagte dann zu Ruedi, dass ich mir auf meinem kleinen Arbeitstischchen doch keinen Stoffballen vorstellen könne, denn wir haben nirgends viel Platz, um grosse Tische aufzustellen. Falls sich ein solcher Handel tatsächlich zur Realität entwickelt, habe ich immer noch Claudine, die diesen übernehmen oder mir zumindest dabei helfen könnte. Aber schmunzeln lässt mich die ganze Geschichte dennoch, denn je älter und unbeweglicher wir werden, umso gefragter scheinen unsere Dienste zu sein. Ich meinte zu Ruedi, dass wir aufpassen müssen, dass man uns nicht noch irgendwo anstellen wolle, wenn wir in die Nähe des hundertsten Geburtstags rücken. Auch spottete ich oft, dass wir ein international tätiges Unternehmen seien. Wir sind zwar nur zwei alte Leutchen, aber unsere Handarbeiten werden in ganz Europa und in Amerika benutzt, denn solche Kunden hatten wir schon öfter.
Wiederum einen Besuch bei „Miggu“ und dem Braunen gemacht. Die Freude über unser Kommen ist unüberhörbar. Der Braune hebt plötzlich seinen Kopf, denn er hat ein Motorengeräusch gehört. Es nähert sich von hinten, über die Felder, ein älterer Jeep mit einem ebenso alten Herrn am Steuer. Er beäugt uns eher unfreundlich. Er sagt nichts, sondern öffnet die Motorhaube und blickt kritisch da rein. Ich kann es nicht lassen, denn mir scheint, dass man doch auch grüssen könnte. „Guten Tag, haben Sie eine Panne?“ „Vermutlich muss die Aufhängung gewechselt werden, denn das Fahrzeug macht ein sehr komisches Geräusch.“ „Sind Sie der Besitzer dieser zwei Tiere? Meinem Mann hat dieser einmal gesagt, dass wir Brot bringen dürfen.“ „Ja, ich bin der Besitzer der beiden Tiere.“ „Wissen Sie, wir geben immer nur ganz hartes Brot an die Tiere ab, welches ich zuvor im Backofen röstete, und wir kommen bloss so einmal im Monat.“ Dieser Mann sagte, dass er Mühe habe mit dem Hören. Es war recht schwierig eine Unterhaltung mit ihm zu führen, denn wir hielten recht grossen Abstand. Ruedi meinte nachher, dass der eigentliche Besitzer und dessen Frau viel netter und freundlicher waren, denn sie hätten gelacht und ihm auch die Namen der Tiere genannt. Der Jeep-Fahrer war da recht zugeknöpft und humorlos. Doch gerade, weil der Braune das Fahrzeug erkannte und darauf reagierte, muss dennoch eine gewisse Verbindung bestehen. Allerdings hätte ich erwartet, dass man mit den Tieren spricht und ein paar Streicheleinheiten abgibt, wenn man sich dem Gehege nähert. aber in diese Richtung geschah gar nichts, darum unsere Zweifel. Gut möglich, dass es nur ein Beauftragter war, um sich um das Wasserfass zu kümmern, denn dieses koppelte er wenig später an seinen Jeep. Wir fuhren weiter nach Poulx und dann runter zum Morgenkaffee bei der Bäckerei im roten Gebäude in St. Gervasy. Man hatte uns wiedererkannt, denn wir zählen dort schon zu den Stammgästen, sodass wir den Sanitär-Pass nicht nochmals vorweisen mussten. Auf der Terrasse stehen sechs Tische für je vier Personen gedacht, aber es sind keine Stühle dabei. Ich fragte nun, ob wir für uns Sitzgelegenheiten haben könnten.
„Selbstverständlich, ich bringe Ihnen gleich welche. Wissen Sie, wir mussten sie im Innern versorgen, denn sonst setzen sich immer wieder nicht geimpfte Leute hin, und wir haben unsere Mühe, denen die gesetzlichen Gepflogenheiten zu erklären. Wir wollen eben keinen Ärger mit der Polizei, denn die kontrolliert regelmässig. Ja, wenn sich die Menschheit doch endlich impfen lassen würde, denn damit kämen wir auch zum Ende der Pandemie.“ Wir sassen also auf zwei Stühlen an unserem Tisch auf der Terrasse und genossen unseren Kaffee. Ich sagte noch zu Ruedi, dass es schon etwas komisch anmute, den Kaffee neben fünf stuhllosen Tischen zu geniessen. Klar verstehe ich die gemachten Argumente, denn dies ist eine Bäckerei, die sehr viel über die Gasse verkauft. In normalen Zeiten sitzen drinnen und draussen verschiedene Kunden bei ihren Getränken oder den Snacks. Wegen der verdammten Pandemie sieht das Leben eben überall etwas anders aus. Nun stellen wir unser Geschirr in die dafür vorgesehene Ablage und die beiden Stühle schön vor die Türe. Wir sitzen gleich wieder auf unseren Rädern und radeln über die Felder. „Was ist das denn?“, rufen wir beide fast zeitgleich, und schon stehen wir neben den Fahrrädern. Ein riesiges Feld, bewachsen mit vielen, uns unbekannten kleinen Bäumchen, können wir ausmachen. Zwei Marokkaner sind am Arbeiten. Wir grüssen und schon frage ich, was sie hier denn gerade tun. „Wir veredeln diese Bäumchen. Diese Reihe zum Beispiel bekommt eine Kirschensorte, und nachher kommen Aprikosen und Pfirsiche dran.“ Indem der ungefähr vierzigjährige Mann uns dies erzählt, macht er mit einem kleinen Messer einen Schnitt unten in das knapp ein Meter grosse Bäumchen, holt einen kleinen Zweig aus der Hosentasche und setzt diesen hierauf ein. Der zweite, der nur wenig hinter dem ersten steht, hat eine Kleberolle in der Hand und umwickelt den eingesetzten Zweig am dünnen Stämmchen. Die Ruten sind ungefähr dreissig Zentimeter lang. „Auf diesem Feld stehen 250‘000 kleine Bäumchen, die wir jetzt alle veredeln müssen. Pro Zeile hat es 1250 Stück.“ „Was sind das denn für Bäumchen?“ „Eine wilde Obstsorte.“ Ruedi und ich kriegen unsere Münder vor lauter Staunen kaum mehr zu. Weiter erzählen uns die beiden Arbeiter, dass sie jeden Tag ihre neun Stunden arbeiten. Das heisst von Montag bis Freitag und am Samstag dann nur noch am Vormittag. Ab und zu komme es vor, dass sie auch an den Sonntagen arbeiten. Verdienen würden sie 1800 € pro Monat. Ja, abends schmerze der Rücken tüchtig, denn den ganzen Tag in so gebückter Haltung arbeiten gehe schon auf die Knochen. Sie arbeiten für eine grosse Baumschule, die ihre gepflanzten oder veredelten Bäumchen in die ganze Welt versendet. Wir haben schon andere Arbeiter gesehen, als diese die Ruten pflanzten, die nach ein paar Jahren in die ganze Welt als junge Obstbäume verkauft werden. Interessant ist es immer wieder, denn wir sehen bei unseren Fahrten überall spezielle Felder, die halt nicht zwingend an den grossen Strassen liegen.
Gerade hatte ich uns für einen Ausstellplatz beim „Vide grenier“ in Saint-Laurent-les-arbres angemeldet. Man werde uns einen Platz reservieren, mich mit Verena ansprechen, denn der Familienname sei zu kompliziert, und wir sollten um sieben Uhr vor Ort sein, beschied mir am Telefon eine junge, nette Frauenstimme. Ich freute mich und hegte natürlich schon die grosse Hoffnung auf einen guten Verkaufstag. Für einmal mussten wir kurz vor sechs Uhr aufstehen, schon beinahe eine christliche Zeit für einen Markttag. Die Ausstellfläche war eine grosse Wiese mit erdigem Boden und getrockneten Gräsern. Ich stellte unser Auto so ab, dass wir problemlos wieder wegfahren konnten, wenn es uns zu warm werden sollte. Der Wetterdienst hatte immerhin noch gute dreissig Grad angekündigt. Wir hatten zum Glück einen grossen Sonnenschirm mit, denn wir hatten uns letzthin bei einem solchen Markt einen schönen violetten, gebrauchten Schirm gekauft. Es gab am anderen Ende des Platzes eine Theke, wo wir den obligaten Kaffee orderten und die noch ofenwarmen Hörnchen dazu. Es schmeckte köstlich. So gestärkt machten wir uns nur wenig später ans Ausstellen. Dieses Dorf zählt ungefähr 3000 Einwohner und macht einen äusserst adretten und sauberen Eindruck. Da es mitten im Weingebiet von Tavel und Lirac liegt, konnte man bemerken, dass hier tüchtig Geld in die Häuser investiert wurde, denn es gab fast ausschliesslich nur Steinhäuser in sehr gepflegter Form. Bald schon konnten wir einige der mitgebrachten, sehr gut erhaltenen Schuhe verkaufen. Auch andere Artikel wechselten den Besitzer. Unsere selber hergestellte Ware erntete zumindest viele Komplimente. Endlich, ein gepflegtes Ehepaar blieb bei den Schürzen stehen. Ich erklärte ihnen sogleich mein System. Sie waren von dem gehörten sehr angetan und suchten sich gleich vier Stück aus, denn das wäre eine super Idee, um welche als Mitbringsel bei einer Einladung zu übergeben. Mein Herz hatte also schon den ersten kleinen Höhenflug gemacht. Ich kreuzte hierauf meine Finger hinter meinem Rücken und murmelte halblaut vor mich hin: „Jetzt unbedingt noch etwas von Ruedis Arbeiten verkaufen, bitte, bitte.“ Nochmals ein Schürzenpaket verkauft, denn dies gebe herrliche Weihnachtsgeschenke. Ich schluckte etwas, denn man dachte bereits an Weihnachten, und ich hatte noch nicht einmal meinen Geburtstag gefeiert, und zudem steckten wir immer noch in dieser grässlichen Pandemie. Die Temperaturen stiegen und ich fühlte mich müde, etwas lustlos und wartete dennoch auf Kundschaft. Der Interessentenstrom war deutlich kleiner geworden, und die Uhrenzeiger meldeten die Mittagszeit. „Ruedi, komm, wir essen unsere mitgebrachten Brote, dann sehen wir weiter.“ Es tat sich kaum mehr etwas und zu unserer Linken packte eine junge Frau ihre Ware bereits zusammen. Wenig später tat es ihr der Nachbar zu unserer Rechten gleich. Wir warteten, aber es schien, als wäre alles schon vorbei. Man kann bei solchen Estrichentrümpelungs- Märkten bleiben bis 17.00 Uhr. Allerdings ist das blosse Augenwischerei, denn die Verkäufe tätigt man vor Mittag, dann gehen die Leute nach Hause an den Mittagstisch. Meistens wird noch eine Siesta nachgeschoben, und zum Schluss bummeln noch einige eher lustlos und kaufunlustig über den Markt. Ich spottete schon oft, dass man seine Sonntagsspaziergänge vor Jahren eher durch den Wald und die Felder machte. Heute werden Kinderwagen, Hunde und die Grossmütter am Nachmittag freudlos über den Markt geschleift. Bereits war es 13.00 Uhr, und ich schwitzte dermassen, dass ich mich nur noch nach unserem kühlen Häuschen sehnte. „Ruedi, packen wir doch zusammen, denn warten bringt uns auch nicht weiter.“ Ruedi sagt immer, dass ich den Ton angeben müsse, denn ich müsse mich ja auch um den Verkauf kümmern. Wir fingen an, die restliche Ware in unsere Gebinde zu verstauen. Oh, eine junge Familie bleibt gerade vor unserem Stand stehen. "Ist das wirklich der Preis für diesen grossen, hölzernen Bären?“ „Ja, sicher.“ Schon kramt die junge Frau in ihrem Geldbeutel zwei Scheine hervor und streckt sie mir entgegen. Ich drücke ihr strahlend den Bären in die Arme. Das Elternpaar wie auch die Kinder sagen uns alle freundlich „au revoir.“ Wenn ich einen