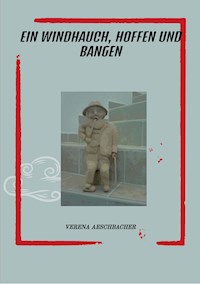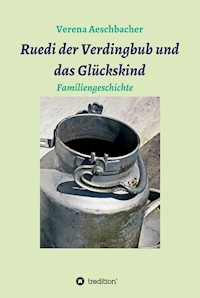9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Viele Erinnerungen aus einem langen Leben. Mit knapp 16 bereits in Brot und Lohn. Die erste Lehrstelle bei einem Staatsbetrieb. Viel Handarbeit und noch keine moderne Technik. Erste Flugreise nach England. Von mee too wurde nicht mal geträumt. Als junge Frau Kind, Haushalt und Arbeit auf die Reihe bringen war nicht so einfach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Verena Aeschbacher
UNBRAUCHBAR…
Man reiht eine Masche an die nächste.
Lektorat: Erika Kühn
ISBN Softcover: 978-3-384-23483-4
ISBN Hardcover: 978-3-384-23484-1
ISBN E-book: 978-3-384-23485-8
Druck und Distribution im Auftrag des Autors, Tredition GmbH, an der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk einschliesslich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwendung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Verena Aeschbacher, 12 rue du château, F-30210 Lédenon
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Kapitel 1
UNBRAUCHBAR…
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Kapitel 1
UNBRAUCHBAR…
Cover
i
ii
iii
iv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
Ja, häkeln ist eine Form von Meditation. Man reiht eine Masche an die nächste. Meine Passion ist ja das Häkeln von Puppenkleidern. Sie entstehen in verschiedenen Farben, mal uni und mal bunt. Meistens tragen sie ein Muster. Ich sitze dabei ganz entspannt in meinem voluminösen Sessel und kann so herrlich die Gedanken schweifen lassen. Diese Tätigkeit wirkt sehr beruhigend auf Körper, Geist und Seele, und ich spüre, dass sämtlicher Groll oder auch die negativen Gefühle sich in Nichts auflösen. Einfach nur wunderbar. Ich rudere in meinen Gedanken und Gefühlen rückwärts und erlebe dabei die verschiedenen Lebensstationen noch einmal. -
UNBRAUCHBAR….. warf irgendwann einen grossen Schatten über meinen beruflichen Alltag. Aber vorerst ging es in die Westschweiz. Junge schulentlassene Mädchen, die keine konkreten Berufswünsche äusserten, wurden jeweils ein ganzes Jahr in die französische Schweiz verfrachtet. Um die Sprache zu lernen oder um wieder normal zu werden. Ich gehörte auch dazu. Am Ostermontag holten mich die Eltern einer Schulkollegin mit einem weissen VW-Käfer ab und fuhren mit uns Mädchen an Bord in Richtung Genf. Dort betraten wir ein recht nobles Restaurant, um uns ein letztes Mal gebührend zu stärken. Marianne, meine Schulkollegin und deren Mutter genossen weder die gehobene Ambiance noch das feine Essen, denn sie weinten und schnieften fast unaufhörlich in die mitgebrachten Taschentücher. Mich machte die ungewisse Zukunft ja selber auch etwas bange, aber im Moment verhalf mir die stille und fremde Vornehmheit des Lokals zu einem beklemmenden Gefühl, weil gar zu ungewohnt. Nach dem traurigen Essen machten wir alle noch einen kurzen Spaziergang, um dann endgültig zum neuen Aufenthaltsort der Kollegin aufzubrechen. Nach etlichen "Aurevoir’s" und einem tränenreichen, fast sintflutartigen, nassen Abschied fuhren nun nur noch wir Drei wieder nach Lausanne zurück. In Assens war dann auch ich am Ziel meiner ersten Arbeitsstelle in der Erwachsenenwelt angekommen. Ich sollte ein Jahr bei einer Bauernfamilie verbringen. Die Familie war uns von meiner Patin, deren Tochter früher dort auch ein Welschlandjahr verbrachte, wärmstens empfohlen worden.
Es gab nebst dem Elternpaar und einem ledigen Onkel noch drei Kinder im Alter von fünf, sieben und neun Jahren. Selbstverständlich hielt die Familie auch einen Hund, die Dolly, mit braunem Fell und kurzen Haaren, eine edlere Promenadenmischung. Diese Hündin legte sich während der Mahlzeiten immer auf meine Füsse, bis sie mir gänzlich eingeschlafen waren. Beim Essen klebte sie an meiner Seite wie ein Siamesischer Zwilling. Ab und zu war Dolly hitzig, und dann verlor sie überall tröpfchenweise Blut, das ich dann zusammenwischen musste. In dieser Zeit stank sie bestialisch, das heisst noch viel mehr als sonst, was mir vor allem beim Essen grosse Mühe bereitete. Ich liebe den Hundegeruch als solchen schon nicht, denn es wird mir richtig übel, aber da bin ich offenbar weit und breit der einzige Mensch, der sich daran stört. Warum wohl teilen sich meine Mitmenschen mit ihrem Hund das gleiche Bett? Bei Tisch vergeht einem die ganze Vorfreude, wenn der Haushund immer stinkend, sabbernd und mit gierigem Blick danebensteht. Auch sind des Halters Hände meistens im stinkigen Hundefell vergraben, und die sonst recht zimperlichen Menschen vergessen das Händewaschen nach jeder Streicheleinheit. Die Probleme in der weiten Welt wären deutlich geringer, wenn man an seine Mitmenschen so viele Streicheleinheiten, liebe Worte, Aufmerksamkeit und Anteilnahme verschwenden würde wie an seinen Hund. Oft wäre es deutlich angenehmer ein Haushund zu sein, denn ein Mitmensch. -
Alle standen jetzt neugierig in der Küche und begafften jede meiner Bewegungen. Mein Chauffeur samt Ehefrau wunderte sich, dass ich immer noch nicht in Tränen ausbrach. So verabschiedeten sie sich bald und wünschten mir für die Zukunft viel Glück. Madame schwatzte, erzählte und lachte in einem fort, und ich verstand nur Bruchstücke des Gesagten.
Ich stellte den Koffer vorerst unausgepackt in mein Zimmer. Jetzt wurden mir die ersten Anweisungen gegeben für das morgige Frühstück. Selbstverständlich hatte ich mich um sechs Uhr zu erheben, dann im Holzherd Feuer zu entfachen und den Tisch zu decken.
Während der ersten Zeit weilte der Vater von Madame zu Besuch, denn mit einigen Brocken Deutsch war er der Einzige, der mir ein bisschen Heimatgefühl vermittelln konnte. Den ersten Tag überstand ich einigermassen gut, trotzdem wollte ich mit dem Auspacken meines Koffers noch etwas zuwarten. Am zweiten Tag so gegen Abend, es war neblig und regnerisch trüb, Madame lachte und erzählte immer noch, dann stellte sie mir plötzlich folgende Frage, die ich sogar auf Anhieb verstand: "Hast Du kein Heimweh?" Es bedurfte nur dieser vier Worte, um einen ungewollten sintflutartigen Gemütsausbruch zu erwirken.
Einmal in Tränen ausgebrochen, konnte ich diesen Zustand kaum mehr beherrschen. Meiner Madame wurde es langsam angst und bange, und bestimmt bereute sie schon bald die ausgesprochenen Worte.
Ich legte mich schluchzend und ungetröstet ins Bett und hoffte inbrünstig, dass es sich nur um einen bösen Traum handeln würde.
Am frühen Morgen stellte ich mich im Mantel und mit gepacktem Koffer in die Küche und verkündete: "Ich gehe nach Hause!" Madame kümmerte sich um das Frühstück und schickte mich mit ihrem Ältesten zur Nachbarsfamilie, damit ich zu Hause anrufen konnte. Ich schluchzte mein ganzes Elend in den schwarzen Telefonhörer und flüsterte am Schluss nur noch: " Ich komme umgehend nach Hause." "Nein, nein!", tönte es am anderen Ende, "Du bleibst!"
Ich schlich geknickt wieder zu meiner Gastfamilie zurück, entledigte mich des Mantels und stellte den Koffer nochmals unausgepackt zurück in mein Zimmer. Allerdings war dies nicht mein letzter dramatischer Auftritt gewesen. Diese Übungen wiederholte ich täglich während einer vollen Woche. Das Aufstehen, Weinen, Telefonieren, Zurückkehren und an die Arbeit gehen gehörte zu meinem Tagesablauf. Dass meine Gastfamilie die Geduld nicht verloren hat, erstaunt mich heute noch.
Am Samstagmorgen schien auf einmal die Sonne. Ich musste das Badezimmer putzen und im grossen Badeofen einheizen, damit wir Heisswasser bekamen. Die drei Kinder wurden gebadet und anschliessend hiess es: "Vreneli, Du darfst jetzt auch baden, und dies kannst Du nun jede Woche." Ich liess mich in die weisse, grosse, mit wohlig warmem Wasser gefüllte Emailwanne gleiten und genoss das erste Schaumbad meines jungen Lebens voller Wonne. In diesem Augenblick beschloss ich, mein Welschlandjahr endlich richtig zu beginnen, denn wenn mir ein so wunderbares wöchentliches Erlebnis zur Verfügung stand, lohnte sich das Ausharren ganz bestimmt.-
Es war nicht leicht, dieses Welschlandjahr, denn oberstes Gebot war: hartes Arbeiten, spärlich bemessene Freizeit und ein kleines Taschengeld. Trotzdem durfte ich mich nicht beklagen, denn das Essen war reichlich und gut und die Behandlung recht familiär. Madame war eine freundliche, immer lachende und schwatzende Frau. Solange das „Jeune-fille“ nicht mehr Freizeit und Geld verlangte, war alles bestens. Ich hatte tatkräftig im Haushalt zu helfen, putzen und bügeln waren auch meine Aufgaben. Da wir einen riesigen Garten besassen, musste ich auch diesen mehrmals pro Jahr mit dem Spaten bearbeiten und auch das munter spriessende Unkraut jäten. Das Hühnerhaus musste monatlich einmal gemistet werden. Selbstverständlich eignete sich das "Jeune-fille" auch hierzu am besten. Es war nicht einmal so schlimm. Sobald man sich an den dort herrschenden Gestank gewöhnt hatte, konnte man recht flott den Besen schwingen. Bereits da konnte ich etwas Grundsätzliches lernen, nämlich dass alles nur eine Frage der eigenen Einstellung zu den Geschehnissen ist. Beim Heuwenden, nach einer ausgiebigen Regenperiode, bekundete ich allerdings weit mehr Mühe. Die riesigen hölzernen, klobigen Gabeln und das sehr lange und schwere, noch ein wenig feuchte Heu, waren für meine Kräfte eindeutig zu schwer. Dennoch musste ich mithalten.-
Auch das Puppenstellen aus gebundenen Garbenbündeln war für mich eine ungewohnte Arbeit. Am Abend waren Arme und Beine vom harten Stroh zerkratzt und zerschnitten und schmerzten ordentlich bei der anschliessenden Körperreinigung.
Da die ganze Familie kein Wort Deutsch sprach, und ich nur am Sonntag- und Mittwochnachmittag je drei Stunden frei hatte, lernte ich sehr gut Französisch. Am Abend setzte ich mich strickend vor den Fernseher und schaute mir alles was zu sehen war an. Das Angebot erstreckte sich von der Tagesschau hin zum Krimi bis zu den Sportsendungen, und so weiter. Damals konnte man es sich noch leisten, bis Sendeschluss dabei zu sein, denn ab 23.30 Uhr herrschte beim Schwarz-Weiss-Fernseher nur noch das grosse Schneien. Auf die Tageszeitung, das „Feuille d’Avis de Lausanne“, wartete ich mit der gleichen Spannung wie deren Abonnenten. Ebenso verschlang ich die süssen Liebesromane des wöchentlich erscheinenden "Nous Deux", denn Bücher hatte ich damals keine, und meine Meisterleute waren mit diesem Druckerzeugnis absolut zufrieden und für ihre Bedürfnisse eingedeckt. Wir hatten natürlich ausser Zeitungslesen noch anderes zu tun. Zum Beispiel sollten die Kirschen geerntet werden. Glücklicherweise hatten wir nur einen einzigen Kirschbaum, bloss wusste man damals noch nichts von den niedrigeren Plantagenbäumen. Besagter Baum war ein Riese in seinem Verein! Monsieur stellte eine sehr lange Leiter in dessen Geäst, und ich sollte mit Ernten beginnen. Nur schon der Gedanke an die lange Leiter liess mich schwindeln und erst noch das Obenstehen, denn ich würde beim Hinunterfallen nicht etwa mit einer Wiese Bekanntschaft schliessen, nein, ich würde auf einer betonierten Zufahrt landen! Mir wird heute noch flau im Magen, wenn ich an diesen Kirschbaum denke. Dies war vermutlich meine unproduktivste Arbeit, denn an einem Tag pflückte ich nur ein knappes halbes Körbchen voll. Ich wagte nicht eine einzige Frucht zu essen, denn sonst wäre das erreichte Tagessoll noch kläglicher ausgefallen. Madame schüttelte unzufrieden ihren schwarzen Lockenkopf und sagte: "Zur Strafe wirst Du keinen einzigen Löffel Kirschenkonfitüre zu essen bekommen." Diese Strafe schien mir gerecht, Hauptsache war, dass ich nur nie mehr auf den verdammten Kirschbaum musste.
Bei der Heuernte hatte ich mich in der Remise auf den voll beladenen Wagen zu stellen und die zusammengebundenen Heuballen zum Onkel Daniel auf den oberen Heuboden hinauf zu werfen. Ich schwitzte und arbeitete wie besessen, denn auch diese Tätigkeit überstieg meine Kräfte um einiges. Natürlich wurde ich durstig und trank nur zu gerne von der eisgekühlten, selbstgemachten Holunderlimonade, die in der Küche zum Durstlöschen bereitstand. Am Abend, nach getaner Arbeit, wurde mir fürchterlich schlecht. Ich musste während der ganzen Nacht in recht kurzen Abständen aufstehen und mich übergeben. Da ich fast gar nicht geschlafen hatte und mich am morgen elend und fiebrig fühlte, blieb ich einfach am nächsten Morgen faul im Bett liegen. Madame jedoch konnte meine "Wehleidigkeit" nur schwer verstehen und kam alle zehn Minuten fragen: "Geht's dir noch immer nicht besser?" Diese ständige ungläubige Fragerei ging mir derart auf die Nerven, dass ich gegen Mittag die Zähne zusammenbiss und zittrig und klapprig meinen "Putzkehr" aufnahm. Im Augenblick war Madame beruhigt und zufrieden, und ich hoffte inständig, dass es mir am nächsten Tag besser gehen würde.
Nun sollten die Kartoffeln geerntet werden. Natürlich besass "meine Familie" noch keine Maschinen, aber unendlich viele Kartoffeln. Tagelang lasen wir gebückt, kniend und kauernd Kartoffeln auf und füllten diese in grosse Drahtkörbe. Sobald ein Korb voll war, musste ich aus der mühsam gebückten Haltung aufstehen und mit Onkel Daniel den Korb in die vorhandenen Säcke leeren. Der heute oft schmerzende Rücken erinnert mich immer wieder an diese Erntezeit, denn manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich in zwei Teile zerbrechen müsste. Wenn draussen keine Arbeiten anfielen, gab es zu stricken und zu flicken. Diese Handarbeiten war ich gewohnt, und es machte mir immer viel Spass. Ich strickte darum auch abends vor dem Fernseher, ohne dass mir dies befohlen war. Madame war mit meinen diesbezüglichen Leistungen so sehr zufrieden, dass sie überall die fabrizierten Werke vorzeigte und sich rühmte, ein so gutes und fleissiges "Jeune-fille" in ihren Diensten zu haben. Es war ja nicht so, dass „Madame“ sich vor grossen Arbeiten drückte. Nein, sie musste sich vor ein paar Jahren eine Niere entfernen lassen und daher wurden halt viele Arbeiten dem jungen Mädchen überlassen.
Als Onkel Daniel für 14 Tage in den Militärdienst einrückte, schienen Monsieur und Madame vollends aus dem Häuschen zu geraten, denn wer sollte die anfallenden Stallarbeiten erledigen? Ich meldete mich dieses Mal gleich freiwillig als Knecht. Das Staunen und die Überraschung bei den beiden war gross. In den nächsten zwei Wochen half ich morgens und abends beim Melken. Diese Tätigkeit war mir ja nicht fremd, denn zu Hause hatte ich oft Gelegenheit gehabt, Kühe zu melken. Eines Abends, ich molk gerade die vierte Kuh, tauchte ein alter krummbeiniger und mit einem starken Buckel behafteter Nachbar im Stall auf. Er sagte: "Ich habe gehört, dass das "Jeune-fille" melken kann, jetzt will ich kontrollieren, ob dieses Gerücht auch stimmt." Als er mein Können bestätigt sah, lachte er wie verrückt, klopfte sich auf die Schenkel und schrie: "Es ist tatsächlich war, das Jeune-fille kann wirklich melken, kann wirklich melken…" Mit diesen Worten hinkte er krummbeinig aus dem Stall und machte sich auf, um die anderen Dorfbewohner darüber in Kenntnis zu setzen.
Jeden zweiten Sonntag wurde ich zum Kirchgang abgeordnet. Madame tat dies ebenfalls. Wir hatten uns also abzuwechseln, denn auf die beiden Männer könne man dabei nicht zählen hiess es, und in so einem kleinen Dorf sollte immer jemand aus der Familie am Sonntag in der Kirche sitzen. Ich befand diese Gottesdienste als ganz angenehm, denn sie waren nicht so langweilig wie bei uns in der Deutschen Schweiz. Es gab keine langen Predigten, nein, man musste sich zum Gebet erheben, dann wieder zum Singen und so fort. Es war jeweils ziemlich Bewegung im Ganzen. Wenn ich heute bei einem Kreuzworträtsel auf die Frage ‚Seele auf französisch‘ treffe, muss ich schmunzeln, denn es ist „âme“ und von dieser wurde ja recht häufig gepredigt.
Ja, auch diese Zeit ging zu Ende, und die Diskussionen über einen Berufswunsch wurden Tagesthema Nummer eins! Bei der örtlichen Poststelle diente auch ein Deutschschweizer-Mädchen. Bei Gelegenheit unterhielten wir uns über unsere Zukunft. Eines Tages sagte Dora: "Ich werde in Lausanne die Aufnahmeprüfung zur Postangestellten absolvieren, willst Du nicht auch mitkommen?" Ich überlegte kurz und meinte: "Warum eigentlich nicht, irgend etwas sollte ich ja wohl lernen, und meine Eltern hatten bereits Andeutungen und Wünsche in dieser Richtung geäussert." Meine eigentlichen Berufswünsche gingen in eine ganz andere Richtung. Lehrerin wäre ich sehr gerne geworden, bloss war dies unmöglich, denn wenn man in Adelboden wohnte, hätte man in Bern das Seminar besuchen müssen. An einen dortigen Aufenthalt war aus finanziellen Günden nicht zu denken, und die öffentlichen Verkehrsmittel waren ebenfals unpassend, denn sie fuhren nicht oft und nicht lange genug. Verkäuferin wäre auch ein Traum gewesen, aber da meinten meine Eltern, dass ich für eine solche Lehre nicht in die Sekundarschule gemusst hätte. Auch eine Lehre im Gastgewerbe stand auf meiner Wunschliste, aber da sagten meine Eltern, dass man dabei ein unstetes Wesen entwickeln könnte. Also verblieb noch die Post, die als sicher und neutral galt, aber halt auf keiner meiner Listen stand. Eine Anmeldung wurde trotzdem getätigt und am Tag-X fanden wir uns also beide in Lausanne ein. Ich nahm die ganze Angelegenheit nicht allzu ernst und schrieb und antwortete, was mir gerade so einfiel. Wir wurden dann mit den Worten verabschiedet: "In den nächsten Tagen bekommt ihr Eure Resultate schriftlich zugestellt." Ich wartete geduldig und ohne jede Nervosität und war dann ordentlich erstaunt, als ich die Mitteilung erhielt, dass ich die Prüfung bestanden hatte. Dora hatte weniger Glück gehabt, denn leider war sie durchgefallen. Eine ärztliche Untersuchung und der obligatorische Haushaltsunterricht mussten noch vor Lehrantritt absolviert werden. Aus diesem Grunde kehrte ich bereits nach elfeinhalb Monaten zurück in die deutsche Schweiz. Das Nachhausekommen machte mir nun fast soviel Kummer wie vor einem Jahr das Weggehen. Ich hatte plötzlich arges Heimweh nach meinen "Romands" und deren Strenge. Bevor der ordentliche Lehrantritt als Postgehilfin erfolgen konnte, galt es noch einen dreiwöchigen Einführungskurs in Thun zu besuchen. Arbeit, Chefs und Kollegen waren mir egal, denn ich litt schon wieder unter Heimweh. Wir konnten nämlich nur an den Wochenenden nach Hause gehen und wurden unter der Woche bei