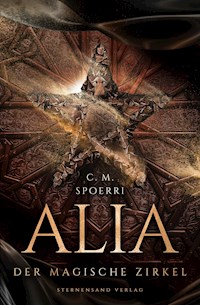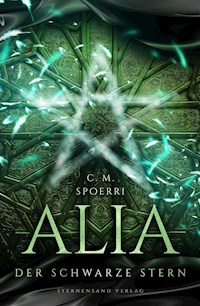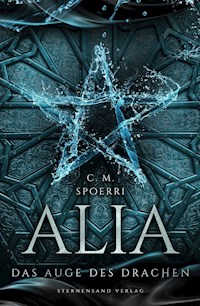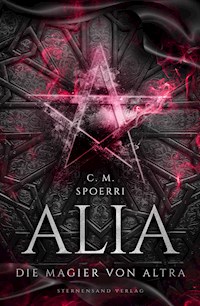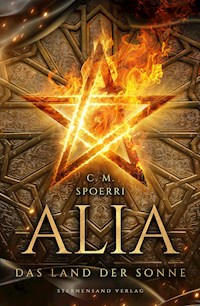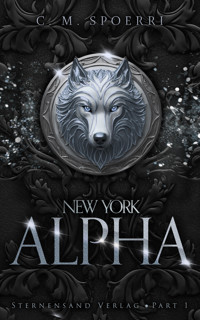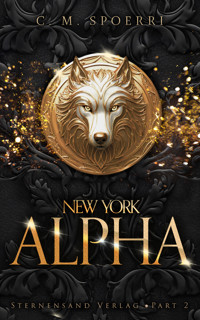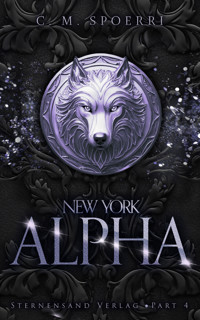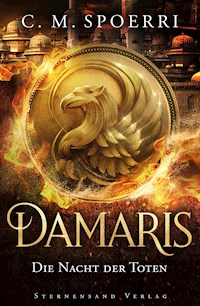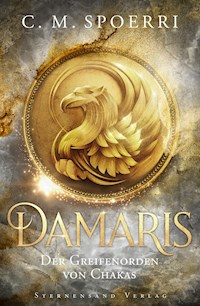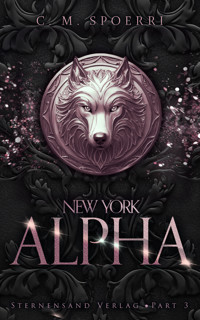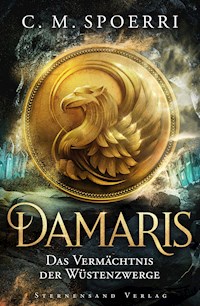Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ich bin Leon, dreiundzwanzig. Alles andere geht euch nichts an. Ihr wollt meine Geschichte lesen? Nun, wer einen Fantasyroman erwartet, den muss ich enttäuschen. Mein Leben ist definitiv kein Roman – auch mit noch so viel Fantasie nicht. Und selbst die Tatsache, dass eines Tages ein Geistermädchen auf meiner Türschwelle stand und mein Leben auf den Kopf stellen wollte, war alles andere als fantastisch. Okay, sie war ja nett anzusehen, mit ihrem roten Pony und den nussbraunen Augen. Aber ehrlich ... dieses ›Leon, Leon, du musst dein Leben ändern und dein Glück finden‹-Gerede braucht keiner. Solltet ihr nun auf einen schnulzigen Liebesroman mit ›Und wenn sie nicht gestorben sind, dann knattern sie noch heute‹ hoffen, werdet ihr hier ebenfalls nicht fündig. Jetzt mal unter uns: Ihr wisst schon, dass das Leben kein rosaroter Ponyhof ist, oder? Warum ihr das Buch dennoch lesen solltet? Keine Ahnung. Mir egal. Ich weiß nur, dass ich mir einen Türspion anschaffen werde, denn der hätte mir diese ganze Geschichte erspart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Widmung
Kapitel 1: Ich Troll - du Geistermädchen
Kapitel 2: Bruder vor Luder - oder so
Kapitel 3: Wer nicht hören will ...
Kapitel 4: Postkartenorgasmus
Kapitel 5: Kleiner Löwe
Kapitel 6: Selbstgespräche mit einem Geist
Kapitel 7: Lass mich, ich will leiden
Kapitel 8: Schlümpfe, überall Schlümpfe
Kapitel 9: Brühe für die Sockenpuppe
Kapitel 10: Zurück in Schlumpfhausen
Kapitel 11: Stalkende Weihnachtsmänner
Kapitel 12: Bier ist alle
Kapitel 13: Einsatz für den Wikinger
Kapitel 14: Vollgekotzte Hose und hüpfende Wolle
Kapitel 15: Tschüss, Leon
Kapitel 16 Nie ohne Gummi(stiefel)
Kapitel 17 Hoppla
Kapitel 18: Sixth Sense
Epilog
Nenn mich Vicky
Schlussworte der Autorin - Feli, Klappe die Zweite
Dank
Weitere humorvolle Urban Fantasy
Weitere Leseempfehlungen
C. M. Spoerri
Leon
Glück trägt einen roten Pony
Fantasy
Leon: Glück trägt einen roten Pony
Ich bin Leon, dreiundzwanzig. Alles andere geht euch nichts an. Ihr wollt meine Geschichte lesen? Nun, wer einen Fantasyroman erwartet, den muss ich enttäuschen. Mein Leben ist definitiv kein Roman – auch mit noch so viel Fantasie nicht. Und selbst die Tatsache, dass eines Tages ein Geistermädchen auf meiner Türschwelle stand und mein Leben auf den Kopf stellen wollte, war alles andere als fantastisch. Okay, sie war ja nett anzusehen, mit ihrem roten Pony und den nussbraunen Augen. Aber ehrlich ... dieses ›Leon, Leon, du musst dein Leben ändern und dein Glück finden‹-Gerede braucht keiner.
Solltet ihr nun auf einen schnulzigen Liebesroman mit ›Und wenn sie nicht gestorben sind, dann knattern sie noch heute‹ hoffen, werdet ihr hier ebenfalls nicht fündig. Jetzt mal unter uns: Ihr wisst schon, dass das Leben kein rosaroter Ponyhof ist, oder?
Warum ihr das Buch dennoch lesen solltet? Keine Ahnung. Mir egal. Ich weiß nur, dass ich mir einen Türspion anschaffen werde, denn der hätte mir diese ganze Geschichte erspart.
Die Autorin
C. M. Spoerri wurde 1983 geboren und lebt in der Schweiz. Ursprünglich aus der Klinischen Psychologie kommend, schreibt sie seit Frühling 2014 erfolgreich Fantasy-Jugendromane (Alia-Saga, Greifen-Saga) und hat im Herbst 2015 mit ihrem Mann zusammen den Sternensand-Verlag gegründet. Weitere Fantasy- und New Adult-Projekte sind dabei, Gestalt anzunehmen.
Kontakt:
Homepage: www.cmspoerri.ch
E-Mail: [email protected]
Facebook: www.facebook.com/c.m.spoerri
Instagram: www.instagram.com/c.m.spoerri
www.sternensand-verlag.ch
1. Auflage, Dezember 2017
© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2017
Umschlaggestaltung: Rica Aitzetmüller | Cover & Books
Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH | Martina König, Jennifer Papendick
Satz: Sternensand Verlag GmbH
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
ISBN Taschenbuch: 978-3-906829-79-1
ISBN E-Book: 978-3-906829-78-4
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für meine treuen Leser <3
Kapitel 1: Ich Troll - du Geistermädchen
Troll!
Selber Troll ;-)
Guck dich doch an, du Opfer!
Kein Wunder, hast du kein Profilbild. Wahrscheinlich hat die Kamera Selbstmord begangen, als sie ein Selfie von dir schießen sollte ;-)
Besser, als ein Vermögen für Shutterstock-Fotos auszugeben! ;-)
Ich hätte noch ewig mit HeinzKunoSchlumpf hin und her schreiben können. In der Disziplin des Users mit dem größten Durchhaltevermögen lief mir niemand den Rang ab. Ja, es bereitete mir regelrecht Genugtuung, all meine Aggressionen in Beschimpfungen, gespickt mit Zwinkersmileys (die nichts anderes als ein Synonym für meinen Mittelfinger darstellten), mit voller Ladung auf mir unbekannte Menschen abzufeuern.
Leider klingelte es in ebendiesem Moment an der Wohnungstür.
Ich warf einen Blick auf mein Handy und verzog den Mund zu einem teuflischen Grinsen. Na warte, noch war nicht das letzte Wort geschrieben. Ich hatte noch ein paar Provokationen parat und die würde ich dem Kerl nachher mit dem größten Vergnügen präsentieren.
Es klingelte erneut – anscheinend wollte jemand ganz dringend eine verpasst bekommen.
Knurrend erhob ich mich vom Sofa und schlurfte zur Tür. Es war früher Abend und ich gerade erst zu Hause angekommen, um meine Freizeit mit irgendeinem Schrott in der Glotze, Bier in der Hand und einem gediegenen Wortgefecht auf Facebook zu verbringen. Oder auch auf YouTube, Twitter … oder einem Blog oder Chatforum. Wahlweise auch gern mal bei Amazon, wo ich alles Mögliche schlecht bewertete – gekauft oder nicht gekauft.
Am meisten Unterhaltung brachten die Sensibelchen namens Autoren. Ich liebte es, sie mit schlechten Rezensionen so richtig zum Heulen zu bringen und sie an ihren Fähigkeiten, Wörter in der richtigen Reihenfolge zu tippen, zweifeln zu lassen. (Nein, ich las keine Bücher – ich war doch nicht bescheuert!)
Gelegenheiten gab es auf jeden Fall genug und meine Fantasie kannte keine Grenzen, wenn es um Provokationen ging.
Als ich die Tür öffnete, blickten mich zwei große braune Augen, verborgen unter einem roten Pony, an. Die Kleine hätte hübsch sein können, hätte sie mir nicht so unsicher ins Gesicht geglotzt und ihre Finger um ein Stück Papier geklammert, als wäre es ihr Rettungsring.
Ich erkannte innerhalb eines Lidschlags, dass sie kaum älter als zwanzig sein konnte und anscheinend für irgendeinen missionarischen Scheiß missionieren musste. So brav, wie sie angezogen war, ziemlich sicher für eine christliche Gebetsgruppe oder die Rettung der Welt, indem sie Katzenbabys an alte Menschen verschenkte.
Sah ich alt aus? Nein, ich war erst dreiundzwanzig.
Oder wie ein Christ? Keinesfalls. Auch wenn mein Look schon mal um einiges verwegener gewesen war als jetzt, so schrien meine schwarz gefärbten Haare, die Tattoos und der ›Leck mich am Arsch‹-Stil meiner Kleidung jeden regelrecht an, er solle mich in Ruhe lassen. Ich hatte meine eigene Religion. Meinen eigenen Willen.
Früher hatte ich noch einen auf dieses ›Lass mich, ich will nicht spielen, sondern beißen‹-Image draufgesetzt, indem ich mich mit anderen Jugendlichen umgab, die teilweise noch abschreckender als ich gekleidet waren. Irgendwann hatte ich dann aber genug davon gehabt, im Rudel unterwegs zu sein, und war zum einsamen Wolf mutiert. Ein einsamer Wolf, der liebend gern Mitmenschen anknurrte, weil sie einen mit belanglosem Müll die Birne vollquatschen wollten. So wie dieses Rotkäppchen, das gerade vor mir stand und mich mit seinen Hundeaugen musterte.
Mein Äußeres schien bei ihr nicht zu funktionieren – zu viele christliche Gene, die ihr einredeten, dass auch diese arme Seele noch gerettet werden könnte.
Konnte ich nicht. Wollte ich nicht.
Ich mochte mein Leben so, wie es war. Auch wenn es in vielen Punkten zugegebenermaßen ein paar Updates hätte vertragen können.
»Guten Abend.« Ihre Stimme klang ebenso zart und rein, wie ihr Äußeres wirkte. »Darf ich mich vorstellen? Ich bin …«
»Ich habe keine Stripperin im Ministranten-Look bestellt«, fiel ich ihr ins Wort und sah mit Genugtuung, wie ihre großen Augen sich noch mehr weiteten.
Ja, so mochte ich es. Genau so. Im Nullkommanichts hatte ich der Kleinen den Wind aus den Segeln gepustet – und wenn sie nicht augenblicklich auf ihren schwarzen Lackschühchen kehrtmachen und jemand anderen belästigen würde, würde ich ihr zeigen, wie ich mit kleinen katholischen Engelchen umging. Die verließen meine Wohnung nämlich nur mit gebrochenen Flügeln, zerzausten Haaren – und OHNE Heiligenschein.
Die Kleine rang sichtlich um Fassung und schien nach Worten zu suchen, die das ›Missverständnis‹ in möglichst tugendhaftem Tonfall aufklären würden.
Ich ließ ihr keine Zeit, in ihrem Mauerblümchen-Vokabular zu forsten, und schoss hinterher: »Aber jetzt, wo du schon hier bist … Deine Titten sehen in der Bluse nicht schlecht aus. Komm rein und ich zeige dir, wie der Teufel einen Engel vögelt.«
Ja, ich war ein Arsch. Ein gemeiner, frauenverachtender Arsch.
Und die Ohrfeige, die nur eine Millisekunde nach diesen Worten in meinem Gesicht landete, hatte ich verdient.
Dennoch spürte ich dieses Hochgefühl. Diese Macht, die ich in dem Moment ausstrahlte und die mir ein Grinsen aufs Gesicht zauberte, obwohl die Hälfte davon brannte.
Ich sah nicht schlecht aus, das wusste ich. Und wenn ein Kerl wie ich einer Frau wie ihr so etwas sagte, konnte sie nur auf zwei Arten reagieren: Entweder sie begann zu heulen und schlug mit zarten Fingerchen zu – oder sie stieg darauf ein und hatte mit mir den Spaß, den ich einer Frau definitiv bieten konnte. Ich verachtete meine Mitmenschen zwar, stöhnen durfte der weibliche Anteil von ihnen trotzdem in meinem Bett.
Tja, Rotkappen-Engelchen gehörte zur ersten Sorte.
Auch wenn sie mir ihre Tränen nicht zeigen wollte, so konnte ich ihre braunen Augen unnatürlich glänzen sehen, ehe sie fast schon fluchtartig auf ihren Schühchen herumwirbelte und das Treppenhaus hinuntereilte.
Ich sah ihr nach, bis sie um die nächste Ecke gebogen war, dann schloss ich mit einem zufriedenen Lächeln die Tür, um mich wieder HeinzKunoSchlumpf zuzuwenden.
Dass mein Handy in ebendiesem Moment auf den Boden fiel, war nicht darauf zurückzuführen, dass ich mit einem Mal einen Schwächeanfall oder Herzinfarkt erlitt. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass ich mir an die Brust fasste, während ich wie versteinert auf das starrte, was sich gerade vor mir in der Luft materialisierte.
Ich hatte doch erst ein Bier gehabt … ein einziges verdammtes Bier!
Halluzinierte ich etwa?
Ja, das musste es sein. Ich halluzinierte.
Okay.
Tief durchatmen. Augen schließen. Bis drei zählen und dann wieder öffnen.
Dann wäre alles gut. Dann würde ich meinen Flur wieder so sehen, wie er war, ehe Katholiken-Tussi geklingelt hatte.
Ich versuchte, meine Panik niederzuringen, atmete bewusst tief ein und kniff die Augen zusammen.
Eins.
Zwei.
»Ich bin keine Halluzination.«
Dr…
Verd…
Was?!
Ich riss die Augen wieder auf und starrte auf die junge Frau, die eben noch vor mir auf der Türschwelle gestanden und mich mit ihren braunen Engelchen-Augen angestarrt hatte – ehe sie mir eine scheuerte.
Nur dass diese junge Frau jetzt halb durchsichtig mitten in meiner Wohnung stand.
Ansonsten war alles genau gleich. Die Augen, die Haare, sogar die weiße Bluse und der knielange schwarze Rock, den sie nun selbst begutachtete, während sie an sich hinunterblickte und dabei die Stirn runzelte.
»Hm, nicht schlecht. Hatte schon schlimmere Körper.«
Gut. Ich versuchte wirklich, mich zusammenzureißen und das hier irgendwie (IRGENDWIE!) zu begreifen.
Ging nicht. Keine Chance.
Ich hatte noch nie Drogen genommen. Das war nicht mein Ding. Alkohol schon. Aber davon hatte ich definitiv noch zu wenig intus, als dass ich mir SOLCHE Sachen eingebildet hätte.
Andere Erklärung: Ich hatte einen Hirntumor.
Ja, das war der plausibelste Grund dafür, dass ich mit einem Mal Dinge sah, die nicht da sein konnten.
Oder ich war schizophren geworden. Konnte man das? Von einem Augenblick auf den anderen schizophren werden?
Ohne es bewusst entschieden zu haben, hob ich mein Handy vom Boden auf (das zum Glück heil geblieben war), wischte über das Display und gab in Safari ›schizophren von heute auf morgen‹ ein.
Im Tippen war ich schnell. Sehr schnell, ich hatte ja auch täglich ganz viel Übung.
»Was machst du da?«
Das rothaarige Mädchen war einen Schritt näher getreten/geschwebt – und ich zuckte zusammen.
Konnten Halluzinationen einen berühren?
Ich wollte es nicht herausfinden.
Also hob ich den Blick und richtete ihn auf die Kleine, die nur noch einen Meter von mir entfernt stand und mich mit schief gelegtem Kopf ihrerseits musterte.
»Du bist noch nicht ohnmächtig geworden, hast noch nicht nach der Polizei gerufen und auch noch keine Kreuze unter meine Nase gehalten«, stellte sie lächelnd fest. »Vielleicht bist du doch nicht so ein hoffnungsloser Fall, wie ich im ersten Moment dachte.«
Ich begann, den Kopf zu schütteln. So lange, bis ich endlich die Kraft fand, auch meine Beine wieder zu bewegen. Ohne sie anzusehen, ging ich an ihr vorbei in die Küche. Ich brauchte jetzt etwas Stärkeres als Bier. Viel, viel stärker.
Google meldete mir inzwischen, dass man nicht plötzlich schizophren werden konnte – zumindest nicht, wenn man die Finger von Drogen ließ.
Okay, dann eben doch der Hirntumor. Aber dann konnte ich mich auch gleich so lange besaufen, bis ich tot umfiel. Das machte jetzt ohnehin keinen Unterschied mehr. Übermorgen würde mein Chef mich anrufen, weil ich nicht zur Arbeit erschien (morgen hatte ich frei) und irgendwann würden sie mich dann tot in der Küche finden.
Guter Plan.
Besser, als diesem rothaarigen Katholiken-Geist zuzuhören, der wirres Zeugs faselte.
Zum Glück hatte ich in der Küche unter der Spüle immer einen Whiskyvorrat. Das hatte ich mir angewöhnt, nachdem meine Ex mir ständig alles weggesoffen hatte – und es auch beibehalten, nachdem ich sie mit einem meiner Kumpels im Keller unseres Hochhauses rumlecken sah. (Das war übrigens das letzte Mal, dass ich sie überhaupt gesehen hatte … Vielleicht sollte ich mal nachsehen gehen, ob da unten im Keller eine Leiche lag …)
Jetzt war ich meiner Ex sogar dankbar dafür, denn ich konnte die volle Whiskyflasche ansetzen und einen großen Schluck trinken. Der Alkohol verbrannte meine Kehle, aber ich spürte mich immerhin. Was ja gut war, wenn man halluzinierte, oder? Keine Ahnung.
Ein weiterer Schluck folgte.
»Du weißt schon, dass Alkohol nicht gut für deine Leber ist?«
Verdammt. Sie war immer noch da. Diese Stimme in meinem Kopf, die dem Katholikenmädchen gehörte.
Ich verdrehte die Augen und nahm einen dritten Schluck. So langsam begann der Alkohol, durch meine Adern zu rauschen.
Vierter Schluck.
»Du kannst mich nicht einfach ›wegtrinken‹, Leon.«
Gut. Das war definitiv das Zeichen, dass ich sie mir nur einbildete. Denn ich hatte Rotkäppchen nie gesagt, wie ich hieß.
Fünfter Schluck.
»Na gut. Ich komme wieder, wenn du dich eingekriegt hast.«
Sechster Schluck.
»Man sieht sich, Leon.«
…
Siebter Schluck.
…
…
…
…
Stille.
Ich wagte beinahe nicht, mich umzudrehen und in die Richtung zu schielen, aus der die Stimme eben noch erklungen war. Dennoch tat ich es – und atmete tief durch.
Sie war weg.
Einfach so, nur mit ein bisschen Single Malt.
Frauen mit Alkohol vertreiben – die Ironie meines Lebens.
Kapitel 2: Bruder vor Luder - oder so
Dass ich am nächsten Tag frei hatte, war Fluch und Segen zugleich. Einerseits brummte mein Schädel vom ungeplanten Whisky-Konsum (der danach noch weitergegangen war – ja, ich hatte ein Alkoholproblem, na und?!). So konnte ich immerhin in Ruhe meinen Kater ausschlafen. Andererseits war heute Mittwoch. Der Tag, an dem ich Wäsche machen sollte. Wollte ich allerdings nicht, ich hasste Waschen.
Seufzend drehte ich mich im Bett herum und suchte nach einer kühlen Stelle auf meinem Kissen, auf die ich meine pochende Stirn legen konnte.
Der gestrige Abend kam mir wie ein böser Traum vor. Welcher Mensch sah denn bitte schön Geister in seiner Wohnung? Und dann noch denjenigen eines katholischen Mädchens? Wenn es wenigstens eine sexy Stripperin gewesen wäre, die sich die Kleider vom Leib gerissen hätte – dann hätte ich mir aus anderen Gründen so viel Alkohol genehmigt. Aber so … Das Leben war manchmal echt ein Arschloch. Oder meine Fantasie. Oder beides.
Ich seufzte in mein Kopfkissen und versuchte, zurück in den Traum zu gelangen, aus dem ich gerade erwacht war. Irgendetwas mit einer Bar. Und hübschen Mädchen, mit denen ich geflirtet hatte (ja, ich konnte auch nett sein – aber nur, wenn ich Sex dafür bekam).
»Du solltest aufstehen …«
Ich erstarrte mitten im Versuch, nicht zu hyperventilieren.
Die Stimme, die direkt an meinem Ohr erklungen war … war diejenige des katholischen Geistermädchens.
Was zum Teufel hatte das zu bedeuten? War ich jetzt wirklich übergeschnappt? Bildete ich mir tatsächlich irgendwelche Stimmen ein? Oder war ich noch am Schlafen?
Beherzt kniff ich mir in die Hand – und fluchte im nächsten Moment.
Verdammt, tat das weh!
»Scheinst dich noch nicht an mich gewöhnt zu haben«, kommentierte die Mädchenstimme trocken.
Jetzt erklang sie etwas weiter entfernt, sodass ich es wagte, mich umzudrehen und nach ihr zu suchen.
Da stand sie. Mitten in meinem unordentlichen Zimmer (ich sollte ja eigentlich Wäsche waschen). Und lächelte mich an.
Sie. Lächelte. Einfach. So.
Immer noch trug sie diese weiße Bluse und den schwarzen Rock. Aber ich glaubte auch nicht, dass Geister sich umziehen mussten. Sie waren schließlich tot …
Verdammt! Was dachte ich da?!
Da stand ein GEIST in meinem Zimmer!
Ein verfluchter lebendiger – äh … toter – Geist!
Einen Moment lang war ich versucht, mir die Decke über den Kopf zu ziehen, hysterisch zu schreien oder auf sie loszugehen.
Ich tat nichts von all dem, sondern starrte sie nur an, als wäre sie … ein Geist.
Ihr Lächeln wurde etwas breiter. »Wir hatten gestern nicht die Gelegenheit, uns vorzustellen.« Jetzt trat sie wieder näher an mein Bett und streckte mir ihre zierliche Hand entgegen, die ich natürlich nicht ergriff – Schockstarre, durchsichtig und so. Letzteres schien sie selbst zu merken, sie zog die Hand zurück. »Hi, ich bin Feli. Eigentlich Felicitas, aber nenn mich Feli.«
Ihre Augenbrauen verschwanden noch weiter unter dem roten Pony, während sie mich ansah. Anscheinend wartete sie auf irgendeine Reaktion.
»Blb …« (Ja. Tatsächlich. ›Blb‹. Mehr kam nicht über meine Lippen.)
Sie legte den Kopf schief. »Bist du dumm oder so?« In ihren Augen erschien ein mitleidiger Ausdruck.
Sie konnte sich ihr Mitleid sonst wohin stecken!
»Verschwinde!«
Ein Wort. Ein Blick. Es hätte reichen sollen. Die Alternative wäre noch mehr Whisky (das hatte ja beim ersten Mal auch gewirkt), aber mein Schädel brummte so stark, dass ich bezweifelte, dass ich, ohne mich zu übergeben, in die Küche gelangen könnte.
Leider reichte dieses eine Wort nicht.
Sie blieb an Ort und Stelle stehen und musterte mich mit ihren Nussaugen. »Ich werde nicht so rasch verschwinden, falls du darauf wartest, Leon. Hier herrschen eine Menge unguter Energien. Die muss ich erst vertreiben, ehe du mich wieder loswirst.«
Okay, in diesem Augenblick wünschte ich mir tatsächlich, ich würde in Ohnmacht fallen. Ein katholisches Geistermädchen war ja schon schlimm genug. Aber eines, das auch noch ein esoterisches Faible besaß – verfluchte Scheiße, was sollte das eigentlich?!
Ich überlegte, wie ich diesen Geist wieder loswerden könnte. Vielleicht sollte ich einen Exorzisten rufen? Ja, das wäre eine gute Idee. Eine sehr …
Als ich nach dem Handy greifen und einen Exorzisten googeln wollte, stoben mit einem Mal Funken und ich zog fluchend die Hand zurück, da ich mir die Finger am Gerät fast verbrannt hatte.
»Erste Lektion: kein Handy mehr«, war der hilfreiche Kommentar der Geistertussi.
Jetzt machte sie mich wütend. Sehr sogar. Ich vergaß, dass ich sie mir ja eigentlich nur einbildete, und knurrte sie an. »Verdammt! Warst du das etwa? Hast du gerade mein Handy kaputt gemacht?!«
Statt sich zu entschuldigen, lächelte sie einfach weiter. »Ja. Das war ich. Das hier ist mein Job.«
»Dein …« Ich versuchte, mich zusammenzureißen, aber es ging nicht. »Verfluchter Job?!«
»Brüll mich nicht so an und hör auf, zu fluchen, das tut mir weh.« Sie verzog tatsächlich ihren schönen Mund. (Okay, ja, ich fand sie schön, na und?! Darf man einen Geist etwa nicht gruselig und schön gleichzeitig finden?!)
»Du kannst keine Schmerzen haben, du bist ein Geist!«, fauchte ich. »Einbildung. Hirngespinst. Halluzination. Such dir was aus! Und dann verschwinde aus meinem Leben!«
Das Lächeln kehrte auf ihr Gesicht zurück und sie sah mich kopfschüttelnd an. »Liebster Leon« (so begann man einen abgefuckten Liebesbrief, keine Konversation!), »ich habe dir doch gestern schon gesagt: Ich bin keine Halluzination. Und alles andere, was du gerade aufgezählt hast, bin ich auch nicht. Ich bin eine Glücksbringerin. Ein Glücksgeist. Nicht mehr und nicht weniger.«
Ich fand, dass es langsam Zeit wurde, aus dem Bett zu steigen. Ungeachtet der Tatsache, dass ich immer nackt schlief, schlug ich meine Decke zurück und setzte mich auf den Bettrand. Mein Kopf und Magen rebellierten gleichzeitig und ich musste mich zusammenreißen, um ihr nicht vor die durchsichtigen Füße zu kotzen. Aber es ging einigermaßen.
Ihr Blick glitt zu gewissen Regionen, die sie mit meinen Boxershorts nicht zu Gesicht bekommen hätte, und ihr Lächeln wurde etwas breiter. »Du scheinst schön geträumt zu haben, das ist doch schon mal ein Anfang.«
V.E.R.D.A.M.M.T.
Vor lauter Geisterzeugs hatte ich gar nicht darauf geachtet, dass ich die Bar aus meinem Traum anscheinend schon verlassen und demnach eeeetwas weiter mit den hübschen Mädchen gewesen war als dort, woran ich mich beim Aufwachen erinnert hatte.
Rasch zog ich die Decke über meine Kronjuwelen und funkelte den Geist verärgert an. »Weißt du, wie abgefuckt sich das anhört?!«, brummte ich. »Ich spreche gerade mit verdammter Luft. Verdammter Luft, die aussieht wie dieses Katholikenmädchen von gestern. Ich sag dir nur eins: Hau ab. Ich will nichts von dir. Und du gefälligst auch nicht von mir!«
Sie legte den Kopf schief und verschränkte die Arme vor der Brust. »Oh, ich will nichts von dir, keine Sorge. Im Gegenteil. Ich will, dass du ganz viel von mir bekommst.«
Nun fielen mir tatsächlich fast die Augen aus dem Kopf.
Eine Geister-Nutte? Echt jetzt? Gab es das? Wie sollte ich das dem Seelenklempner verklickern (den ich zweifelsohne treffen würde, würde ich jemals irgendjemandem von dieser Unterhaltung erzählen)? ›Oh, Onkel Doktor, da war ein Geist, der Doktorspielchen mit mir machen wollte.‹
Nein, viel peinlicher wäre nur noch, ihm zu gestehen, dass ich dieselben auch gemacht hätte. Was ich nicht tun würde! Sie war nicht echt! War sie nicht. Nein.
Und das würde ich ihr gleich beweisen.
Ich sprang auf und lief zielstrebig an ihr vorbei zu meiner Jeans, die ich achtlos auf den Boden geworfen hatte. Ein Shirt folgte sowie meine Jacke. Es war seit einiger Zeit beschissenes Wetter draußen.
»Hey, wo willst du hin?«, protestierte das Geistermädchen hinter mir.
Natürlich erhielt sie keine Antwort. Ich fand es besser, sie einfach Geistermädchen sein zu lassen, während ich mich der Realität zuwandte – die pochend in meinem Kopf dröhnte, als ich die Wohnung verließ.
Keine zwei Minuten später stand ich in einer uralten Telefonzelle, die sich nur eine Straße weiter von meinem Wohnblock befand. Ja, es gab sie noch, diese seltenen kleinen Glasräume, die jedoch kaum mehr benutzt wurden. Entsprechend stank es hier drinnen nach Urin und irgendetwas Totem, das immerhin von jemandem weggeräumt worden war.
Ich wühlte in meiner Jeans nach einer Münze (zum Glück hatte ich gestern das Restgeld von meinem Biereinkauf einfach in die Hose gesteckt) und war noch nie so froh darüber gewesen, dass ich einen gewissen Spleen für Zahlen hatte. Ich konnte mir alle Zahlenreihen merken. Jede, war sie noch so lang und kompliziert. Auch die Telefonnummer meines besten Freundes.
»Jens!« Ich hörte selbst, wie abgehetzt ich klang, als es endlich in der Leitung klickte.
Und Jens ebenfalls. »Was ist los, Alter? Warum rufst du mich von dieser Nummer aus an?« Er wirkte schläfrig.
Es war zwar ziemlich sicher bereits Mittag (ich hatte nicht mehr aufs Handy schauen können, ehe es den Geist aufgegeben hatte – was für ein Wortspiel …), aber auch er hatte die Angewohnheit, an seinen freien Tagen länger zu schlafen. Wir arbeiteten zusammen bei einem Getränkelieferanten und der lieferte mittwochs nicht aus.
»Hör zu«, murmelte ich ins Telefon. »Kannst du bei mir vorbeikommen? In einer halben Stunde? Es ist wichtig.«
Ich hörte Jens am anderen Ende tief seufzen. »Alter, ich hab gestern … Warte, Süße … bin gleich bei dir.« Ich hörte, wie er eine Tür schloss, da er anscheinend in einen anderen Raum gegangen war, weil er nicht wollte, dass ›Süße‹ etwas von unserem Gespräch mitbekam. »Sie ist der Wahnsinn, Mann.« Seine Stimme klang gedämpft, da er extra leise sprach. »Doppel-D, und ihr Arsch …! Verflucht, Alter. Ich brauche definitiv länger als eine halbe Stunde – ich werde sie den ganzen Tag durchvögeln.«
Ich verdrehte die Augen. »Sag ihr doch, du willst sie heute Abend wiedersehen, dann kannst du sie in Ruhe …«
»Nein! Alter!« Kurz war Jens laut geworden, jetzt flüsterte er wieder. »Ich bin doch nicht wahnsinnig. Weißt du, was Frauen denken, wenn du sie am selben Tag wiedersehen willst? Richtig. Sie erwarten einen Verlobungsring. Ne, das tu ich mir nicht an. Ich will sie bloß vögeln, dann ist sie Gebrauchtware.«
Gut, es gab jemanden, der zu Frauen noch mieser war als ich: Jens.
»Ach vergiss es«, brummte ich und warf einen wütenden Blick hinüber zu meinem Wohnblock.
Dort, im zehnten Stock, wartete ein Geistermädchen auf mich. Ohne Doppel-D, aber mit mindestens genauso perversen Gedanken, wie Jens sie gerade hatte.
Wer wusste schon, ob sie nicht nackt war, wenn ich zurückkäme?
Ich hörte ein Knacken, dann war Jens weg – und ich merkte, wie meine Hand zitterte, als ich den Hörer auf die Gabel zurücklegte.
Wenn ich Glück hätte, wäre sie verschwunden.
Leider hatte ich kein Glück. Sie stand noch da. Mitten in meiner Wohnung. Und lächelte mich an.
»Hey, da bist du ja wieder!«, rief sie erfreut und kam auf mich zu.
Ich wich zurück. Wenn sie mich tatsächlich verführen wollte, müsste sie schon härtere Geschütze auffahren als ein Lächeln. Gegen weibliche Verführungskünste war ich immun – jahrelanges Training.
»Also, lass uns doch den Verhaltenskodex klären.« Ihr Lächeln wurde noch etwas breiter.
Verdammt, wo war ich hier gelandet? In einer okkulten Pornoversion von ›Fifty Shades of Grey‹?!
»Hör zu«, begann ich und hob die Hände zum Zeichen, dass sie nicht noch näher kommen sollte. »Egal, was du von mir willst – du wirst es nicht kriegen, klar? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist, aber es wird aufhören. Sofort!«
»Oh, du durchläufst die Phasen ja wirklich schnell«, erwiderte sie und zog die Augenbrauen hoch.
»Phasen?« Ich starrte sie verwirrt an.
»Ja«, nickte sie und begann, anhand ihrer Finger aufzuzählen. »Erste Phase, wenn man einem Glücksgeist begegnet: Verleugnung. Zweite Phase: Ärger. Dritte: Verhandeln. Da schlitterst du jetzt gerade rein. Dann folgen meist noch Depression und schließlich Akzeptanz. Und dann, ja, dann die Veränderung.« Ihr Lächeln blieb auf ihren Lippen, als wäre es dort festgeklebt.
»Depression?«, brummte ich. »Ich dachte, du bist ein Glücksgeist!«
Wieder nickte sie und ihre nussbraunen Augen begannen zu strahlen. »Oh ja, das bin ich. Du bist echt schnell, weißt du das? Der letzte meiner Schützlinge hat zwei ganze Wochen dafür gebraucht, bis er mich akzeptiert hat. Leider war es dann zu spät, um ihn zu retten. Aber bei dir wird es anders sein. Das spüre ich.«
»Halt, halt, halt!«, unterbrach ich ihren Redeschwall. »Was faselst du da?! Glücksgeist? Mich retten? Was wird hier eigentlich gespielt? Ich dachte, du willst Sex mit mir?!«
In diesem Moment erklang das glockenhellste Lachen, das ich jemals gehört hatte. Und ich wusste auf der Stelle, dass ich süchtig nach diesem Lachen werden würde. Es durchflutete mich wie eine Welle voller Wärme, Geborgenheit und … ja, Glück. Besser als jede Pille, die man einwerfen konnte.
Leider war die Flut viel zu rasch vorbei und an ihrer Stelle blieben gähnende Leere und Dunkelheit. Der Kontrast ließ sich in etwa mit einem herrlichen Sonnenbad vergleichen – ehe jemand einen Eimer Eiswasser über einem auskippt.
Ich fröstelte sogar, während das Geistermädchen mich nun mit belehrend in die Luft gehobenem Zeigefinger ansah. »Ich will keinen Sex mit dir. Wie stellst du dir das denn vor? Ich bin doch durchsichtig, Leon. Hach, ihr Männer … denkt immer an das Eine und nie an das Wichtige.«
Okay, Glockenstimmchen war sexistisch. Aber ich auch. Passte also.