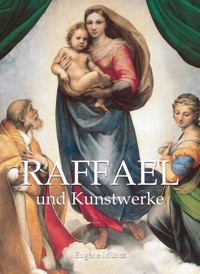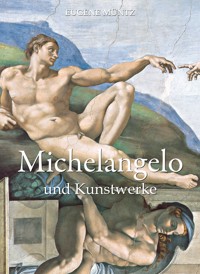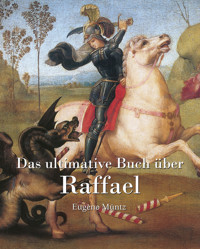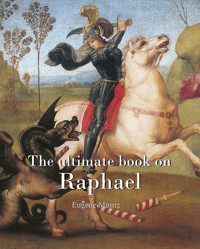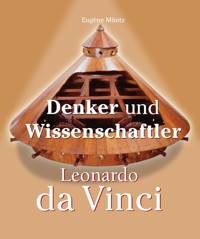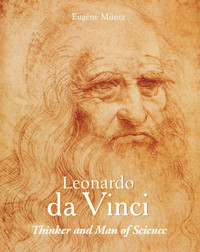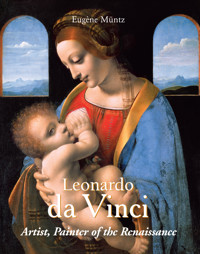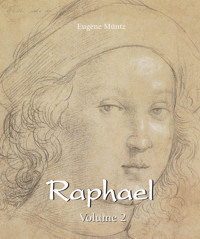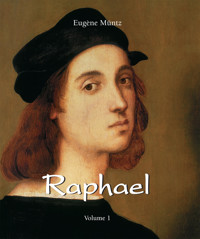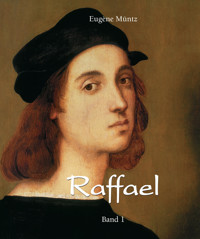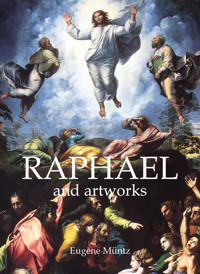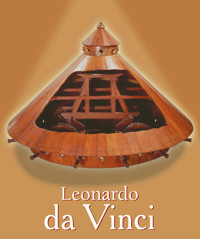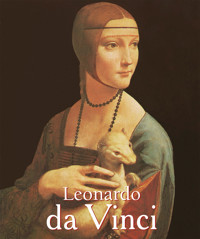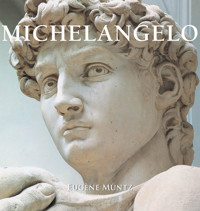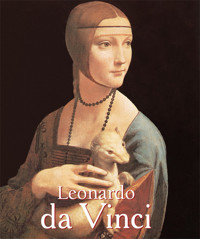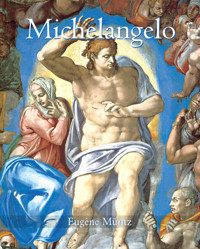15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Parkstone International
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
„Dadurch, dass er die Natur und alle für ihre vollkommene Wiedergabe wichtigen Wissenschaften - Anatomie, Perspektive, Physiognomie - leidenschaftlich studierte und klassische Modelle konsultierte, sich gleichzeitig allerdings die für ihn typische Unabhängigkeit bewahrte, konnte er bei der Kombination von Präzision mit Freiheit und von Wahrheit mit Schönheit nicht fehl gehen. Die raison d’être und der Ruhm des Meisters beruhen auf dieser endgültigen Emanzipation, dieser perfekten Meisterschaft der Modellierung, der Lichtgebung und des Ausdrucks, dieser Weite und Freiheit. Auch andere mögen neue Wege gebahnt haben, aber niemand reiste weiter oder stieg höher als er.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Eugène Müntz
LEONARDO DAVINCI
Autor: Eugène Müntz
Übersetzung: Dr. Martin Goch
© Parkstone Press USA, New York
© Confidential Concepts, Worldwide, USA
© Image-Barwww.image-bar.com
Weltweit alle Rechte vorbehalten. Soweit nicht anders vermerkt, gehört das Copyright der Arbeiten den jeweiligen Fotografen. Trotz intensiver Nachforschungen war es aber nicht in jedem Fall möglich, die Eigentumsrechte festzustellen. Gegebenenfalls bitten wir um Benachrichtigung.
ISBN 13: 978-1-64461-863-9
Anmerkung des Herausgebers
Aus Respekt vor der einzigartigen Arbeit des Autors wurde der Text nicht aktualisiert, was die Änderungen bezüglich der Zuschreibungen und Datierungen der Werke betrifft, die bisher unsicher waren und es in manchen Fällen immer noch sind.
INHALT
Vorwort
Leonardos Kindheit und seine ErstenWerke
Der Hof der Sforza
Die Madonna in der Felsengrotte und die Meisterwerke aus Santa Maria delleGrazie
Leonardos Akademie
Liste der Maler
Vorwort
Es gibt in den Annalen der Kunst und der Wissenschaft keinen berühmteren Namen als den Leonardo da Vincis. Und dennoch existiert über dieses herausragende Genie keine Biographie, die ihn in all seiner Vielseitigkeit bekannt macht.
Die überwiegende Anzahl seiner Zeichnungen ist niemals reproduziert worden, und kein Kritiker hat es jemals versucht, diese Meisterwerke zu katalogisieren und zu klassifizieren. Ich habe mich zunächst dieser Aufgabe zugewandt. So kann ich, neben anderen Resultaten, der Öffentlichkeit den ersten kritischen Katalog der unvergleichlichen Sammlung von Zeichnungen der Königin von England in Windsor Castle präsentieren.
Der Leser wird in den zahlreichen früheren Schriften zu Leonardo vergeblich nach Details zur Entstehung seiner Bilder, dem Prozess von der ersten Skizze bis zum letzten Pinselstrich suchen. Wie meine Forschungen zeigen, erreichte Leonardo Perfektion nur durch unermüdliche Arbeit. Es lag an seiner mit ungeheurer Sorgfalt durchgeführten Grundlagenarbeit, dass die Madonna in der Felsengrotte, die Mona Lisa (vgl. Vol. II, S. 163) und die Anna Selbdritt so voller Leben sind.
Vor allem aber war eine Zusammenfassung und eine Analyse der künstlerischen, literarischen und wissenschaftlichen Manuskripte gefordert, deren erste vollständige Publikation in unserer Generation von Gelehrten wie Richter, Charles Ravaisson-Mollien, Beltrami, Ludwig, Sabachnikoff und Rouveyre und den Mitgliedern der römischen Akademie der “Lincei“ begonnen wurde.
Ich bin überzeugt, dank einer methodischen Untersuchung dieser Handschriften des Meisters tiefer in das innere Leben meines Helden eingedrungen zu sein als meine Vorgänger. Ich möchte die Aufmerksamkeit des Lesers besonders auf die Kapitel über Leonardos Einstellung gegenüber den okkulten Wissenschaften, über seine literarische Bedeutung, seine religiösen Überzeugungen und moralischen Prinzipien sowie seine – bislang bestrittenen – Studien antiker Modelle lenken.
Ich habe mich ferner bemüht, die Gesellschaft, in der Leonardo lebte und arbeitete, zu beschreiben, vor allem den Hof von Ludovico il Moro in Mailand, jenes faszinierende und anregende Zentrum, das eine so große Bedeutung für die italienische Renaissance hatte. Meine ausgedehnte Lektüre hat mich in die Lage versetzt, bei zahlreichen Bildern und Zeichnungen neue Bedeutungen zu entschlüsseln und den wahren Sinn vieler Notizen in den Manuskripten aufzuzeigen. Ich bilde mir nicht ein, alle Probleme gelöst zu haben. Ein Unternehmen wie das vorliegende erfordert die Zusammenarbeit einer ganzen Generation Gelehrter. Die Bemühungen eines Einzelnen konnten nicht ausreichen. Aber ich kann zumindest beanspruchen, Ansichten, die ich nicht teilen kann, ausgewogen und höflich erörtert zu haben, weshalb ich vom Leser eine gewisse Nachsicht erwarten kann.
Mir bleibt noch die angenehme Pflicht, den zahlreichen Freunden und Menschen, mit denen ich korrespondiert habe, für ihre Hilfe im Verlauf meiner langen und arbeitsreichen Untersuchung zu danken. Sie sind zu zahlreich, als dass ich Sie hier jeweils nennen könnte, aber ich habe mich im Buch selbst bemüht, anzuzeigen, wo ich ihnen etwas verdanke.
EUGÈNEMÜNTZ
PARIS, im Oktober 1898
1. Selbstporträt, ca. 1512. Rötel auf Papier, 33,3 x 21,3 cm. Biblioteca Reale, Turin.
Leonardos Kindheit und seine Ersten Werke
Leonardo da Vinci ist der vollkommenste Vertreter des modernen Intellekts, die großartigste Verkörperung der Hochzeit von Kunst und Wissenschaft: der Denker, der Dichter, der Zauberer, dessen Faszination unerreicht ist. Wir finden beim Studium seiner unvergleichlich vielfältigen Kunst sogar in seinen launenhaften Werken, um Edgar Quintets gelungenen Ausdruck ein wenig abzuwandeln, “…die Gesetze der italienischen Renaissance und die Geometrie der universalen Schönheit“.
Es ist leider wahr, dass, wenn man die wenigen vollendeten Werke – die Madonna in der Felsengrotte, Das Abendmahl, Anna Selbdritt und die Mona Lisa – einmal ausklammert, Leonardos Errungenschaften als Maler und Bildhauer vor allem in Form großartiger Fragmente vorliegen. Wir müssen uns seinen Zeichnungen zuwenden, um die Zartheit seines Herzens und den Reichtum seiner Vorstellungskraft zu verstehen.
Zwei Abschnitte des menschlichen Lebens scheinen Leonardo besonders fasziniert zu haben: die Jugend und das Alter. Die Kindheit und das Erwachsenenleben scheinen ihn weniger interessiert zu haben. Er hat uns eine ganze Serie von Abbildungen von Jugendlichen hinterlassen, einige träumerisch, andere leidenschaftlich.
Ich kenne in der gesamten modernen Kunst keine Werke, die so frei, großartig und spontan, in einem Wort göttlich sind und die man den Wundern des Altertums gegenüber stellen könnte. Dank Leonardos Genie beschwören diese Gestalten, beflügelt, durchscheinend, aber gleichzeitig im höchsten Sinn wahr, eine Perfektion herauf und transportieren uns auf ihre Ebene. Nehmen wir als Beispiel zwei Köpfe aus dem Louvre. Wenn ich mich nicht irre, illustrieren sie die klassische Schönheit und das Schönheitsideal der Renaissance. Der erste zeigt einen Jugendlichen mit einem Profil, das so pur und korrekt ist wie das einer griechischen Kamee. Sein Hals ist nackt, und in sein langes, kunstvoll gelocktes Haar ist ein Lorbeerkranz geflochten. Der zweite Kopf zeigt denselben Typus, ist aber im italienischen Stil, kraftvoller und lebendiger, gehalten. Das Haar ist von einer kleinen Kappe bedeckt und um die Schultern findet sich eine Andeutung eines bis zum Hals zugeknöpften Wamses. Die Locken fallen natürlich und ungekünstelt. Wer kann in diesen beiden Köpfen nicht den Kontrast zwischen der klassischen, im Kern idealistischen und der Form gewidmeten Kunst und der modernen Kunst erkennen, die freier, spontaner und lebhafter ist?
Leonardos Darstellungen erwachsener Menschen sind kraftvoll und voller Energie und Willen. Sein Ideal ist ein Mann wie eine Eiche. Einen solchen zeigt die Profilansicht in der Royal Library in Windsor, dessen Züge so fest modelliert sind. Diese Zeichnung sollte mit einer anderen desselben Kopfes in jüngerem Alter verglichen werden.
Das Alter wird uns in all seinen unterschiedlichen Aspekten, von der Majestät bis zur Gebrechlichkeit, präsentiert. Einige Gesichter sind bis auf die bloße Knochenstruktur reduziert, in anderen sehen wir den Verfall der Gesichtszüge, die Hakennase, das zum Mund heraufgezogene Kinn, die schlaffen Muskeln, den kahlen Kopf. Das großartigste dieser Bilder ist Leonardos Selbstbildnis: ein kraftvoller Kopf mit durchdringenden Augen unter zusammengezogenen Augenlidern, ein spöttischer Mund mit einem fast bitteren Ausdruck, eine feine, wohlproportionierte Nase, lange Haare und ein langer unordentlicher Bart. Das Ganze erinnert an einen Sternendeuter, wenn nicht gar einen Magier.
Wenn wir uns seiner Darstellung des weiblichen Ideals zuwenden, sehen wir dieselbe Frische und Vielfalt. Seine Frauen sind mal offen, mal rätselhaft, mal stolz, mal zärtlich, ihre Augen blicken träge oder es leuchtet in ihnen ein undefinierbares Lächeln. Und doch war Leonardo, wie Donatello, einer jener außergewöhnlichen großen Künstler, in deren Leben die Liebe zur Frau keine Rolle gespielt zu haben scheint. Während Eros’ Pfeile in der epikureischen Renaissancewelt um den Meister herum niedergingen; während Giorgione und Raffael als Opfer zu leidenschaftlich erwiderter Leidenschaften starben; während Andrea del Sarto seine Ehre der Liebe zu seiner launischen Frau Lucrezia Fedi opferte; während selbst Michelangelo, der nüchterne Misanthrop, für Vittoria Colonna eine gleichermaßen leidenschaftliche wie respektvolle Zuneigung hegte, widmete Leonardo sich vollständig der Kunst und der Wissenschaft und schwebte über den menschlichen Schwächen. Die Freuden des Geistes genügten ihm. Er selbst drückte es deutlich aus: “Die schöne Menschheit vergeht, aber die Kunst überdauert.“ (“Cosa bella mortal passa e non arte.“)
2. Die Madonna mit der Blume (Madonna Benois), 1475-1478. Öl auf Leinwand, von Holz übertragen, 49,5 x 33 cm. Eremitage, St Petersburg.
3. Cimabue, Thronende Madonna mit acht Engeln und vier Propheten, ca. 1280. Tempera auf Holztafel, 385 x 223 cm. Galleria degli Uffizi, Florenz.
4. Giotto di Bondone, Thronende Gottesmutter mit dem Kind, 1310. Tempera auf Holztafel, 325 x 204 cm. Galleria degli Uffizi, Florenz.
5. Leonardo da Vinci und Andrea del Verrocchio, Madonna mit dem Kind und Engeln, ca. 1470. Tempera auf Holztafel, 96,5 x 70,5 cm. The National Gallery, London.
Kein anderer Künstler war jemals so von seiner Kunst absorbiert wie er, auf der einen Seite von der Suche nach der Wahrheit, auf der anderen Seite von der Verfolgung eines Ideals, das die exquisite Zartheit seines Geschmacks befriedigen sollte. Niemand brachte vergänglichen Gefühlen jemals weniger Opfer dar. In den uns von ihm hinterlassenen 5000 Manuskriptblättern erwähnt er nicht ein einziges Mal einen Frauennamen, außer um mit der Trockenheit eines Naturforschers einen Charakterzug zu benennen, der ihm in einer Person aufgefallen ist: “Giovannina hat ein fantastisches Gesicht; sie ist im Hospital in Santa Catarina.“ Dies ist typisch für seine kurzen Feststellungen.
Uns fällt sofort Leonardos Sorgfalt bei der Auswahl seiner Modelle auf. Er war kein Verfechter der Anerkennung der Natur an sich, sei sie schön oder hässlich, interessant oder unbedeutend. Er widmete sich über Monate hinweg der Suche nach außergewöhnlichen Verkörperungen des Menschlichen. Das Porträt der Gioconda zeigt uns, mit welcher Hartnäckigkeit er sich der Wiedergabe seines Modells widmete, sobald er einen solchen Phoenix gefunden hatte. Es ist zu bedauern, dass er bei der Suche nach wirklich schönen und sympathischen, leuchtenden oder verführerischen Frauentypen weniger engagiert war als bei der nach alten oder jungen Männern oder nach an Karikaturen grenzenden Typen. Es wäre so interessant gewesen, von seiner Hand eine ganze Ikonographie, sei es auch nur in Form einer Serie von Zeichnungen, zu haben – zusätzlich zu den drei oder vier Meisterwerken, auf die er seine Kräfte konzentrierte: die unbekannte Prinzessin aus der Ambrosiana, Isabella d’Este, La Belle Ferronnière und die Gioconda. Wie kam es, dass all die großen Damen der italienischen Renaissance nicht danach strebten, von jenem magischen Pinsel unsterblich gemacht zu werden? Leonardos Subtilität und Hellsichtigkeit prädestinierten ihn eigentlich zum herausragenden Interpreten der Frau. Kein anderer hätte mit einer vergleichbaren Kombination aus Subtilität und Vornehmheit ihre Gesichtszüge abbilden und ihren Charakter analysieren können.
Gleichzeitig erfreute sich, so seltsam dies ist, der Künstler, der die Frau in einer so exquisiten Darstellung verherrlicht hatte, auf Grund einer kuriosen und starken Abscheu daran, die extremen Deformationen jenes Geschlechts zu unterstreichen, dessen wertvollste Mitgift die Schönheit ist. In einem Wort, der Wissenschaftler kam hier in Konflikt mit dem Künstler: Leonardo kontrastiert Frauen in all ihrer jugendlichen Frische mit den Köpfen von Xanthippen und Schwachsinnigen und jeder Form abstoßender Verzerrung. Es scheint fast so, als wollte Leonardo – um eine Idee von Champfleury auszuleihen – dafür einen Ausgleich schaffen, dass er in seinen Bildern so vieles idealisiert hatte. Champfleury ergänzt: “Der italienische Meister hat die Frau härter behandelt als die eigentlichen Karikaturisten, denn die meisten von jenen scheinen ihre Liebe zur Schönheit dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass sie die Frau respektieren, während sie den Mann mit ihrem Sarkasmus verfolgen.“
Als Bildhauer zeichnete Leonardo sich – nach Verrocchio und Donatello – durch die Wiedererweckung der monumentalen Darstellung des Pferdes aus.
Leonardo war nicht nur Maler und Bildhauer, sondern auch Dichter, und zwar nicht der geringste unter ihnen. Er ist tatsächlich sogar hauptsächlich ein Dichter: zunächst in seinen Bildern, die eine ganze Welt schöner Eindrücke heraufbeschwören, zweitens in seinen Prosaschriften, vor allem in seinem Traktat über die Malerei, den die Welt erst vor kurzem vollständig zu Gesicht bekommen hat. Wenn er die in ihm so stark ausgeprägte analytische Fähigkeit zum Schweigen brachte, erhob sich seine Vorstellungskraft mit unvergleichlicher Freiheit und Leichtigkeit in große Höhen. Statt der professionellen Fähigkeiten, die zu leicht zu Routine degenerieren, finden wir Emotion, Fantasie, Reichtum und originelle Bilder – ebenfalls sehr wertvolle Qualitäten. Auch wenn Leonardo nicht von aktuellen Formeln, von geflügelten und eindrucksvollen Worten, von der Kunst der Kondensation weiß, macht er doch mit seinem angeborenen Charme und durch einen magischen Ausbruch seines Genies großen Eindruck auf uns.
Der Denker und der Moralist sind Verbündete des Dichters. Leonardos Aphorismen und Maximen bilden einen wertvollen Schatz der italienischen Weisheit der Renaissancezeit. Es handelt sich bei ihnen um mit unendlicher Zartheit verbundenen Instinkt, eine grenzenlose Süße und Gelassenheit. So rät er uns einmal, die Studien zu vernachlässigen, da ihre Ergebnisse mit uns sterben, ein anderes Mal erklärt er, dass derjenige, der in einem Tag reich werden will, Gefahr läuft, in einem Jahr gehängt zu werden. Die Eloquenz anderer Gedanken wird nur von ihrer Tiefe erreicht: “Wo das meiste Gefühl ist, wird es auch das meiste Leid geben“. – “Tränen kommen vom Herzen, nicht vom Gehirn.“ Es ist der Physiologe, der hier spricht; aber welcher Denker wäre nicht auf diese bewundernswerte Definition stolz gewesen! Auch der Wissenschaftler verdient unsere Bewunderung. Es ist kein Geheimnis mehr, dass Leonardo ein Gelehrter von höchstem Rang war, dass er 20 Naturgesetze erkannte, während die Entdeckung nur eines einzigen seinen Nachfolgern zu Ruhm verhalf. Was sage ich? Er erfand die Methode der modernen Wissenschaft und sein späterer Biograph M. Séailles[1] hat ihn zu Recht als den wahren Vorläufer Bacons bezeichnet. Die Namen einer Reihe von Genies - Archimedes, Columbus, Galileo, Kopernikus, Cuvier, Harvey, Newton, Pascal, Lavoisier – sind mit Entdeckungen von größerer Bedeutung verbunden. Aber gibt es einen, der eine solche Vielzahl an angeborenen Begabungen vereinte, der mit einer so leidenschaftlichen Neugier und so großem Erkenntnisdrang so unterschiedliche Wissensbereiche untersuchte; der so erhellende Geistesblitze und eine solch große Intuition für die unbekannten Verbindungen zwischen den Dingen hatte? Wären seine Schriften veröffentlicht worden, hätten sie den Fortschritt der Wissenschaft um ein ganzes Jahrhundert beschleunigt. Wir können seine Bescheidenheit und seine ausgeprägte Abneigung vor der Druckkunst nicht genug beklagen. Während ein Schreiber wie sein Freund Fra Luca Pacioli mehrere Bände in schönen Typen vorweisen kann, veröffentlichte Leonardo, aus Stolz oder aus Furcht, niemals auch nur eine einzige Zeile.
In dieser kurzen Skizze begegnen uns einige der Eigenschaften, die Leonardo Michelangelo und Raffael ebenbürtig und zu einem der führenden Meister des Gefühls, des Denkens und der Schönheit machen.
6. Jacopo Bellini, Die von Leonello d’Este bewunderte Madonna der Demut, ca. 1440. Öl auf Holztafel, 60 x 40 cm. Musée du Louvre, Paris.
7. Madonna mit der Nelke, ca. 1470. Öl auf Holztafel, 62 x 47,5 cm. Alte Pinakothek, München.
8. Andrea Mantegna, Taufe Christi, ca. 1500-1505. Tempera auf Leinwand, 228 x 175 cm. Kirche Sankt Andrea, Mantua.
9. Piero della Francesca, Taufe Christi, ca. 1440-1445. Tempera auf Holztafel, 167 x 116 cm. The National Gallery, London.
Es ist an der Zeit für eine methodische Analyse so vieler Wunder, ich könnte sagen, so vieler tours de force, wäre Leonardos Kunst nicht so gesund und so normal, so zutiefst lebendig. Wir werden damit beginnen, die Herkunft und die frühen Jahre des Zauberers zu beleuchten. Der Maler von Das Abendmahl und La Gioconda, der Bildhauer der Reiterstatue von Francesco Sforza, das wissenschaftliche Genie, das so viele unserer modernen Erfindungen und Entdeckungen vorwegnahm, wurde 1452 in der Umgebung von Empoli am rechten Ufer des Arno zwischen Florenz und Pisa geboren. Die kleine Stadt Vinci, in der er das Licht der Welt erblickte, liegt versteckt in den zahlreichen Wellen des Monte Albano. Auf der einen Seite die Ebene mit dem Fluss – mal fast ausgetrocknet, mal ein lauter gelber Strom; auf der anderen eine der am stärksten gebrochenen Landschaften überhaupt; endlose, mit Häusern bedeckte Hügel und hier und da eine eindrucksvollere Erhöhung, dessen kahle Spitze beim Sonnenuntergang in violettes Licht getaucht ist.
Leonardos Heimat war damals so, wie wir sie noch heute sehen; eher streng als lächelnd oder überschwänglich, eine felsige Gegend, die von Mauern unterbrochen wird, über die, in der Nähe der Häuser, zuweilen der Ast eines Rosenbusches kriecht. Reben und Olivenbäume bilden den Kern der Vegetation. Hier und da erhascht man einen Blick auf ein Haus, eine Hütte oder einen Bauernhof. Aus der Ferne wirkt die Behausung mit ihren gelben Wänden und grünen Fensterläden freundlich, aber im Inneren findet man Nacktheit und Armut – die Wände tragen nur eine einfache Schicht aus rauem Putz und der Boden besteht aus Zement oder Ziegelsteinen. Es gibt nur wenig Mobiliar, und das vorhandene ist ärmlich, während Teppiche oder Tapeten völlig fehlen. Nichts sorgt hier für Bequemlichkeit, geschweige denn für Luxus. Und schließlich existiert keinerlei Vorrichtung gegen die in diesem Landesteil während der langen Wintermonate sehr bittere Kälte.
Auf diesen strengen Höhen ist ein genügsamer, fleißiger und aufmerksamer Menschenschlag aufgewachsen, der von der Nonchalance des Römers, dem Mystizismus des Umbriers oder der nervösen Aufgeregtheit des Neapolitaners unberührt geblieben ist. Die Mehrheit der Menschen arbeitet in der Landwirtschaft, und die wenigen Kunsthandwerker sind allein für den lokalen Markt tätig. Die sich vom Horizont ihrer Dörfer eingeengt fühlenden ehrgeizigeren Geister gehen nach Florenz, Pisa oder Siena, um ihr Glück zu suchen.
Einige moderne Biographen schreiben von der Burg, in der Leonardo zuerst das Licht der Welt erblickte, und sie fügen sogar noch einen der Familie verbundenen Lehrer, eine Bibliothek, in der das Kind zunächst seine Neugier stillte und noch vieles mehr hinzu. Aber all dies gehört – es muss gesagt werden – in den Bereich der Legende und nicht den der Geschichte.
Es gab zwar eine Burg in Vinci, es handelte sich jedoch um eine Festung in florentinischem Besitz. Leonardos Eltern können nur in einem Haus gelebt haben, und zwar einem recht bescheidenen. Wir wissen nicht einmal, ob sich dieses Haus überhaupt innerhalb der Stadtmauern von Vinci oder etwas außerhalb, im Dorf Anchiano befand. Die Dienerschaft bestand aus einer fante, d.h. einer Dienerin, die pro Jahr acht Gulden erhielt.
Wenn es überhaupt eine Familie gab, der die Welt der Kunst fremd war, dann war es die Leonardos. Von seinen fünf Vorfahren väterlicherseits hatten vier die Position eines Notars eingenommen, die diesen würdigen Amtsträgern den dem französischen maitre entsprechenden Titel Ser eingebracht hatte. Es handelte sich um Leonardos Vater, seinen Großvater, den Urgroßvater und den Ururgroßvater. Es muss uns nicht überraschen, dass sich dieser unabhängige Geist par excellence inmitten von staubigen Rechtsbüchern entwickelte. Der italienische Notar entsprach in keiner Weise dem pompösen Schreiber moderner Dramatiker. Im 13. Jahrhundert mangelte es Brunetto Latini, Dantes Meister, sehr an der pedantischen Ernsthaftigkeit, die wir heute mit diesem Berufsstand verbinden. Im folgenden Jahrhundert wurde ein anderer Notar – Ser Lappo Mazzei de Prato – durch seine Briefe berühmt, die im reinsten toskanischen Idiom feurig von den zeitgenössischen Sitten berichteten. Im 15. Jahrhundert schließlich gab der Notar von Nantiporta eine nicht immer erhabene Chronik des römischen Hofs heraus. Wir sollten uns ferner vor Augen führen, dass auch Brunellesco und Masaccio die Söhne von Notaren waren.
Ein besonders interessanter Aspekt der Nachzeichnung von Leonardos Herkunft und seiner familiären Verbindungen ist die bemerkenswerte Schicksalsfügung, dass dieses künstlerische Phänomen aus der Verbindung eines Notars mit einem Bauernmädchen hervorging, und zwar inmitten der normalsten und sachlichsten Umgebung. Bei Raffael kann man gut von der Auswahl der Natur und einer erblichen Veranlagung, von Anregungen durch die Bildung sprechen. Die Wahrheit ist jedoch, dass bei der großen Mehrheit unserer berühmten Künstler die Begabungen und besonderen Fähigkeiten der Eltern keine Rolle spielen und die persönliche Berufung, das geheimnisvolle Geschenk, alles ist. Oh, ihr eitlen Theorien von Darwin und Lombrosco, widerlegt nicht die unerklärliche Erscheinung großer Talente und großer Genies eure Theorien? So wie nichts in der Tätigkeit von Leonardos Vorfahren auf die Entwicklung einer künstlerischen Berufung hinwies, so waren auch der Neffe und der Großneffe des großen Mannes wiederum lediglich einfache Bauern. Auf diese Weise verhöhnt die Natur unsere Spekulationen! Wenn die Anhänger Darwins ihren Plan der Kreuzung auf die menschliche Gattung anwenden könnten, bestünde die große Möglichkeit, dass das Resultat eine Rasse von Ungeheuern und nicht von überlegenen Königen sein würde. Aber auch wenn Leonardos Eltern ihm kein Genie vererben konnten, konnten sie ihm doch zumindest eine gute Gesundheit und ein großzügiges Herz mit auf den Weg geben.
Leonardo muss als Kind seinen Großvater väterlicherseits, Antonio di Ser Piero, der 84 Jahre alt war, als der Junge fünf war, gekannt haben. Auch seine Großmutter, die 21 Jahre jünger als ihr Ehemann war, muss Leonardo gekannt haben. Es gibt über diese beiden Personen keine weiteren Informationen, und ich will offen gestehen, dass ich nicht versuchen werde, die sie umgebenden Rätsel aufzulösen. Es wäre aber nicht zu entschuldigen, wenn ich nicht mit allen Mitteln versuchen würde, zumindest einige charakteristische Eigenschaften ihres Sohnes, des Vaters Leonardos, aufzudecken.
10. Werkstatt von Andrea del Verrocchio, Studie des Engels für die Taufe Christi, ca. 1470. Metallstift und Ocker, 23 x 17 cm. Biblioteca Reale, Turin.
11. Leonardo da Vinci und Andrea del Verrocchio, Taufe Christi (Detail), 1470-1476. Öl und Tempera auf Holztafel, 177 x 151 cm. Galleria degli Uffizi, Florenz.
12. Leonardo da Vinci und Andrea del Verrocchio, Taufe Christi, 1470-1476. Öl und Tempera auf Holztafel, 177 x 151 cm. Galleria degli Uffizi, Florenz.
Ser Piero war bei Leonardos Geburt 22 oder 23 Jahre alt. Er war – wie die existierenden Dokumente trotz ihrer Trockenheit klar belegen – ein aktiver, intelligenter und unternehmungslustiger Mann und der wahre Begründer des Familienvermögens. Er begann klein, baute seine Praxis aber rasch aus und erwarb mehr und mehr Grund und Boden, kurz, er entwickelte sich von einem armen Dorfnotar zu einem wohlhabenden und allseits respektierten Mann. Im Jahr 1498 z.B. sehen wir ihn als Besitzer mehrerer Häuser und verschiedener Grundstücke unterschiedlicher Größe. Nach seiner Vermehrung des Vermögens, seinen vier Ehen, denen eine uneheliche Beziehung vorausging und auch nach seinen zahlreichen Nachkommen zu urteilen, besaß er zweifellos eine lebhafte und überschwängliche Natur. Er war eine jener patriarchalischen Figuren, die Benozzo Gozzoli so treffend auf die Wand des Campo Santo in Pisa malte.
Noch in jungem Alter ging Ser Piero eine Verbindung mit jener Frau ein, die zwar niemals seine Ehefrau, aber die Mutter seines ältesten Sohns war. Es handelte sich um eine gewisse Catarina, mit größter Wahrscheinlichkeit ein einfaches Bauernmädchen aus Vinci oder der Umgebung. (Ein anonymer Autor des 16. Jahrhunderts behauptet dennoch, dass Leonardo “...per madre nato di bon sangue“ war.) Diese Liaison war von kurzer Dauer. Ser Piero heiratete in Leonardos Geburtsjahr, während Catarina einen Mann ihres eigenen Standes heiratete, der den nicht sonderlich wohlklingenden Namen Chartabrigha oder Accarrabrigha di Piero del Vaccha trug, wahrscheinlich ebenfalls ein Bauer – wovon konnte man sich in Vinci schließlich ernähren, wenn nicht vom Acker! Im Gegensatz zur modernen Sitte und dem modernen Gesetz übernahm es der Vater, das Kind aufzuziehen.
Leonardos Position war zu Beginn relativ beneidenswert, da seine ersten beiden Stiefmütter keine eigenen Kinder hatten – ein Umstand, der bislang nicht beachtet worden ist und der erklärt, warum sie den kleinen Eindringling adoptierten: er machte niemandem sein Erbrecht streitig.
Leonardo war bereits 23, als sein Vater – der die verlorene Zeit anschließend so schnell aufholte – immer noch keine ehelichen Nachkommen hatte. Mit der Ankunft des ersten Bruders jedoch endete das Glück des jungen Mannes und es gab für ihn unter dem Dach seines Vaters keinen Frieden mehr. Er erkannte, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als sein Glück anderswo zu suchen und wartete nicht ab, bis man ihm dies zum zweiten Mal sagte. Zu diesem Zeitpunkt verschwindet sein Name in offiziellen Dokumenten auch aus den Listen der Familie.
Leonardo erwähnt bei mehr als einer Gelegenheit seine Eltern, vor allem seinen Vater, den er bei seinem Titel Ser Piero nennt. Es findet sich allerdings kein Wort, aus dem man Rückschlüsse auf Leonardos Gefühle gegenüber seinem Vater ziehen könnte. Man könnte versucht sein, ihm Gefühlskälte vorzuwerfen, wenn eine solche Abwesenheit von Gefühl nicht ein charakteristisches Merkmal dieser Zeit wäre. Sowohl Eltern als auch Kinder unterdrückten ihre Emotionen und vermieden insbesondere auch nur die kleinste Andeutung von Sentimentalität. Keine Epoche legte jemals eine deutlichere Abneigung gegen Gefühle oder Pathos an den Tag. Nur hier und da, in Briefen – etwa in den bewundernswerten Briefen der florentinischen Patrizierin Alessandra Strozzi, der Mutter des berühmten Bankiers – entkommt ein nicht zu unterdrückender Schrei des Herzens.
Aber dennoch ist Leonardos Gelassenheit außergewöhnlich groß und stellt ein echtes psychologisches Problem dar. Der Meister registriert ohne ein einziges Wort des Zorns, des Gefühls oder des Bedauerns die kleinen Diebstähle seines Schülers, den Untergang seines Gönners Ludovico il Moro, den Tod seines Vaters. Und doch wissen wir, welcher Reichtum an Freundlichkeit und Zuneigung in ihm schlummerte, wie nachsichtig er war, sogar gegenüber der Schwäche, gegenüber seinen Dienern, wie er sich ihren Launen beugte, sie pflegte, wenn sie krank waren und ihren Schwestern eine Mitgift gab.
Wir wollen nun die Beschreibung von Leonardos Beziehung zu seiner leiblichen Familie, die ihn indes nicht adoptierte, beenden. Ser Piero starb am 9. Juli 1504 im Alter von 77 Jahren, und nicht von 80 Jahren, wie Leonardo berichtet, als er lakonisch seinen Tod vermerkt. Von seinen vier Stiefmüttern wird nur die letzte, Lucrezia, die 1520 noch am Leben war, von einem Dichterfreund Leonardos, Bellincioni, lobend erwähnt. Die allesamt den beiden letzten Ehen seines Vaters entstammenden neun Söhne und zwei Töchter scheinen eher die Feinde als die Freunde ihres unehelichen Stiefbruders gewesen zu sein. Nach dem Tod ihres Onkels im Jahr 1507 machten sie ihm finanzielle Schwierigkeiten. In seinem Testament vom 12. August 1504 hatte Francesco da Vinci Leonardo ein wenig Grund und Boden vermacht – und prompt kam es zu einem Rechtsstreit. Später gelang allerdings eine Einigung. Im Jahr 1513, während Leonardos Aufenthalt in Rom, trug eine seiner Schwägerinnen ihrem Ehemann auf, den sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seines Ruhmes befindenden Leonardo an sie zu erinnern. In seinem Testament vermachte Leonardo seinen Brüdern als Zeichen seiner Zuneigung jene 400 Gulden, die er im Hospital von Santa Maria Novella in Florenz hinterlegt hatte. Schließlich fügte Leonardos geliebter Schüler Melzi in seinem die Brüder über Leonardos Tod in Kenntnis setzenden Brief hinzu, dass Leonardo ihnen sein kleines Grundstück in Fiesole hinterließ. Das Testament hingegen sagt zu diesem Punkt nichts. Darüber hinaus blieb eines seiner Jugendwerke, die Zeichnung von Adam und Eva, im Besitz eines seiner Verwandten (laut Vasari sein Onkel), der sie anschließend Ottavio de Medici schenkte.
Bis auf einen Neffen Leonardos, Pierino, einen fähigen Bildhauer, der um die Mitte des 16. Jahrhunderts im Alter von 33 Jahren in Pisa verstarb, ist kein anderes Mitglied der Familie da Vinci in die Geschichte eingegangen. Die einzige Eigenschaft, die die Mitglieder der Familie von ihrem gemeinsamen Vorfahren geerbt zu haben scheinen, ist eine außergewöhnliche Vitalität. Es gibt sogar in unserer Zeit Nachfahren von Ser Piero. Signor Uzielli, ein sehr glücklicher Forscher, entdeckte 1869 in der Nähe von Montespertoli an einem Ort namens Bottinaccio einen Bauern namens Tommaso Vinci. Die entsprechenden Nachforschungen ergaben, dass dieser Bauer, der die Familienpapiere in seinem Besitz hatte und wie sein Vorfahre Ser Piero mit einer umfangreichen Nachkommenschaft gesegnet war, tatsächlich ein Nachkomme von Domenico, einem von Leonardos Halbbrüdern, war. Ein Mitleid erregender Zug in dieser Familie, die ihre hohe Stellung eingebüßt hat, ist die Tatsache, dass Tommaso da Vinci seinem ältesten Sohn den glorreichen Namen Leonardo gab. Auf Seite 15 findet sich die Genealogie der Familie da Vinci gemäß den Aufzeichnungen von Signor Uzielli.
13. Entwurf für den Tiburio, Mailänder Dom, ca. 1450-1500. Biblioteca Ambrosiana, Mailand.
14. Studien von Kirchen mit Plänen des Mittelschiffes, 1485-1490. Feder und Tinte, 23,3 x 16,2 cm. Bibliothèque de l’Institut de France, Paris.
15. Studien von antiken Gebäuden, Arenen und Kirchen mit Plänen des Mittelschiffes. Stift und Tinte. Biblioteca Ambrosiana, Mailand.
Nichts reicht an die Lebenskraft italienischer Familien heran. Wie die von Leonardo existiert auch die Michelangelos noch heute. Aber welch ein Niedergang! Als 1875 anlässlich der Hundertjahrfeierlichkeiten nach überlebenden Mitgliedern der Familie Buonarroti gesucht wurde, kam ans Licht, dass der Kopf der Familie, Graf Buonarroti, wegen Fälschung zum Galeerendienst verurteilt worden war, ein anderes Familienmitglied in Siena als Droschkenkutscher arbeitete und wiederum ein anderes ein gewöhnlicher Soldat war. Wir wollen hoffen, dass er zu Ehren seines berühmten Vorfahren zum General befördert wurde! Wenn die jüngsten Vertreter von Leonardos Haus auch keine hohen Positionen einnehmen, so ist ihr Name doch wenigstens unbefleckt.
Nachdem wir uns mit der Familie von Leonardo da Vinci bekannt gemacht haben, ist es an der Zeit, die Eigenschaften dieses genialen Kindes zu analysieren, seine mit vielen Gaben versehene Natur, diesen ausgezeichneten Kavalier, diesen Proteus, Hermes, Prometheus - Titel, die sich in den Schriften seiner beeindruckten Zeitgenossen immer wieder finden.
“Wir sehen, wie die Vorsehung“, schreibt einer von ihnen, “die wertvollsten Geschenke auf bestimmte Männer herabregnen lässt, häufig gleichmäßig, häufig im Überfluss: wir sehen, wie sie in ein und demselben Wesen ohne Maß Schönheit, Anmut und Talent vereint und jede dieser Eigenschaften zu einer solchen Vollkommenheit bringt, dass, wohin sich der Privilegierte auch wendet, jede seiner Handlungen göttlich ist und jene anderer Menschen übertrifft; seine Qualitäten erscheinen als das, was sie in Wahrheit auch sind: von Gott verliehen und nicht durch menschlichen Fleiß erlangt. So war es bei Leonardo da Vinci, in dessen Handlungen sich physische Schönheit jenseits jeglichen Lobs und endlose Anmut vereinten; was seine Talente anbetraf, so war es so, dass er, welche Schwierigkeit sich auch präsentierte, alles ohne Mühe löste. In ihm verbündete sich Schnelligkeit mit außergewöhnlich großer Kraft; sein Geist und sein Mut zeigten etwas Königliches und Prachtvolles. Sein Ruhm schließlich erreichte solche Ausmaße, dass er, so verbreitet er schon zu seiner Lebenszeit war, sich noch über seinen Tod hinaus erstreckte.“
Vasari, dem wir diese eloquente Einschätzung verdanken, schließt mit einer Phrase, deren kraftvolle Wiedergabe der Majestät der beschriebenen Person sich kaum übersetzen lässt: “Lo splendor dell’ aria sue, che bellissimo era, rissereneva ogni animo mesto.“ (“Die Pracht seiner Erscheinung, die ohne Maßen schön war, erfreute die traurigsten Seelen.“)
Leonardo war von der Natur mit einer äußerst ungewöhnlichen Muskelkraft ausgestattet worden, er konnte den Schwengel einer Glocke oder ein Hufeisen verbiegen, als seien sie aus Blei. Es verband sich jedoch eine Schwäche mit dieser außergewöhnlichen Fähigkeit: der Künstler war Linkshänder – seine Biographen bestätigen dies–, und im Alter raubte ihm eine Lähmung schließlich die Kontrolle über seine rechte Hand.
Die Renaissance hatte bereits einen vergleichbaren außergewöhnlichen Menschen hervorgebracht, der die seltensten intellektuellen Fähigkeiten mit jeder körperlichen Vollkommenheit, Kraft, Schönheit, Schnelligkeit vereinte. Leone Battista Alberti, der große florentinische Denker und Künstler, gleichzeitig Mathematiker, Dichter, Musiker, Philosoph, Architekt, Bildhauer und eifriger Schüler der Antike, zeichnete sich bei allen körperlichen Übungen aus. Die feurigsten Pferde zitterten vor ihm; er konnte mit sich berührenden Füßen über die Schulter eines erwachsenen Menschen springen; in der Kathedrale von Florenz warf er häufiger eine Münze mit solcher Kraft in die Luft, dass man hören konnte, wie sie gegen die Gewölbedecke dieses gigantischen Bauwerks schlug. Der Tempel des Heiligen Franziskus in Rimini, der Rucellai-Palast in Florenz, die Erfindung der camera lucida, die früheste Verwendung von freien Rhythmen in der italienischen Sprache, die Reorganisation des italienischen Theaters, Traktate über die Malerei, die Bildhauerei und viele andere Werke von höchstem Rang – all dies begründet Albertis Anspruch auf die Bewunderung und Dankbarkeit der Nachwelt. Aber die sich ihrer Reife nähernde Renaissance sollte einen anderen Sohn von Florenz mit sogar noch größerer Kraft und einem noch breiteren Spektrum an Fähigkeiten ausstatten. Wie pedantisch, eng, ja geradezu ängstlich Alberti im Vergleich zu Leonardo erscheint!
Diese intellektuellen Fähigkeiten hatten keinerlei negative Auswirkungen auf die Qualitäten des Herzens. Wie Raffael war auch Leonardo für seine grenzenlose Freundlichkeit bekannt, und wie dieser widmete er sogar Tieren Interesse und Zuneigung. Vasari berichtet, dass Leonardo ein so reizendes Verhalten an den Tag legte und über eine so große Fähigkeit zur Konversation verfügte, dass er alle Herzen für sich gewann. Obwohl er in gewisser Hinsicht selbst wenig hatte und wenig arbeitete, hatte er doch immer Diener und Pferde. An den Pferden hing er sehr, wie überhaupt an allen Tieren. Er zog sie auf und zähmte sie mit so viel Liebe wie Geduld. Wenn er an den Orten vorbeikam, an denen Vögel verkauft wurden, kaufte er häufig welche, befreite sie mit seinen eigenen Händen aus ihren Käfigen und gab ihnen die Freiheit wieder. Andrea Corsali schrieb 1515 Giuliano de Medici aus Indien, dass die Einwohner jener Gegend wie “il nostro Leonardo da Vinci“ nicht zulassen, dass einem Lebewesen Gewalt angetan wird.[2] Dieses Verlangen nach Zuneigung, diese Großzügigkeit, diese Gewohnheit, ihre Schüler wie Familienmitglieder anzusehen, sind Eigenschaften, die die beiden großen Maler gemeinsam haben, sie jedoch gleichzeitig von Michelangelo unterscheiden, dem misanthropischen, einsamen Künstler, dem eingeschworenen Gegner von Feiern und Genuss. Hinsichtlich der Gestaltung seiner Laufbahn hingegen ähnelt Raffael Michelangelo viel stärker als Leonardo, der sprichwörtlich nachlässig und sorglos war. Raffael aber bereitete seine Zukunft mit großer Sorgfalt vor. Er war nicht nur begabt, sondern auch sehr fleißig und widmete sich schon früh dem Aufbau seines Vermögens, während Leonardo von der Hand in den Mund lebte und seine eigenen Interessen den Erfordernissen der Wissenschaft unterordnete.
16. Anonym, Dom von Florenz, 1418-1436. Florenz.
17. Anonym, Santa Maria della Consolazione, nach einem Entwurf von Bramante, 1508. Todi.
18. Schule von Piero della Francesca (Laurana oder Giuliano da Sangallo?), Ideale Stadt, ca. 1460. Öl auf Holztafel, 60 x 200 cm. Galleria Nazionale delle Marche, Urbino.
Von Anfang an – und hier zögern wir nicht, Vasaris Zeugnis Glauben zu schenken – zeigte das Kind einen unbescheidenen, ja zuweilen extravaganten Hunger nach Wissen jeglicher Art. Er hätte große Fortschritte gemacht, wenn nicht seine ausgeprägte Sprunghaftigkeit gewesen wäre. Er stürzte sich leidenschaftlich auf das Studium einer Wissenschaft nach der anderen, kam sofort auf die Wurzel der Probleme, stellte die Arbeit jedoch so schnell wieder ein, wie er sie begonnen hatte. Während der wenigen der Arithmetik, oder besser der Mathematik gewidmeten Monate erwarb er sich so tiefe Kenntnisse, dass er seinen Meister immer wieder überraschte und beschämte. Die Musik zog ihn genauso an. Die Laute konnte er besonders gut spielen, und er benutzte dieses Instrument später zur Begleitung der von ihm improvisierten Lieder. Kurz, er wollte wie ein zweiter Faust den riesigen Kreis des menschlichen Wissens umspannen, wobei er sich nicht damit zufrieden gab, die Entdeckungen seiner Zeitgenossen zu verstehen, sondern sich direkt der Natur zuwandte, um das Feld der Wissenschaft zu vergrößern.
Wir haben nun die seltenen Fähigkeiten des jungen Genies, die Vielseitigkeit seiner Interessen und Leistungen herausgestellt: seine Vortrefflichkeit in allen körperlichen Übungen und allen intellektuellen Wettbewerben. Es ist nun an der Zeit zu beschreiben, wie er diese außergewöhnlichen Begabungen nutzte. Trotz seiner frühreifen Vielseitigkeit zeigte sich eine vorherrschende Eigenschaft deutlich, eine starke, eine unwiderstehliche Berufung für die gestaltenden Künste. Beim Studium seiner ersten eigenen Schöpfung erkennen wir, dass Leonardo in viel stärkerem Maße als Raffael ein Wunderkind war. Die jüngsten Forschungen haben gezeigt, wie langsam und mühsam die Entwicklung des Künstlers aus Urbino vor sich ging, welch harte Arbeit er leisten musste, bevor er seiner Originalität freien Lauf lassen konnte. Bei Leonardo war es völlig anders. Er zeigt von Anfang an eine bewundernswerte Autorität und Originalität. Nicht etwa, dass er ein oberflächlicher Arbeiter gewesen wäre – kein Künstler arbeitete langsamer–, aber seine Vision war von Anfang an so persönlich, dass er nicht der Schüler seiner Meister war, sondern ihr Vorläufer wurde.
Leonardos Vater scheint sich häufiger in Florenz als in Vinci aufgehalten zu haben, und die brillanten Fähigkeiten des Kindes entfalteten sich sicherlich auch in der Hauptstadt der Toskana und nicht in der obskuren Kleinstadt. Der Standort des von der Familie bewohnten Hauses ist kürzlich festgestellt worden: es stand an der Piazza San Firenze an der Stelle, wo sich heute der Gondi-Palast befindet und verschwand gegen Ende des 15. Jahrhunderts, als Giuliano Gondi es abriss, um Platz für den Palast zu schaffen, dem er seinen Namen gab.
Ich werde nicht versuchen, Florenz in dieser Phase politischer Erschöpfung, materiellen Wohlstands, künstlerischer, literarischer und wissenschaftlicher Begeisterung zu beschreiben. Unter meinen gegenwärtigen Lesern befinden sich vielleicht einige, die frühere Veröffentlichungen von mir nicht vergessen haben, vor allem die Histoire de l’Art pendant la Renaissance, wo ich ein – wie ich meine, recht vollständiges – Bild des geistigen Lebens an den Ufern des Arno in der Zeit Lorenzos des Prächtigen entworfen habe.
Gegen Ende der Zeit, in der sich die Familie Vinci in Florenz aufhielt, hatte die Florentinische Schule gerade eine jener großen Krisen erreicht, bei der eine Macht entweder abdanken oder aber einen wirklichen Neuanfang wagen muss. Die von Brunellesco, Donatello und Masaccio initiierte Revolution hatte so viel erreicht, wie sie nur erreichen konnte, und wir sehen, wie ihre Nachfolger gegen Ende des 15. Jahrhunderts zwischen Imitation und Manierismus schwankten, unfähig, ein ermüdetes Erbe wiederzubeleben. So groß das Talent von San Galli in der Architektur auch war, das Szepter ging rasch in die Hände von Bramante aus Urbino über, anschließend in die der Vertreter Oberitaliens: der in der Nähe von Modena geborene Vignole, Serlio aus Bologna, Palladio, der berühmteste Sohn Vicenzas. In der Bildhauerei hatte seit Verrocchio und Pollaiuolo nur ein Florentiner eine bedeutende Position erlangt. Sein Name ist zwar Michelangelo, aber welch eine hoffnungslose Mittelmäßigkeit umgab ihn und wie stark ist das Gefühl, dass auch hier das letzte Wort gesagt ist!
Wie in allen Zeiten, denen es an Inspiration fehlt, herrschte in den Künstlerwerkstätten von Florenz ein Klima der Diskussionen und erbitterter Kritik vor, die nur darauf abzielte zu entmutigen und zu entnerven. Da sie nicht mehr in der Lage waren, starke und einfache Werke wie die großartigen Meister der ersten Hälfte des Jahrhunderts zu schaffen, strebten Masaccio, Fra Angelico, Piero della Francesca und sogar Andrea del Castagno, einfach alle Maler, nach Neuheit und Originalität, nach terribilità – das Wort, mit dem Vasari diese Tendenz beschrieb – und hofften, sich auf diese Weise über die Kritik zu erheben. Keine Künstler könnten manierierter sein als diese florentinischen Maler des späten 15. Jahrhunderts. Man würde gerne all die Schläue eines Pollaiuolo für eine schwungvolle Inspiration hingeben. In Bezug auf die weibliche Schönheit bestand das Ideal in einem morbiden und leidenden Typus, blasse, verbrauchte Gesichter, herabhängende Augenlider, trübe Blicke, ein schwermütiges Lächeln. Wenn diese Bilder trotz ihrer wenig gelungenen Linien gefallen, dann liegt es daran, dass sie einen letzten Lichtstrahl der mystischen Poesie des Mittelalters reflektieren. Dieses Ideal war von den robusten und fast virilen Figuren von Masaccio, Piero della Francesca und Andrea del Castagno so weit entfernt wie von der strengen, allerdings trockenen Vornehmheit von Ghirlandaios Typus und wurde vor allem von Fra Filippo Lippi vertreten, der wiederum von seinem Sohn Filippino und von Botticelli nachgeahmt wurde. Es handelte sich um Manierismus in einer seiner gefährlichen Erscheinungen.
19. Gherardo Mechini, Gerüst für die Kathedrale Santa Maria del Fiore, 18. Jahrhundert. Feder und Tinte, Tusche. Galleria degli Uffizi, Florenz.
20. Battista Nelli, Innengerüst für die Kathedrale Santa Maria del Fiore, 18. Jahrhundert. Florenz.
21. Filippo Brunelleschi, Pazzi-Kapelle, Santa Croce, ca. 1430. Florenz.
22. Michelangelo, Entwurf für die Fassade von San Lorenzo, ca. 1518. Casa Buonarroti, Florenz.
Aber wir wollen hören, was Leonardo selbst zu sagen hat und wie deutlich er beschreibt, welche Rolle Giotto und anschließend Masaccio, dessen Fresken er zweifellos wie alle jungen Florentiner dieser Zeit kopierte, spielten:
“Danach kam Giotto der Florentiner, der – nicht zufrieden damit, die Werke von Cimabue, seinem Meister, zu kopieren – in diesen Bergen geboren wurde, und in einer nur von Ziegen und derartigen Tieren unterbrochenen Einsamkeit, und von der Natur zu seiner Kunst geführt, damit begann, auf die Felsen die Bewegungen der von ihm gehüteten Ziegen zu malen. Und so fing er an, all die auf dem Land zu findenden Tiere zu malen, und auf eine solche Weise, dass er nach vielen Studien nicht nur all die Meister seiner Zeit übertraf, sondern alle vieler vergangener Epochen.“ (Wir können nebenbei darauf hinweisen, dass Leonardos Zeugnis den – zuweilen bezweifelten – tief berührenden Bericht von Ghiberti und Vasari über die frühen Versuche Giottos bestätigt.) “Anschließend befand sich diese Kunst wieder in einem Niedergang, weil jeder die bereits gemalten Bilder imitierte. So ging es von Jahrhundert zu Jahrhundert weiter, bis Thomas von Florenz, mit Spitznamen Masaccio genannt, durch seine vollkommenen Werke zeigte, dass diejenigen, die sich an etwas anderem als der Natur – der Herrin aller Meister – orientieren, sich umsonst abmühen.“
Gemäß einer authentisch erscheinenden Geschichte zeigte der von den ausgeprägten Fähigkeiten seines Sohnes beeindruckte Ser Piero da Vinci einige von Leonardos Skizzen seinem Freund Verrocchio und bat ihn um seine Meinung. Der Eindruck, den Verrocchio gewann, war, wie uns berichtet wird, exzellent und er zögerte nicht, den Jugendlichen als Schüler zu akzeptieren.
Wenn wir in Ermangelung einer eindeutigen Aussage davon ausgehen, dass Leonardo zu dieser Zeit etwa 15 Jahre alt war, dürften wir der Wahrheit nahe kommen. Wie ich an einer anderen Stelle gezeigt habe, zeichnete sich die Mehrheit der Künstler der Renaissance durch eine gewisse Frühreife aus: Perugino war neun, Fra Bartolommeo zehn, und Michelangelo erschuf die Maske eines Satyrn, die die Aufmerksamkeit von Lorenzo dem Prächtigen erregte, im Alter von 15 Jahren. Mantegna schließlich malte sein erstes Meisterwerk – die Madonna in der Kirche der Heiligen Sophia in Padua–, als er gerade 17 Jahre alt war.
Autres temps, autres moeurs! Heutzutage gilt ein Künstler mit 30 Jahren als jung und brillant, mit seiner gesamten Zukunft noch vor sich. Vierhundert Jahre zuvor hatten viele Künstler in diesem Alter bereits ihre letzten Worte gesagt.
Die so genannte Lehrzeit – im Rahmen derer der Lehrling in die Familie des Meisters eintrat – umfasste, abhängig vom Eintrittsalter des Lehrlings, zwei, vier oder sechs Jahre. Darauf folgte die Gesellenzeit, deren Dauer ebenfalls im Abhängigkeit vom Alter variierte und während derer der Meister einen mehr oder weniger hohen Lohn zahlte (Lorenzo di Credi, Leonardos Mitschüler, erhielt 12 Gulden, was etwa 24 Englischen Pfund Sterling entspricht). Die Erhebung in den Stand eines Meisters war das Ziel dieser langen und mühsamen Initiation.[3]
Bevor wir uns dem Verhältnis zwischen Leonardo da Vinci und Verrocchio zuwenden, wollen wir zunächst versuchen, den Charakter Verrocchios zu beschreiben.
Andrea Verrocchio (1435 geboren) war nur 17 Jahre älter als sein Schüler, ein Altersunterschied, der bei einem solch wertvollen Genie wie Leonardo gering erscheint. Darüber hinaus hatte der würdige florentinische Bildhauer sich nur langsam weiterentwickelt und sich lange mit Goldschmiedearbeiten und anderen zweitrangigen Tätigkeiten befasst. Trotz seines wachsenden Interesses an der Bildhauerei in einem großen Maßstab setzte er bis zum Ende diese eher kunsthandwerklichen Tätigkeiten fort, an denen seine Zeitgenossen, die Familien Majani, Civitali, Ferrucci, große Freude hatten. Wir lernen aus einem Dokument aus dem Jahr 1488, dass er bis zum Vorabend seines Todes an einem Marmorspringbrunnen für König Mathias Corvinus arbeitete. In dieser Hinsicht war er ein echter Vertreter des 15. Jahrhunderts.