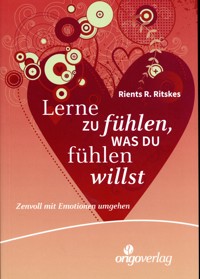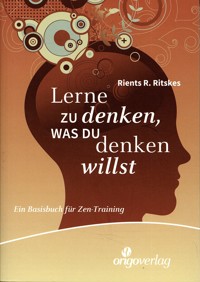
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Origo Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Rients R. Ritskes vermittelt in diesem Buch praxisrelevante Kenntnisse zum Zen für alle Zen-Interessierten, Meditierenden und solche, die es werden wollen. Klar und zugänglich erklärt er traditionelle Konzepte wie Erleuchtung und Kōans und erläutert den physischen Aspekt des Zen durch Informationen zu Stress- und Glückshormonen sowie zur Körperhaltung während der Meditation. Der mentale Aspekt des Zen wird in Kapiteln über Symbolsprache und die Verarbeitung von Erfahrungen deutlich. In anschaulichen Darstellungen zu Zen-Ritualen vereint Ritskes schließlich physische und mentale Aspekte. Das Buch bietet eine umfassende Übersicht über die Zen-Praxis und kombiniert nachvollziehbar Anekdoten, Theorie und wissenschaftliche Erkenntnisse. Geeignet für alle, die einen praktischen und alltagsnahen Zugang zu Meditation, Spiritualität und Zen suchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zu diesem Buch
Zen regt bei Praktizierenden schon seit Jahrhunderten heilsame Prozesse an, doch was steckt dahinter? Ritskes gibt entlang des Weges traditioneller Zen-Praktiken wie Meditation, Zen-Rituale und Koan Antworten auf diese Frage und kombiniert sie mit westlichen Perspektiven – alltagsnah und zugänglich.
Rients R. Ritskes vermittelt in diesem Buch praxisrelevante Kenntnisse zum Zen für alle Zen-Interessierten, Meditierenden und solche, die es werden wollen. Klar und zugänglich erklärt er traditionelle Konzepte wie Erleuchtung und Koans und erläutert den physischen Aspekt des Zen durch Informationen zu Stress- und Glückshormonen sowie zur Körperhaltung während der Meditation. Der mentale Aspekt des Zen wird in Kapiteln über Symbolsprache und die Verarbeitung von Erfahrungen deutlich. In anschaulichen Darstellungen zu Zen-Ritualen vereint Ritskes schließlich physische und mentale Aspekte. Das Buch bietet eine umfassende Übersicht über die Zen-Praxis und kombiniert nachvollziehbar Anekdoten, Theorie und wissenschaftliche Erkenntnisse. Geeignet für alle, die einen praktischen und alltagsnahen Zugang zu Meditation, Spiritualität und Zen suchen.
„... Rients Ritskes hat eine verständliche Einführung in die Zen-Praxis geschrieben; auch Fortgeschrittene können darin manchen frischen Blick auf die Praxis gewinnen.“ (Michael Schornstheimer in „Buddhismus aktuell“)
Zum Autor
Rients R. Ritskes ist Autor mehrerer praktischer Bücher über Zen und Gründer von zen.nl, einem niederländischen Ausbildungsinstitut für Zen-Lehrer und Verband von über 40 „Niederlassungen“, in denen Meditation gelehrt wird. Ritskes studierte Philosophie und betreibt seit über 40 Jahren Zen-Meditation.
Von Rients R. Ritskes ist ebenfalls als E-Book lieferbar:
Lerne zu fühlen, was du fühlen willst
Zenvoll mit Emotionen umgehen. Ein Basisbuch für Zen-Training,
Band 2. Übersetzt von Michel Keil
ISBN 978-3-282-00213-9
Zum Übersetzer
Der Übersetzer Michel Keil (1994 in Düsseldorf) lebt in Koblenz und ist Übersetzer der Bücher von Rients R. Ritskes „Lerne zu denken, was du denken willst. Ein Basisbuch für Zen-Training.“ und „Lerne zu fühlen, was du fühlen willst. Zenvoll mit Emotionen umgehen.“ und Mitglied von zen.nl. Michel Keil betreibt seit 2015 Zen-Meditation, ist approbierter Psychotherapeut und Dozent für Psychologie. Im Zen-Buddhismus sieht er Parallelen zu seiner Tätigkeit als Psychologe. Keil wird seine Erfahrungen zusammen mit Mitwirkenden bei der Etablierung eines Netzwerks aus Meditationszentren nutzen. Erste Zentren entstehen kurz- und mittelfristig in Koblenz, Mainz und Berlin. Wenn Sie Interesse am Aufbau eines Meditationszentrums auf der Basis von Rients R. Ritskes Büchern und anderen Einflüssen in Deutschland, der Schweiz und Österreich haben, senden Sie gerne eine E-Mail an [email protected]
RIENTS RITSKES
LERNE ZU DENKEN, WAS DU DENKEN WILLST
[EIN BASISBUCH FÜR ZEN-TRAINING, BAND 1]
Aus dem Niederländischen von Michel Keil
Impressum
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmassnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung sowie die Nutzung durch unbefugte
Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritte enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung,da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Aktualisierte und erweiterte deutsche Ausgabe.
Übersetzung und Korrektorat: Michel Keil
Illustrationen: Daido Maas
© 2010 by Rients Ritskes
© 2024 der deutschsprachigen Rechte beim Autor
und beim Origo Verlag Bern
Umschlagsgestaltung unter Verwendung des Originalumschlags:
Giessform, Bern
© 2024 by Origo Verlag
Rathausgasse 30
CH-3011 Bern/Schweiz
E-Mail: [email protected]
ISBN 978-3-282-00212-2
Unser gesamtes Programm finden Sie hier: www.origoverlag.ch
Die in diesem Buch vorgestellten Themen und die damit verbundenen Aussagen basieren auf Rients R. Ritskes jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Zen, Zen-Coaching und Zen-Organisation sowie mitunter wissenschaftlichen Befunden. Die Informationen des Buches stellen keine medizinischen oder psychologisch-psychotherapeutischen Fachinformationen dar, sind keine Diagnosen, Ratschläge oder Empfehlungen hinsichtlich Erkrankungen und ersetzen nicht den Rat eines Psychotherapeuten oder Arztes. Der Autor, Übersetzer und der Verlag haben dieses Buch mit höchster Sorgfalt erstellt. Dennoch ist eine Haftung des Autors, des Übersetzers oder des Verlags ausgeschlossen. Die im Buch wiedergegebenen Aussagen spiegeln die Meinungen des Autors wider und müssen nicht zwingend mit den Ansichten des Verlags oder des Übersetzers übereinstimmen.
Im vorliegenden Buch wurde auf die Verwendung geschlechtsneutraler Begriffe geachtet. In einigen Fällen musste aufgrund der Lesbarkeit auf das generische Maskulinum zurückgegriffen werden. In allen Fällen sind stets alle Geschlechter angesprochen.
Inhalt
Einleitung
Zen und Buddhismus
Zielgerichtetes Zen
Bubbles und Punkte
Projektion und selektive Wahrnehmung
Symbole
Nen
Kōan
Rituale
Herz-Sutra
Körper und Geist
Stress und Glück
Erleuchtung
Appendix I – Die Meditationshaltung
Appendix II – Verwendete Literatur
Stichwort- und Namensverzeichnis
Einleitung
Zen-Meditation erfreut sich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren immer größerer Beliebtheit. Auch die Zen-Philosophie gewinnt dadurch deutlich an Popularität. Diese Entwicklung ist dem wachsenden Andrang aus allen Gesellschaftsschichten der Bevölkerung zuzuschreiben. Von Haushalts- und Führungskräften bis zu Ärztinnen und Spitzensportlern. Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Glück, Leben in Achtsamkeit und Lebenskunst werden nicht länger tabuisiert. Die früheren Vorbehalte sind aufrechtem Interesse gewichen. Viele Leute erscheinen hochmotiviert an unseren Zen-Toren.
Für das steigende Interesse, durch Meditation an persönlicher Entwicklung zu arbeiten, gibt es verschiedene Erklärungen: Viele Menschen sind aufgeschlossener dafür, von den schönen Dingen anderer Kulturen, wie Zen, zu lernen. Was früher exotisch, unbegreiflich oder sogar unheimlich war, wird nun mehr und mehr vertraut und selbstredend. Dazu kommt, dass es in unserer hektischen „Multi-Auswahl-Gesellschaft“ ein schreiendes Bedürfnis nach Sinngebung, innerer Ruhe und mentaler Flexibilität gibt. Ein dritter erklärender Faktor für das zunehmende Interesse ist, dass wir gegenwärtig eine große Menge wissenschaftlich belegter Effekte für Meditation zeigen können. Während man früher daran glauben musste, dass Zen gut ist, wird es heutzutage auch auf diese Weise untermauert.
Lerne zu denken, was du denken willst ist für alle geschrieben, die Interesse an Zen, Buddhismus, Meditation und persönlicher Entwicklung haben. Ich möchte der Leserschaft eine praktische und effektive Zen-Einleitung an die Hand geben, die auf der Grundlage meiner rund vierzigjährigen Erfahrung im Zen-Training beruht. Zen-Training bietet eine klare Perspektive auf was Zen, als ein gezieltes Training des Denkens, Fühlens und Handelns für diejenigen, die es praktizieren, bedeuten kann.
Meine Perspektive unterscheidet sich in einigen spezifischen Eigenschaften von anderen Zen-Herangehensweisen. Viele der anderen Zen-Lehrenden der Niederlande und des deutschsprachigen Raumes stammen aus der Welt der Sprachen oder der Theologie. Daraus resultieren andere Sichtweisen. Für mich sind neurowissenschaftliche und psychologische Untersuchungen von Zen schon jahrzehntelang ein wichtiges Element, weswegen ich vor bereits zwanzig Jahren selbst an einer solchen Untersuchung teilnahm. Natürlich sind mir die mystischen Aspekte des Zen auch wichtig, doch ich lege den Fokus vor allem auf die praktische Seite.
Zielgerichtet und zielbewusst
Zielorientiertheit und vor allem Ziel-Bewusstsein ist in der Zen-Tradition, wie ich sie vertrete, von äußerster Wichtigkeit. Wir bitten Kursteilnehmende zu Beginn der Kurse, sich Ziele zu setzen und zu überprüfen, ob diese am Ende auch realisiert wurden. Um sein Ziel zu erreichen, ist es wesentlich, das denken zu lernen, was man denken will, das fühlen zu wollen, was man fühlen will und das tun zu wollen, was man tun will. Nicht umsonst nenne ich Zen in diesem Buch auch: Die Kunst, das denken zu wollen, was man denken will. Das Beherrschen des eigenen Geistes ist die Basis für das Fühlen und Handeln und auch für das Erreichen seiner Ziele.
Für manche sind Zen und Zielorientiertheit noch immer unvereinbar. Regelmäßig hört man noch, dass es im Zen gerade um das „Loslassen aller Ziele“ gehe. Das stimmt auch, doch man muss sich seiner Ziele schon bewusst sein, bevor man sie loslassen kann. Darin liegt die Herausforderung. Sehr viele Menschen sind sich nicht oder kaum dessen bewusst, was für sie das Ziel ihres Lebens ist; so wird es ziemlich schwierig, loszulassen. Diejenigen, die zielbewusster leben, müssen nicht hinter jeder Möglichkeit oder Eventualität herjagen und können durch ihr gewachsenes Verständnis über den Sinn ihres Lebens viel mehr Dinge loslassen. Das gibt Ruhe, Fokus und Achtsamkeit und das Vermögen, im Hier und Jetzt zu sein. Ziele spielen immer eine Rolle, wenn man mit dem Meditieren beginnt. Man meditiert, um etwas zum Positiven zu verändern und es hilft, sich seiner Ziele bewusst zu sein; sei es, besser zu schlafen, ein höheres Konzentrationsvermögen zu bekommen, mehr innere Ruhe zu finden, zufriedener zu werden, den Sinn des Daseins zu ergründen, den Weltfrieden zu fördern.
Wissenschaftliches Fundament
Unser Ansatz unterscheidet sich insofern noch, als dass wir versuchen, Zen aus seiner mystischen Ecke zu holen und wo möglich mit einem soliden wissenschaftlichen Fundament zu untermauern. Aus diesem Grund suchen wir bei Zen.nl aktiv die Zusammenarbeit mit Forschenden. In diesem Zusammenhang untersuchte die Professorin für Achtsamkeit der Radboud Universität Nimwegen, Anne Speckens, die Effekte von Meditation in unseren Einführungs- und weiterführenden Gruppen. Momentan läuft zusammen mit dem Professor für Psychologie Ap Dijksterhuis eine weitere Studie. Diese und andere Studien deuten immer wieder an, dass Meditieren wirksam ist und es ist gut zu wissen, dass Meditation wissenschaftlich belegbare Effekte hat. Wer sich die Mühe macht, zwei Mal zwanzig Minuten am Tag zu meditieren (so wie wir es raten), möchte natürlich, dass das irgendwo hinführt. Wissenschaft hilft, solche konkreten Effekte und Funktionsweisen deutlicher zu zeigen.
Denken, was du denken willst
Charakteristisch für unseren Ansatz ist auch die ausführliche Betrachtung des Denkprozesses. Dieses Buch widmet diesem Thema drei volle Kapitel – und das nicht umsonst. Wie gesagt, Zen kann als Kunst verstanden werden, das denken zu lernen, was man denken will. Unter Denken verstehe ich innerhalb des Kontexts dieses Buchs den Prozess des mentalen Verarbeitens von Eindrücken und Gedanken. Diesen Prozess der mentalen Verarbeitung können wir durch zielgerichtetes Training verfeinern, genauso wie ein Jongleur mit den richtigen Übungen seine Augen- und Handkoordination verfeinern und so mehr Bälle in der Luft halten kann. Der Grad der Verfeinerung, den wir hinsichtlich unseres Denkens erreichen wollen, hängt von zwei Faktoren ab: von der Quantität und Qualität der Übung und von der Anzahl an verarbeiteten Bubbles, die wir mit uns herumtragen. Mit Bubbles meine ich – innerhalb des Denkmodells, über das ich in diesem Buch spreche – unverarbeitete Erfahrungen und die dazugehörigen Emotionen. Zur Verdeutlichung: Bei „Denken“ geht es mir also nicht um das Denken bestimmter „richtiger“ Gedanken, sondern vielmehr darum, die Gedanken zu richten – auf das, was im jetzigen Moment wichtig ist.
Nen
Eine letzte Besonderheit, worauf unsere Zen-Praxis viel wert legt, ist das gezielte Trainieren unseres nens. Diesen japanischen Begriff definiere ich wie folgt: der kleinst-mögliche, bewusste und gezielte, saubere Achtsamkeitsmoment. Je kleiner das Nen, desto besser. Mit einem Nen einer Zehntelsekunde kann man, vereinfacht ausgedrückt, im Laufe einer Sekunde zehn Mal die bewusste Entscheidung treffen, seine Achtsamkeit auf etwas zu richten.1 Durch Training können wir lernen, mehr und besser wahrzunehmen. Von Spitzentennisspielern ist bekannt, dass sie den Tennisball während eines Wettkampfes in Zeitlupe auf sie zukommen sehen können, während der Ball faktisch manchmal ein Tempo von hundert Stundenkilometern erreicht. Dahingegen sieht ein Neuling nur einen gelben Streifen durch die Luft flitzen und ist schon froh, wenn er den Ball überhaupt berührt. So wie geübte Tennisspieler den Ball sehen, so kann jemand mit einem trainierten offenen Geist Dinge allgemein besser auf sich zukommen sehen. Dies gibt mehr Ruhe und Übersicht.
Aufbau dieses Buchs
Jetzt, da die Lesenden eine Vorstellung meiner Herangehensweise an Zen bekommen haben, folgt hier eine zusammenfassende Erläuterung zum Aufbau des Buches. Nachdem ich im ersten Kapitel den breiteren Kontext von Zen und Buddhismus skizziere, erläutere ich in Kapitel zwei den Mehrwert des zielgerichteten und zielbewussten Meditierens. In den Kapiteln drei bis fünf wird das Denkmodell erläutert. Anschließend gehen wir von der Theorie in die Praxis. In den Kapiteln sechs bis neun richten wir die Aufmerksamkeit auf einige Methoden, mit deren Hilfe wir das Denken, unsere Konzentration, trainieren können: Von Nen und Kōan bis Teezeremonie und Herz-Sutra. Danach bespreche ich die Effekte des Zen-Trainings bezogen auf die Einheit von Körper und Geist (Kapitel zehn) und bezogen auf das Zusammenspiel von Stress und Glück (Kapitel elf). Über das Thema Glück schlagen wir die Brücke zum abschließenden Kapitel: Erleuchtung.
Am Ende des Buches geht es schließlich um die eigene Praxis! Appendix I beinhaltet eine ausführliche Meditationsanleitung für alle, die keine Zen-Lehrenden in der Nähe haben, aber gerne loslegen möchten.
Zum Schluss möchte ich noch denjenigen meinen Dank aussprechen, die mich inspiriert und geholfen haben, den Inhalt und die Form des Buches entstehen zu lassen. Insbesondere Lux Carrière, der beim Schreiben des Manuskripts in der Anfangsphase wesentliche Arbeit geleistet hat. Harmen Maas danke ich für die vergnügliche Art, mit der die Zeichnungen zustande gekommen sind. Ihr hoher Zen- und Nen-Gehalt bedarf keiner Hervorhebung, denn das wird jedem, der sie betrachtet, deutlich werden. Schließlich gilt mein Dank Hans Wanningen, der mit sehr viel Achtsamkeit, Sachverstand und unbekümmerter Zuwendung die Endredaktion übernommen hat.
Rients Ritskes.
www.zen.nl
1Zen und Buddhismus
Was ist Zen und in welcher Tradition steht es? Wie hat es sich zur heutigen Form, wie wir es in Westeuropa kennen, entwickelt? Und wie verhält sich Zen zu den fundamentalen Themen wie Religion, Gottesbild, Wiedergeburt und Moral? Bevor ich auf spezifische Aspekte der Zen-Praxis eingehe, beantworte in diesem Kapitel zunächst diese globalen Fragen.
Was ist Zen?
Zen entzieht sich inhärent jeglicher Definition. Über Zen schreiben und sprechen ist noch lange kein Zen. Zen muss man tun. Es ist die Zen-Praxis selbst, die nach und nach deutlich macht, worum es bei Zen geht. Trotzdem müssen wir Zen nicht mit einer Glorie von Erhabenheit und östlicher Mystik auftakeln; wir können sicherlich den Versuch wagen, zumindest die Konturen des Zen in Worte zu fassen.
Zen handelt vor allem vom Irdischen und Praktischen, wie es sich direkt vor unseren Augen ereignet. Zen weist sehr schlicht und realistisch auf unmissverständliche Tatsachen im Hier und Jetzt hin. Oft vor unseren eigenen Füßen, oft vor unserer eigenen Nase, von Moment zu Moment.
So nah diese tatsächliche Wirklichkeit jedoch auch ist, sie entgeht uns nur allzu oft. Warum? Weil uns unsere Wahrnehmung einen Strich durch die Rechnung macht. Unser Blick scheint gewaltig vernebelt zu sein. Kein Wunder, denn uns steht viel im Weg: Überzeugungen, Absichten, Ängste, Konditionierungen, unverarbeitete Erfahrungen und andere geistige Beschwerden. Genauer betrachtet stehen wir uns also selbst im Weg. So kreieren wir unser eigenes Leiden. Als Antwort darauf können wir durch die Zen-Praxis, insbesondere durch die Zen-Meditation, unseren Geist klären. Auf diese Weise entledigen wir uns der festen Denkschubladen, Auffassungen, Annahmen und Vorurteilen. Nach langjährigem, konzentriertem und vielfachem Üben fühlen wir uns mit unserer Umgebung mehr und mehr verbunden. Es geht bei Zen stets um die direkte Erfahrung dieser Einheit und Verbundenheit im alltäglichen Leben. Eine Erfahrung, die in all ihrer Einfachheit befreiend wirkt, tiefe Einsicht gibt und für uns selbst und unsere Umgebung heilsam ist.
China: Die Wiege des Zen
Zen ist in China entstanden, aus dem breiten Mutterschoß des Buddhismus. Von da aus wurde es in Richtung Japan verbreitet. Bodhidharma, der den Buddhismus im Zen-Stil von Indien nach China brachte, wird als erster Zen-Meister betrachtet. Vor ca. 1500 Jahren eröffnete er seine erste Schule, den Shaolin-Tempel. Bodhidharma gilt auch als Gründer des später in Japan genannten Budo (ein Sammelname für japanische Kampfsportarten oder Kriegskünste). Die Geschichte besagt, dass er mit einem einzelnen Lehrling begann, doch schon bald eine große Gefolgschaft um sich versammelte. Sie bauten ein Kloster, legten Wintervorräte an und wurden Selbstversorger. Ihr Lagerhaus wurde jedoch Mal für Mal von Räubern bedroht. Darum lehrte Bodhidharma seinen Lehrlingen, den Tempel auf gewaltlose Weise zu verteidigen. Das war der Ansatz für die späteren Budo-Künste. Der Shaolin-Tempel ist somit sowohl Heimat der Zen-Tradition als auch späterer Kampfsportarten.
Der Buddhismus stand in China unter dem enormen Einfluss der vorherrschenden spirituellen und intellektuellen Traditionen, vor allem dem Taoismus und, in minderem Maße, dem Konfuzianismus. Manche behaupten sogar, Zen wäre mit dem Taoismus näher verwandt als mit dem Buddhismus. Man bezieht sich dabei auf die gemeinsamen Grundzüge, wie z. B. handeln ohne zu forcieren, die Wichtigkeit der natürlichen Einfachheit und die Praxisnähe der jeweiligen Tradition. Auch das Augenmerk auf Naturpoesie, feinsinnige Ästhetik und die losgelöste Haltung ähneln sich. Zen hat einen unverkennbar starken taoistischen Einschlag. Diesen Einschlag erkennt man schon anhand der Sprache: Tao bedeutet „der Weg“, ein Wort, das in Zen-Kreisen regelmäßig verwendet wird. So bedeutet „Zendo“ (Meditationshalle) wortwörtlich „der Weg des Zen“, oder „chadō“, der Weg des Tees. Und „Kōdō“, der Weg des Duftes. „Kyūdō“ ist der Weg des Bogenschießens. All das sind Formen der Übung „des Wegs“. Es wurden sogar Bücher über „Buddho-Taoismus“ geschrieben.
Tao und Zen haben also miteinander zu tun. Das passt nahtlos ins allgemeine Bild des Buddhismus, der sich stetig und geschmeidig an die Kulturen und Gesellschaften anpasst, mit denen er im Laufe der Geschichte in Berührung kommt. Jedes Mal scheint der Buddhismus gegenüber wertvollen Elementen anderer Kulturen offen sein, ohne dabei seine Eigenheit zu verlieren. Der „Chinesische Buddha“ ist dafür ein gutes Beispiel.
Japan: Zen perfektioniert
Im zwölften Jahrhundert gelangte Zen vom chinesischen Festland nach Japan. Hier entwickelten sich im Laufe der Zeit zwei große Zen-Schulen, Rinzai und Sōtō (später kam die dritte, weniger einflussreiche Ōbaku-Schule hinzu). Rinzai, an der sich auch meine Organisation orientiert, unterscheidet sich von Sōtō in Form des Kōan-Trainings (siehe Kapitel sieben). Bei Sōtō liegt der Nachdruck, noch stärker als bei Rinzai, auf der Meditation. Zen erreichte das japanische Festland zu einer Zeit, in der die japanische Gesellschaft begierig die vielen Erfindungen und Erneuerungen des großen mächtigen Nachbarn im Westen importierte. Meistens versuchte man mit Erfolg das zu perfektionieren, was in China begonnen hat. Das gilt sicher auch für Zen. Was der Integration des Zen in die japanische Kultur half, war, dass es sich gut in die bestehende Kultur einfügte. So gab es beispielsweise viele Berührungspunkte mit dem bereits weitverbreiteten Shintoismus und seinen Vorläufern. Die Zen-Tradition konnte sich in Japan weiter entfalten und wurde ritualisiert. Damals war diese Entwicklung überwiegend positiv, heute ist sie das nicht immer uneingeschränkt. So hat beispielsweise ein Teil der Zen-Rituale seine Lebendigkeit verloren. Es wird manchmal vergessen, was der Ursprung und der Sinn eines Rituals ist. Wohlgemerkt: Natürlich wissen viele japanische Zen-Meister genau, worum es geht. Dies habe ich im Laufe meiner Begegnungen und Gespräche mit ihnen feststellen können. Allerdings traf ich auch einige Zen-Meister, die vor allem „Träger des Amts“ zu sein schienen. Dieses Phänomen kann man mit unseren Bischöfen vergleichen: Manche sind ein Vorbild der christlichen Nächstenliebe; andere erwecken den Eindruck, als führten sie nur pflichtmäßig aus, was ihnen die Tradition vorschreibt.
Trotz dieser Entwicklung im Land des Zen bin ich dankbar dafür, dass ich in verschiedenen japanischen Klöstern intensives Zen-Training praktizieren durfte. Bis heute rate ich motivierten Zen-Lehrlingen, eine Zeit lang nach Japan zu gehen. In der Form, in der das Zen-Training in Japan Gestalt annimmt, verbirgt sich ein großer Schatz praktischer Weisheit. Und obwohl manche Rituale erstarrt sind, tragen auch sie noch Spuren der Erleuchtung – wie ein Fossil noch Spuren des einstigen Tieres zeigt. Um es mit dem Katholizismus zu vergleichen (konkret mit Liturgie): Ein Ritual ist und bleibt ein herrlicher Brauch, besonders, solange es wie ursprünglich gedacht praktiziert wird, als spirituelle Übung. So praktiziert, muss sich Gregorianischer Gesang mitnichten hinter japanischen Sutras (verschriftlichte Lehren des Buddha) verstecken. Dass die Messe mancherorts noch immer auf Latein abgehalten wird und dass gregorianisches Latein gesungen wird, hat den gleichen Wert wie das Rezitieren der Sutras in ursprünglicher japanischer Aussprache, wie wir es in unseren Kursen tun. Es ist ein geistiges Training, eine Achtsamkeitsübung. Der Text ist mühsamer auszusprechen als im vertrauten Niederländisch oder Deutsch. Äußerste Konzentration ist also geboten, vor allem, wenn man nicht schneller oder langsamer als der Rest der Gruppe singen will. Außerdem sind die Sutra-Texte schwieriger zu behalten, wodurch auch das Gedächtnis trainiert wird (siehe Kapitel neun über das Herz-Sutra).
Rituale haben also ihren Sinn, genauso wie Traditionen. Welchen Wert das exakte Befolgen von Traditionen hat, wurde mir deutlich, als ich mit der Vorbereitung meines Buchs über Erleuchtung im Zen-Kloster Tenryū-ji beschäftigt war. Ich war bei Nen-san Sasaki Roshi und wollte ihn zu diesem Thema befragen. Er wollte sich jedoch in keiner Weise dazu äußern. Damit folgte er der strikten, Jahrhunderte alten Gewohnheit der Zen-Meister, kein Wort über die Erleuchtung zu verlieren. Als ich später bei den Mönchen im Zendo saß, machte ich unerwartet selbst eine Erleuchtungserfahrung. Wäre Nen-san auf meine Bitte eingegangen, wäre mir diese Erfahrung wohl nicht vergönnt gewesen. Ich hätte vermutlich eher auf meinem Kissen sitzend über seine weisen Worte gegrübelt. Auf diese Erfahrung werde ich noch in Kapitel zwölf zurückkommen. Vielleicht schwieg Nen-san aufgrund didaktischer Erwägungen, vielleicht schwieg er aus anderen Gründen; im Endeffekt macht es jedoch nichts aus. In beiden Fällen kann Schweigen im richtigen Kontext dem Lehrling helfen. Es gibt jedoch auch Zen-Meister, die rein aus Prinzip zu schweigen scheinen. Wenn am Ende keiner mehr versteht, worum es geht, wird es heikel. Auf diese Problematik komme ich ebenfalls in Kapitel zwölf zu sprechen. Wie dem auch sei, glücklicherweise gibt es genug erfahrene und fähige Zen-Meisterinnen und Zen-Meister.
Das soll nicht heißen, dass Zen überall floriert. Man kann feststellen, dass der Anteil aktiver Zen-Praktizierender in Japan rückläufig ist. Es ist vielsagend, dass immer mehr Zen-Priester einen oder mehrere Nebenjobs ausüben müssen, um ihr Kloster noch irgendwie unterhalten zu können. In Japan ist die Zen-Motivation gegenwärtig dürftig. Einmal nahm ich mit einer Gruppe von fünfzehn niederländischen Zen-Lehrlingen an einem Retreat in einem japanischen Zen-Kloster teil. Bei unserer Abfahrt machte der Abt eine beeindruckende Aussage: „Die Sesshin2 mit der niederländischen Gruppe war der Höhepunkt meiner Arbeit als Zen-Meister!“ Außer seiner großen Höflichkeit deutet dies darauf hin, dass die Zen-Tradition bei uns im Westen ein neues, spannendes Kapitel aufgeschlagen hat. Schauen wir wiederum auf das Christentum, so sehen wir, dass die Kirche in Afrika, Asien und Südamerika lebendiger und ursprünglicher ist als ihr oft ermattetes Äquivalent in europäischen Ländern. Zweifellos haben die katholischen Messen in Rom ein höheres Niveau als ihr Pendant im afrikanischen Flachland. Allerdings ist das Christentum in Afrika und anderen Gebieten eine dynamische und alltagsrelevante Bewegung statt eine wertvolle, aber erstarrte Institution. Und auch wenn Zen-Tempel in Japan unübertroffen sind, findet man die pulsierende Zen-Tradition gegenwärtig in westlichem Terrain.
Zen.nl
Nun zur Situation in meinem eigenen Land. Ich begrenze mich dabei auf meine eigene Zen-Organisation, mit landesweit mittlerweile 40 Niederlassungen: Zen.nl. Unsere Abendgruppen sind von japanischen Laiengruppen inspiriert. Diese heißen zazenkai und dauern oft genau wie bei uns eine Stunde und eine dreiviertel Stunde. Die Versammlungen beginnen mit einem Begrüßungswort, gefolgt von einer thematischen Einleitung und dann zwei Mal fünfundzwanzig Minuten meditieren. Zum Abschluss trinken die Teilnehmenden auf zeremonielle Weise Tee, wonach jeder seines Weges geht. Diese jahrhundertealte, japanische und möglicherweise auch chinesische Tradition halten wir bei Zen.nl aus gutem Grund in Ehren (siehe Kapitel acht). Die zazenkai ermöglicht uns, unsere weltliche Erfahrung zu vertiefen. Außerdem dient sie als wöchentlicher Halt und Orientierung für die eigene, tägliche Meditationspraxis.
Die Perle des Zen-Trainings ist jedoch die Sesshin, worauf wir bei Zen.nl großen Wert legen. Sesshins sind Zen-Retreats, in denen sich die Teilnehmenden über eine längere Periode (meist eine Woche) von ihren Mühen des alltäglichen Lebens zurückziehen, um im Gruppenverband intensiv zu meditieren.
Selbst diese Perle hat in Japan oft ihren Glanz verloren. Japanische Mönche sind in der Regel nicht sehr motiviert. Viele von ihnen sitzen ein paar Jahre im Kloster ab, um danach als Nachfolge-Priester in die Fußstapfen ihrer Väter zu treten. Dem liegt natürlich eine ganz andere Einstellung zugrunde, als bei Menschen, die sich freiwillig zum Retreat anmelden: Letztere haben Ziele, wie sich spirituell zu vertiefen und mit anderen zu verbinden oder das eigene Schlafmuster zu verbessern.
Es folgt ein kurzes Beispiel um aufzuzeigen, wie motiviert Sesshin-Teilnehmende in den Niederlanden oft sein können: Eine unserer Kursteilnehmerinnen meditierte regelmäßig und merkte, dass das ihrem Schlaf guttat. Sie hatte das Gefühl, dass die Teilnahme an einer Sesshin ihre Schlafqualität noch weiter verbessern würde. Die Sesshin brachte ihr schließlich den gewünschten Effekt. Sie war intrinsisch3 motiviert und setzte sich vollständig ein: Trotz ihrer anstrengenden Arbeit investierte sie eine Woche ihres Urlaubs und kam sogar für eine zweite Sesshin zurück. Es würde mich nicht wundern, wenn sie nächstes Jahr wiederkäme.
Wir versuchen, mit unseren Sesshins so nah wie möglich an der japanischen Tradition zu bleiben. Beispielsweise sprechen wir während der Sesshin den ganzen Tag nicht, ausgenommen der Zen-Lehrer4 während Vorträgen (Teisho auf Japanisch) und während des persönlichen Gesprächs (Dokusan)5. Genau wie in Japan steht auch die körperliche Ertüchtigung bei Sesshins von Zen.nl fest im Programm und wir ermutigen alle, auch tatsächlich mitzumachen. In Japan wird während Sesshins fast immer körperliche Arbeit verrichtet: Sei es Holzhacken im Wald, im Gemüsegarten arbeiten oder auch Betteln. Letzteres hat entgegen mancher Erwartung eine sehr sportliche Seite: Mönche laufen gut und gerne vier Stunden bettelnd herum – von sieben bis elf Uhr morgens.
Zugegebenermaßen halten auch wir uns nicht vollständig an die Tradition. Das gilt allerdings nur für die Form, nicht für das zugrunde liegende Prinzip: Bei uns werden wie in Japan sowohl Körper als auch Geist trainiert.
Die wöchentlichen zazenkai-Zusammenkünfte unterstützen die eigene, tägliche Meditationsroutine, halten diese vital und fördern ihre Entwicklung. Die Sesshins sind dazu bestimmt, darüber hinaus den spirituellen Tiefgang der Teilnehmenden zu fördern. Wir evaluieren sowohl die zazenkai als auch die Sesshins regelmäßig und sehen, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Intensität der Teilnahme einerseits, und der Note, die sich Teilnehmende selbst für ihre Lebenszufriedenheit geben andererseits, besteht. Die Bewertungen sprechen eine deutliche Sprache: Kursteilnehmende und Sesshin- Teilnehmende fühlen sich nachweisbar besser. Der Effekt der Sesshins übertrifft dabei noch den der regulären Einführungs- und weiterführenden Kurse. Durch das Tainieren in Leiden (denn das ist eine Woche oder längeres intensives Meditieren natürlich auch), verlegen die Teilnehmenden ihre Grenzen. Dadurch entwickeln sie eine größere, mentale Flexibilität. So können sie die Stürme und Stürmchen ihres Lebens besser bewältigen und sich in ihrer Haut wohler fühlen. Selbst lange nach Ablauf der Sesshin geben sich Teilnehmende noch höhere Glücksnoten.
Ist Zen eine Religion?
Wie vorher erläutert, ist Zen eine Strömung des Buddhismus, die auf eine Tradition, die bis Buddha reicht, zurückgeht. Zen ist also eine Form des Buddhismus. Wenn ich gefragt werde, ob Zen eine Religion ist, antworte ich, dass Zen Buddhismus ist, so wie Yoga Hinduismus. Yoga ist ein Gebilde aus spirituellen Übungen, die vom Hinduismus abstammen; Zen ist eine spirituelle Tradition, die vom Buddhismus abstammt. Obwohl Zen in seiner Entwicklung über China und Korea von allerlei Strömungen beeinflusst wurde, ist die Zen-Philosophie eine Form der buddhistischen Philosophie. Das Herz-Sutra, das in Kapitel neun ausführlich zur Sprache kommen wird, ist der Kern der Lehre des Mahayana-Buddhismus6 und auch der Zen-Philosophie.
Strikt genommen ist Zen kein Gottesdienst, denn Zen kennt keine Götter. Das gleiche gilt im Prinzip auch für den Buddhismus. Nichtsdestotrotz rechnen die meisten Religionswissenschaftler den Buddhismus zu den fünf großen Weltreligionen. Nicht ohne Grund: Manche der vielen buddhistischen Schulen verehren Buddha wie einen Gott7 oder eine gottgleiche Figur; sie fassen Buddha als jemanden auf, mit dem die Anhängerschaft ein persönliches Band haben kann. Buddhas Position in diesen Schulen ist mit der des Jesu im Christentum vergleichbar.
Zen-Buddhisten glauben nicht an ein höheres Wesen, wie wir es aus den abrahamitischen Gottesdiensten kennen. Trotzdem steht es allen, inklusive den eigenen Mönchen, Nonnen und Laien im Zen frei, dies doch zu tun. Es hängt natürlich sehr davon ab, was man genau unter „Gott“ versteht. Der Emeritus Bischof Jan Bluyssen sagte dazu: „Gott ist vor allem auf den leeren Seiten der Bibel und im Zeilenzwischenraum zu finden“. Dieser Gott, der sich jeder Beschreibung entzieht, ist häufig der Gott der Theologen, die ihn bedeutend mehr studiert haben, als der durchschnittliche Gläubige. Das ist eine Definition, zu der wir innerhalb der Zen-Tradition eine Affinität haben. Auch Meister Eckharts Gott, der in diesem Zusammenhang vom „inneren Funken“ sprach, ist der Zen-Philosophie nah. An anderer Stelle nennt der mittelalterliche Mystiker Gott die „leere Stelle in uns selbst“. Meister Eckhart ging nicht von einem identifizierbaren Gott aus, sondern von einer nicht-identifizierbaren Entität; vorbei an Worten, genauso wie Zen an Worten vorbeigeht.
Auch wenn wir es nicht mit einem Gott oder Menschengott zu tun haben, ist es sicherlich empfehlenswert, sich tiefgründig und aufmerksam mit der Lebensgeschichte Buddhas zu beschäftigen. Das gilt übrigens genauso für die Lebensgeschichte Mahatma Gandhis, Mutter Teresas oder die unserer eigenen Mutter oder die unseres eigenen Vaters. Aus jeder Lebensgeschichte kann man etwas lernen, so auch von der Geschichte Buddhas. Anzumerken ist, dass die Studie des Lebens des Buddha, und sogar die Studie des Buddhismus keine Voraussetzung für Erleuchtung ist. Die ersten Schritte auf dem Pfad der Erleuchtung (denke dabei an mehr Entspannung, eine gleichmäßigere Stimmung und eine bessere Nachtruhe) kann man genauso gut auf andere Weise gehen. Wohl wird sich in der Praxis nahezu jeder, der sich intensiv mit Zen beschäftigt, mit der Lehre und dem Leben Buddhas verbunden fühlen. Gerade im universellen Charakter jener Lehre liegt ihre Kraft, beziehungsweise Aussagekraft. Buddhas Lebensgeschichte drückt die Essenz dieser Lehre aus.
Das Leiden loslassen
Die zentralen Leitsätze des Buddhismus sind die Vier Edlen Wahrheiten:
Das Leben ist Leiden
Das Leiden wird durch Unwissenheit
8
verursacht
Das Leiden kann durch das Aufheben von Unwissenheit gelöst werden
Unwissenheit kann durch das Folgen des achtfachen Pfads aufgehoben werden: Die rechte Erkenntnis, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte Handeln, der rechte Lebensunterhalt, die rechte Anstrengung, die rechte Bewusstheit, die rechte Konzentration (Meditation)
Das ist meiner Ansicht nach pures Zen. Der Titel dieses Buches, „Lerne zu denken, was du denken willst.“, ist vom achtfachen Pfad inspiriert. Er drückt im Endeffekt den achten Schritt des achtfachen Pfads aus: Die rechte Konzentration. Diesen Schritt zu gehen, führt zum vierten Schritt des achtfachen Pfads: das rechte Handeln, oder auch: das tun, was man tun will. Denkt und handelt man auf diese Weise, kann man besser fühlen, was man fühlen will. Das zu fühlen, was man fühlen will, ist die Essenz des Buddhismus und auch des Zen: Es geht darum, das Leiden loszulassen. Stärker als andere buddhistische Schulen, betont Zen die rechte Konzentration als wesentlichen Wirkfaktor der Praxis. Mit der rechten Konzentration handeln wir recht und können so die Ketten des Leidens Stück für Stück ablegen.
Reinkarnation
Reinkarnation – der Glaube, dass die Seele nach dem Verscheiden in einen anderen Körper übergeht – ist ein prekäres Thema, wenn es um östliche, spirituelle Wege geht. In der Zen-Philosophie spielt Reinkarnation, anders als in vielen anderen buddhistischen Schulen, eine vergleichsweise geringe Rolle. Trotzdem sind innerhalb der Zen-Tradition vermutlich Zen-Praktizierende zu finden, die an Reinkarnation glauben. Die Zen-Tradition bietet viel Raum für spezielle Glaubensüberzeugungen – ob es nun um Reinkarnation geht oder den Glauben an eine Seele oder einen Gott. Alle sind herzlich dazu eingeladen und willkommen, ungeachtet der persönlichen Sichtweise und Vorlieben auf dem Sitzkissen Platz zu nehmen. Als ich mit der Zen-Praxis begann, fragte ich meinen Zen-Meister: „Glaubst du an Reinkarnation?“ Er antwortete: „Ich sage dir sowohl meinen offiziellen Zen-Meister-Standpunkt als auch meinen persönlichen Standpunkt. Persönlich habe ich Erfahrungen gemacht, die stark vermuten lassen, dass so etwas wie Reinkarnation existiert. Aber nach der Zen-Lehre ist die Wirklichkeit, so wie wir sie sehen, eine Illusion. Sollte also etwas re-inkarnieren so sind das Illusionen.“ Wer weiß, vielleicht hat er Recht und vor allem Illusionen „re-inkarnieren“, indem sie von Generation zu Generation weitergetragen werden. Eltern drängen Kindern ihre eigenen Ideen auf, wodurch diese aufrechterhalten werden. Zen hilft uns zu durchschauen, dass all unsere Denkmuster im Wesentlichen mehr oder weniger hilfreiche Illusionen sind. Aber es steht jedem frei, daran zu glauben oder nicht.
Bompu-Zen
In der heutigen Zeit ist es ein Vorteil für die Verbreitung von Zen, dass die Zen-Tradition von Anfang an keine Götter kannte. Von Beginn an war Zen ein spiritueller, aber vor allem auch praktischer Übungsweg. Vor dreißig Jahren wurde mir vorgeworfen, ich würde Zen zweckentfremden und die Erleuchtung verhökern, indem ich Führungskräfte in Zen unterrichtete. Ich verfolgte dabei jedoch sehr banale, irdischen Ziele, wie Menschen zu einer besseren Konzentration und einem besseren Schlaf zu verhelfen. Zen wird schon seit Jahrhunderten auf verschiedenen spirituellen Niveaus unterwiesen. Bompu-Zen, die Basisform aller Zen-Praktiken, wird als Zen für das Volk beschrieben; durch Bompu-Zen fühlen sich Menschen besser. Am anderen Ende des Spektrums befindet sich die klösterliche Praxis. Schlussendlich sind dies aber nur Facetten des gleichen Diamanten.
Der niedrigschwellige Zugang zu Zen trägt sicherlich zu seiner Praxisnähe bei. Das zeigt auch die Vielzahl an veröffentlichten Büchern, deren Titel diese Praxisnähe besonders hervorheben, von Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten bis Zen und die Kunst des Studierens. Die praktische Seite des Zen ist keine Erfindung der modernen, westlichen Lehre, sondern so alt wie der Weg nach Kyōto. In den Zen-Klöstern dieser Stadt werden übrigens seit Jahr und Tag Führungskräfte in Zen unterwiesen.
Kurzum: Nichts Neues unter der Sonne. So habe ich Dart-Spieler Raymond van Barneveld betreut und schon in klassischen buddhistischen Texten stehen Geschichten über Zen-Meister, die Sumo-Ringer begleitet haben. Die Beziehung zur Praxis ist aus Zen-Perspektive logisch. Es geht bei der Zen-Tradition unumstritten auch darum, besser denken zu lernen und dadurch besser zu funktionieren – ob wir nun Sportlerin oder Pfleger sind. Jeder Berufstätige gewinnt Nutzen durch mehr Klarheit über den Geist und jeder, der arbeitet, kann auch arbeitend seinen Geist trainieren.
Moral in Zen
Die Moral nimmt innerhalb des Zen einen ganz anderen Platz ein als beispielsweise im Christentum. Es gibt keine in Stein gemeißelten Gebote. Selbst der achtfache Pfad ist keine von oben auferlegte Verordnung; vielmehr dient er als Ermutigung, alles, was man tut, mit Achtsamkeit zu tun. Die Moral steckt bei Zen nicht in den Geboten, Zen ist ein Aufruf zum bewussten Leben. Es ist allerdings so, dass das Kultivieren dieser Form der Achtsamkeit einen großen Effekt auf uns als moralische Wesen hat. Wer alles mit liebevoller Achtsamkeit tut, verfällt nicht so rasch in egoistisches oder unethisches Handeln. Handelt man achtsam und in Verbundenheit mit der Umgebung, vermittelt einem die dadurch gewachsene Intuition, anderen kein Leid anzutun. Man wird davon durchdrungen, dass anderen schaden, sich selbst schaden bedeutet. Das Ziel des Zen und des Buddhismus ist es, Menschen dazu zu bewegen, aufmerksam und liebevoll zu leben; Menschen, die so leben, haben meist von selbst weniger Bedarf an Ge- oder Verboten. Zen-Praktizierende lernen, mit Hilfe des eigenen moralischen Kompasses zu fahren.
Es wäre allerdings falsch zu behaupten, dass innerhalb der Zen-Tradition überhaupt keine Moralvermittlung stattfände. In Kapitel sieben werden wir sehen, dass manche Kōans deutliche Moralvorstellungen transportieren. Außerdem kennt auch das Zen-Kloster selbst eine strikte Klostermoral; im Endeffekt schadet es auch nicht, einen moralischen Rahmen zu verinnerlichen, auch wenn dieser nur dadurch entstünde, dass man (un)ethisches Verhalten schlichtweg bewusster wahrnimmt. Insgesamt liegt der Nachdruck in der Zen-Philosophie jedoch auf dem Empfinden dessen, was für einen selbst und seine Umgebung im Wesentlichen gut ist – und nicht auf unbewusstem Folgen moralischer Regeln.
Wir haben in diesem Kapitel einen groben Überblick über buddhistische Kernideen erhalten. Auch haben wir gesehen, wie sich Zen gegenüber einiger wichtiger Fragen wie Moral, Spiritualität und Religion verhält. Außerdem habe ich meine Herangehensweise an Zen angedeutet. Im folgenden Kapitel werde ich genauer erklären, worin diese sich im Kern von anderen Strömungen und Richtungen innerhalb des Zen unterscheidet.
2Zielgerichtetes Zen
Nur wer zielbewusst Zen praktiziert, ist wirklich effektiv; effektiv bedeutet hierbei, dass man so denkt, fühlt und handelt, dass man die Ziele erreicht, die man sich vornimmt und die Ziele loslässt, die für einen selbst und andere unheilsam sind. Diese Erkenntnis gewann ich zu Beginn meiner Zen-Praxis. Spätere Erfahrungen als Studienberater und Meditationslehrer führten zur Einsicht, dass Zielbewusstsein tatsächlich für jeden ein Schlüssel zu einem zufriedenstellenden Dasein ist. Ohne klar umrissenes Ziel weiß man nicht, was man mit seinem Leben anstellen soll – mit Ziel hingegen schon. Kennt man sein Ziel, kann man dementsprechend leben. Dadurch erreicht man in den meisten Fällen auch, was man möchte. Und selbst wenn nicht, hat man sich auf einen sinnvollen Weg begeben. Das macht zufriedener und gesünder. Darauf gehen wir in diesem Buch noch ausführlich ein.
Vielleicht liegt es für einen Teil der Lesenden nicht auf der Hand, warum ich für Zielbewusstsein, sprich genau zu wissen, wohin man möchte, eine Lanze breche. Passt das zur Zen-Tradition mit ihrem starken Fokus auf das Hier und Jetzt und das Loslassen aller Ziele? In diesem Kapitel möchte ich aufzeigen: Zielbewusstsein und Ziellosigkeit sind zwei Seiten der gleichen Medaille.
Deutliche Ziele
Ich nehme mich zunächst selbst als Beispiel. Vor rund 40 Jahren war ich ein nicht besonders talentierter und genauso wenig motivierter Student. Meine Gedanken schweiften permanent ab und meine Interessen waren (zu) zahlreich. Es gelang mir selten, vollkommen konzentriert hinter meinen Studienbüchern zu sitzen. Glücklicherweise begriff ich wohl, dass es mit mir und meinem Studium so nicht gut enden würde: Ich musste lernen, mich besser zu konzentrieren. Also beschloss ich, mich für einen Meditationskurs anzumelden. In einer der ersten Unterrichtsstunden sprachen wir in der Gruppe untereinander ab, jeden Tag zwei Mal zwanzig Minuten zu meditieren. Zwei Wochen später stellte sich heraus, dass sich niemand außer mir an die Absprache gehalten hatte. Die anderen gaben an, dass sie aufgrund ihrer anderen Beschäftigungen und Verpflichtungen nicht dazu gekommen wären. Das verwunderte mich: Ich hatte angefangen zu meditieren, gerade weil ich ein geschäftiges Leben hatte und ich kaum Achtsamkeit für mein Studium aufbringen konnte. Das Argument eines vollen Terminkalenders konnte nicht erklären, warum praktisch alle Kursteilnehmenden das Handtuch geworfen hatten.
Erst Jahre später wurde mir klar, woran es wohl gelegen hatte: Mangel an Zielbewusstsein. Ich war der Einzige der Gruppe, der sich ein deutliches Ziel gesetzt hatte: Eine bessere Konzentration und bessere Studienresultate.
Wer sich seiner Ziele bewusst ist, ist deutlich wirksamer. Das gilt für alles was wir tun, ob es nun um Zen-Meditation, eine Ausbildung, einen Wohnortwechsel oder selbst die Wahl unseres Partners geht. Ohne klares Ziel kommen wir nicht zurecht. Dies versucht auch die weise Katze aus Lewis Carolls Alice im Wunderland Alice klarzumachen:
„Würdest du mir bitte sagen, wie ich von hier aus weitergehen soll?“ fragte Alice.
„Das hängt zum großen Teil davon ab, wohin du willst,” sagte die Katze.
„Es ist nicht so wichtig, wo –“ sagte Alice.
„Dann ist es egal, welchen Weg du nimmst,” sagte die Katze.
Die Botschaft der Katze ist genauso lustig, wie wahr. Uns kann das Ziel, sprich der Grund, warum wir mit dem Meditieren beginnen, nicht klar genug vor Augen liegen. Zweifellos denkt jeder, der mit einem Meditationskurs beginnt, mehr oder weniger an ein Ziel. Worauf es jedoch ankommt, ist, dieses Ziel so präzise wie möglich in Worte zu fassen und stets zu berücksichtigen. Das sind kritische erste Schritte, um diese Ziele auch tatsächlich zu erreichen oder eben loszulassen. Als ich den Meditationskurs begann, lief mein Studium an der Hochschule gelinde gesagt mäßig. Die Hälfte der Stunden, die ich hinter meinen Studienbüchern saß, war ich mit den Gedanken woanders. Ich setze mir also das Ziel, mit meiner Aufmerksamkeit nach einigen Monaten dreiviertel der Zeit den Büchern widmen konnte. Meine Rechnung war, dass ich die Zeit, die ich in die Meditation investiert habe, in gleichem Ausmaß für das Studium zurückgewinne. Zu meiner Verwunderung schien die Konzentration tatsächlich schon nach drei Wochen merklich gestiegen zu sein. Noch heute ist für mich ein wichtiger Beweggrund zu meditieren, dass ich die Mühe und Zeit, die ich investiere, reichlich zurückerstattet bekomme.
Mit neunzehn nahm mein Konzentrationsvermögen noch weiter zu. Früher passierte es regelmäßig, dass ich die Seite eines Buches umschlug und nicht mehr wusste, was ich gerade gelesen hatte. Nach zwei Jahren der Meditation war ich diesem Übel beigekommen – ein bemerkenswertes Resultat.
Ein hinzukommender Vorteil war, dass ich aus meinem Studium mehr Lebensqualität herausholte. Jedes Mal die gleichen Seiten durchzuwühlen schlägt normalerweise auf die Stimmung, doch das belastete mich immer weniger: Ich las meine Studienbücher mit mehr Achtsamkeit und Freude, nahm dadurch mehr auf und wurde besser in dem, was ich tat. Das schien sich auch auf andere Bereiche meines Lebens, selbst derer, auf die ich bisher keine Lust hatte, zu übertragen. Dies ermöglichte mir, mein Studium mit Hilfe eines Samstag-Nebenjobs zu finanzieren. Dadurch, dass ich auch dort mehr Achtsamkeit aufbringen konnte, kam ich häufiger gut gelaunt und mit mehr Energie nach Hause. Bevor ich mit dem Meditieren begonnen habe, fiel ich noch nach jedem Arbeitstag erschöpft ins Bett.
Es ist wichtig zu wissen, welches Ziel man hat und es ist entscheidend, es präzise zu formulieren. Die anderen Kursteilnehmenden formulierten ihre Motive für die Teilnahme am Meditationskurs, wie bereits angedeutet, nicht oder eher vage: „Ich würde mich schon gerne etwas besser fühlen“, „Ich habe gehört, dass es schön ist“, „Ich würde gerne meine Schlafprobleme angehen.“ Letzteres war zwar etwas gezielter, doch inzwischen mag deutlich sein, dass Ziele noch punktgenauer gesetzt werden können. Ein allgemeiner Grundsatz für das Formulieren von Zielen kann lauten: „Je konzentrierter, je besser!“
Meditation mit Effekt
Der Erfolg unserer Meditationskurse kommt unter anderem dadurch, dass wir in der ersten Unterrichtsstunde auf die persönlichen Zielsetzungen der Teilnehmenden eingehen. Wir stellen Fragen wie: „Warum kommst du hierhin?“ Als wir seinerzeit damit begannen, war dies in Zen-Kreisen so unüblich wie Fluchen im Zendo.
Wenn ein Kursteilnehmer erklärt, dass er regelmäßig Kopfschmerzen habe und diese loswerden wolle, ist es Sache des Lehrers, bei einer solch vagen Umschreibung nachzufragen. Denn was ist „regelmäßig“? Einmal pro Monat, einmal pro Jahr oder einmal pro Tag? Viele Kursteilnehmende müssen auf derartiges Nachfragen wahrlich laut nachdenken – sie scheinen ihre Probleme nicht gut zu kennen. Für den besagten Kursteilnehmer waren die Kopfschmerzen dreimal pro Woche so heftig, dass er zu Schmerzmitteln griff. Ich notierte folgendes Ziel: „Er möchte seine Kopfschmerzen loswerden und schluckt derzeit dreimal die Woche Aspirin.“ Drei Wochen später hielten wir einen Reflexionstag ab. In einem Kreisgespräch kamen die Zielsetzungen der Teilnehmenden wieder zur Sprache. Der besagte Kursteilnehmer kam auch an die Reihe. Er schien zwei Mal zwanzig Minuten pro Tag zu meditieren, merkte davon aber nach eigener Aussage nicht viel. Als ich ihn daraufhin fragte, wie es um seine Kopfschmerzen steht, antwortete er: „Da habe ich in letzter Zeit nichts mehr von bemerkt, warum?“ „Vor drei Wochen hast du noch dreimal pro Woche Schmerzmittel geschluckt!“ „Hm, jetzt wo du es sagst“ erwiderte er, „aber das kann doch nicht am Meditieren liegen!“
Manche entgegnen dieser Anekdote vielleicht: „Was zählt ist, dass er seine Kopfschmerzen los ist, oder?“ Ja und nein. Wer die Verbindung zwischen der Meditationspraxis und den damit verbundenen Veränderungen nicht sieht, verwehrt sich selbst eine Inspirationsquelle, die dafür sorgen könnte, auch nachhaltig weiter zu meditieren. Es kommt durchaus vor, dass sich ehemalige Kursteilnehmende nach einigen Jahren wieder einschreiben, da ihre Beschwerden zurückgekehrt sind. Sie beherrschen zwar die Technik und begreifen die Theorie, aber es mangelt ihnen an Einsicht über die persönlichen Effekte der Meditation. Sie haben unzureichendes Zielbewusstsein und infolgedessen in der Praxis wenig Meditationsdisziplin.
Es folgt eine weitere Illustration von bewusstem versus unbewusstem Lernen: Im Einführungskurs fragen wir die Teilnehmenden einmal im Monat während eines Kreisgesprächs: „Was ist deine Zielsetzung? Welche Entwicklungen kannst du hinsichtlich dieser Zielsetzung feststellen?“ Im Zuge dessen entwickeln viele Teilnehmende ein stärkeres Bewusstsein dafür, welchen Effekt die Meditationspraxis bisher auf sie hatte. So hatte sich eine Kursteilnehmerin das Ziel gesetzt, mehr Energie zu haben. Anfangs war sie beinahe durchgehend müde, doch mittlerweile ging es besser. Und nicht nur sie konnte einen Erfolg verbuchen. Diejenige, die neben ihr saß, erzählte: „Bevor ich mit dem Meditieren begann, hatte ich Verdauungsprobleme. Seitdem ich meditiere, habe ich damit keinen Ärger mehr und ich fühle mich fitter.“ Daraufhin sagte die Frau daneben: „Jetzt wo du es sagst ... Auch ich fühle mich energetischer und meine Darmbeschwerden haben sich deutlich verbessert.“ Meditieren wird einfach, wenn man weiß, wofür man es macht. Zu sehen, dass es effektiv ist, motiviert Menschen, weiterhin in ihre mentale und körperliche Verfassung zu investieren. Die konkreten Ziele können dabei unterschiedlicher Natur sein. Von „Ich möchte mich weniger mit meinem Partner streiten.“ zu „Ich möchte es schaffen, regelmäßig etwas für den guten Zweck zu tun.“ bis hin zu „Ich möchte meinen Medienkonsum reduzieren.“ habe ich im Laufe der Zeit verschiedene Ziele gehört. Ich glaube, dass von bewusst gesetzten und wohlüberlegten Zielen sowohl man selbst auch die Umgebung profitieren.
Bewusste und unbewusste Ziele
Im Allgemeinen finden es Menschen schwierig, sich bewusst konkrete Ziele zu setzen. Das liegt meines Erachtens daran, dass sie vor unbewussten Zielen geradezu platzen. Sie können sich angesichts des unendlichen Wollens nicht entscheiden. Nicht selten ist unser Geist ein Wirrwarr an Wunschlisten und von den meisten Wünschen wissen wir gar nichts. Erst wenn wir uns eingehend mit unseren Wünschen beschäftigen, stellen wir fest, was wir eigentlich alles wollen. Als ich einmal einem Ehepaar Meditation beibrachte, sagte ich ihnen: „Viele Menschen denken, dass sie nicht viel wollen, sind aber gleichzeitig ziemlich neidisch.“ „Naja“, sagte der Mann, „Neid ist bei mir kein Thema.“ Er meinte dies ernst. Seine Frau musste an der Stelle jedoch unbändig lachen. Wenn man neidisch ist, strebt man meistens heimlich nach Eigenschaften, Leistungen und Besitztümern anderer. Das führt uns zum Kern der buddhistischen Lehre. Buddha gab an, dass das große Problem des Menschen Begierde ist. Unser Verlangen wird nie gestillt. Immer wieder denken wir: Erst wenn ich dieses oder jenes einmal erreicht habe, bin ich glücklich. In unserem Unbewussten schlummern tausende Ziele, bereit, früher oder später auf dem Podium des Geistes zu erscheinen. An Begierde bzw. Wünschen an sich ist nichts falsch oder verkehrt. Es ist allerdings wichtig, dass wir Einsicht über unsere Wünsche erlangen – zum Beispiel durch Meditation. Unbewusste Wünsche versklaven uns. Bewusstem Verlangen können wir auf eigenen Wunsch wohl oder eben kein Gehör schenken.