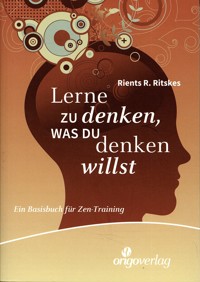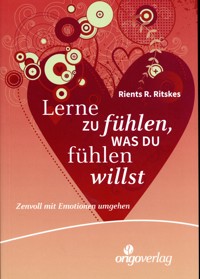
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Origo Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Rients R. Ritskes beschreibt in diesem Buch, wie Zen Klarheit in die verwirrende Realität der Gefühle und Emotionen bringen kann. Diese Klarheit ermöglicht es uns, die Verstrickungen mit uns selbst und anderen zu lösen. Die gegebenen Definitionen von „Fühlen“ und „Emotionen“ sind so praktisch wie innovativ, die Perspektiven auf Emotionen wie „Wut“, „Neid“, „Traurigkeit“ und „Liebe“ so erhellend wie einleuchtend. Viele Menschen glauben, dass es im Zen-Buddhismus kaum oder gar nicht um Gefühle und Emotionen geht, ist doch das Bild eines klassischen Zen-Meisters eher regungslos und erhaben. Das vorliegende Buch zeigt, dass der Schein trügt. Es liest sich wie ein Reiseführer durch die eigene Gefühlswelt aus Zen-Perspektive. Es richtet sich nicht nur an bereits Meditierende, sondern auch an alle, die diesen Weg kennenlernen wollen. Ritskes bekannt bodenständiger und klarer Schreibstil, untermauert mit vielen praktischen Beispielen, Wissenschaft und Theorie, sorgt dafür, dass sich jeder schnell in der Welt der Gefühle und Emotionen zu Hause fühlt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zu diesem Buch
Rients R. Ritskes beschreibt in diesem Buch, wie Zen Klarheit in die verwirrende Realität der Gefühle und Emotionen bringen kann. Diese Klarheit ermöglicht es uns, die Verstrickungen mit uns selbst und anderen zu lösen. Die gegebenen Definitionen von „Fühlen“ und „Emotionen“ sind so praktisch wie innovativ, die Perspektiven auf Emotionen wie „Wut“, „Neid“, „Traurigkeit“ und „Liebe“ so erhellend wie einleuchtend. Viele Menschen glauben, dass es im Zen-Buddhismus kaum oder gar nicht um Gefühle und Emotionen geht, ist doch das Bild eines klassischen Zen-Meisters eher regungslos und erhaben. Das vorliegende Buch zeigt, dass der Schein trügt. Es liest sich wie ein Reiseführer durch die eigene Gefühlswelt aus Zen-Perspektive. Es richtet sich nicht nur an bereits Meditierende, sondern auch an alle, die diesen Weg kennenlernen wollen. Ritskes bekannt bodenständiger und klarer Schreibstil, untermauert mit vielen praktischen Beispielen, Wissenschaft und Theorie, sorgt dafür, dass sich jeder schnell in der Welt der Gefühle und Emotionen zu Hause fühlt.
Zum Autor
Rients R. Ritskes ist Autor mehrerer praktischer Bücher über Zen und Gründer von zen.nl, einem niederländischen Ausbildungsinstitut für Zen-Lehrer und Verband von über 40 „Niederlassungen“, in denen Meditation gelehrt wird. Ritskes studierte Philosophie und betreibt seit über 40 Jahren Zen-Meditation.
Von Rients R. Ritskes ist ebenfalls als E-Book lieferbar:
Lerne zu denken, was du denken willst
Ein Basisbuch für Zen-Training. Übersetzt von Michel Keil.
ISBN 978-3-282-00212-2
Zum Übersetzer
Der Übersetzer Michel Keil (1994 in Düsseldorf) lebt in Koblenz und ist Übersetzer der Bücher von Rients R. Ritskes „Lerne zu denken, was du denken willst. Ein Basisbuch für Zen-Training.“ und „Lerne zu fühlen, was du fühlen willst. Zenvoll mit Emotionen umgehen.“ und Mitglied von zen.nl. Michel Keil betreibt seit 2015 Zen-Meditation, ist approbierter Psychotherapeut und Dozent für Psychologie. Im Zen-Buddhismus sieht er Parallelen zu seiner Tätigkeit als Psychologe. Keil wird seine Erfahrungen zusammen mit Mitwirkenden bei der Etablierung eines Netzwerks aus Meditationszentren nutzen. Erste Zentren entstehen kurz- und mittelfristig in Koblenz, Mainz und Berlin. Wenn Sie Interesse am Aufbau eines Meditationszentrums auf der Basis von Rients R. Ritskes Büchern und anderen Einflüssen in Deutschland, der Schweiz und Österreich haben, senden Sie gerne eine E-Mail an [email protected]
RIENTS RITSKES
LERNE ZU FÜHLEN,WAS DU FÜHLEN WILLST
Zenvoll mit Emotionen umgehen
[EIN BASISBUCH FÜR ZEN-TRAINING, BAND 2]
Aus dem Niederländischen von Michel Keil
Impressum
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmassnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritte enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, d a wir uns d iese nicht z u eigen m achen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2024 by Origo Verlag
Rathausgasse 30
CH-3011 Bern/Schweiz
E-Mail: [email protected]
ISBN 978-3-282-00213-9
Unser gesamtes Programm finden Sie hier: www.origoverlag.ch
Die in diesem Buch vorgestellten Themen und die damit verbundenen Aussagen basieren auf Rients R. Ritskes jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Zen, Zen-Coaching und Zen-Organisation sowie mitunter wissenschaftlichen Befunden. Die Informationen des Buches stellen keine medizinischen oder psychologisch-psychotherapeutischen Fachinformationen dar, sind keine Diagnosen, Ratschläge oder Empfehlungen hinsichtlich Erkrankungen und ersetzen nicht den Rat eines Psychotherapeuten oder Arztes. Der Autor, Übersetzer und der Verlag haben dieses Buch mit höchster Sorgfalt erstellt. Dennoch ist eine Haftung des Autors, des Übersetzers oder des Verlags ausgeschlossen. Die im Buch wiedergegebenen Aussagen spiegeln die Meinungen des Autors wider und müssen nicht zwingend mit den Ansichten des Verlags oder des Übersetzers übereinstimmen.
Im vorliegenden Buch wurde auf die Verwendung geschlechtsneutraler Begriffe geachtet. In einigen Fällen musste aufgrund der Lesbarkeit auf das generische Maskulinum zurückgegriffen werden. In allen Fällen sind stets alle Geschlechter angesprochen.
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Zen und Fühlen
Emotionen, Fühlen und Gefühle
Sich gut fühlen
Die Wichtigkeit des Erfühlens
Basale Formen des Fühlens
Mit Gefühlen und Emotionen umgehen lernen
Urbubbles
Neid
Traurigkeit
Liebe
Wut und Hoffnung
Nachwort
Appendix I – Meditieren lernen
Appendix II – Das Denkmodell
Appendix III – Literatur
Stichwort- und Namensverzeichnis
Vorwort
Das Buch Lerne zu fühlen, was du fühlen willst ist ein konsequenter Nachfolger des bereits erschienenen Buches Lerne zu denken, was du denken willst (OrigoVerlag, 2024). Konsequent aus Zen-Perspektive, jedoch unscheinbarer, als man es auf den ersten Blick vermuten mag. In unserer westlichen Welt sind wir nämlich mehr mit Denken, als mit Fühlen beschäftigt. Dieses Phänomen spiegelt sich unter anderem in der immensen Anzahl an publizierten Büchern wider, die von Denkprozessen aus philosophischer, psychologischer und psychiatrischer Sicht handeln. Seit der griechischen Antike haben wir uns als denkende Wesen in die Prozesse und Ergebnisse unseres Denkens vertieft. Denken wird in unserer westlichen Kultur als höchster Ausdruck des Menschseins in den Himmel gehoben.
Fühlen hingegen, ist nicht dem Menschen allein vorbehalten. Fühlen kann jedes lebende Wesen, denn Fühlen ist nichts mehr als die Interaktion zwischen dem Äußeren und Inneren. Was Fühlen jedoch so interessant macht, ist nicht das Fühlen an sich, sondern die Reaktion oder Interaktion, die darauf folgt. Diese komplexen Ketten werden von Rients Ritskes als Fühlen, Gefühle und Emotionen beschrieben. Die Beziehung zwischen Fühlen und Gefühlen einerseits und Gefühlen und Emotionen andererseits ist verzwickt. Wie in diesem Buch erklärt wird, herrscht in der Fachliteratur zu diesem Thema Unklarheit und sogar Widerspruch.
In Lerne zu fühlen, was du fühlen willst, legt Rients auf Basis etlicher Beispiele auf treffende Weise dar, was der Unterschied zwischen Fühlen, Gefühlen und Emotionen ist.
Was kann man mit diesem Wissen anfangen? Die Antwort ist täuschend einfach: Man kann sich besser fühlen.
Wie wichtig Einsicht in die Interaktion zwischen Fühlen, Gefühlen und Emotionen ist, sehe ich häufig bei Patientinnen und Patienten in meiner Poliklinik für unerklärliche Magen-Darm-Beschwerden. Die wissenschaftlichen Studien, an denen viele meiner Patientinnen und Patienten teilgenommen haben, zeigen, wie stark Emotionen beziehungsweise der Gemütszustand auf die sensorische Funktion (das Fühlen) und die motorische Funktion (die Bewegung) von Magen und Darm Einfluss nehmen. Die Aktivität der sympathischen und parasympathischen Nervenbahnen, die die Verbindung zwischen Rückenmark, Gehirn und Eingeweide darstellen, ist bei diesen Patienten messbar anders. Mit anderen Worten: Emotionen und Gefühle beeinflussen das „Fühlen“ des Magens und des Darms. Andersherum gilt dies auch: unangenehme Empfindungen im Magen beeinflussen Gefühle und Emotionen – dies merken wir beispielsweise, wenn wir „etwas Falsches gegessen haben“.
Rients widmet dem, was er die drei basalen Formen des Fühlens nennt, viel Aufmerksamkeit: Verlangen, Abneigung und sich gut fühlen. Was für viele, inklusive mir selbst, ein Augenöffner sein wird, ist, dass sich gut zu fühlen ein bewusstes Ziel sein kann und vielleicht auch sein muss. Vordergründig liegt auf der Hand, dass sich gut fühlen etwas ist, was gerade stattfindet oder nicht. Doch das aktive Kultivieren dieses Zustands wird für viele ein unbekanntes Ziel sein. Dass Zen dabei eine wichtige Rolle spielen kann, zeigt Rients anhand verschiedener Perspektiven und unterstützenden Beispielen. Für diejenigen, die wie ich regelmäßig meditieren, gibt dies Halt, um jeden Tag aufs Neue auf dem Kissen zu sitzen. Und das ... fühlt sich gut an!
Prof. Dr. Melvin Samsom
Vorstandsvorsitzender des Universitär Medizinischen Zentrums St. Radboud
Einleitung
Zen entstand in China aus dem breiten Mutterschoß des Buddhismus. Im zwölften Jahrhundert machte der Zen-Buddhismus die Überfahrt vom chinesischen Festland nach Japan. Hier entwickelten sich im Laufe der Zeit zwei große Zen-Schulen, Rinzai und Sōtō1 (später kam die weniger einflussreiche Ōbaku-Schule hinzu). Mit dem Zutun berühmter japanischer Zen-Größen wie Daisetsu Teitaro Suzuki und Shunryū Suzuki (nicht verwandt) konnte Zen im Laufe des vergangenen Jahrhunderts auch in Amerika und Europa Fuß fassen.
Im meinem eigenen Land, die Niederlande, sind in den vergangenen Jahrzehnten viele Zen-Zentren entstanden, in denen Menschen Meditationstraining erhalten können. Darüber hinaus hat die charakteristische Ästhetik des Zen ihren Weg in zahlreiche niederländische Wohnzimmer, Restaurants und Läden gefunden. Unverkennbar haben sowohl der Stil als auch das Gedankengut des Zen Wurzeln geschlagen. Als Beispiel hierfür kann meine eigene Zen-Schule, Zen.nl, dienen. Diese existiert inzwischen fünfunddreißig Jahre und umfasst zum Zeitpunkt des Schreibens mehr als vierzig Standorte.
Was ist Zen?
Was ist Zen? Inhärent an Zen ist, dass es sich jeglicher Definition entzieht. Über Zen schreiben oder sprechen ist noch lange kein Zen. Zen ist praktisch, Zen muss man tun. Dennoch ist es nicht nötig, Zen mit Geheimniskrämerei zu umhüllen. Wir können durchaus den Versuch wagen, die Konturen des Zen in Worte zu fassen – doch nur, solange wir uns eine wichtige Zen-Weisheit zu Herzen nehmen: Zen ist der Finger, der auf den Mond zeigt. Vergiss den Finger!2
Diese Weisheit zu Herzen nehmend, werden in diesem Buch diverse Definitionen des Zen erläutert, die, so hoffe ich, der Leserschaft eine Richtung weisen können. Ich begreife Zen als Bewusstseinstraining, das uns tiefgehend mit der Realität, wie sie sich kontinuierlich vor uns abspielt, in Kontakt bringt. Zen weist sehr einfach und realistisch auf bloße Tatsachen hin, hier und jetzt – direkt vor unseren Füßen, direkt vor unserer Nase, von Moment zu Moment.
So nah die tatsächliche Wirklichkeit auch ist, so häufig entgeht sie uns durch unseren verzerrten Blick. Das ist nicht verwunderlich, denn sobald wir auf uns selbst, auf andere und die Welt schauen, stehen uns diverse innere Filter im Weg: Überzeugungen, Absichten, Hintergedanken, Ängste, Konditionierungen, unverarbeitete Erfahrungen und anderes geistiges Ungemach. Genauer betrachtet stehen wir uns selbst im Weg. So kreieren wir in vielen Fällen unser eigenes Leiden.
Um dieses Leiden aufzulösen, klärt Zen – vor allem die Zen-Meditation – unseren Geist. Durch Zen trainieren wir uns darin, uns der festen Denkschubladen, Auffassungen, Annahmen und Vorurteilen zu entledigen. Nach langanhaltender, zugewandter und vielfacher Übung fühlen wir uns mehr und mehr mit allem und allen um uns herum verbunden. Es geht bei Zen stets um die unmittelbare Erfahrung dieser Einheit und Verbundenheit im alltäglichen Leben. Eine Erfahrung, die in all ihrer Einfachheit befreiend wirkt, tiefe Einsicht gibt und heilsam für uns und unsere Umgebung ist.
Die Wichtigkeit des Sich-Gut-Fühlens
In meinem Buch, Lerne zu denken, was du denken willst, gehe ich auf einen der zwei Basisfaktoren ein, die Einfluss auf die Qualität unseres Lebens nehmen: das Denken. In diesem Buch behandle ich den anderen Faktor, welcher ebenfalls von ausschlaggebender Wichtigkeit ist: das Fühlen. Ich möchte zeigen, wie Zen Klarheit in die faszinierende und komplexe Welt der Gefühle und Emotionen bringen kann. Es ist mein Wunsch, dass das Lesen dieses Buches zu Einsichten in das eigene Gefühlsleben führt, sodass man ihm nicht mehr machtlos ausgeliefert ist, sondern im Gegenteil einen Verbündeten in ihm sehen kann.
Die Definitionen von Fühlen, Gefühlen und Emotionen, die in den nachfolgenden Kapiteln präsentiert werden, sind einfach gehalten und damit hoffentlich praxistauglich. Sie sollen die Klarheit und den Halt bieten, an denen innerhalb unserer hoch emotionalisierten und komplexen Gesellschaft gerade in dieser turbulenten Zeitenwende dringend Bedarf herrscht. Ich lade die Leserschaft dazu ein, die Perspektiven, die in diesem Buch dargeboten werden, in der Praxis zu testen.
Der rote Faden dieses Buchs ist die Ansicht, dass sich gut zu fühlen in der Essenz eine Frage des guten Fühlens ist. Oft wissen wir überhaupt nicht, wie wir uns fühlen. Es hat den Anschein, als seien all unsere Sinnesorgane in einen tiefen Schlaf gefallen. Dennoch sind sie immer aktiv, ob wir uns dessen nun bewusst sind oder nicht. Meistens fühlen wir erst etwas, wenn Verlangen oder Abneigung in uns aufkommen. Mit anderen Worten: Ein großer Teil unseres Gefühlserlebens wird durch das beansprucht, was wir wollen (Verlangen) beziehungsweise das, was wir nicht wollen (Abneigung). Was uns jedoch entgeht, ist das unauffällige, jedoch viel umfassendere Basalgefühl: Jenseits von Abneigung und Verlangen befindet sich der wahre Schatz: das „normal-gute“ Gefühl, welches unserer Aufmerksamkeit nur allzu oft entgeht und damit nicht bewusst wird.
Dieses „normal-gute“ Gefühl wirst du kennen. Vielleicht hast du es während einer Tasse Tee erfahren, vielleicht in einem ruhigen Moment am Schreibtisch. In solchen Momenten gibt es weder starke Abneigung noch starkes Verlangen nach irgendetwas. Meine Behauptung ist, dass dieses „normal-gute“ Gefühl uns die meiste Zeit über zugänglich wäre, wir es aber nicht bewusst fühlen. Und was wir nicht bewusst fühlen, existiert in unserem Erleben nicht.
Um dieses Gefühl doch erfassen zu können, müssen wir unsere Sinnesorgane öffnen. Das ist manchmal leichter gesagt als getan. Die gute Nachricht ist jedoch, dass gerichtetes Bewusstseinstraining – sprich Zen – uns dabei helfen kann. Zen schärft und vergrößert unser Bewusstsein über das, was wir fühlen. Dadurch fühlen wir besser.
Neben diesem Bewusstseinstraining kann uns Zen weiterhin lehren, wie wir mit Abneigung und Verlangen und anderen Turbulenzen unseres Gefühlslebens besser umgehen können. Das trägt zu unserem Glück und das derjenigen um uns herum bei.
Wissen, was man will
Ferner möchte ich mit Lerne zu fühlen, was du fühlen willst ein klareres Licht auf ein weiteres vernachlässigtes Phänomen werfen: Wir lassen uns unbemerkt von einer endlosen Wunschliste steuern. Wer dies einmal durchschaut hat, kann das Ruder herumreißen und sich auf das fokussieren, was er wirklich zutiefst will. Das hat positiv-einschneidende Folgen für unsere Lebensweise. Von Frustration zu Inspiration – so nenne ich diese radikale Kursänderung im Umgang mit Wünschen und Zielen.
Eng verbunden mit dem uferlosen Wollen, das aus unserem Unbewussten heraus sein Zepter über uns hält, ist die Emotion Neid. Neid hat uns viel mehr im Griff, als wir für möglich halten. Die Ursache dafür ist recht einfach: Wir wollen immer alles, was alle um uns herum auch haben. Das ist eine unbequeme Wahrheit, der wir nicht anerkennen wollen. Aufgrund dieser Vogel-Strauß-Taktik richtet Neid jedoch viel mehr Schaden an, als wir (an)erkennen – und als nötig wäre! Werden wir uns unseres Neids nämlich bewusst, können wir ihn erstens besser regulieren und zweitens kann er sogar eine reiche Quelle von Einsichten und Inspiration werden. Sowohl die destruktive als auch konstruktive Facette des Neids werden im Verlauf dieses Buches genauer untersucht.
Von Emotionen lernen
In der zweiten Hälfte des Buchs werden einige Emotionen behandelt, die großen Einfluss auf uns haben. Dazu gehören der bereits erwähnte Neid sowie Wut, Traurigkeit, Liebe und Mitgefühl. Stets wird anhand zahlreicher Beispiele und Anekdoten aus dem Alltag sowie Geschichten aus der Zen-Literatur beschrieben, wie wir mit der jeweiligen Emotion umgehen können – und stets wird sich zeigen, dass es weder positive noch negative Emotionen gibt. Unter besonderen Umständen ist Wut passender als Fröhlichkeit. Manchmal kann Traurigkeit uns mehr verdeutlichen, als Freude. Jede Emotion kann uns aus der Balance holen und Elend verursachen. Genauso hat jede Emotion das Potential, unser Lebensglück zu vergrößern. Ob sich eine Emotion positiv oder negativ für uns auswirkt, bestimmt nicht die Ladung der Emotion, sondern hängt davon ab, ob wir die Emotion bewusst erfahren und durchschauen können. Es geht im Zen nicht um das Unterdrücken der eigenen Emotionen, sondern um das Erforschen und Durchschauen dieser.
Wer die eigenen Emotionen auf diese Weise transparent macht, wird erstaunt über den Reichtum an Einsichten sein, den man aus ihnen ziehen kann. Eine Emotion blindlings zu äußern ist immer eine vertane Chance zur Selbsteinsicht. Umgekehrt gilt: Eine Emotion bewusst zu erfahren und zu durchschauen ist eine gute Gelegenheit, sich selbst besser kennenzulernen. Emotionen spielen uns nicht zwangsweise einen Streich. Sie können sogar unsere größten Bündnispartner werden. In diesem Buch möchte ich darlegen, wie Emotionen Richtung geben, wie sie deutlich machen, was für uns wirklich wichtig ist und wie sie uns unseren fundamentalen Zielen näherbringen (aber auch von ihnen entfernen) können. Das macht uns und die Menschen um uns herum zufriedener und darum geht es in Zen.
Dieses Buch soll der Leserschaft als Reiseführer durch das eigene Bewusstsein und durch die eigene Gefühlswelt dienen. Lerne zu fühlen, was du fühlen willst soll eine Anleitung zum emotionalen Erwachsenwerden sein. Mein Wunsch ist, dass ich mit diesem Buch einen Beitrag dazu liefern kann, dass Menschen mit ihrem wesentlichen Gefühl in Kontakt kommen. Dazu ist es notwendig, dass auch die Lesenden an die Arbeit gehen und schrittweise entdecken, wie sie fühlen können und wollen.
Wie schon erwähnt, ist Zen durch und durch praxisorientiert. Darum lege ich allen Lesenden Appendix I ans Herz: Dieser Anhang beinhaltet eine detaillierte Meditationsanleitung für alle, die keine Zen-Lehrenden in der Nähe haben, aber trotzdem mit Zen und Meditation loslegen möchten.
Zum Abschluss der Einleitung möchte ich ein Wort an die vielen Menschen richten, die mich dazu inspirierten und mir halfen, diesem Buch Form und Inhalt zu geben. Als erstes bedanke ich mich bei den vielen Zen-Lehrlingen, die mich stets aufs Neue mit ihren Fragen, ihrem Vertrauen und dem enormen spirituellen Einsatz inspirieren. Leo Stout, Martijn de Jong und Evert Jan Kema danke ich für das Transkribieren der eingesprochenen Texte. Ap Dijksterhuis, Rob van Grinsven und rund fünfzig Zen-Lehrende in der Ausbildung haben durch ihre Kommentare auf ein oder mehrere Kapitel direkten Einfluss auf das Manuskript genommen. Davon profitierten sowohl ich persönlich als auch die Qualität des Buches.
Ich möchte insbesondere Hans Wanningen danken. Als Kommunikationsexperte, Philosoph, Zen-Lehrer und Sekretär von Zen.nl, hat er mir von Anfang bis Ende konstruktiv und fähig geholfen, die Einsichten in diesem Buch so klar wie möglich in Worte zu fassen.
Rients R. Ritskes
Zen.nl
1Zen und Fühlen
Zen lässt sich nicht in eine Schublade stecken. Genauso wie die trotzige, veränderliche Wirklichkeit, in der wir leben, entzieht sich Zen jedem Versuch, es für alle Zeit in Sprache festzulegen. Das letzte Wort über Zen ist noch nicht gesprochen und das wird es auch nie. Aus diesem Grund ist es auch nicht verwunderlich, dass Dutzende Definitionen über Zen im Umlauf sind – und jede von ihnen hat ihren eigenen Schwerpunkt.
In Kyōto befindet sich ein Zen-Garten namens Ryōanji. In diesem befinden sich fünfzehn große Steine. Aus keinem Blickwinkel sind alle fünfzehn Steine sichtbar. Das ist kein Zufall, sondern eine wohldurchdachte Absicht der Gartenarchitektur. Es soll uns Demut lehren. Welche Perspektive wir auch einnehmen, wir sehen nie das Gesamtbild. Nichtsdestotrotz wirft jede Perspektive ihr eigenes Licht auf die Sache, wodurch wir schrittweise lernen zu erfühlen, worum es im Kern geht. Aus diesem Grund lohnt es sich, in diesem ersten Kapitel einige der besseren Definitionen des Zen näher zu betrachten, bevor wir die Verbindung zwischen Zen und Fühlen genauer untersuchen.
Definitionen von Zen
Zunächst die mehr oder weniger offizielle Definition: Unter dem Schlagwort „Zen“ kann man auf Wikipedia lesen, dass Zen eine Form des Buddhismus ist, die im sechsten Jahrhundert unserer Jahreszählung in China entstand und sich ebenfalls in Japan verbreitete. Im Zen-Buddhismus liegt besonderer Fokus auf der Praxis des Zazen (Sitzmeditation) und dem Lösen von Kōans (Fragen, die nicht auf logischem Wege beantwortet werden können). Ziel des Zen – was wortwörtlich „Meditation“ bedeutet – ist gemäß dieser Definition: Einsicht in seine wahre Natur und den Ausdruck dessen im täglichen Leben zu bekommen. Die höchste Form dieses Vorgangs nennt sich Erleuchtung.
Ich selbst nenne Zen oft kurz und bündig Rückgrattraining, wortwörtlich und bildlich gesprochen. Zweimal pro Tag fünfundzwanzig Minuten gerade auf einem Kissen zu sitzen hilft uns enorm, in körperlicher und mentaler Hinsicht den Rücken zu stärken. Meditieren ist eine Wohltat für unseren Rücken. Sie stärkt die Muskulatur entlang des Rückgrats und bewahrt die Rückenwirbel damit vor Verschleiß.
Man kann die Rückenmuskulatur durch regelmäßigen Sport oder durch spezifische Fitnessübungen trainieren. Ein weiteres probates Mittel ist zwei Mal am Tag fünfundzwanzig Minuten aufrecht zu sitzen – und zwar ohne die Hilfe einer Rückenlehne. Ersetzt man seinen Bürostuhl durch einen ergonomischen Hocker, ist das ein gutes Rückgrattraining.
Körper und Psyche sind unlösbar miteinander verbunden. Ein geschmeidiges und starkes Rückgrat kann sowohl die mentale Geschmeidigkeit als auch das mentale Durchhaltevermögen steigern; meditiert man regelmäßig, fühlt man sich dadurch stabiler und kräftiger und strahlt dies auch auf die Umgebung aus.3
Genauso wie man Zen als Rückgrattraining bezeichnen kann, kann man Zen als Bewusstseinstraining betrachten – anders gesagt, als eine Methode, das dritte Auge zu öffnen. Damit meine ich keine übersinnliche oder gar esoterische Fähigkeit. Mit dem dritten Auge meine ich die Fähigkeit, seine Perspektive zu erweitern – eine Fähigkeit, die jeder Mensch trainieren kann. Dies bedarf einiger Erläuterungen.
Zwei Augen sehen mehr als eines. Wer zwei Augen hat, betrachtet die Welt von zwei Standpunkten aus – dem linken und dem rechten Auge. Dies entgeht uns in der Regel, da unser Gehirn das Bild des linken und das Bild des rechten Auges fusioniert. An diesem Beispiel der visuellen Wahrnehmung sehen wir, dass Wahrnehmung eine Frage der Perspektive, des Standpunktes, ist.
Im Zen geht es darum, seine eigene, begrenzte Perspektive zu erkennen und diese zu erweitern. Wir erweitern unsere Perspektive jedoch nicht, um in „höhere Sphären“ aufzusteigen, sondern im Gegenteil, um die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist. Bewusstseinstraining beinhaltet, dass man in der täglichen Praxis darauf achtet, aufmerksam anwesend zu sein und gut zu beobachten, was wirklich geschieht. Bewusstseinstraining bedeutet, besser darin zu werden, Dinge aus mehreren Perspektiven zu betrachten. Ich nutze den Ausdruck „Drittes Auge“, um diese Haltung kurz zusammenzufassen – nicht mehr und nicht weniger.
Die Zen-Praxis ist darauf ausgerichtet, dass wir mit uns und der Situation verbunden bleiben. Wir bleiben bewusst. Wir lernen, unsere Werturteile aufzuschieben, bis wir alle relevanten Standpunkte durchfühlt haben. Bewusstsein ist keine Frage des Wissens, sondern des klaren Registrierens dessen, was sich von Moment zu Moment ereignet. Man erkennt seine eigene begrenzte Perspektive, erweitert sie, öffnet sich gegenüber der Welt und fühlt sich mit ihr verbunden. Kurzum, es geht darum, der komplexen, kontinuierlich verändernden Realität gerechter zu werden.
Daran anschließend kann man Zen als das Kultivieren einer offenen, empfänglichen Geisteshaltung betrachten. Es ist die Kunst, stets aufs Neue mit klarem Blick in die Welt zu schauen. Das kann nur gelingen, wenn wir die Dinge, die unseren Blick vernebeln, durchschauen. Das bedeutet konkret: Wir müssen die unverarbeiteten Erfahrungen (Bubbles4, wie ich sie nenne), die wir alle mit uns rumtragen mitsamt den dazugehörigen Emotionen verarbeiten. Unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit wird nämlich durch frühere Erfahrungen eingefärbt und zwar mehr, als gut für uns ist. Je weniger Bubbles wir haben, desto mehr können wir die Wirklichkeit sehen, wie sie wirklich ist.
Das ist die Zen-Perspektive: ein trainierter Geist, das Kultivieren eines offenen Geistes, ein Anfänger Geist5.
Zur Verdeutlichung: Die oben beschriebene Perspektive ist nicht mit der unbefangenen Perspektive eines Kindes zu verwechseln. Ein Kind verfügt noch über wenig Lebenserfahrung. Eine erleuchtete Person hingegen, hat viel Erfahrung gesammelt, doch sie vernebelt ihren Blick nicht. Sie hat einen unbefangenen Blick und Lebenserfahrung. Darum geht es in der Zen-Praxis: Wir üben, ungehindert und unbefangen die Realität zu betrachten, auf Basis durchlebter und durchfühlter Lebenserfahrung.
Verlangen fühlen
Alle genannten Definitionen haben ihre Vorzüge und tragen zum Verständnis des Buchthemas bei. Dennoch entscheide ich mich für einen anderen Ausgangspunkt: Zen ist, fühlen zu lernen, was man fühlen will.
Eine Kernaussage des Buddhismus und auch des Zen ist, dass Begierde zu Leiden führt. Wer sich sklavisch seinen Begierden hingibt, kreiert eigenes und fremdes Elend. Je mehr wir verlangen, desto mehr leiden wir, wenn wir etwas nicht bekommen. Können wir das Verlangen stillen, rettet uns das aber auch nicht. Bekommen wir, was wir verlangen, haben wir Angst, es wieder zu verlieren und leiden also wieder. Oder wir leiden, sobald wir das Bekommene verlieren. Egal wie man es dreht und wendet, Verlangen und Leiden scheinen oft Hand in Hand zu gehen. Darum sagen Buddhisten, dass man von Verlangen besser Abstand nimmt.
Diese Schlussfolgerung scheint plausibel und unumstößlich. Dennoch möchte ich sie nuancieren. Im weiteren Verlauf des Buches erläutere ich, dass Begierde bzw. Verlangen vielleicht nicht so basal ist, wie man im Buddhismus häufig glaubt. Die Grundlage und damit tiefere Ebene des Verlangens ist meiner Ansicht nach Neid, doch dazu wie angedeutet später mehr.
Vorläufig konzentrieren wir uns auf die Frage: Wie gehen wir mit dem endlosen Strom des Verlangens um? Ohne zu übertreiben, kann man feststellen, dass wir ununterbrochen Wünsche an die Welt und unser eigenes Leben richten. In der Praxis sind sich die meisten Menschen kaum dessen bewusst, was sie alles wollen. Meiner Einschätzung nach ist dies eines der großen Probleme unserer Zeit: Wir alle wollen immer alles. Diese Neigung wird teilweise zusätzlich durch geschickte Werbung befeuert. Die wahre Ursache unseres uferlosen Verlangens liegt jedoch woanders: in der menschlichen Natur. Das Potential, immer alles zu wollen, ist fest in unserer Art verankert und kann gravierende Auswirkungen sowohl für uns als Individuum als auch gesamtgesellschaftlich haben.
Gravierende Auswirkung hat dieses Potential aber erst dann, wenn es unbewusst bleibt (wir es also nicht fühlen) oder wenn wir es leugnen. Letzteres kommt leider häufig vor. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Erstens sind wir uns, wie bereits erwähnt, meist nicht dessen bewusst, wie gerne wir potentiell alles haben wollen – die Annahme, dass es doch so ist, mag deswegen absurd erscheinen. Zweitens wollen wir keinen unzivilisierten oder gar bedürftigen Eindruck machen. Allzu schnell behaupten wir daher: „Ach nein, das schöne Auto / den ansehnlichen Titel / die vorteilshafte Position / die schöne Jacke / ... brauche ich nicht.“ Damit verleugnen wir, was wir in Wahrheit doch all das haben möchten. Diese Verleugnung zu erkennen, ist der erste kritische Schritt, wenn wir mehr Einblick in unsere tieferen Beweggründe bekommen möchten. Dann erst können wir erkennen: was wir meinen zu wollen ist nicht das, was wir wirklich und zutiefst wollen.
Das wahre Bedürfnis
Doch wie schaffen wir es, unser wahres Bedürfnis zu entdecken? Hier kann Meditation große Dienste leisten. Meditieren hilft, Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen und kann uns entdecken lassen, was wir wirklich und zutiefst wollen. Meditation bewirkt Bewusstsein.
Es folgt ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, um diesen Prozess konkreter darzustellen. Mit siebzehn entschied ich mich dazu, mit Meditation anzufangen. Ich hatte damals die Hoffnung, mich dadurch besser konzentrieren zu können. Es gelang mir bis dato nämlich nicht, ausreichende Aufmerksamkeit für meinen Lernstoff aufzubringen. Nach kurzer Zeit wurde mir deutlich, dass mir die tägliche Meditation viel brachte. Ich konnte mich merklich besser konzentrieren, das Lernen fiel mir leichter und meine Klausuren bestand ich zufriedenstellend. Es traten auch in anderen Lebensbereichen positive Veränderungen zutage und ich wurde zufriedener.
Die beachtenswerten Einflüsse der Meditationspraxis faszinierten mich derart, dass ich jeden Tag treu meditierte und mich außerdem in die Zen-Philosophie vertiefte. Dies führte rasch zur Erkenntnis, dass ich tief in meinem Innersten etwas ganz anderes wollte, als das, wofür ich in die Wiege gelegt zu worden schien: das Unternehmen meines Vaters. Mir wurde klar, dass sein Geschäft nicht das meinige war. An einem Samstagmittag, ein halbes Jahr bevor ich den Betrieb übernehmen sollte, teilte ich meinem Vater meinen Beschluss mit, sein Geschäft nicht zu übernehmen. Ich teilte ihm außerdem mit, dass ich nach meiner ökonomischen Ausbildung Philosophie studieren wollte. Obwohl er natürlich enttäuscht war, akzeptierte er meine Entscheidung.
Auf diese Art gab mir Meditation einen klaren Blick auf das, was ich losgelöst von elterlichen Erwartungen tief in meinem Innersten wirklich wollte. Auch in meiner späteren Tätigkeit als Meditationslehrer stellte ich fest, dass Zen-Meditation für viele einen signifikanten Beitrag dazu liefern kann, den Sinn ihres Lebens zu entdecken. Dieser ist für jede und jeden anders, doch Zen-Meditation kann ein klareres Licht auf das, wozu man sich im tiefsten Innersten hingezogen fühlt, werfen.
Zen ist eine Methode, die dir offenlegt, wer du wirklich bist und was zu dir passt. Dabei verlangt jedoch niemand, dass man seine Lebensplanung wie mein damaliges Ich umkrempelt und völlig andere Entscheidungen trifft. Im Zen spielen Ge- und Verbote kaum eine Rolle. Es geht eher darum zu entdecken, was gut zu einem passt und was gleichzeitig gut für die Umgebung ist. Werden, wer man ist und tun, was zu einem passt – das ist in aller Kürze die Philosophie und Ethik des Zen. Das ist alles andere als einfach. Es ist eine wahre Kunst, die viel Training erfordert.
Zen ist, wie bereits erwähnt und wie im Verlauf des Buches noch weiter herausgearbeitet wird, die Kunst, fühlen zu lernen, was man fühlen will. Sich in sich selbst, andere und die Welt um einen herum gut einzufühlen – besonders in kritischen Momenten und bei wichtigen Entscheidungen – wer will das nicht? Gelernt wird dies aber weniger in den kritischen Momenten, sondern mehr in der alltäglichen Übung, sprich in alltäglichen Situationen. Jeder Moment ist eine Gelegenheit zum Üben, eine Chance, mit seinem Gefühl in Kontakt zu kommen. Damit meine ich das Körpergefühl, denn Fühlen ist etwas Körperliches. Während des Essens fühlt man so zum Beispiel, dass man ein Messer und eine Gabel in den Händen hält. Statt das Essen achtlos hinterzuschlucken, nimmt man Biss für Biss bewusst seine Textur und Temperatur wahr.
Hören, Sehen, Fühlen
Zen stützt sich auf drei Pfeiler. Der erste ist die Meditation als Basisübung. Der zweite Pfeiler ist das Studium des Zen, welche unsere Einsicht weiter vertieft. Schlussendlich ist der dritte Pfeiler: Mache alles in deinem täglichen Leben so bewusst wie möglich, sprich mit voller Achtsamkeit und vollem Einsatz. Wer so seine Achtsamkeit kultiviert, entwickelt auch gleich sein Gefühl. Man kann sagen, dass sowohl Meditation als auch das Studium des Zen in der Praxis angewandt werden, indem wir so viel wie möglich mit Achtsamkeit tun und uns bewusst darüber sind, wie sich das anfühlt.
In Retreats6 stelle ich den Teilnehmenden regelmäßig folgende drei Fragen: „Was höre ich? Was rieche ich? Was fühle ich?“ Die Absicht ist, dass die Teilnehmenden diese dreiteilige Frage während des Meditierens auf sich einwirken lassen und zwar angewandt auf das, was sich in diesem Moment zeigt. Bei „Was höre ich?“ hören sie so zum Beispiel das Rauschen des Windes durch die Blätter, das Brodeln des eigenen Darms, das Räuspern einer anderen Teilnehmerin oder den Rasenmäher, der irgendwo in der Ferne sein Werk verrichtet. Im Anschluss berichten beinahe alle, dass man bewusster und besser hört. Das Gleiche gilt für die Fragen „Was fühle ich?“ und „Was rieche ich?“ Bei ersterer Frage gibt unser Tastsinn die Antwort: Man fühlt die Sonnenstrahlen oder das unbehagliche Gefühl schmerzender Knie während des Meditierens. Bei zweiterer Frage gibt unser Geruchssinn die Antwort: Man riecht die Reste des abbrennenden Weihrauchs oder auch das Duschgel der Nachbarin. Das Schöne dieser Übung ist, dass sie uns mehr fühlen, hören und riechen lässt. Sie hilft uns, offener für Sinneseindrücke zu werden und sie bewusster wahrzunehmen.
Für Menschen mit Meditationserfahrung ist dies eine gute Übung. Zen-Neulinge richten ihre Aufmerksamkeit während der Meditation besser auf das Zählen der Atmung. Mit dreiteiligen Fragen wie oben beschrieben zu arbeiten, kann nämlich eine Reihe anderer, möglicherweise „verkopfter“ Fragen und dazugehörige Verwirrung hervorrufen und das ist nicht der Zweck der Übung.
Erfahrene Zen-Lehrlinge entdecken immer wieder, dass sich eine große Geistesgegenwärtigkeit einstellt, wenn man intensiv mit dieser dreiteiligen Frage arbeitet. Es fühlt sich an, als würde man zum ersten Mal ohne Augenmaske, Ohrstöpsel und/oder Handschuhen durchs Leben gehen. Vor dir öffnet sich eine Welt, wobei genauer gesagt du es bist, der sich für die Welt öffnet. Als ich die Übung einmal während einer Sesshin7 mitmachte, bemerkte ich ihren Einfluss auf meinen Geruchssinn. Obwohl der Gebrauch von Aftershaves, Parfüms und Shampoos während Sesshins nicht erlaubt ist, überkam mich während besagter Sesshin das Gefühl, dass praktisch alle diese Regel ignorierten. Mir wurde bewusst, dass ein ganz normales Shampoo noch Stunden später zu riechen ist – selbst bei Flakons mit der Aufschrift „geruchlos“ oder „neutral“. Unter normalen Umständen wären mir diese subtilen Gerüche mit Sicherheit entgangen. Im Laufe der Sesshin konnte ich jedoch mehr und mehr Gerüche voneinander unterscheiden. Während ich anfangs noch die Frage „Was rieche ich?“ auf mich einwirken ließ, hatte ich das Gefühl, im Laufe der Sesshin auf einer Blumenwiese umherzuwandern.
Fühlen, was man wirklich will
Begierde und das Leiden, welches durch Begierde verursacht wird, sind zentrale Themen im buddhistischen Denken. Diese Begierde ist wie erwähnt potentiell unerschöpflich und kann sich darüber hinaus auch auf alles Mögliche beziehen: Wir alle wollen potentiell immer alles. Diese Tatsache an sich ist unbedenklich. Die Tatsache, dass wir uns dessen jedoch überhaupt nicht bewusst sind, macht uns unzufrieden und unglücklich. Wir verfolgen unbewusst eine potentiell unendliche Liste an Begierden und werden zwangsläufig und schmerzhaft frustriert, denn es ist schlichtweg unmöglich, immer alles zu bekommen, was man haben möchte. Um diese Frustration und diese Unzufriedenheit, sprich das Leid, aufzulösen, tun wir gut daran, unserem uferlosen Verlangen Grenzen zu setzen. Dies erreichen wir, indem wir uns zunächst des irrealen Charakters dieses zügellosen Wollens bewusst werden. Im Anschluss müssen wir lernen, unsere Verlangen zu durchschauen. Tun wir dies, haben wir die besten Voraussetzungen dafür, gesunde Entscheidungen zu treffen – Entscheidungen, die sich gut anfühlen und eine nachhaltige Zufriedenheit fördern. Als eine mögliche Übung empfehle ich, einen Monat lang alle aufkommenden Wünsche, und seien sie auch noch so winzig und scheinbar unbedeutend, aufzuschreiben.
Wer diesen Weg der Bewusstwerdung nicht geht – wie der Großteil der Menschen – läuft bestenfalls mit einem nagenden Gefühl der Unzufriedenheit umher. Denn wir können zwar alles begehren, in der Praxis wird sich diese Begierde jedoch niemals stillen lassen. Wer immer alles will, verstrickt seinen Geist in das, was er noch nicht hat oder nicht bekommen kann. Regelmäßig liest man in der Zeitung, wie Milliardäre trotz ihres Reichtums der Verlockung nicht widerstehen können, Steuerhinterziehung zu begehen. Für manche endet dies sogar im Gefängnis. Man fragt sich: Was überkommt einen solchen Menschen? Die Antwort ist, dass diese Handlungen eigentlich nur Manifestationen dessen sind, was wir alle in uns haben. Wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir potentiell alles wollen, und damit meine ich wirklich alles, stehen wir uns selbst und unserem Glück im Weg – selbst wenn wir in Luxus und Wohlstand leben.
Angenommen, jemand entscheidet sich dafür, ein guter Koch zu werden. Dieser Entschluss bedeutet für ihn automatisch, dass er von vielen anderen Wünschen und Ambitionen ablassen muss. Vieles wird für das höhere Ziel weichen müssen. Trotz dieses Verzichts ist die Chance groß, dass eine solche Entscheidung bei ausreichendem Einsatz und Talent zu Zufriedenheit beim zukünftigen Koch führt. Er wird nämlich leidenschaftlich das machen, was zu ihm passt. Dass er viele andere, schlummernde Wünsche links liegen lässt, tut daran keinen Abbruch.
Sich zugunsten für etwas zu entscheiden, ist per Definition auch das Ausschließen anderer Wahlmöglichkeiten. So betrachtet, ist eine Entscheidung zu treffen, ein Ausdruck dessen, sowohl etwas bewusst zu wollen als auch etwas anderes bewusst nicht zu wollen. Wenige leben so ihr Leben. Meistens wollen sich Menschen ihre Optionen lieber offenhalten, statt sich zu entscheiden. Diese halbherzige Haltung führt zu halbherzigen Entscheidungen. Es geht jedoch auch anders. Meditation ist ein gutes Hilfsmittel, um fühlen zu lernen, was wir zutiefst wollen. Auf diese Weise lernen wir, Prioritäten zu setzen und gute Entscheidungen zu treffen.
Existentialismus oder Buddhismus?
Gut zu erfühlen, was man will, bedeutet auch zu erfühlen, was man nicht will. Das „Nicht-Wollen“ ist ein zentrales Thema im Buddhismus. Laut Buddha tun wir gut daran, nichts zu begehren. Für manchen Zen-Neuling zieht das die Frage nach sich, ob er seinem aktuellen Lebensstil Lebewohl sagen muss. Wenn wir uns von aller Begierde befreien müssen, müssen wir dann nicht sofort Haus und Hof verkaufen, uns den Kopf scheren und ins Kloster eintreten? Zur Beruhigung: Das ist sicherlich nicht das, was Buddha meinte, als er sagte, dass man sich von seinen Begierden lösen solle. Er meinte, dass man an seiner Begierde nicht anhaften solle.
Dies bedarf weiterer Erläuterungen. Als ich anfing, über Existentialismus zu lesen, war ich begeistert. Vor allem das Gedankengut der Simone de Beauvoir und des Jean-Paul Sartre sprach mich sehr an. Dies brachte mich in einen Gewissenskonflikt, denn der Existentialismus schien geradewegs konträr zum Buddhismus zu stehen. Ich hatte jedoch das Gefühl, dass Sartre in seinen Analysen stichhaltig war. Als Buddhist empfand ich gleichzeitig, dass auch Buddha Recht hatte.
Daraufhin beschloss ich, den Existentialismus zum eigenen Verständnis so prägnant wie möglich zusammenzufassen. Mit Sartres und de Beauvoirs Büchern im Gepäck bin ich schlussendlich zum Ergebnis gekommen, dass der Existentialismus in seiner Essenz auf folgende Formulierung hinausläuft: Der Mensch ist sein Wunsch. Darum sagen Sartre und seine Anhängerschaft: Mensch, wünsch‘! Wünsche viel und immerzu, denn erst dann lebst du! Zusammen mit Simone de Beauvoir lebte er diesen Grundsatz und stellte als jemand, der in vollen Zügen wünschte und lebte, das gute Vorbild dar. Er brachte es als großer Philosoph und tonangebende öffentliche Figur sehr weit und auch ich empfand ihn als inspirierend. Trotzdem fragte ich mich, wie ich seine Kerngedanken mit der buddhistischen Perspektive vereinbaren konnte. Der Buddhismus lehrt uns nämlich, dass wir das Leiden durch all unsere Wünsche nur befeuern. Wollen ist Leiden, denn all die (erfüllten) Verlangen geben uns häufig nur ein unerfülltes Gefühl. Darum verkünden Buddhisten kurz zusammengefasst: Mensch, wünsch‘ nicht! Mit dieser Aussage konnte ich mich genauso gut identifizieren.
Was war jetzt „wahrer“? Nach einiger Zeit fand ich eine adäquate Antwort. Unabhängig davon empfand ich, dass sich diese Fragestellung auch gut in der Gruppe besprechen ließe. Während der erstfolgenden Sesshin fragte ich alle Teilnehmenden: „Muss ich Existentialist werden oder Buddhist bleiben? Und wie kommst du zu deiner Antwort?“ Zwei der fünfzig Antworten stachen hervor. Eine glich meiner (dazu später mehr), die andere empfand ich als sehr originell.
Letztere Antwort gab Anneke. Diese lautete: „Ich würde Buddhist bleiben. Sartre verhielt sich in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen teils grausig. Buddha war, zumindest der Überlieferung nach, bezaubernd und führte ein glückliches Leben.“ Eine genauso originelle wie interessante Antwort. Wir können uns tatsächlich fragen, ob Sartre wirklich glücklich war. Zweifellos war er erfolgreich, doch ob seine von Höhen und Tiefen geprägten Affären ihn glücklicher machten, ist zu bezweifeln. Zum Ende seiner Karriere kamen noch seine Bande mit der Roten Armee Fraktion hinzu, die bekanntermaßen nicht vor Gewalt und Terror zurückschreckte. Seine Kontakte mit RAF-Mitgliedern entblößen in meinen Augen sein grenzenloses Verlangen danach, im Rampenlicht zu stehen – auch, als dieses nicht mehr wie gewohnt auf ihn gerichtet war. Offenbar wollte er am Ende seiner Laufbahn einfach zu viel – und wer zu viel will, dem bleibt am Ende wenig.
Wie Anneke zu Recht bemerkte, ist dies bei Buddha anders. Liest man seine Lebensgeschichte, hat man das Gefühl, dass sie im Verlaufe der Jahre mehr und mehr an Aussagekraft und Schönheit gewann. Lehre und Leben waren bei ihm eins. Für viele war Buddha bis zu seinem Sterbebett eine Inspirationsquelle. Fünfundzwanzig Jahrhunderte später ist dies noch immer so.
Jan, ein anderer Sesshin-Teilnehmer, gab die Antwort, die ich mir überlegt hatte. „Ich würde Buddhist bleiben. Der Buddhismus strebt danach, nicht zu wollen. Dieses Streben an sich ist schon ein Wunsch. Der Buddhismus umfasst daher den Existentialismus. Daraus folgt, dass der Buddhismus ein weiteres Blickfeld hat als der Existentialismus.“ Beziehen wir dies auf die alltägliche Praxis, bedeutet dies, dass es nicht schlimm ist, ein Haus zu besitzen, solange man sich nicht daran klammert. Man kann etwas besitzen, solange man es nicht (zu sehr) besitzen will. Diese Freiheit von (allzu starker) Begierde hat außerdem den Vorteil, dass man das, was einem zufällt, mehr genießen kann. Kurz: Es lohnt sich, sich im Nicht-Wollen zu trainieren.
Der Beginn dieses Trainings ist wie gesagt die Erkenntnis unserer „gierigen Veranlagung“. Ich verspüre zwar keinen großen Drang, die Pyramiden in Ägypten mit eigenen Augen anzuschauen, doch das kann sich ändern. Ein guter Film oder eine fesselnde Dokumentation kann das Verlangen sicher problemlos entfachen. Mit anderen Worten: Wir tragen einen fruchtbaren Boden des uferlosen Wollens in uns, der je nach Außeneinwirkung anfängt, seine Früchte zu tragen. Davon gibt es kein Entrinnen. Doch noch einmal: Das muss keine Belastung sein, solange wir uns davon nicht bewusst oder unbewusst völlig vereinnahmen lassen.
Letzteres mündet unvermeidbar in ein unbefriedigendes Leben, in dem wir ziellos auf dem endlosen See des Wollens, auf dem es keine Heimkehr gibt, umhertreiben. Es ist erfüllender, als Kapitän ans Ruder unseres eigenen Schiffes zu gehen und entschieden den Kurs zu setzen, den wir wirklich fahren wollen. Wer nur herumtreibt, setzt keine Prioritäten und fällt keine zielgerichteten Entscheidungen. Und auch wenn man manchmal zufällig nur das erreicht, was man sich vorgenommen hat, fühlt man sich unter der Last der übriggebliebenen, noch nicht erfüllten Verlangen, weiterhin unglücklich. Ein Zufallstreffer ist dann höchstens ein Tropfen auf den heißen Stein. Übt man jedoch, sich mehr und mehr von seiner Begierde zu lösen, macht allein schon die Übung zufriedener. Alles, was sich daraus noch ergibt, sind netter Beifang und lehrreiche Lektionen.
Ein angenehmes Paradox
Dies ist ein Paradox, was es zu ergründen gilt: Gerade die bewusste Entscheidung, von vielen unserer Wünsche Abstand zu nehmen, macht uns zufriedener. Gerade im Beschluss, auf das, was wir wollen, zu verzichten, liegt die menschliche Freiheit. Vor Kurzem fragte mich Misha, ein sehr motivierter Zen-Lehrling: „Denkst du, dass Indien für mich ein gutes Urlaubsziel in diesem Sommer sein könnte?“ Das dachte ich nicht. Er war nämlich knapp bei Kasse. Als wir alternative Reisemöglichkeiten besprachen, kam er auf die Idee, wandern zu gehen. Er empfand es als eine schöne Herausforderung, die Distanz zwischen zwei Orten, in denen er in jenem Sommer an meinen Retreats teilnehmen würde (Barchem in den Niederlanden und Kibaek in Dänemark), zu Fuß zu laufen. Die Retreats fanden im zeitlichen Abstand von sechs Wochen statt. Er hatte ausgerechnet, dass er durchschnittlich fünfunddreißig Kilometer am Tag laufen müsste, was er als machbar einschätzte. Die wirkliche Herausforderung, so gab er an, läge darin, die Reise ohne einen einzigen Cent auszugeben abschließen zu können. Er nahm sich vor, die Reise als Bettelmönch zu unternehmen. Sobald er Hunger bekäme, würde er bei Leuten klingeln und sie über seine Wanderreise als Bettelmönch informieren. Bei dieser Gelegenheit würde er sie auch fragen, ob sie einen Schlafplatz und etwas zu essen für ihn hätten.
Gesagt, Getan. Es war eine außergewöhnlich lehrreiche Erfahrung für ihn. Er war an keinem Tag hungrig und immer, wenn er wollte, hatte er nachts ein Dach über dem Kopf. Auf Letzteres verzichtete er manchmal bewusst, da er bei schönem Wetter lieber draußen schlief. Als besonders bereichernd empfand er die Gespräche, die er mit den Menschen, denen er begegnete, führen konnte.
Seine Erlebnisse illustrieren treffend, wie es einem auch in der modernen Gesellschaft an nichts mangelt, wenn man sich bewusst dazu entscheidet, auf Dinge zu verzichten. Stärker noch, manchmal wird man unter dieser Prämisse sogar angenehm überrascht. So wird die bewusste Entscheidung, zu verzichten, eine reiche Quelle von Inspiration und Glück. Darin erkennen wir ein Paradox: Man entscheidet sich für Armut und erfährt Reichtum. Jemand, der auf die Zunahme seines Besitzes oder Vermögens fixiert ist, wird selten das genießen können, was er schon hat. Darum lernen wir im Zen, nicht alles zu wollen und genau das zu nehmen, was uns zufällt.