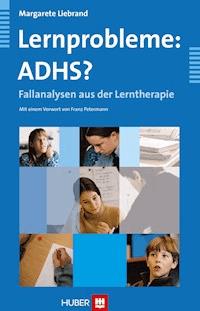
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kaum eine Störung, die Kinder und Jugendliche betrifft, hat in den letzten Jahren mehr Aufsehen erregt als ADHS. Weltweit sollen Millionen von Kindern unter Unaufmerksamkeit, Überaktivität und Impulsivität leiden. Doch gegenüber vorschnellen Schlüssen ist Vorsicht geboten. Nicht alles, was auffällt am Verhalten von Kindern, besonders wenn es um das Lernen geht, ist einzig dem Syndrom ADHS zuzuschreiben. Im Zentrum des Buches stehen zahlreiche Fallanalysen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2006
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Margarete Liebrand
Lernprobleme: ADHS?
Aus dem Programm Verlag Hans Huber:
Psychologie Sachbuch
Wissenschaftlicher Beirat:
Prof. Dr. Dieter Frey, München
Prof. Dr. Kurt Pawlik, Hamburg
Prof. Dr. Meinrad Perrez, Freiburg (CH)
Prof. Dr. Franz Petermann, Bremen
Prof. Dr. Hans Spada, Freiburg i. Br.
Zum Thema ADHS bei Kindern ist im Verlag Hans Huber außerdem erschienen:
Russel A. Barkley
Das große ADHS-Handbuch für Eltern
Verantwortung übernehmen für Kinder
mit Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität
Aus dem Englischen übersetzt von Matthias Wengenroth
Mit einem Geleitwort von Franz Petermann
453 Seiten (ISBN 3-456-84262-7)
Ulrike Schäfer
Tim Zippelzappel und Philipp Wippelwappel
Eine Geschichte für Kinder mit ADHS-Syndrom
61 Seiten (ISBN 3-456-83880-8)
Weitere Bücher zu ADHS bei Erwachsenen:
Doris Ryffel-Rawak
ADHS bei Frauen –
Den Gefühlen ausgeliefert
163 Seiten (ISBN 3-456-84382-8)
Doris Ryffel-Rawak
ADS bei Erwachsenen
Betroffene berichten aus ihrem Leben
Mit einem Geleitwort von Brigitte Woggon
144 Seiten (ISBN 3-456-83631-7)
Doris Ryffel-Rawak
Wir fühlen uns anders!
Wie betroffene Erwachsene mit ADS/ADHS sich selbst und ihre Partnerschaft erleben 147 Seiten (ISBN 3-456-83959-6)
Informationen über unsere Neuerscheinungen finden Sie im Internet unter: www.verlag-hanshuber.com
Margarete Liebrand
Lernprobleme: ADHS?
Fallanalysen aus der Lerntherapie
Mit einem Vorwort von Franz Petermann
Verlag Hans Huber
Adresse der Autorin:
Dr. phil. Margarete Liebrand
Nabweg 12
D-22393 Hamburg
Lektorat: Monika Eginger
Umschlag: Atelier Mühlberg, Basel
eBook-Herstellung und Auslieferung:
Brockhaus Commission, Kornwestheim
www.brocom.de
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Verlag Hans Huber
Hogrefe AG
Länggass-Strasse 76
CH-3000 Bern 9
Tel: 0041 (0)31 300 4500
Fax: 0041 (0)31 300 4593
© 2007 by Verlag Hans Huber, Bern
EPUB-ISBN: 978-3-456-74350-9
Danksagung
Bei einem Erarbeitungs- und Reflektionsprozess, der sich über Jahre erstreckt, ist es kaum möglich, alle Ideengeber, wichtigen Informationen und Anregungen, die sich in der Auseinandersetzung mit Werken vornehmlich aus der pädagogisch-psychologischen und neuropsychologischen Wissenschaft und Therapie ergaben, im einzelnen zu rekonstruieren. Die Kennzeichnung der wichtigsten Publikationen im Literaturverzeichnis mit einem Sternchen (*) soll stellvertretend die Literatur hervorheben, die meine Lern- und Arbeitsprozesse in besonderer Weise verdichtet und bereichert hat. Gleichzeitig möchte ich meinen Dank auf diese Weise zum Ausdruck bringen.
Um die Lesbarkeit des Buches zu verbessern, haben Verwandte und Freunde Entwürfe kommentiert und so wesentlich zu deren Weiterentwicklung beigetragen. Vor allem möchte ich mich bei Ingeborg Rischer und Gabriele Runge-Soppe für ihre Unterstützung herzlich bedanken.
Mein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Dietrich Rabenstein und Prof. Dr. Georg Rückriem. Ohne ihre konstruktive Kritik, ihre wertvollen Hinweise und ihre Mithilfe beim mühevollen Korrekturlesen wäre das Buch nicht das, was es ist.
Für die Gestaltung und redaktionelle Betreuung danke ich Frau Monika Eginger vom Huber Verlag. Sie hat nicht nur meine eigenwilligen Gestaltungswünsche ausgehalten, sondern sie hat es auch verstanden, mir in dem langen Prozess der Fertigstellung immer wieder Mut zu machen.
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Auffälligkeiten im Lernverhalten
Warum Fallanalysen?
Zum Aufbau des Buches
Teil 1: Fallanalysen
Zentrale Begriffe
Therapeutische Orientierungen
Orientierungsverhalten in sozialen Beziehungen
Kinder machen doch keine Verträge?
Von Holzstäben und Muggelsteinen, die helfen sollen, sich in der Zeit zu orientieren
Machtkämpfe und Wut, die verrauchen muss
Alles soll bleiben so wie immer
Psychisch wirksame Lenkung der Aufmerksamkeit durch Arbeitsmittel
Von Hexenbesen, Peitschen und Zügeln
Obelix und STOPP müssen sich scheiden lassen und bleiben dennoch zusammen
Von Kraftsäckchen und selbstgesägten Rechenstäben
Interaktions- und Lernprozesse, die Sinn vermitteln.
Das kann ich nicht, das will ich nicht und die Geschichte von Kann-Will-Nie
Wer bestimmt das Tempo der kleinen Schritte?
Das bitterernste Spiel mit dem Nein
Winzige Lernschritte, die sich wie im Puzzle zusammenfügen
Das überraschend starke Ich: Frieda will und kann hoch hinaus
Veränderungen im Verhalten als Gratwanderung zwischen Halt geben und verstören
Die zweifache Karla
Der Machtkampf mit der Uhr
Nicht reden, sondern handelnd Orientierung vorgeben
Aufmerksamkeitserziehung als psychologisches und didaktisches Problem
Wandernde Zahlen: Einfachen und schnellen Lösungen ist kaum zu trauen.
Nicht alle Zügel verhindern ein Vorwärtspreschen im Galopp
Aufmerksam handeln beim Sammeln und Jagen
Lernschwierigkeiten als Problem der Bildung von Interessen und Motiven
Übung macht den Meister: Eine Leseschwäche als Stärke bei Übungsaufgaben.
Gemeinsam Motive für geistige Anstrengungen entwickeln
Im Spiegel Motive suchen und entdecken
Durch Aufgaben motivieren
Zusammenhänge zwischen Entwicklungsprozessen und Rahmenbedingungen
Der Chef des linken Winkels
Ludwigs Kampf mit dem Wochenplan
Das Geheimnis der geilen Zahlenmauern: Zugänge durch differenzierte Auswahl und Vereinfachung
Wie kommen Fernseher, Computer und Kühlschrank in eine Höhle?
Teil 2: Grundlegende Gedanken zu den Fallanalysen
1. Zusammenhänge zwischen sozialen Rahmenbedingungen und Lernschwierigkeiten
2. Lernen und Aufmerksamkeit
3. Entwicklungsprozesse
4. Aufmerksamkeit und Aufgaben, die sich dem Kind stellen
5. Emotionen in Lern- und Entwicklungsprozessen
6. Lernmotive und Lernentwicklung
7. Resümee
Literatur
Personenverzeichnis
Sachwortverzeichnis
Vorwort
Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit der wechselseitigen Beeinflussung von Lernproblemen und der Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADS) beziehungsweise der Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS). Nach einer Einführung in mögliche Hintergründe dieser Beeinträchtigungen und Auffälligkeiten illustriert Margarete Liebrand einfühlsam und differenziert anhand von Fallbeispielen aus der Lerntherapie ihr über viele Jahre entwickeltes und erprobtes, praktisches Vorgehen im Rahmen der Förderung von lern- und verhaltensbeeinträchtigten Kindern. Aus dem Blickwinkel der Lerntherapie ist eine kritische Haltung gegenüber einer medikamentösen Behandlung von Kindern mit einer kombiniert auftretenden Lern- und Aufmerksamkeitsproblematik nachvollziehbar. Vielerorts wird heute allzu unkritisch eine medikamentöse Therapie empfohlen, ohne ausreichend die Lebenssituation, Motivationslage und Problemgeschichte des Kindes zu berücksichtigen.
Bei Kindern mit Lern- und Verhaltensproblemen kommt einer neuro-psychologischen Sichtweise eine bedeutsame Rolle zu, die von Margarete Liebrand durch Praxisbeispiele unterstrichen wird. Auf diesem Hintergrund können die spezifischen Lernvoraussetzungen eines Kindes, vor allem Stärken und Schwächen im Bereich der Wahrnehmung sowie im emotionalen und motivationalen Bereich, differenziert bewertet werden. Für die Förderung dieser Kinder wählt Margarete Liebrand vor allem einen lerntherapeutischen Ansatz, der die Aufmerksamkeitsproblematik in den Gesamtzusammenhang des Entwicklungs- und Lernprozesses einbettet. Sehr eindrucksvoll werden zum Beispiel die Inhalte und die Umsetzung eines Lernvertrages beschrieben, wodurch Lerntherapien von Anfang an gut strukturiert und eine eindeutige Kind-Therapeut-Beziehung gestaltet werden können.
Die anonymisierten Fallanalysen des Buches verdeutlichen die Leitgedanken einer Lerntherapie anhand ausgewählter Therapiesitzungen. Diese therapeutischen Leitgedanken vermitteln anhand von Einzelfällen den Leserinnen und Lesern eine gute Orientierung über das praktische Vorgehen. Auf diese Weise werden auch die allgemeinen Ziele der Lerntherapie verdeutlicht. So soll – allgemein formuliert – eine Lerntherapie einem Kind Handlungskompetenzen und Handlungssicherheit vermitteln, um ihm auf diese Weise Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Die fallbezogenen Ausführungen von Margarete Liebrand gliedern sich, optisch durch unterschiedliche Schrifttypen gekennzeichnet, in Fallschilderungen und therapeutische Kommentare. Den Leserinnen und Lesern fällt es damit leicht, zwischen den Therapiedokumenten und der Interpretation therapeutischer Prozesse zu unterscheiden.
Bei der Einordnung von Lern- und Verhaltensauffälligkeiten greift Margarete Liebrand auf moderne neuropsychologische Konzepte zurück, wobei ihre Erfahrungen einer langjährigen Praxis mit einfließen. Mit solchen Konzepten gelingt eine viel versprechende und zukunftsweisende Sichtweise der vieldiskutierten Aufmerksamkeitsproblematik von Kindern. Auf diese Weise werden die vorliegenden Ausführungen zweifellos dazu beitragen, die Arbeit mit Kindern und ihren Familien zu optimieren.
Bremen, im Mai 2006
Franz Petermann
Einleitung
Auffälligkeiten im Lernverhalten
Kaum eine Störung, die Kinder und Jugendliche betrifft, hat in den letzten Jahren mehr öffentliches Aufsehen erregt als das so genannte Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS). Es wird auch als ADHS bezeichnet, wenn zusätzlich auf hyperaktive Auffälligkeiten hingewiesen werden soll. Weltweit sollen Millionen von Kindern unter Unaufmerksamkeit, Überaktivität und Impulsivität leiden. Kinder, die sich kaum an Regeln zu halten vermögen, die sich durch provozierendes Verhalten in den Vordergrund drängen, die sprunghaft und impulsiv reagieren und Unruhe verbreiten, behindern sich selbst in ihrer Entwicklung und belasten Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer.
Nicht selten lässt der Umgang mit solchen Kindern Gefühle von Hilflosigkeit und Verzweiflung aufkommen. Eltern und Lehrer sehen sich gezwungen, um Hilfe und Unterstützung nachzusuchen. Vorsicht ist allerdings geboten bei Angeboten, die schnelle Lösungen versprechen und auf die Anwendung einfacher Methoden setzen. Schon allein deshalb, weil nicht alles, was am Verhalten von Kindern, besonders an ihrem Lernverhalten auffällt, einzig und allein dem Syndrom ADS/ADHS zuzuschreiben ist. Vor allem, weil viele der schnellen Lösungen ausschließlich auf Medikamente setzen anstatt auf eine begleitende Unterstützung und Hilfestellung der Kinder und ihrer Familien. Zu viele Fragen sind noch offen, zu viele Probleme noch ungeklärt, sowohl was die Zuordnung von Erscheinungsformen zu einem umschriebenen auffälligen Verhaltenskomplex, einem Syndrom, betrifft, als auch was die Therapie angeht.
In erster Linie betrifft das den Verhaltenskomplex, den man <Aufmerk-samkeitsstörungen> nennt. In den vielen Jahren meiner Arbeit als Lerntherapeutin mit Kindern, die Lernschwierigkeiten hatten, sind mir Zweifel gekommen, ob Aufmerksamkeitsstörungen tatsächlich zu Recht als eine weitere eigenständige Entwicklungsstörung betrachtet werden müssen, die der Reihe von Wahrnehmungsstörungen, Rechenstörungen, Lese- und Rechtschreibstörungen, sensorischen Integrationsstörungen und oppositionellen Verhaltensproblemen hinzuzufügen sind. Vor allem in medizinischen Diagnose-Leitfäden findet man oft Beschreibungen, in denen Kinder als rastlos, zerstreut, fahrig, drauflos stürmend und hektisch oder auch als träumerisch und selbstvergessen, als unstet und vergesslich charakterisiert werden. Kinder mit solchen und ähnlichen Symptomen kommen seit Jahren in meine Praxis. Auf Grund meiner Erfahrungen mit ihnen glaube ich nicht, dass solche Symptombeschreibungen eine ausreichende Grundlage bilden, um Kindern ein Aufrnerksamkeits-Defizit-Syndrom zu attestieren. Vor allen Dingen erscheint es mir jedoch äußerst problematisch, wenn die Orientierung an Symptomen die Grundlage für eine medikamentöse Behandlung bildet und wenn einzig auf diese Behandlungsmethode gesetzt wird. Besonders beunruhigt mich, dass noch gar nicht ausreichend geklärt ist, was unter Aufmerksamkeit zu verstehen ist, und dass dennoch unhinterfragt neurochemische Eingriffe in die kindliche Entwicklung vorgenommen werden. Je mehr ich mich mit diesem Problem auseinandersetze, umso stärker fehlt mir ein Bezugsrahmen für die Zuordnung von Symptomen zu Syndromen, mit dem derart gravierende Eingriffe legitimiert werden könnten. Zumal die Spätfolgen einer solchen medikamentösen Behandlung für die Entwicklung des kindlichen Gehirns noch völlig unbekannt und auch nicht ansatzweise erforscht worden sind.
Weitere Fragen ergeben sich, wenn man sich mit der Tendenz auseinandersetzt, Auffälligkeiten im Lernverhalten von Kindern, die als abwesend und flüchtig, impulsiv, planlos und unkontrolliert, manchmal auch als chaotisch umschrieben werden, ebenfalls vielfach auf Aufmerksamkeitsdefizite zurückzuführen. Auf diese Weise wird eine Unklarheit durch eine andere Unklarheit <ersetzt>. Es gibt bisher kaum Untersuchungen zur Klärung der Frage, welche Zusammenhänge zwischen dem Lernen und Aufmerksamkeitsprozessen existieren. Wie aber will man bei der Diagnose von Auffälligkeiten im Lernverhalten gravierende Fehleinschätzungen verhindern, wenn nicht einmal klare Abgrenzungskriterien für unterschiedliche Störungsbilder bekannt sind?
Auch der beobachtbare Eigensinn dieser Kinder, ihr aufbrausendes Gemüt oder ihre auffallende Antriebslosigkeit sowie das in bestimmten Situationen fehlende soziale Einfühlungsvermögen werden nicht selten auf mangelnde Aufmerksamkeit und auf hyperaktives Verhalten zurückgeführt, ohne dass nach einer Abgrenzung zwischen Aufmerksamkeits-problemen und emotionalen oder motivationalen Schwierigkeiten auch nur gefragt wird. Wie will man bei einer solchen Beliebigkeit in der Zuordnung von Symptomen zu Ursachen eine sinnvolle, hilfreiche und vertretbare Therapie entwickeln?
Die Hilflosigkeit in der Diagnose dessen, was eigentlich therapiert werden soll, schlägt sich auch darin nieder, dass in der biologisch orientierten medizinischen Literatur
• Anpassungsdefizite im Sozialverhalten,
• Lernprobleme,
• Auffälligkeiten in der Steuerung, Kontrolle und Umsetzung von eingeforderten altersentsprechenden Handlungen
• sowie Entwicklungsrückstände in der Regulierung und Bewertung der eigenen Bedürfnisse, Wahrnehmungen und Fähigkeiten
unterschiedslos zu einem einzigen Störungsbild zusammengefasst werden. Nicht nur Aufmerksamkeitsprozesse, auch die Wahrnehmung und ihre Verarbeitung, die Motivation, Emotionen oder soziale Rahmenbedingungen können sich günstig oder ungünstig auf Lernvorgänge auswirken. Diese Faktoren werden jedoch einfach ignoriert. Vertreter dieses Wissenschaftszweiges haben bis heute keine zufriedenstellende Antwort auf die Frage gegeben, was Entwicklungsdefizite von Lernproblemen oder Aufmerksamkeitsschwierigkeiten unterscheidet.
Wenn Kinder Schwierigkeiten haben, den Anforderungen zu entsprechen, mit denen sie sich konfrontiert sehen, dann reagieren sie darauf mit den ihnen möglichen Verhaltenweisen. Diese ergeben aber für sich genommen noch keine hinreichenden Anhaltspunkte für die dahinter stehenden Ursachen. Wenn Kinder Probleme haben, über einen längeren Zeitraum bei der Sache zu bleiben, dann kann der Anlass dafür eine innere Unruhe und eine fehlende Aufmerksamkeitsfokussierung sein. Zwingend ist dieser Zusammenhang jedoch nicht. Diese Symptome können auch bei emotionalen Problemen in Erscheinung treten, ohne dass dies gleich offensichtlich wird. Der Blick auf die Verhaltensauffälligkeiten allein gibt noch keinen schlüssigen Hinweis auf zugrunde liegende Ursachen, weder auf Aufmerksamkeitsprobleme noch darauf, dass negative oder bedrängende Gefühle abgewehrt werden sollen. Es ist also im Einzelfall erst einmal die Frage zu stellen, was zum beobachteten Mangel an Aufmerksamkeitsfokussierung führt und warum die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten, fehlt bzw. noch nicht ausgebildet worden ist.
Auffallend viele der von mir in Eingangsgesprächen befragten Eltern berichteten, dass insbesondere Jungen, die in der Schule und bei den Hausaufgaben kaum bei der Sache bleiben konnten und die zu vielen <Flüchtigkeitsfehlern> neigten, bei Computerspielen durchaus zu ausdauerndem Verhalten in der Lage waren. Über diese Beobachtung wird auch in der psychiatrischen Literatur berichtet (Döpfner/Frölich/Lehmkuhl 2000, S.l). Außerdem beherrschten sie mühelos die in ihren bevorzugten Spielen geforderten Wahrnehmungsaufgaben, die Reiz-Differenzierungsund Reiz-Selektionsleistungen erforderten. Ich führte Wahrnehmungstests mit diesen Kindern durch; in den meisten Fällen bestätigten die Ergebnisse den Eindruck der Eltern. Von medizinischer Seite war diesen Jungen jedoch ADS/ADHS attestiert worden.
Mir kamen Zweifel an der Berechtigung solcher Diagnosen, vor allem jedoch an der vorgeschlagenen Therapie. Diese Zweifel betreffen nicht den Anlass für diese Diagnosen. In einer von mir durchgeführten Prozessanalyse ergaben sich ebenfalls Hinweise auf Probleme in der Entwicklung von Kompetenzen, die Aufmerksamkeitsleistungen ermöglichen. Beispielsweise zeigte sich bei den Jungen ein Mangel an Fähigkeiten, bei bestimmten Aufgaben alle vorhandenen Informationen auszunutzen. Oder sie neigten dazu, das Problemlösungsverhalten auf ein Agieren zu beschränken, statt sich die Kenntnisse, über die sie zweifelsohne verfügten, als innere Schemata für die Bildung von Analogien oder für ein kontrollierendes Vergleichen dienlich zu machen. Ich halte es für eine Fehleinschätzung, diese Auffälligkeiten auf eine Schwäche in der Reizdifferenzierung und -Selektion zu reduzieren, wie dies von der biologisch orientierten medizinischen Seite geschieht. Meines Erachtens zeigten diese Jungen kaum Lücken in den Basisfunktionen der Reizdifferenzierung und Reizselektion. Wohl aber traten Probleme auf, wenn Aufmerksamkeitsleistungen gefordert waren, an denen kognitive Prozesse beteiligt waren.
Um die aufmerksame Bearbeitung von Aufgaben durchführen zu können, müssen Kinder nicht nur über Kompetenzen der Reizdifferenzierung und -Selektion verfügen, sondern auch über die Fähigkeit des Planens und des kontrollierenden Vergleichens. Die Jungen brauchen also beim Lernen vor allem eine Unterstützung im planenden und kontrollierenden Arbeitsverhalten und im Aufbau von Handlungsorientierungen, die strukturierende, planende und vergleichende Verhaltensstrategien beinhalten.
Um hinreichende Aufmerksamkeit von gestörter Aufmerksamkeit unterscheiden zu können, reicht es nicht aus, pauschal von der Aufmerksamkeit schlechthin zu sprechen. Wenn man Kindern wie diesen Jungen in ihrer speziellen Problematik gezielt weiterhelfen will, muss man zwischen verschiedenen Aufmerksamkeitsfunktionen unterscheiden. Nur den wenigsten Kindern mit Aufmerksamkeitsproblemen ist mit einer Medikamention geholfen, die an Problemstellen der Reizdifferenzierung und -Selektion sowie an der Impulsivität ansetzt.
Es kann daher nicht verwundern, dass die medikamentöse Behandlung von Störungsbildern, die als ADS/ADHS diagnostiziert wurden, von vielen Eltern, Lehrern, Psychologen und kritischen Ärzten als problematisch eingeschätzt wird. Zwar lässt sich nachweisen, dass der Einsatz von Medikamenten Auswirkungen auf einige der als auffällig empfundenen Reaktionsweisen der behandelten Kinder zeigt. Beim Einsatz von Psychopharmaka mit dem Wirkstoff Methylphenidat konnte eine Verringerung der motorischen Unruhe und der Impulsivität beobachtet werden. Die schulischen Leistungen verbesserten sich jedoch durchgehend nicht. Zu diesem Ergebnis kommen alle mir bekannten Untersuchungen (Barkley 1997, Walter 2001a).
Dass Eltern wie Lehrende nach Möglichkeiten einer wirksamen Ein-flussnahme auf die als gravierend empfundenen Störungen suchen, ist nicht nur verständlich, sondern auch im Sinne der betroffenen Kinder. Wenn aber eine Diskrepanz zwischen dem erwarteten Leistungsvermögen und den in der Schule erzielten Leistungen nicht selten pauschal mit dem Etikett ADS/ADHS versehen und ebenso pauschal mit einer Pharmako-therapie als der angeblich einzig wirksamen Maßnahme behandelt wird, dann bleibt mehr als fraglich, ob dieser Weg dem Wohle des Kindes dient.
Eine durch den Einsatz von Psychopharmaka erzielte Reduzierung des Störverhaltens der behandelten Kinder, die vor allem von Vorteil für die betroffenen Lehrer und Mitschüler ist, rechtfertigt die Medikamention noch nicht. Insbesondere entbehrt dieses therapeutische Vorgehen einer verantwortlich begründeten Legitimation, wenn sich der Lernerfolg der Kinder nicht verbessert und wenn die Langzeitfolgen dieser Behandlung für die Entwicklung des kindlichen Gehirns nicht abzuschätzen sind. Auch wenn betroffene Kinder und ihre Umwelt durch eine medikamentös erwirkte Verringerung der motorischen Unruhe und der Impulsivität sowie durch eine Verbesserung der Filterung von Reizen situativ entlastet werden können, so bleibt die offene Frage nach dem langfristigen Nutzen für den Lernerfolg der Kinder. Die situative Entlastung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass bisher keinerlei Beweise dafür erbracht wurden, dass die medikamentöse Behandlung die Handlungsbereitschaft der Kinder, die Schwierigkeiten haben, und ihre Fähigkeiten zur Aneignung von schulischen Kompetenzen positiv verändert hätte. Wenn Kinder Probleme in der Selbststeuerung und -regulation haben und wenn diese Schwierigkeiten insbesondere ihr Lernverhalten beeinträchtigen, dann brauchen sie eine Unterstützung, die sie befähigt, ihre Handlungsbereitschaft und ihre Fähigkeiten, sich schulische Kompetenzen anzueignen, individuell beeinflussen zu können. Wie das erreicht werden soll, wenn ihre Reaktionen durch Außeneinwirkung verlangsamt werden, ist ein Rätsel.
So bleibt fraglich, ob die als positiv herausgestellten Wirkungen einer medikamentösen Behandlung dieser Vielzahl an auffälligen Symptomen tatsächlich als Lösungen, Entwicklungen und hilfreiche Unterstützung für die Schaffung von Voraussetzungen für Lernfortschritte interpretiert werden dürfen. Vor allen Dingen aber bleibt zu fragen, ob diese Hilfestellung die erwünschte Selbststeuerung des Kindes auf den Weg zu bringen vermag.
Ein anderes Problem betrifft die vielen Auseinandersetzungen um die Frage, ob eine medizinische oder pädagogische oder psychologische Behandlung dieser Kinder alternativ oder in Kombination angezeigt ist, ob eine pädagogische Begleitung der in ihren Lernaktivitäten und in ihrem sozialen Verhalten auffälligen Kinder und Jugendlichen eine medikamentöse Behandlung einzuschließen hat oder nicht. Diese Debatten betrafen häufig die grundsätzliche Frage, ob Verhaltensauffälligkeiten biologisch verursacht sind oder sozial. Meines Erachtens muss es um mehr als um diese Fragestellung gehen. Wenn man den betroffenen Kindern weiterhelfen will, so sind die Bedingungen für eine optimale Entwicklung dieser Kinder in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung zu stellen. Hat man dieses Leitziel vor Augen, so muss man sich fragen, ob nicht gerade das verantwortliche Bemühen um die Unterstützung der kindlichen Entwicklung zunächst einmal die Akzeptanz der Auffälligkeiten voraussetzt, auch wenn es sich um nonkonforme Tendenzen handelt. Und geht es nicht darum, diese Akzeptanz der Nonkonformität vorausgesetzt, die Kinder darin zu unterstützen, die Suche nach Lösungen für ihre Selbststeuerungsprobleme in die eigene Hand zu nehmen?
Eine Lösung des Therapieproblems ist allerdings auch nicht darin zu suchen, Therapiekonzepte, die es immer schon gab, wie zum Beispiel die Verhaltenstherapie, der Aufmerksamkeitsproblematik einfach überzustülpen. Ich machte jedenfalls die Erfahrung, dass dieses Vorgehen besonders dann nicht hilfreich war, wenn Kinder keinen Sinn in den verhaltensregulierenden Maßnahmen für sich entdecken konnten. Wird die Hinwendung zu Erziehungspraktiken der Grenzsetzung und Reglementierung nicht hinterfragt vor dem Hintergrund der besonderen Problematik des jeweiligen Kindes und der spezifischen Situation seiner Familie, dann kann dies dazu führen, dass Kindern keine Luft zum Atmen bleibt, dass ihnen kein Raum gelassen wird für die Entwicklung von Eigenständigkeit, selbsttätig gelebter Produktivität, Kreativität und Phantasie.
Warum Fallanalysen?
Natürlich lassen sich die Anliegen, mit denen die Eltern und Kinder in eine lern therapeutische Praxis kommen, nicht einfach aufschieben bis alle offenen Fragen geklärt sind. Die Probleme, die sich mit den Stimmungsschwankungen, den Anpassungsschwierigkeiten und den Hindernissen in der Aktivierung und Selbstorganisation von alltagsrelevanten Routinetätigkeiten sowie der systematischen Bearbeitung von Lernaufgaben verbinden, machen therapeutische und erzieherische Entscheidungen notwendig, unabhängig davon, ob die Problematik bereits wissenschaftlich hinreichend durchdrungen ist.
Es ist nicht die primäre Aufgabe einer Therapeutin, Theoriearbeit zu betreiben oder empirische Studien durchzuführen, wohl aber, die eigene Arbeit theoretisch und methodisch zu begründen. Um meine anfänglichen Fragen und Bedenken klären zu können, habe ich damit begonnen, die Protokolle meiner therapeutischen Arbeit mit den Kindern, die mit der Diagnose ADS/ADHS zu mir kamen, zu durchdenken. Ich suchte auf pädagogischem und auf psychologischem Gebiet nach wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit dem Gegenstand der Aufmerksamkeit und mit dem Lernen auseinandersetzen, um meiner Reflexion einen Orientierungsrahmen geben zu können. Und ich begab mich auf die Suche nach Begründungen für ein lerntherapeutisches Vorgehen, die aus der Spezifik der Problematik, um die es geht, herzuleiten waren. In den Wissenschaftszweigen Pädagogik, Neuropsychologie und Pädagogische Psychologie fand ich Anhaltspunkte.
Solange es an einheitlichen wissenschaftlich abgesicherten Erklärungen und Konzepten mangelt, kommt dem Austausch von therapeutischen Erfahrungen erhöhte Bedeutung zu. Deshalb möchte ich die von mir gemachten Erfahrungen beim lösungsorientierten therapeutischen Handeln sowie meine Suche nach Begründungen für ein lerntherapeutisches Vorgehen zur Diskussion stellen und zwar anhand von Fallanalysen. Fallanalysen scheinen mir deshalb besonders geeignet für einen Erfahrungsaustausch, weil diese es ermöglichen, dem Leser das Verhalten des einzelnen Kindes und die auf das jeweilige Kind zugeschnittenen spezifischen therapeutischen Interventionen konkret vor Augen zu führen.
Da viele konkrete und vor allem typische Situationen vorgestellt werden, in die lernschwierige, unaufmerksame und unruhige Kinder im Lerngeschehen und im sozialen Miteinander geraten können, dürften sich für die Leser auch Anknüpfungspunkte zu den eigenen Erfahrungen ergeben. Das Erzählen von <Geschichten> hat den Vorteil, dass jeder mit dem, was vorgestellt wird, etwas verknüpfen kann. Denn es kann Berührungspunkte geben, Identifikationen können ermöglicht werden und Prozesse des therapeutischen Geschehens können Schritt für Schritt nachvollzogen werden.
Ein Erzählen von <Geschichten> hat allerdings auch Nachteile. Das Individuelle und Konkrete, das in den Vordergrund rückt, ist nicht ohne weiteres verallgemeinerbar. Was sich für Malte therapeutisch als hilfreich erwiesen hat, muss für Knut nicht unbedingt von Vorteil sein. Die Lernvoraussetzungen, Lerngeschichten und Lernumstände einzelner Kinder können höchst unterschiedlich sein. Und hinter dem auffälligen Verhalten, das mit Lern- und Aufmerksamkeitsproblemen in Verbindung gebracht wird, können komplexe Lern- und Entwicklungsprobleme stehen und vor allem vielfältige Probleme. Nicht zuletzt die umfangreiche Palette an Symptomen, die in den medizinischen Diagnose-Leitfäden zusammengetragen wurde, lässt dies erahnen.
Da individuelle Problemlösungen nicht umstandslos übertragbar sind, ist es nicht ratsam, sich darauf zu beschränken, nur <Geschichten> zu erzählen. Damit auch wirklich alle Leserinnen und Leser den individuellen therapeutischen Erfahrungen etwas für sich entnehmen können, müssen zumindest Möglichkeiten der Verallgemeinerung angeboten werden. Deshalb habe ich den Fallgeschichten analysierende Kommentare hinzugefügt. Es soll damit deutlich werden, dass sich das dargestellte lerntherapeutische Handeln an vorläufigen Annahmen über Lern- und Aufmerksamkeitsprobleme orientiert hat, dass diesem Handeln bestimmte Vorstellungen über hilfreiche methodische Vorgehensweisen zugrunde lagen und dass sich auch in den vielen Prozessabläufen nach und nach Fragestellungen zu den Zusammenhängen von Lern- und Aufmerksamkeitsproblemen entwickelt haben. Denn der lerntherapeutische Prozess gestaltete sich zwar als eine Art Pfadsuche, als eine prozessorientierte Analyse der individuellen Schwierigkeiten des jeweiligen Kindes und als ein Aufspüren von möglichen Bedingungszusammenhängen für diese individuellen Schwierigkeiten. Doch erfolgte diese Suche nicht voraussetzungslos. Ihr lagen bestimmte theoretische und methodische Orientierungen zugrunde, dies aber als eine Art Arbeitskonzept, an dem mit Hilfe der ausgewerteten Erfahrungen weitergearbeitet wurde.
Die in den Wissenschaftszweigen Pädagogik, Neuropsychologie und Pädagogische Psychologie entwickelten theoretischen und begrifflichen Anhaltspunkte eröffneten mir vor allem die Möglichkeit, die Entwicklung von Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit dem Lernen zu betrachten und damit dem beschriebenen Begriffswirrwarr entkommen zu können. Die Eltern und Kinder kommen zu mir mit dem Anliegen um Unterstützung bei Lernschwierigkeiten. Das Lernen ist also der zentrale Punkt, auf den wir uns zu beziehen haben. Ein solch eindeutiger Bezugspunkt ist für unsere gemeinsame Arbeit auch notwendig.
Zwar lassen sich Legasthenie- und Dyskalkulie-Probleme zuweilen noch eindeutig diagnostizieren. Doch wenn Aufmerksamkeitsprobleme und Dyskalkulie- oder Legasthenieprobleme einander verschärfen oder wenn, wie dies nicht selten vorkommt, Aufmerksamkeitsprobleme vor allen Dingen situationsspezifisch in schulischen Zusammenhängen Schwierigkeiten bereiten, in anderen dagegen sehr viel weniger ausgeprägt auftreten, so helfen häufig weder die medizinischen Diagnose-Leitfäden noch Testverfahren weiter, um differenzieren zu können, welche Problematik die jeweils andere in welcher Weise bedingt und welcher Faktor letztlich als maßgeblich für die auffälligen Schwierigkeiten einzuschätzen ist. Besondere Probleme bereitet dann die mangelnde begriffliche Präzision der Symptombeschreibungen in den Diagnose-Leitfäden. Lege ich allerdings den Lernbegriff als Orientierungsrahmen zugrunde, so ist es mir möglich, nicht nur Legasthenie-, Dyskalkulie- und Aufmerksamkeitsprobleme in einem Zusammenhang zu sehen, sondern auch Wahrnehmungs-, Motivations- und emotionale Schwierigkeiten. Außerdem ermöglicht mir die Orientierung am Lernbegriff, den Rückgriff auf bewährte therapeutische Konzepte aus der jeweiligen spezifischen Lernproblematik begründen und konzipieren zu können.
Darüber hinaus hat mir insbesondere die tätigkeitstheoretisch orientierte Pädagogische Psychologie und die neuere Hirnforschung eine Basis für die Begründung der dem therapeutischen Handeln zugrundeliegenden Leitvorstellungen geboten. Und in therapeutisch-methodischer Hinsicht fanden sich Orientierungsmöglichkeiten in der systemischen Familientherapie, in didaktischen Konzepten der pädagogischen Handlungsforschung, in psychomotorischen Konzepten, die auf neuropsycho-logischen Ergebnissen der Wahrnehmungsforschung beruhen sowie in verhaltenstherapeutischen Vorgehensweisen.
In diesem Buch soll also die Entwicklung von Problemlösungswegen so dargestellt werden, dass nachvollzogen werden kann, welche Überlegungen zu Lern- und Verhaltensschwierigkeiten und welche therapeutischen Vorgehensweisen als bedeutsam angesehen wurden und zum Erfolg des therapeutischen Handelns beigetragen zu haben scheinen. Das therapeutische Vorgehen wird begründet und die Analysekriterien werden offengelegt.
Damit dürfte auch deutlich geworden sein, dass dieses Buch nicht wie ein Rezeptbuch gelesen werden kann. Hinter dem auffälligen Verhalten, das mit Lern- und Aufmerksamkeitsproblemen in Verbindung gebracht wird, können komplexe Lern- und Entwicklungsprobleme stehen, die nicht mit Hilfe der Bereitstellung von Rezepten und dem Abarbeiten von Schemata in den Griff zu bekommen sind.
Die Fallanalysen zielen darauf ab, Eltern, Erzieher und Erzieherinnen, Lehrende, Kindertherapeuten und -therapeutinnen sowie Pädiater und Pädiaterinnen anzuregen, sich in die Probleme von Kindern mit Lernschwierigkeiten, von unruhigen und unaufmerksamen Kindern einzufühlen und einzudenken, diese Probleme in größere Zusammenhänge einzuordnen und sich selbst Anhaltspunkte für spezifische Problemlösungen zu erschließen. Es werden viele konkrete Situationen dargestellt und Handlungsmöglichkeiten beschrieben. Diese sollen Haltungen und Orientierungen wiedergeben und als solche auffordern, Übersetzungsarbeit für individuelle Problemlösungswege zu leisten.
In die dargestellten und analysierten Fallgeschichten der Jungen, die die fiktiven Namen Ferdi, Heiner, Jörg, Kim, Knut, Ludwig, Malte und Theo erhielten, und der Mädchen, denen die fiktiven Namen Beate, Frieda und Karla gegeben wurden, sind bestimmte Abschnitte der Lebens- und Therapiegeschichten von Kindern eingeflossen, mit denen ich im Laufe von mehr als zehn Jahren lerntherapeutisch gearbeitet habe. Die Namen und persönlichen Daten der Kinder und der Familien wurden so geändert, dass ihre Anonymität gesichert ist.
Mit nur einer Ausnahme kamen alle Kinder mit der medizinisch gestellten Diagnose von Aufmerksamkeits-Defizit-Störungen zu mir in die Praxis. Einige dieser Kinder fielen in der Schule durch ihre schwache Konzentrationsfähigkeit und ihr impulsives Arbeitsverhalten auf. Ein kleinerer Teil der Kinder zeigte darüber hinaus hyperaktive Auffälligkeiten. Alle Kinder hatten ausgeprägte Schulprobleme, die nicht selten verschärft wurden durch sogenannte Teilleistungsstörungen wie Legasthe-nie- und Dyskalkulie-Probleme. Im Verlauf der Lerntherapie stellte sich heraus, dass die Lernschwierigkeiten von drei dieser elf Kinder unter anderem auch durch Reizdifferenzierungs- und -Selektionsprobleme bedingt waren. In dieser Hinsicht war die Diagnose ADS/ADHS berechtigt. Um den Kindern bei der Verbesserung ihrer schulischen Leistungen helfen zu können, reichten jedoch auch bei ihnen therapeutische Maßnahmen, die ausschließlich an diesen Basisfunktionen der Aufmerksamkeit ansetzen, keinesfalls aus. Bei allen anderen Kindern, von denen die Rede sein wird, lag der Schwerpunkt ihrer Problematik nicht im Bereich der Reizdifferenzierung- und -Selektion. Die Diagnose von Aufmerksamkeits-Defizit-Störungen konnte bei ihnen in diesem Sinne also nicht bestätigt werden.
Zum Aufbau des Buches
Das Buch enthält zwei deutlich voneinander abgegrenzte Teile. Wer sich vor allen Dingen für die Fallbeschreibungen und für die Kommentare zu den Fallbeschreibungen interessiert, der kann sich auf den ersten Teil des Buches beschränken. Diesem habe ich eine kurze Lese-Orientierung vorangestellt. Denn um die Analysen der Fallgeschichten nachvollziehen und einordnen zu können, scheinen mir zumindest einige wenige Angaben erforderlich, die deutlich machen, welche Vorannahmen und Absichten dem therapeutischen Handeln und der Analyse zugrunde gelegen haben. Um die Fallanalysen und die Kommentare optisch unterscheidbar zu machen, wurden sie mit unterschiedlichen Schrifttypen dargestellt.
Im zweiten Teil des Buches werden die den Fallanalysen zugrunde liegenden impliziten Vorannahmen über Lern- und Aufmerksamkeitsprobleme, die die therapeutischen Vorgehensweisen begründet haben, theoretisch aufgearbeitet. Wissenschaftlich fundierte Argumente zum Zusammenhang von Lernen, Entwicklung und Aufmerksamkeit werden thesenartig zusammengefasst, um die theoretischen und methodischen Kriterien des therapeutischen Vorgehens offen zu legen. Über die theoretische und methodische Aufarbeitung soll der hier verhandelte Gegenstand selbst als ein sich entwickelnder vorgestellt werden. Diese Überlegungen sind für Leserinnen und Leser gedacht, die sich vertiefend mit der lerntherapeutischen Sicht von Entwicklungs-, Lern- und Aufmerksamkeitsprozessen auseinandersetzen wollen.
Es war nicht meine Absicht, den Ablauf der lern therapeutischen Sitzungen vollständig und in chronologischer Folge abzubilden. Mir ging es vielmehr darum, typische Situationen vorzustellen und zu analysieren, in die lernschwierige, unruhige und unaufmerksame Kinder bei der Konfrontation mit fremdgestellten Aufgaben und im sozialen Miteinander geraten können. Deshalb werden Ausschnitte ausgewählter lern therapeutischer Sitzungen wiedergegeben und Resultate therapeutischer Interventionen beschrieben. Auf diese Weise können Leserinnen und Leser bestimmten Gesprächsabläufen zwischen der Therapeutin und den Kindern, die zur Therapie kamen, sowie ausgewählten Therapieabläufen folgen und anhand der eingefügten Kommentare nachvollziehen, wie sich das Therapiegeschehen aus lerntherapeutischer Sicht verstehen lässt.
Die Anordnung der im ersten Teil des Buches dargestellten Fallanalysen orientiert sich an bestimmten therapeutischen Leitgedanken. Die Orientierung an diesen Ideen hat sich in meiner langjährigen Arbeit als sehr viel hilfreicher erwiesen als die Orientierung an Begriffen wie Unruhe, fehlende Aufmerksamkeit, Reizfilterschwäche oder an ähnlichen Defizit -Zuschreibungen, die in der medizinischen Diagnosepraxis üblich sind. Diese Leitgedanken sind das konzentrierte Fazit meiner reflektierten Erfahrungen in der lerntherapeutischen Arbeit mit Kindern und in den Gesprächen mit ihren Eltern. Jedem therapeutischen Leitgedanken sind mehrere Fallanalysen zugeordnet.
Damit die Leserinnen und Leser sich vorab orientieren können und in die Lage versetzt werden nachzuvollziehen, welche Erfahrungen und Fragestellungen den therapeutischen Leitgedanken zugrunde liegen, werden diese Ideen und die Fragestellungen hier kurz umrissen.
1. Orientierungsverhalten in sozialen Beziehungen
Zu diesem Leitgedanken hat mich die Erfahrung geführt, dass viele der diagnostizierten hektischen Verhaltensformen aus mangelnder Verhaltenssicherheit resultieren. Wenn Kinder, die mit einer ungewöhnlich großen Offenheit auf die Welt kommen, eine für sie nur unzureichende Strukturierung des Alltagsgeschehen erfahren und wenn die Erfahrung sozialer Grenzen sie nicht zu stabilisieren vermag, dann reagieren sie darauf mit Verhaltensweisen, in denen sie ihre Überforderung zum Ausdruck bringen.
In den Fallanalysen, die diesem Leitgedanken zugeordnet wurden, geht es um die Frage, wie Orientierungen handgreiflich vermittelbar sind. Ferner wird gefragt, wie Orientierungen durch Sicherheit von außen stabilisierbar sind. Grenzen geben Halt und Sicherheit. Deshalb werden in diesen Kapiteln auch mögliche Wege der Grenzsetzung aufgezeigt. Dabei soll deutlich werden, dass Grenzsetzungen vor allen Dingen der Beachtung der Grenzen des Kindes bedürfen und sich in einem ausgewogenen Verhältnis von Abgrenzungen und Verhandlungen zu vollziehen haben.
Therapeutisches Handeln, das sich anschickt, in eingefahrene Bahnen einzugreifen, um über wohl überlegte und dosierte Interventionen Erwartungsmuster ver-rücken und Wege für Veränderungen ebnen zu können, ist Beziehungsgestaltung. Beziehungen lassen sich nur gestalten auf der Grundlage von gegenseitigem Vertrauen. Insofern befassen sich diese Kapitel darüber hinaus mit dem Thema der Grundvoraussetzung therapeutischen Handelns, mit der Frage, wie sich Vertrauen erarbeiten lässt. Denn Vertrauen setzt stabile Orientierung voraus.
2. Psychisch wirksame Lenkung von Aufmerksamkeitsprozessen durch Arbeitsmittel
Eine meiner wichtigen Erfahrungen war, dass die Kinder, die Schwierigkeiten hatten, ihr Lernen zu organisieren, selbst nach geeigneten <Werk-zeugen> suchten, um ihre fehlenden oder noch wenig ausgeprägten Kompetenzen absichern zu können. Einige Kinder brachten regelmäßig Kuscheltiere mit zur Therapiestunde, die auf uns aufpassen sollten. Andere Kinder forderten Rituale ein, die sich stets in der gleichen Weise zu wiederholen hatten. Die zugehörigen Fallanalysen behandeln die Frage, wie Arbeitsmittel beschaffen und eingesetzt werden müssen, um eine im psychischen Erleben des Kindes sich wirksam manifestierende Lenkung von Aufmerksamkeitsprozessen gewährleisten zu können. Im Zentrum der analysierten Fallberichte steht nicht nur die Überlegung, welche Möglichkeiten es gibt, um Aufmerksamkeit über bestimmte Arbeitsmittel lenken zu können. Es wird auch analysiert, wie diese Arbeitsmittel psychisch wirksam werden können, indem sie Interesse wecken und indem sie zum persönlichen Besitz eines Kindes werden. Und schließlich findet eine Auseinandersetzung mit dem vorhandenen Wissen über die Entwicklung von Aufmerksamkeit statt. Diese Auseinandersetzung soll klären helfen, wie sich die Aufmerksamkeit auch wirklich auf das lenken lässt, was gelernt werden soll.
3. Interaktions- und Lernprozesse, die Sinn vermitteln
In der lerntherapeutischen Arbeit wurde ich besonders gefordert, in der Zusammenarbeit mit den Kindern um eine gemeinsame Sprache zu ringen. Kinder, die durch immer wieder zu verkraftende Misserfolge in ihrem Selbstbewusstsein belastet waren, neigten oft dazu, kleine Schritte, die sie erreicht hatten, zu ignorieren oder kleinzumachen, ohne innere Beteiligung nur kurz zu registrieren oder das Bewältigte hochzujubeln, um der Auseinandersetzung mit den Lerninhalten schnell aus dem Wege zu gehen. Ihr Problemverhalten konnte erst dann pädagogischen Orientierungs- und Strukturierungshilfen zugänglich gemacht werden, wenn es uns gelang, einander nicht nur zu <verstehen>, sondern unsere Gefühle zu teilen. Dem Leitgedanken, dass Lernen Sinn zu vermitteln hat, sind Fallanalysen zugeordnet, die sich auf die These beziehen, dass Emotionen, verstanden als Bewertungsprozesse, die Sinn signalisieren, beim Lernen eine wichtige Rolle spielen. Infolgedessen wird die Kommunikation von Gefühlen als ein wesentlicher Bestandteil der lerntherapeutischen Unterstützung von Kindern angesehen. Es wird gefragt, welche kindgemäßen Gestaltungsmöglichkeiten geeignete Rahmenbedingungen für Erfolgslernen schaffen können. Es wird darüber hinaus die Frage gestellt, welche Formen der emotionalen Unterstützung Kindern helfen können, einen Sinn für sich darin zu entdecken, ihre eigenen Ressourcen für Problemlösungen zu nutzen.
4. Gratwanderung zwischen Halt geben und verstören
Besonders intensiv beschäftigt haben mich Erfahrungen mit Interventionen, die Kinder einerseits stabilisieren und sie andererseits herausfordern sollen, sich ihren übernommenen und zur Disposition stehenden <Anlagen> und vorgefundenen Verhältnissen nicht passiv zu überlassen. Viele Kinder mussten erst einmal entdecken, dass sie innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen entscheiden können, wozu sie ihre Potentiale benutzen wollen. Und ich musste lernen, stabilisierende Unterstützungen so zu gestalten, dass Raum für Herausforderungen offen blieb. Ich musste den passenden Zeitpunkt für Herausforderungen erfassen und das Maß an herausfordernden «Ver-Störungen» (Maturana/Varela) individuell angemessen dosieren. Außerdem musste ich besonders sorgsam auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen irritierenden und stabilisierenden Interventionen achten.
In den diesem Leitgedanken zugeordneten Fallanalysen geht es um Erfahrungen in sozialen Zusammenhängen, die Kindern helfen, sich sicher zu orientieren in den Dingen, die sie umgeben, mit den Menschen, die ihnen begegnen, in dem durch Raum und Zeit strukturierten Umfeld, das ihr Verhalten prägt. Es geht auch um Prozesse, die es ihnen möglich machen, sich neuen Aufgaben zu stellen, sich auf Unwägbarkeiten einzulassen, alte Gewohnheiten in Frage zu stellen in einem Rahmen, der Halt, Struktur und Sicherheit zu vermitteln vermag.
5. Aufmerksamkeitserziehung als ein psychologisches und als ein didaktisches Problem
Eine für den Erfolg der Therapie zentrale Einsicht war es, dass didaktische Strategien einen entscheidenden Stellenwert haben können. Fallanalysen, die diese Einsicht zum Thema haben, setzen sich mit der Frage der Aufmerksamkeitserziehung als ein psychologisches und als ein didaktisches Problem auseinander. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Frage, wie sich die Aufmerksamkeit von Kindern so fesseln lässt, dass sie innerlich mit dem Gegenstand, auf den ihre Aufmerksamkeit gerichtet ist, beschäftigt sind. Außerdem wird die Frage der didaktischen Aufbereitung von Aufgaben behandelt. Dabei geht es um Aufgaben, die gewährleisten sollen, dass sich Kinder die Entwicklung eines Aufmerksamkeitsverhaltens, das an kognitive Leistungen wie an ein planvolles Vorgehen und an ein selbständiges Arbeiten geknüpft ist, selbst zum Lerngegenstand machen.
6. Entwicklung von Aufmerksamkeit, die geistige Anstrengungen erfordert
Eine der für mich faszinierendsten Erfahrungen war, wie Interessen, Emotionen und Motive geistige Anstrengungen und die Ausbildung von Kontroll-Aufmerksamkeit beeinflussen. Dieser Thematik werden daher weitere Fallanalysen zugeordnet, in denen gezeigt wird, wie Erzieher und Therapeuten auf die Entwicklung von Interessen und Motiven Einfluss nehmen können. Dabei soll deutlich werden, dass es bei Interessens- und Motivationsproblemen letztlich immer um Schwierigkeiten geht, die Kinder damit haben, dass sie etwas tun sollen, was als von außen kommende Anforderung an sie herangetragen wird. Sie sollen sich mit etwas auseinandersetzen, was andere von ihnen verlangen. Die in der medizinischen Literatur vertretene These, dass Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen sich ganz besonders schwer tun, fremdgestellte Anforderungen zu erfüllen, wird bei diesen Fallanalysen als Frage nach der Bedeutung der Motivationserziehung für die Entwicklung der Aufmerksamkeit behandelt. Im Rahmen von Schule wird davon ausgegangen, dass sich die Motivationserziehung auf die Ausbildung von Motiven richtet, die geistige Anstrengungen und bewusst gesteuerte, dauerhaft aufrecht erhaltene Aufmerksamkeitsprozesse veranlassen.
7. Zusammenhänge zwischen Entwicklungsprozessen und Rahmenbedingungen
Bei nicht wenigen Kindern traten Lernprobleme auf oder verschärften sich Lernschwierigkeiten, weil die schulischen Lernbedingungen für sie und ihre entwicklungsbedingt momentanen Lernmöglichkeiten nicht <passend> waren. Oder sie sahen sich gesellschaftlichen Lernanforderungen gegenüber, denen sie aufgrund ihrer Lerngeschichte und der Bedingungen, unter denen sie die sie prägenden Lernerfahrungen gemacht hatten, nicht entsprechen konnten.
Daher befassen sich weitere Fallanalysen mit den Zusammenhängen zwischen gesellschaftlichen, schulischen sowie therapeutischen Rahmenbedingungen und den Entwicklungsprozessen beim Lernen. In diesen Analysen wird die Frage nach den Auswirkungen von bestimmten Rahmenbedingungen auf die Ausbildung von Interessen und Motiven, die Ausrichtung von Wahrnehmungen und das Erlernen von kontrollierter Aufmerksamkeit gestellt.
Teil 1: Fallanalysen
Da die Fallgeschichten immer von Analysen begleitet sind, ist es notwendig, vorab offenzulegen, welche Orientierungen zum Verständnis von Lernen und Aufmerksamkeit die lerntherapeutische Arbeit geprägt haben und welche Vorannahmen und Absichten den Analysen zugrunde liegen.
Zentrale Begriffe
Ich verstehe menschliches Lernen vor allem als zielgerichtete und motivierte und das heißt im Wesentlichen bewusst organisierte und gesteuerte Aktivität.
Lernen setzt einen wachen Kopf voraus, der zur Aufnahme von Informationen in der Lage ist. Um aufnehmen zu können, müssen innere «Scheinwerfer» (Posner) nach außen ausgefahren werden. Dieser Zustand wird mit Wachheit umschrieben. Er gewährleistet eine Reaktionsbereitschaft und bewirkt, dass die Aufmerksamkeit auf Hinweis-Reize hin kurzfristig aktiviert werden kann. Es handelt sich um eine Grundfunktion von Aufmerksamkeitsprozessen. Wach zu sein, die Welt um uns herum wahrzunehmen, sind Vorgänge, die quasi automatisch, ohne jede Anstrengung abzulaufen scheinen. Doch dieser Eindruck trügt, er trifft nicht die ganze Wahrheit. Um etwas aufnehmen zu können, müssen innere Scheinwerfer nicht nur ausgefahren, sondern aktiv ausgerichtet werden, von bestimmten Dingen weg, auf andere Ereignisse bzw. Informationen hin gelenkt werden.
Unser Gehirn kann unmöglich alle Reize, alle Stimuli, mit denen es konfrontiert wird, verarbeiten. Es muss aus den vielen uns erreichenden Reizen bestimmte auswählen und bevorzugt verarbeiten. Diesen Prozess nennt man ebenfalls Aufmerksamkeit und zwar selektive Aufmerksamkeit. Diese hat die Funktion eines Filters, der wichtige von unwichtigen Reizen trennt. Aus der Neuropsychologie weiß man inzwischen, dass dieser Vorgang nur zustande kommt, wenn nicht nur wahrgenommen wird, sondern wenn die Wahrnehmung auf etwas Bestimmtes ausgerichtet wird (Spitzer 2002).
Das zeigt, wie eng Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsvorgänge in bestimmten Funktionsbereichen miteinander verknüpft sind. Der Mensch, der seine Wahrnehmung auf einen ausgewählten Ausschnitt dessen, was seine Sinne erregt, ausrichtet, verhält sich aufmerksam.
Wenn der Mensch seine Aufmerksamkeit ausrichtet, indem er sich einem bestimmten Gegenstand der Wahrnehmung zuwendet, dann ist er aktiv an diesem Vorgang beteiligt. Eine zielgerichtet spezifisch ausgerichtete Aktivität zeigt er allerdings nur in dem Maße, wie diese bestimmten Gegenstände sich als sinnstiftend für ihn erweisen. Es ist gelungen, diese Aktivität neurobiologisch zu messen. Mit Hilfe funktioneller Bild-gebungsverfahren kann man nachweisen, dass und wie stark gerade diejenigen neuronalen Strukturen und Areale aktiviert werden, die für die Verarbeitung von Ausschnitten aus der Vielzahl der aus der Außenwelt einströmenden Stimuli zuständig sind, auf die die Aufmerksamkeit gerichtet wurde (Spitzer 2002).
Dieser aktive Prozess ist nicht nur mit Wahrnehmungsaufgaben verknüpft, er beinhaltet auch eine motorische Komponente.
Um schauen zu können, muss man hin-schauen. Das bedeutet, man muss die Blickrichtung steuern, die Augen ausrichten. Voraussetzung für ein aktives Betrachten ist die Wahrnehmungskompetenz der Blicksteuerung. Nicht bei allen Kindern ist diese Wahrnehmungskompetenz altersgemäß entwickelt.
Eventuell muss man nicht nur den Blick steuern können, um etwas gezielt betrachten zu können, sondern auch den Körper dem Gegenstand zuwenden, den man in den Blick nehmen will. Auch das ist ein aktiver Prozess. Gezielt eine bestimmte Körperhaltung über einen längeren Zeitraum einzunehmen, gelingt nur, wenn auch eine gewisse Körperspannung und ein Körperempfinden vorhanden sind. Diese Funktionen entwickeln sich ebenfalls nicht immer bei allen Kindern altersgemäß.
Es können sich Lernschwierigkeiten in unterschiedlichen Bereichen einstellen: In der Orientierung, die durch gesteigerte Wachheit und Aktivierung ermöglicht wird, bei der Auswahl von Reizen, die mit Aufmerksamkeit bedacht werden, weil sie neuartig und mit Wichtigkeit belegt sind, bei Wahrnehmungsvorgängen oder in der Motorik.
Aktivität kann reflexhaftes, automatisiertes, reaktives Verhalten beinhalten oder zielgerichtetes, bewusstes Verhalten. Wir Menschen zeigen die ganze Palette dieser Verhaltensformen.
Damit sich menschliche Aktivität in bestimmte Richtungen bewegen kann, damit der Mensch bestimmte Ziele verfolgen kann, braucht er einen sozialen Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens wird die Orientierung gelenkt, werden soziale Ziele vorgegeben. Das schafft die notwendige Sicherheit für Kinder, um aufwachsen zu können. Wenn es jedoch richtig ist, dass wir uns orientieren, indem wir die Außenwelt in uns hineinnehmen, dann haben wir uns auch immer mit Aspekten von Fremdbestimmung auseinander zu setzen. Das macht Abstimmungsprozesse erforderlich. Abstimmungsprozesse und die Verarbeitung von Einflüssen, die von außen kommen, können emotionale Schwierigkeiten bereiten. Es können sich Motivkonflikte einstellen, die Motiventwicklung kann stagnieren oder es kann zu Verzögerungen in der Aneignung sozialer Kompetenzen kommen. Diese Entwicklungsprobleme können sich in Verhaltensproblemen und auch in Lernschwierigkeiten niederschlagen. Es ist also angebracht, genau hinzuschauen, welche Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten auf weiche Probleme verweisen könnten. Nicht alle Auffälligkeiten im Verhalten und beim Lernen sind auf Aufmerksamkeitsprobleme zurückzuführen.
Wir lernen mit anderen Menschen und im «Spiegel» anderer Menschen (Stern). Wir lernen an natürlichen Gegenständen und an Kulturgütern unsere Empfindungen zu schärfen und unsere Wahrnehmungsvorgänge zu entwickeln. Wir erproben an diesen Gegenständen und mit der Unterstützung und der Rückmeldung durch andere Menschen unseren Körper. Wir erlernen Kulturtechniken in sozialen Zusammenhängen. Sowohl die Prozesse der Aufmerksamkeitszuwendung, die durch Wachheit und Auswahl Orientierungen ermöglichen, als auch die sogenannte Kontroll-Aufmerksamkeit, die mit komplexen kognitiven Leistungen verknüpft ist, unterliegen der sozialen Beeinflussung. Um sich orientieren zu lernen, muss sich ein Kind seines Platzes im sozialen Umfeld sicher sein können. Es muss eine Orientierung und Steuerung durch Erwachsene erfahren, die ihm hilft, sich seiner selbst bewusst zu werden und Selbstsicherheit zu erlangen. Auch das Umfeld ist ein entscheidender Faktor, der sich auf Lernprozesse günstig oder ungünstig auswirken kann.
Für das Erlernen der Kontroll-Aufmerksamkeit hat sich das soziale Umfeld in dem Sinne als förderlich zu erweisen, dass es Kinder herausfordert, sich weiter zu entwickeln. Kinder müssen mit geeigneten Aufgaben konfrontiert werden, um ihre Empfindungen schärfen zu können, um die Feinheit und Genauigkeit ihrer Sinnesorgane auszubilden und um ihre Wahrnehmungen und ihren Körper steuern zu lernen. Denn um Kontroll-Aufmerksamkeit ausüben zu können, ist die bewusste Konzentration auf die Wahrnehmung und Regulierung der wesentlichen Merkmale dessen, was zu kontrollieren ist, notwendig. Die Kontroll-Aufmerksamkeit beinhaltet darüber hinaus Prozesse eines verinnerlichten Planens und Vergleichens von Handlungsvollzügen, die notwendig sind, um Aufgaben bearbeiten und Fehler vermeiden zu können. Das sind geistige Anstrengungen, die erbracht werden müssen, um abstrakte Dinge erlernen zu können, Dinge, die nicht über unmittelbare Erfahrungen erfassbar sind. Kinder erlernen die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um Leistungen der Kontroll-Aufmerksamkeit erbringen zu können, über Aufgaben, die ihnen gestellt werden.
Welche Vorstellungen sich Kinder von den ihnen gestellten Aufgaben und von der Art und Weise ihrer Bearbeitung machen, hängt von vielen Faktoren ab, die vor allem die kognitive Entwicklung der Kinder betreffen. Vorstellungen entwickeln sich in Abhängigkeit vom Wissen, das die Umwelt zur Verfügung stellen muss, vom Denken, das sich entwickeln muss, von den Motiven, die Lernen veranlassen und von Emotionen, die diese Prozesse begleiten und die die Erfahrungen, die gemacht werden, bewerten und prägen. Es bedarf also vieler und komplizierter Prozesse, damit sich Kontroll-Aufmerksamkeit entwickeln kann. Entsprechend vielfältig können die Ursachen sein, wenn sich Probleme in diesen Prozessen des Aufbaus von Kontroll-Aufmerksamkeit einstellen. Sie lassen sich keinesfalls auf Schwierigkeiten in der Reizdifferenzierung und -Selektion reduzieren.
Bereits diese grundlegenden Erkenntnisse lassen sich in diagnostisches und therapeutisches Handeln und in pädagogische Aufgaben umsetzen.
Therapeutische Orientierungen
Therapieziele
Verhalten wird in einem langen Prozess gelernt, der sich aus unzähligen Mosaiksteinchen zusammensetzt. In pädagogisch-psychologischen Therapieprozessen geht es darum, diese Mosaiksteinchen in der Weise ordnen zu helfen, dass neue Bilder entstehen, die sich Kinder als Werkzeuge nutzbar machen können. Die Ziele dieser Neuordnungsprozesse liegen darin, Kindern sichere Orientierungen zu vermitteln, ihnen Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen und sie darin zu unterstützen, Handlungskompetenzen und Handlungssicherheit zu entwickeln. Die Kinder sollen sich über hilfreiche Maßnahmen befähigen, ihr Spektrum an Bewältigungsstrategien für Selbststeuerungsprozesse zu erweitern und Motive für geistige Anstrengungen auszubilden. Aufgaben, die von außen an sie herangetragen werden, sollen ihnen in einer Weise vermittelt werden, die es ihnen ermöglicht, sich darin wiederzufinden, damit sie ihre Entwicklungs- und Lernaufgaben wahrnehmen können.
Aufmerksamkeit und Lernen
Ein Kind entwickelt sich, indem es lernt. Lernen setzt voraus, dass man sich aufmerksam verhält. Das bedeutet: Das Kind wendet sich einer Sache neugierig und aufgeschlossen zu, es bleibt interessiert über einen längeren Zeitraum bei dieser Sache und unterdrückt andere als die mit der Sache zusammenhängenden Bedürfnisse, um begonnene Handlungen zu Ende führen zu können. Jedoch nicht nur Aufmerksamkeitsleistungen entscheiden darüber, wie sich Lernprozesse vollziehen. Auch Wahrnehmungsprozesse, Motivation und Emotionen sind wesentliche Faktoren, die Lernprozesse günstig oder ungünstig beeinflussen. Wer Lernschwierigkeiten verstehen will, kommt nicht umhin, sich mit diesen grundlegenden Aspekten des Lernens auseinander zu setzen.
Aufmerksamkeitsprobleme kann man ohne eine differenzierte Vorstellung vom kindlichen Entwicklungsgeschehen nicht verstehen. Deshalb orientieren sich die hier vorgestellten Wege des therapeutischen Handelns an Vorstellungen von einer Entwicklung, die Lernprozesse im Zusammenhang sehen mit Prozessen der Wahrnehmung, der Aufmerksamkeit, der Motivation und mit emotionalen Prozessen. Dies allerdings in einem sehr spezifischen Verständnis, das im Folgenden kurz beschrieben wird.
Lernen als System
Die in den Fallgeschichten rekonstruierte therapeutische Arbeit erfolgte nicht im Sinne einer additiven Aneinanderreihung von Bausteinen, die einzelne Lernfaktoren betreffen, wie Körperarbeit, Wahrnehmungstraining, Beziehungsarbeit, Verhaltenstraining und speziell didaktisch aufbereitete Wissensvermittlung. Sie orientierte sich vielmehr an theoretischen Vorannahmen und empirischen Ergebnissen zur Entwicklung von Kindern, zum Zusammenhang von Lernen und Aufmerksamkeit und zur Ausbildung von Fähigkeiten, die sich unter dem Einfluss von Faktoren wie Wahrnehmen und Empfinden, Aufmerksamkeit, Emotionen und Motive vollzieht. Der therapeutische Prozess wurde auch getragen von einer Haltung und Zuwendung, die darauf gerichtet war, flexibel bestimmte Situationen zu nutzen, in denen die vom Kind ausgehenden Impulse aufgenommen und in begründetes therapeutisches Handeln umgesetzt wurden.
Anknüpfung an schulbezogene Inhalte
Die Arbeit am Körper-Selbstbild über Bewegungs-Kontrolle oder das Training von bestimmten Verfahren, die Steuerung von Handlungen bzw. die Lenkung von geistiger Auseinandersetzung wurden durch Verhaltensangebote von Seiten des Kindes initiiert, therapeutisch weitergeführt und immer verknüpft mit dem Ziel, Transfermöglichkeiten für die schulbezogene Arbeit herzustellen. Die Erfahrungen in der Arbeit mit Schulkindern zeigten, dass diese an schulbezogenen Inhalten arbeiten und sich durch diese herausgefordert sehen wollten. Dem wurde in therapeutischen Prozessen Rechnung getragen.
Anknüpfung an vorhandene Kompetenzen
Um Kindern mit Lernproblemen hilfreiche Unterstützungsangebote machen zu können, muss man sie dort abholen, wo sie stehen. Deshalb setzte die lerntherapeutische Arbeit stets an solchen Handlungen des Kindes an, die es ausführte, um mit der Therapeutin, den Eltern, Mitschülern und Lehrern in Kontakt zu treten bzw. auf sie zu reagieren. Außerdem lag der Ansatzpunkt der Arbeit bei den vorhandenen oder fehlenden Kompetenzen, die dem Kind Handlungssicherheit zu geben oder nicht zu geben vermochten und bei den Zielen und Motiven, die das Kind manchmal, aber nicht immer ersichtlich mit diesen Handlungen verknüpfte.
Gemeinsame Verantwortung
Die Kinder und Eltern bestimmten gemeinsam mit der Therapeutin im therapeutischen Prozess auch die Ziele, die in der Aneignung von Handlungssicherheit und -kompetenz, in der Wissensaneignung und in der Beherrschung von Verhaltensweisen, von Vorgehensweisen beim Lernen und von Lerntechniken anzustreben waren. Zielvorstellungen sollten von allen Beteiligten – also ausdrücklich auch von den Kindern selbst – als Wünsche akzeptiert werden, die berechtigte und wichtige Orientierungen für die Therapie darstellen. Das Respektieren unterschiedlicher Wünsche war oftmals mit einem Lernprozess sowohl für die Eltern wie für die betroffenen Kinder verbunden. Besonderes Augenmerk wurde im Therapieverlauf einer Auseinandersetzung gewidmet, der sich alle Beteiligten zu stellen hatten: Beim Versuch, Schwierigkeiten zu überwinden, ging es darum, zu bestimmen, was es für das Kind und seine Familie bedeuten könnte, den Weg dahin als ein konkretes Ziel vor Augen zu haben.
Das Prinzip der kleinen realistischen Schritte
Um vor allen Dingen weitere leidvolle Erfahrungen mit Misserfolgen möglichst kleinhalten zu können, orientierte ich mich in der Lerntherapie an dem Prinzip der kleinen Schritte. Kleine Schritte müssen ohne fixe, vorab definierte und unumstößliche Zielgrößen auskommen. Wünschenswerte Ziele sollen von den Betroffenen als erreichbar empfunden und formuliert werden. Sie sollen den Beginn von realisierbaren Veränderungen markieren. Und sie sollen an die Probleme des Kindes und an die spezielle Situation in der Schule und in der Familie individuell angepasst werden.
Die Bestimmung der «Zone der nächsten Entwicklung» (Wygotski)
Ausgehend von diesen Eckpfeilern wurde individuell diagnostiziert, welche Kompetenzen und Sicherheiten vorhanden waren und worin für das Kind der nächste Entwicklungsschritt bestehen könnte. Auf dieser Grundlage wurde bestimmt, auf welchem Wege der nächste Schritt in der Entwicklung für das Kind am einfachsten, effektivsten, angemessensten und sinnvollsten zu erreichen sein könnte. Wenn es beispielsweise gelang, dem Kind über Körperarbeit einen Zugang zu einer Verhaltens-, Wissens- oder Motivproblematik zu verschaffen, dann wurde die Körperarbeit zu einem Baustein der Lerntherapie so lange, wie dies notwendig war. Da die Kinder, von denen die Rede sein wird, alle das Vorschulalter bereits überschritten hatten, stand die Körperarbeit jedoch nie für sich. Sie war ein Mittel oder ein Baustein unter anderen bei der Aneignung von Schulkompetenzen, was jedoch keineswegs bei jedem Kind notwendig und angezeigt war.
Flexible Gestaltung
Bei allen Kinder stellte sich allerdings die oft vielfältige Aufgabe, sehr individuelle Wege zu beschreiten, um ihnen bei ihrer Suche nach Einsicht und Sinn in ihren Lernprozessen beizustehen, um ihnen Möglichkeiten zu eröffnen, Ordnung und Struktur mit ihren Lernaktivitäten zu verknüpfen. Für den Therapieerfolg war es wichtig, dass die Kinder und ihre sehr unterschiedlichen Schwierigkeiten in den Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit gestellt wurden und nicht ein Schema mit festen Abfolgen.
Orientierungsverhalten in sozialen Beziehungen
Kinder machen doch keine Verträge?
1Als Knut mir vorgestellt wird, ist er acht Jahre alt. Seine Mutter beklagt, dass er für sie nur schwer zu verstehen sei. Gerade er erfahre viel Beachtung durch sie, mehr als seine zwei Geschwister. Dennoch verlange er stets ihre volle Aufmerksamkeit, entweder in seinem unaufhörlichen Drängen, sich ihm zuzuwenden oder aber durch sein massives Trotzverhalten. Nur selten beschäftige er sich allein, vor allem sei er extrem unruhig.
Mit dem Lernen habe er große Schwierigkeiten. Es sei ihm unmöglich, sich einer Sache über einen längeren Zeitraum konzentriert zu widmen. Bei den Hausaufgaben sei ihm jede Ablenkung willkommen, um nicht mit Bleistift und Papier arbeiten müssen.
Er habe keine Freunde in der Klasse, werde geduldet, wenn er sich an Pausenspielen beteiligen wolle, doch spielten seine Klassenkameraden lieber ohne ihn miteinander:
«Weil er immer meckert, auch flucht, weil er immer der Boss sein will und nicht richtig mitmacht. Er tobt nur herum.»
Vor allen Dingen störe die Mitschüler und Mitschülerinnen an Knut, dass er sie mit seiner direkten und zuweilen unverfrorenen Kritik vor den Kopf stoße.
Knut schleppt schwer an der großen Unruhe, die er in sich trägt. Er verliert sich darin, er eckt damit an, verpasst den Anschluss an die Aufgaben, die es zu bewältigen gilt. Sein aufsässiges und Beachtung heischendes Verhalten schreckt die Kinder, auf die er in der Schule oder in der Nachbarschaft stößt, ab, sich intensiver mit ihm zu beschäftigen. Mitte der zweiten Klasse kommt er zu mir, weil er noch keinen Zahlbegriff entwickelt hat. Er rechnet blitzschnell mit Hilfe seiner Finger, doch diese Strategie versagt, wenn der Zahlenraum von 1 bis 10 über-schritten wird. Bei der Subtraktion versagt sie ihm oftmals bereits bei Aufgaben ihren Dienst, die sich auf den Zahlenraum 1 bis 10 beschränken. In allem, was er tut, ist Knut blitzschnell. Aufgaben sind dazu da, dass man losrennt, kopflos, Hauptsache Knut hat etwas in Bewegung gesetzt. Für Knut scheint nicht wichtig zu sein, was er tut, er muss es stets sofort tun und das möglichst schnell zu Ende bringen.
In einer der ersten Stunden stellt Knut unmissverständlich klar: «Ich kann rechnen, ich kann schnell rechnen, du kannst mir ruhig Aufgaben stellen!»
Ich stelle ihm Rechen-Aufgaben, die er bewältigen kann. Er meistert sie rasch mit Hilfe seiner Finger. Sie werden in einer Geschwindigkeit ruckartig auf- und zugeklappt, die jeglichen Versuch nachzuvoUziehen, wie er rechnet, unmöglich macht.
Einen winzigen Augenblick lang schaut er mich erwartungsvoll an, um dann schnell trotzig festzustellen: «Das ist richtig gerechnet!» Seine Botschaft an mich ist eindeutig: Eine Widerrede ist zwecklos und wohl auch nicht erlaubt.
Ich teile seinen Triumph über das schnelle Rechnen. Offen bleibt zwischen uns, ob er alle Aufgaben auch tatsächlich korrekt gelöst hat. Dieses Spielchen spielen wir eine Weile mit Aufgaben im Zahlenraum unter 10. Knut achtet peinlich genau darauf, dass ihm keine Subtraktionsaufgaben gestellt werden.
Obwohl er erfolgreich ist, verliert dieses Spiel, wie so viele andere Beschäftigungen auch, schnell seinen Reiz für ihn. Er wird unwirsch in seinen Äußerungen, wandert im Raum umher, kramt in der Spielkiste und angelt sich einen Ball. Knapp kann ich einen gezielten Wurf auf die Fensterscheibe verhindern, indem ich den Ball abfange. Knut wirkt erschrocken.
Ich schlage ihm vor, sich mit mir auf den Teppichboden zu setzen, weil ich etwas mit ihm besprechen möchte. Er wendet sich brüsk ab, will sich nicht auf den Teppich setzen, verständlich, denn er erwartet wohl eine Zurechtweisung. Ihn bereits jetzt mit dem Chaotischen seines Handelns zu konfrontieren, könnte zu diesem frühen Zeitpunkt unseres Kennen-lernens niederschmetternde Schuldgefühle in ihm auszulösen im Sinne von <er ist schlecht), <er ist ein Problem) und nicht das, was er tut. Gleichwohl kommen wir um das Thema <Grenzen> nicht herum.
Ich setze mich auf den Boden und rede in den Raum hinein. Bei mir sei es üblich, einen Lernvertrag abzuschließen, einen Vertrag, so wie ihn Erwachsene auch oft miteinander abschließen, wenn eine Arbeit erledigt werden soll, wenn es um eine größere Anschaffung wie z. B. einen Autokauf geht.
Knut wandert eine ganze Weile ziellos und grollend im Raum umher. Viele Minuten seines Schweigens vergehen, bis meine Reden in den Raum ihn zu tangieren scheinen wie eine Art Echo-Leitsystem. Denn er nimmt sich schließlich missmutig einen der beiden Sitzbälle und legt sich bäuchlings auf ihn. Er schaut mich nicht an, den Kopf hält er jedoch mir zugewandt. Und endlich bricht er auch sein Schweigen. «Was steht da drin?», will er wissen.
Ich versuche, Blickkontakt mit ihm aufzunehmen, was nicht leicht ist. Sein Blick irrt, wie so oft, unruhig im Raum umher.
Er erfährt, dass darin Sätze aufgeführt sind wie: Wann er kommt und wie lange er bleibt. Und weil auch dieses in einen Lernvertrag aufgenommen wird, muss ich ihm die für ihn wohl schmerzliche Frage stellen, ob er denn weiß, warum er in Zukunft jede Woche einmal zu mir kommt, ob seine Eltern dies mit ihm besprochen haben?
Knut starrt mich mit unverhohlener Abneigung an und schweigt sich gründlich aus. Ich warte ab, ebenfalls ohne etwas zu sagen. Obwohl ich volles Verständnis für sein beredtes Schweigen habe, fällt es mir nicht leicht, ihm die Zeit zu geben, die er braucht, um in meinem Schweigen auch meine Offenheit für ihn zu erspüren.
Plötzlich kommt Bewegung in seine Gesichtszüge, zunächst noch ganz leicht arbeitet es in ihnen, dann faucht er mich verbittert an: «Weil ich nicht rechnen kann. Aber ich bin kein Idiot!». Fast zeitgleich atmen wir beide tief ein und aus. Es ist sehr schwer, wenn man sich eingestehen muss, dass es beim Lernen in der Schule etwas gibt, das nicht die Früchte trägt, die man selbst so gerne möchte und die wohl auch die Eltern sich wünschen und die man selbst vor Augen hat. Das ist wahrlich ein Grund für tiefe Seufzer.
Wir lassen Momente gemeinsamen Verharrens im Schweigen verstreichen.
Vorsichtig nähern wir uns der Frage:





























